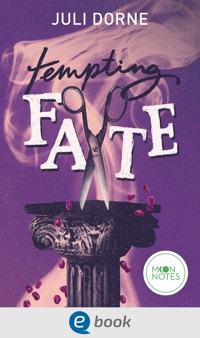9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Götter und Gefühle – dein Portal in andere Welten. Wenn du moderne Versionen griechischer Mythen, starke Frauen und ebenso starke Gefühle liebst, ist dies dein Pageturner. Zwei Fremde, die ein göttliches Schicksal zusammenführt. Er ist der Prinz des Hades, sie seine Bodyguard. Seit Ewigkeiten fristet Taru ein trostloses Dasein: als Fluch für ein unverzeihliches Verbrechen darf er sein Appartement in New York nicht verlassen. Die Erinnyen warten nur darauf, ihn in Stu¨cke zu zerreißen, sollte er es wagen. Das zufällige Zusammentreffen mit Rio ändert alles, denn an ihrer Seite ist er für die Furien unsichtbar. Und so heuert er sie an, ihn zu beschützen. Zusammen machen die beiden sich auf eine Reise durch die Welt, die reale wie die mythologische. Immer auf der Suche nach den Nymphen, der Sphinx und schließlich Pandora, die als Einzige Tarus Fluch aufheben kann. Doch nichts kann Rio und Taru auf das vorbereiten, was sie über sich selbst erfahren werden – und über einander. Fighting Fate: Göttliche Romantasy mit feministischem Twist. - Ein Stierkopf im Penthouse? Hier erwartet dich griechische Mythologie in einer originellen Neuinterpretation. - Female Power: Die beliebte Bodyguard-Thematik mal anders herum. - Eine Göttergeschichte zwischen Romantasy und Modern Love. - New York, Hawaii, Hades ... bereise die aufregendsten Schauplätze der echten und der mythologischen Welt. - Young Adult und New Adult Fantasy ab 16 Jahren von Juli Dorne, die für euch auf Instagram über ihre Lieblingsbücher bloggt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
ER IST DER PRINZ DES HADES, SIE SEIN BODYGUARD. ZWEI FREMDE, DIE DAS SCHICKSAL ZUSAMMENGEFÜHRT HAT.
Taru fristet ein trostloses Dasein. Seit Jahrhunderten darf er sein Apartment in New York nicht verlassen – die Strafe für ein unverzeihliches Verbrechen. Die Erinnyen warten nur darauf, ihn in Stücke zu zerreißen, sollte er einen Fehler machen. Das zufällige Zusammentreffen mit Rio ändert alles: Taru stellt fest, dass er an ihrer Seite für die Erinnyen unsichtbar ist. Und so heuert er sie an, ihn zu beschützen. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach Pandora, die Tarus Fluch als Einzige aufheben kann. Doch nichts kann Rio und Taru auf das vorbereiten, was sie über sich selbst erfahren werden. Und über einander.
Für Kat, weil du von Anfang an wusstest, dass es um Liebe geht.
Liebe*r Leser*in,
wenn du traumatisierende Erfahrungen gemacht hast, können einige Passagen in diesem Buch triggernd wirken. Sollte es dir damit nicht gut gehen, sprich mit einer Person deines Vertrauens. Auch hier kannst du Hilfe finden:
www.nummergegenkummer.de
Schau gern unter »Triggerwarnung«, dort findest du eine Auflistung der potenziell triggernden Themen in diesem Buch. (Um keinem*r Leser*in etwas zu spoilern, steht der Hinweis hinten im Buch.)
Playlist
Monsters (feat. blackbear) – All Time Low
Parting of the River of Three Crossings – Hong Dae Sung
Orbit – Hwa Sa
Achilles Come Down – Gang of Youths
Wires – The Neighbourhood
BLUE – Troye Sivan, Alex Hope
you broke me first – Tate McRae
Without You – Ursine Vulpine, Annaca
Artemis – Stephen Rezza
if u love me – Nessa Barrett
Achilles Heel – J. Maya
Wish I Never Loved You – Bolshiee
Bad Dreams (Stripped) – Faouzia
Lightning – Stonefox
Rain – Unprocessed
Chemical – The Devil Wears Prada
Demons – Jacob Lee
Chosen (feat. Svrcina) – Generdyn
Teil 1Hoffnung
1
Taru
Manche Tode waren wie seltsame Sitcoms im Free-TV, bei denen man genau wusste, wann man lachen sollte. Wann das Klavier auf die Straße fallen und den Protagonisten wie eine Wassermelone zermatschen würde. Menschliches Blut war zwar dicker als das vieler anderer Lebensformen – aber das waren nur Nebensächlichkeiten.
Alles in allem ziemlich vorhersehbar.
Andere Tode hingegen waren tragisch. Hätten nicht passieren sollen, weil die Menschen zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Weil sie es wirklich nicht verdient hatten. Aber was wusste ich schon? Ich war schließlich nicht derjenige, der den Lebensfaden durchschnitt. Das übernahm jemand anderes.
Aber auch das war ein anderes Thema.
Ich war nur die Marionette, die die Seelen dorthin schickte, wo sie ihr restliches Dasein fristen konnten. Totenrichter. Todesengel. Sensenmann. Die Menschen gaben mir die unsinnigsten Bezeichnungen. Doch egal, wie sie mich nannten: Meine Aufgabe blieb gleich.
Ich stöhnte genervt auf, als mein Blick über das Pergament huschte, auf dem ein weiterer Tod beschrieben stand. Wieder einer dieser Trottel, der den gleichen Fehler wie Zigtausende vor ihm beging. Menschen lernten einfach nicht aus ihren Fehlern.
Schon von Anfang an hätte er dieser Frau nicht trauen sollen. Ihr mörderischer Blick allein hätte ausgereicht, und ich hätte die Beine in die Hand genommen. Selbst ihre Wohnung schrie nach Serienkiller – schaute der Mann keine Filme? Traue niemandem, der mehr Messer als Unterwäsche hat. Aber wie alle Menschen war auch er blind vor Liebe gewesen, bis ihm diese verrückte Dame ein Messer in die Brust rammte. Dann in den Bauch. Guter Treffer in die Leber – er war wahrscheinlich nicht ihr erstes Opfer.
Dieser Mensch tat mir beinahe schon leid.
Ob er sich auch nur eine Sekunde gefragt hatte, wie sich eine Frau wie sie in ihn verlieben konnte? Ob ihn dieser Verrat geschmerzt hatte, als er merkte, dass ihre Gefühle nicht echt waren?
Vielleicht. Er war zwar nur ein Mensch gewesen, aber er hatte sie geliebt, wirklich und wahrhaftig. Das war der erste Schritt in seinen sicheren Tod gewesen.
Frustriert schüttelte ich den Kopf und legte sein Protokoll auf den Stapel jener Seelen, die in den Asphodeliengrund gebracht wurden. Ein Ort, reserviert für die Normalos. Diejenigen, die ab und zu mal einen Kaugummi beim Imbiss hatten mitgehen lassen. Kleine Sünden, die verziehen werden konnten. Die Märtyrer, die als Helden in Geschichten gefeiert und verehrt wurden und denen auch Jahrhunderte später immer noch nachgetrauert wurde, kamen in das Elysion.
Ich lehnte mich in meinem ledernen Sessel zurück und versuchte, die hundert weiteren Protokolle nicht zu beachten, die sich auf dem Glastisch vor mir stapelten. Mit den Händen rieb ich über mein Gesicht und ließ meinen Blick zu den bodentiefen Fenstern gleiten. Ich erhob mich, um wenigstens von außen ein bisschen Leben zu spüren. Pulsierende Lichter, beleuchtete Fenster von Wohnungen und Büros, rote und grüne Ampeln. Ungeduldige Menschen, die auf ihre Uhren sahen, weil ihnen die Zeit davonlief. Während sie lebten und rannten, verweilte ich im Stillstand.
»Wolltest du das mit dem Trübsalblasen nicht sein lassen?«
Ich rollte mit den Augen, drehte mich um und sah, wie Dixie mein Büro betrat. Ihre rotbraunen, vollen Haare sahen aus, als hätte sich zuvor ein Paar Hände darin vergraben, und eine Duftwolke Pheromone umgab sie.
»Du riechst nach Alkohol und Sex«, sagte ich und setzte mich wieder an den Schreibtisch. Die unsortierten Seelen konnten nicht für immer im Leerraum schwirren.
»Da liegst du richtig.« Dixie stolzierte durch den weitläufigen Raum und ließ sich geräuschvoll auf einen der Samtsessel fallen. Sie legte ihre in schwarzen High Heels steckenden Füße auf den Stapel der Seelen, die ins Elysion treten durften. »Auf der Zehnten in Chelsea hat ein neuer Club aufgemacht. Die Drinks sind fast so lecker wie die Barkeeper.« Ein breites Grinsen entstand auf ihrem Gesicht. Mit ihrer Zunge fuhr sie über ihre strahlend weißen Zähne und sah mich herausfordernd an.
»Wie schön, dass du dein Leben genießt«, gab ich trocken zurück und widmete mich wieder den Protokollen. Ein missglückter Banküberfall. Der achte in diesem Monat.
»Du kannst das auch tun, Taru.«
Dixie sagte es betont beiläufig, doch als ich aufsah, erkannte ich das provozierende Funkeln in ihren Augen. Langsam legte ich das Pergament nieder, stützte mein Gesicht auf meiner Hand ab und warf ihr ein unschuldiges Lächeln zu. Wir führten dieses Gespräch seit Hunderten von Jahren, und immer endete es in einem Streit. »Und wie soll ich das deiner Meinung nach anstellen?«
»Du könntest Menschen hierher einladen. Jeden Tag eine Party schmeißen. Dich amüsieren.« Dixie nahm ihre Füße vom Tisch, lehnte sich etwas nach vorn. »Du lebst in einem über dreihundert Quadratmeter großen Apartment in der aufregendsten Stadt der Welt und nutzt es nicht. Dieser Ort könnte ein Lusttempel werden, ein Ort voller Kunst und Magie. Du könntest etwas unternehmen, statt dich hier zu verkriechen –«
»Mich verkriechen?«
Dixie kniff die Lippen zusammen, als ich mich noch weiter nach vorn beugte. Mein Kiefer spannte sich an, während das Blut in mir zu kochen begann. Wahrscheinlich kräuselten sich schon die ersten Schatten hinter meinem Rücken, bereit, gänzlich aus mir auszubrechen und alles in Dunkelheit zu hüllen, kurz nachdem ich den Raum niedergebrannt hätte.
»Ich bin hier gefangen, Dixie. Dieser Lusttempel, von dem du sprichst, ist Teil meiner Strafe.«
»Taru«, setzte sie beschwichtigend an, doch die versengende Wut raste schon durch meine Venen. Das Pergament unter meinen Händen fing bereits Feuer. Auch die Luft knisterte von der Magie, die die kleinen Staubpartikel verbrannte.
»Wenn es dich hier langweilt, hast du die Freiheit zu gehen.«
Rauch brannte in meiner Nase, während ich versuchte, ruhiger zu atmen. Dixie ließ mich keinen Augenblick aus den Augen, aus Angst, ich würde wieder die Kontrolle verlieren. Doch die Zeiten waren vorbei. Es gab nichts mehr, wofür es sich zu kämpfen lohnte. Dieses Leben war schlimmer als der Tod, und ich hatte es verdient.
Nachdem das Feuer in meinen Adern wieder versiegt war, entspannten sich Dixies Schultern, und sie atmete kaum merklich aus. Ihr Blick zuckte zu den verkohlten Pergamenten, deren Asche ich nun mit meiner Hand vom Schreibtisch fegte. Zwei verlorene Seelen, die für immer im Leerraum bleiben würden. Verdammt.
Dixie reckte ihr Kinn und warf sich ihr langes Haar über die Schulter. »Ich will nur sagen, dass dieses Leben hier nicht ganz so schrecklich und trostlos sein muss. Du könntest es erträglicher machen.«
»Mich durch ganz New York vögeln, in der Hoffnung, dass alles andere dadurch nebensächlich wird?« Ich deutete auf ihr neuestes Smartphone, das in einer Glitzerhülle steckte, und betrachtete sie skeptisch. »Diese Damen, die du dir auf dieser scheußlichen App anschaust, würden das sicher nicht gutheißen.« Dixie rollte nur mit den Augen. Dabei wussten wir beide, dass sie zu viel Zeit mit diesem Ding verbrachte. »Orpheus ist tot, und du bist frei. Findest du nicht, du könntest etwas Sinnvolleres mit deiner Zeit anstellen?«
»Orpheus hat damit nichts zu tun.« Dixies Pupillen wurden zu Schlitzen, und über ihre Haut zog sich das Muster einer Baumrinde. Die Dryaden waren wohl die Nymphen mit der geringsten Selbstkontrolle. Auch wenn das Aufflackern ihres wahren Wesens nur einen Bruchteil einer Sekunde andauerte, bis sie sich beruhigt hatte und mich lediglich mit einem kalten Funkeln in den Augen bedachte. »Du bist ein Mistkerl, Taru«, zischte sie. »Würde ich dir nicht mein Leben verdanken, hätte ich schon längst Cerberus auf dich gehetzt.«
Ich zuckte nur mit den Schultern und schwieg. Dieser Teufelshund fraß Dixie tatsächlich aus der Hand.
»Und außerdem ist die Art, wie du mit deinen Problemen umgehst, genauso ungesund.« In einer geschmeidigen Bewegung erhob sie sich vom Sessel. »Ich werde uns etwas zu Essen bestellen. Du kannst hier weiter schmollen und alle von dir stoßen, aber ändern wirst du dadurch nichts.«
»Ich schmolle nicht«, rief ich ihr hinterher, doch da hatte sie mein Büro schon verlassen.
Mein Blick glitt ein letztes Mal zu dem lebendigen Pulsieren der Stadt, ehe ich mich wieder den Toten widmete.
Wir hatten uns auf die Dachterrasse begeben, nachdem das Essen da war. Egal, wo Dixie ihren Tag verbrachte, sie schaffte es immer pünktlich zum Abendessen. Es war unser Ritual – initiiert von Dixie, an einem meiner besonders schlechten Tage.
»Übrigens hab ich den Dreckskerl, den ich finden sollte, ausgeschaltet.«
Überrascht zog ich eine Augenbraue hoch, als ich Dixie noch etwas Gin nachschenkte. Sie wedelte entschuldigend mit der Hand.
»Nicht so, wie du denkst! Ich hab ihn nur k.o. geschlagen und dann vor der Polizeiwache abgelegt. Das wolltest du doch.«
Ich nahm mir noch eine der Sommerrollen, die Dixie beim Japaner ihres Vertrauens bestellt hatte, und schüttelte grinsend den Kopf. »Über sein Protokoll wäre ich nicht traurig gewesen«, sagte ich. Eine Ewigkeit im Tartaros, dem grausamsten Teil des Hades, war das Mindeste, was er verdient hätte. Dieser Mensch hatte, sogar verglichen mit den Taten einiger Götter, wirklich schreckliche Dinge getan, und ich hatte Dixie gebeten, ihn ausfindig zu machen. Menschen waren einfach zu … simpel, um zu sehen, was sich vor ihren eigenen Augen abspielte.
»Ich schon. Sonst hätte mich das Schicksal nicht zu …«
Ich schluckte schwer, als dieses eine Wort sich wie ein Speer in mein Herz bohrte. Treffsicher und präzise, als hätte Achill selbst zum Wurf angesetzt.
Dixie wandte sich ihrem Glas zu und nahm einen großen Schluck, ehe sie sich räusperte und weitersprach. »Jedenfalls wäre ich sonst nicht in diese Bar gekommen – mit den sexy Barkeepern. Einer davon war unglaublich süß, hat mich sogar nach seiner Schicht zum Eislaufen in den Central Park mitgenommen, bevor wir in seinem Apartment gelandet sind.«
Sie steckte sich noch eine Sommerrolle in den Mund und berichtete mir dann in aller Ausführlichkeit, was sie mit ihm in seiner Wohnung getan hatte.
»Oh, außerdem hab ich dir noch ein paar Cupcakes mitgebracht.« Dixie deutete mit ihrem leeren Glas auf den Wohnbereich hinter uns. Ich hob die Ginkaraffe an und schenke ihr etwas nach. »Ich kann sie dir holen, wenn du willst. Bevor ich diesen widerlichen Menschen gefunden hatte, war ich in einem Café – Coffee Variety. Supersüß! Und eine riesige Auswahl … Das reicht, danke.«
Ich warf ihr ein halbwegs glaubwürdiges Lächeln zu, als ich nun auch mir etwas von dem Alkohol eingoss, und lehnte ihr Angebot ab. Es war nicht das erste Mal, dass Dixie mir etwas von ihren Unternehmungen mitbrachte. Doch immer, wenn ich diese Dinge annahm, ob es ein Kleidungsstück oder etwas zu Essen war, fühlte es sich falsch an. Jedes Mal spielte sich vor meinem inneren Auge ein Film ab, wie Dixie durch die Straßen New Yorks streifte, Bibliotheken besuchte, in Cafés saß und das Leben genoss, das ich niemals haben würde. Es war bitter. Dieses Gefühl klebte förmlich an all ihren Geschenken und fraß sich tief in mein Herz. Dennoch hörte ich ihr weiter still zu, wie sie mir vom herbstlichen New York erzählte, während Neid mich den Gin nur schneller trinken ließ. Wenn ich diese Dinge schon nicht durch meine eigenen Augen sehen konnte, dann durch Dixies. Das war unsere Abmachung. Was hatte ich denn auch für eine andere Wahl?
Wir blieben noch mehrere Stunden auf der Dachterrasse. Die Nacht legte sich über die Stadt, aber wirklich dunkel wurde es hier nie. Erst als Dixie ihr Zähneklappern kaum noch verbergen konnte, verabschiedete sie sich und ging auf ihr Zimmer. Über unseren kleinen Streit hatten wir nicht gesprochen – das taten wir nie. Diese Dinge regelten sich meistens von allein.
Ich wartete noch einen Moment, ehe ich zu dem Geländer der Terrasse lief. Mit meinen Unterarmen stützte ich mich auf dem kühlen Metall ab und atmete tief ein. Unter mir strömten Menschen über die Madison Avenue. Den Wunsch danach, selbst durch diese Straßen zu laufen, hatte ich immer wieder begraben. Ich wusste, dass es keine Möglichkeit gab. Und doch war dieses Verlangen nach dem, was ich mir unter dem Leben vorstellte, nie ganz verschwunden. Verfluchte Hoffnung. Sie war schlimmer als jedes Gift.
Ich ließ den Kopf hängen und wandte der Stadt meinen Rücken zu. Ich sollte weitere Protokolle abarbeiten. Mich ablenken. Doch wie von selbst trugen mich meine Füße durch den offenen Wohnbereich, vorbei an einem der fünf Kamine in dieser Wohnung. Vorbei an den wertvollen Kunstwerken aus verschiedenen Ländern, die ich nie bereisen konnte, hin zu dem privaten Fahrstuhl, den ich seit Ewigkeiten nicht betreten hatte. Aber der Alkohol und Dixies Erzählungen über die Eiskunstlaufbahn im Central Park, auf den ich von meiner Wohnung einen exzellenten Blick hatte, ließen mich wehmütig werden.
Ich wollte nur einen Blick darauf werfen. Nur einen Schritt wagen, und dann würde ich mich wieder zurückziehen. Ich wollte für einen Moment die Welt von unten sehen, statt von meinem Gefängnis hinabzuschauen. Nichts Großes.
Beim Ping der Fahrstuhltüren zuckte ich zusammen. Ich steckte meine Hände tief in die Taschen meiner Hose, um mir selbst einreden zu können, sie würden nicht zittern, und betrat den Aufzug. Mit jedem Stockwerk, das ich hinabfuhr, wurde mir wärmer. Der Gin musste definitiv seine Wirkung entfaltet haben.
Ich schluckte, als ich das Erdgeschoss erreichte. Die hohen Marmorsäulen und den schweren roten Teppich des Foyers beachtete ich kaum. Mein Ziel war eine langweilige, normale Tür.
Kaum jemand schien mich zu bemerken. Für das menschliche Auge verschwamm ich mit den Schatten. Ein Vorteil, wenn man der Schattenprinz war.
Mit immer schneller werdenden Schritten lief ich an den Räumen des Personals, des Sicherheitschefs und der Küche des Restaurants, das sich im unteren Bereich dieses Hauses befand, vorbei. Ich atmete tief durch, als ich die unscheinbare Tür erreichte. Auf Menschen wirkte sie wie ein gewöhnlicher Personalausgang. Sie sahen nicht den Schimmer, der die Tür umgab. Sie hörten nicht das leise Flüstern der Magie.
Die Tür öffnete sich so einfach, als wäre sie erst gestern frisch geölt worden. Ich schloss die Augen und atmete den warmen Geruch der Magie ein. Spürte, wie sich der Geschmack von Honig auf meine Zunge legte. Ambrosia, der Atem des Olymps, drang in meine Lungen. Als ich meine Augen öffnete, erstreckte sich vor mir die nächtliche Madison Avenue. Ruhig und ungewöhnlich still. Nur vereinzelt liefen Menschen vorbei, mit dem Smartphone am Ohr, blind und gehetzt. Es würde mich nicht überraschen, hätte ich morgen ein Protokoll von ihnen auf dem Schreibtisch.
Noch ein tiefer Atemzug, bevor ich aus der Tür trat. Nur ein Schritt. Ein Schritt und ich war draußen. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Das Zittern meiner Hände konnte ich kaum noch unterdrücken.
Wenige Sekunden später spürte ich sie. Knapp eine Minute später sah ich sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Lauernd. Kahlköpfig. Die blinden Augen auf mich gerichtet. Sie schnupperten, nahmen meinen Geruch wahr, und ihre knöchernen Flügel waren eng an den schmalen Körper gelegt.
Erinnyen.
Gänsehaut kroch über meine Arme. Ein angeborener Instinkt. Schon von klein auf wurde mir gesagt, ich sollte die Rachegöttinnen fürchten. Doch Furcht war nicht das, was ich spürte. Ich hatte Respekt vor den fledermausartigen Wesen, die selbst einen mächtigen Gott in Stücke reißen konnten. Nichts, was ich selbst erfahren wollte.
Wenn ich mich nicht weiter rührte, würden sie sich auch nicht bewegen. Ein Schritt aus dem Haus, nur das war mir gewährt. So viel Güte hatte mir der ach so ehrenhafte Göttervater bei seinem Urteil dann doch noch zuteilwerden lassen. Damals hätte ich ihm am liebsten vor die Füße gespuckt und ihm gesagt, dass er sich diese Güte sonst wohin schieben konnte.
Ich richtete meinen Blick wieder auf die ledrigen Damen vor mir. Wer wusste, ob sie sich nicht doch spontan dazu entscheiden würden, mir näher zu kommen.
Ich wollte mich gerade umdrehen und wieder ins Haus zurückkehren, mein Glück nicht weiter ausreizen, als eine der Erinnyen unruhig wurde. Sie reckte den Kopf, stellte ihre Flügel auf. Auch ihre Schwestern hoben die Köpfe. Aufgeregt und ruhelos, als hätten sie die Orientierung verloren. Als hätten sie mich verloren.
Das konnte nicht sein. Die Erinnyen waren zwar blind, doch dafür waren ihre anderen Sinne besser ausgereift als Dionysus’ Wein. Und dennoch flogen sie aufgeregt über den Bürgersteig bis zur Kreuzung der Madison Avenue, wo gerade eine kleine Gruppe von Menschen die Straße überquerte. Ich zögerte. Beobachtete die Erinnyen noch einige Sekunden länger, ehe ich mich nicht mehr weiter davon abhalten konnte. Ich stürmte zur Straße, musste auskosten, wie weit ich mich bewegen konnte. Das erste Mal seit Jahrhunderten war ich frei. Adrenalin rauschte durch meine Adern, und ein ungläubiges Lachen entfuhr mir. Ich drehte mich um mich selbst und konnte es kaum fassen. Nur am Rande nahm ich wahr, wie die Menschen, die eben noch die Straßenseite gewechselt hatten, an mir vorbeizogen. Einige murmelten leise Flüche, weil ich ihnen im Weg stand. Doch es war mir egal. Irgendetwas musste sich verändert haben, dass die Erinnyen mich nicht mehr sahen.
Blut rauschte in meinen Ohren. Mein gesamter Körper kribbelte. Mein Atem ging schneller, weil das Gefühl von purem Glück mein Herz auf das Dreifache anschwellen ließ.
Ich drehte mich wieder zur Kreuzung, dorthin, wo die Erinnyen sich bewegten. Erneut hielten sie inne. Ihre Köpfe zuckten plötzlich wieder in meine Richtung. Ich hatte kaum Zeit, mich zu bewegen, da stürmten sie auf mich zu. Die langgliedrige Klaue einer Erinnye presste mich gegen die Hauswand.
Die Prise Freiheit war vergangen.
»Da ist ja der kleine Schattenprinz.« Ich verzog mein Gesicht, als mir der faulige Atem der Erinnye entgegenschlug. »Wir sollten dich zerfetzen. Du bist verschwunden.«
»Ein Regelbrecher«, krächzte die zweite.
»Wer Regeln bricht, dem brechen wir die Knochen«, vervollständigte die dritte der Schwestern ihre Raserei. Die anderen beiden Erinnyen jauchzten vor Vorfreude auf. Beschwichtigend hob ich die Hände, während mich die ledrige Klaue immer stärker gegen die Mauer drückte, dass in meinem Rücken die Steine nachgaben.
»Meine Damen«, presste ich mühsam hervor. Eine Klaue bohrte sich in meinen Hals, doch ich ignorierte den Schmerz. Das würde sie nur noch rasender machen. Hungriger. »Ihr seht heute ganz fabelhaft aus, wisst ihr das?«
»Lass die Schmeicheleien, Prinz. Uns kannst du nicht entkommen.«
»Es war nur ein Moment«, gab ich besänftigend zurück. Fieberhaft überlegte ich, wie ich den Erinnyen entkommen konnte. Sie waren stark, und in die Schatten konnte ich nicht verschwinden. Ohne Ablenkung hatte ich keine Chance. »Ihr könnt das wohl kaum als Regelbruch ansehen. So weit habe ich mich doch gar nicht entfernt. Wie weit war das? Ein Meter? Zwei? Bei eurem schönen Antlitz habe ich das ganz ver–«
»Los, Schwester«, zischte die Rechte, die zuvor meine Knochen brechen wollte. »Reiß ihn auf, ich will seine Organe kosten.«
Die Erinnye, die mich an die Wand presste, legte den Kopf schief und schnupperte erneut an mir wie eine Raubkatze an einem rohen Stück Fleisch.
Aus dem Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr. Rotbraune Haare. Die Erinnye reckte den Kopf.
Ich schlug meine Hand in das Mauerwerk. In der nächsten Sekunde riss ich einen Steinbrocken heraus und zog ihn der Erinnye über den Kopf. Sie kreischte auf, lockerte den Griff um meinen Hals. Ich stieß sie von mir. Sie prallte gegen ihre Schwestern, die wütende Drohungen zischten. Doch diesmal war ich schneller und sprang zur schmalen Tür, wo Dixie schon auf mich wartete. Sie zog mich am Kragen meines Hemdes hinein. Ich landete auf dem Boden, als Dixie die Tür zuwarf. Die Erinnyen heulten frustriert auf, kratzten mit ihren Klauen an der Tür. Zwecklos. Neben meinem Vater hatten nur diejenigen Zutritt, die ich hereinbat.
»Was zum Hades war das?«, fragte Dixie.
Ungläubig schüttelte ich den Kopf und erhob mich vom Boden, klopfte mir den Staub von der Hose. Ich ignorierte das warme Blut, das mir am Hals hinablief, als ich breit grinsend zu Dixie sah.
»Hoffnung.«
2
Rio
Ein Jahr später.
»Na, Sonnenschein?« Jakes Schicht im Celestial musste erst vor paar Minuten angefangen haben. Er war gerade noch dabei, seine Schürze vor seinem Bauch festzubinden, als ich an den Tresen trat.
»Wohl eher hundert Prozent Regenwahrscheinlichkeit«, murmelte ich und nahm einen großen Schluck vom Vanille Latte, den ich fälschlicherweise zubereitet hatte. Die Kundin hatte mich zum Glück darauf hingewiesen, bevor sie ihn überhaupt probiert hatte. Wenn auch nicht gerade freundlich. Meine Konzentration ließ heute schon den ganzen Tag zu wünschen übrig. »Machst du mir einen Vanille Chai für Tisch sechs?«
Jake reckte seinen Hals, um das rothaarige Biest zu sehen, und verzog den Mund. Ich war schon einiger unfreundlicher Kundschaft begegnet, aber sie war eine von der speziellen Sorte. »Ein bisschen Salz zu dem Vanille-Sirup?«
»Und da soll noch mal einer sagen, Rache wäre süß«, gab ich mit einem Grinsen zurück und merkte, wie sich meine Schultern wieder etwas entspannten. »Aber leider müssen wir auf das Salz verzichten, sonst verliere ich am Ende noch meinen Job.«
Jake verzog mitleidig das Gesicht, doch er machte sich gleich an die Arbeit. Nachdem ich das richtige Getränk an den Tisch gebracht und noch zwei weitere Gäste bedient hatte, zog ich meine Schürze über den Kopf und setzte mich auf einen Hocker an der Bar. Zum Glück war meine Schicht für heute vorbei.
»Was ist noch passiert, dass bei dir Unwetterstimmung herrscht?«, fragte Jake, während er Cocktailgläser für die Spätschicht polierte. Das Celestial war Café am Tag und trendige Bar in der Nacht. Der perfekte Ort, um als Studentin zu jobben. Für die Spätschichten gab es normalerweise einen Bonus. Nur wurden die mir heute gestrichen. In letzter Zeit hatten sich einfach zu viele Gäste über mich beschwert. Zu unkonzentriert. Zu launisch. Zu viele kaputte Gläser.
Ich zuckte nur mit den Schultern und schlürfte an meinem Kaffee. »Nichts Wildes.«
»Rio, Schatz«, setzte Jake an und stützte sich mit seinen tätowierten Armen auf dem schwarzen Holz des Tresens ab. »Wie lange bin ich schon dein bester Freund?«
»Jake …« Ich verdrehte die Augen, denn ich wusste, was jetzt kommen würde.
»Wie lange, Rio?«
»Sechs Jahre.«
»Richtig«, sagte er mit ernster Miene. »Und wie lange kannst du mir nichts mehr vormachen?«
Wenn er wüsste. »Sechs Jahre.«
Zufrieden nickte Jake und fuhr mit dem Polieren der Gläser fort. »Und jetzt erzähl mir, welche Wolke dein Herz heute verdeckt.«
Ich lehnte mich zurück und rührte möglichst unbeteiligt in meiner halb leeren Tasse herum. »Ich –«
Gänsehaut überzog meinen Körper, als hätte man mir einen Eimer Wasser übergekippt. Ich riss den Kopf herum, auch wenn ich wusste, was ich gleich sehen würde. Mein Hals wurde staubtrocken, als ich sie durch die Schaufenster des Cafés entdeckte. Meine Muskeln verkrampften sich.
Nein, bitte nicht. Nicht heute. Nicht, wo der Tag mir jetzt schon in den Knochen steckt.
Kahle Köpfe. Klauen, so lang wie meine Finger, und lederne Flügel. Sie lauerten auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Unruhig, als suchten sie etwas. Oder jemanden.
Meine persönlichen Dämonen. Rachegeister. Das sagte zumindest Google. Meine Therapeutin war da anderer Meinung, doch die Pillen, die sie mir verschrieben hatte, hatten nicht geholfen. Darum wusste ich, dass sie real waren. Zumindest zu real für Psychopharmaka.
»Rio, alles gut?« Jake legte seine Hand auf meinen Arm, und ich drehte meinen Kopf wieder zu ihm. Ich blinzelte ein paarmal und versuchte, mir meinen Schock nicht anmerken zu lassen. Vor einem Jahr waren sie wieder aufgetaucht. Immer in unregelmäßigen Abständen, immer zu unterschiedlichen Zeiten. Nur eines veränderte sich niemals – danach geschah nichts Gutes. So wie auch vor elf Jahren nichts Gutes geschehen war, als ich sie das erste Mal gesehen hatte.
»Erde an Rio.« Jake wedelte mit einer Hand vor meinem Gesicht. »Was ist los?«
»Nichts«, sagte ich und versuchte, die unheimlichen Wesen mit aller Macht zu ignorieren. Doch ihre Anwesenheit brachte etwas in mir zum Vibrieren. Als würden sie mich zu sich ziehen. »Alles gut. Ich dachte nur, ich hätte jemanden gesehen.«
Noch einmal sah ich zu den überdimensionalen Fledermäusen. Sie hatten sich noch kein Stück gerührt. Nur ihre Köpfe neigten sich leicht, als würden sie etwas wahrnehmen, es aber nicht richtig zuordnen können. Passanten liefen an ihnen vorbei. Als wäre da eine unsichtbare Hand, die sie an den Wesen vorbeilenkte. Niemand nahm sie wahr.
Jake beugte sich weiter über die Theke und versuchte, meinem Blick zu folgen. Angespannt beobachtete ich, ob er sie auch sehen würde. Aber die Wesen zogen einfach langsam weiter, ohne dass Jake etwas bemerkte. Ein Stich ging durch mein Herz. Natürlich sah er sie nicht.
»Ich sehe niemanden, den wir kennen.« Jake zuckte mit den Schultern, doch sein aufmerksamer Blick blieb an meinem Gesicht hängen.
»Es war auch nichts«, antwortete ich mit einem gezwungenen Lächeln. »Hab mich geirrt.«
Ich nahm meine Hände vom Tresen und legte sie auf meinen Schoß, wo niemand sehen konnte, wie sehr sie zitterten.
»Also«, setzte Jake an. »Was war denn jetzt der Grund für den Wetterwechsel?«
Ich atmete aus und versuchte, mich wieder auf Jake zu konzentrieren. »Theo hat mir wieder die Spätdienste gestrichen.« Jake zog eine Augenbraue hoch, aber ich wedelte nur abwehrend mit der Hand. »Er meinte, die Gäste beschweren sich ständig über mich. Angeblich bin ich unfreundlich und mache meinen Job nicht richtig.« Ich zuckte träge mit den Schultern. Es war nichts Neues, dass Theo mir eine Abmahnung erteilte. Auch wenn es diesmal wirkte, als würde er es nicht mehr lange mitmachen. Ich sollte mich einfach mehr bemühen.
»Vielleicht hat er recht?«, fragte Jake vorsichtig und hob sofort die Hände, als wollte er die Worte aufhalten, die sich schon hinter meinen Lippen sammelten. »Nicht, dass du unfreundlich bist – ein bisschen schlecht gelaunt, vielleicht.« Ich verdrehte die Augen, doch Jake ignorierte es und sprach weiter: »Aber dein Studium, das ganze Training, der Job hier und im Theater. Das ist nicht gerade wenig, Rio.« Jakes Blick wurde sanft, während ich nur die Lippen zusammenpresste. »Wie wäre es, wenn du einen Gang runterschaltest? Was ist mit deinem Nebenjob im Theater? Das reicht doch.«
Ich schüttelte den Kopf und brachte die leere Kaffeetasse hinter den Tresen, damit ich sie schnell selbst abwaschen konnte. »Eben nicht. Das Geld vom Theater geht für mein Studium drauf. Das Geld hier für meine Miete. Ich –«
»Du könntest auch einfach deinen Dad fragen«, schlug Jake vor, und ich warf ihm einen bösen Blick zu.
»Nein.«
»Schatz, dein Vater hat genug Geld, um dir beides zu finanzieren. Mein Gott, er könnte selbst mein Studium bezahlen.« Jake warf sich sein Geschirrtuch über die Schulter und sah mich streng an. »Schluck deinen Stolz runter, bevor du daran erstickst.«
Ich schnaubte und wich Jakes eindringlichem Blick aus. Er glaubte, er kannte mich in- und auswendig, doch würde ich ihm erzählen, was ich in der Nacht gesehen hatte, als meine Mom verschwand, würde er mich nicht mehr so ansehen wie jetzt. Wenn ich ihm von den Schatten erzählen würde, die aufgetaucht waren. Von der Dunkelheit, die das ganze Wohnzimmer verschluckt hatte.
Niemand hatte mir geglaubt. Doch ich wusste, was ich gesehen hatte. Ich hatte mich gegen die Wand gepresst und die Augen keine Sekunde geschlossen. Nicht, als die Schatten Mom verschlangen. Nicht, als sie danach einfach weg war, und auch nicht, als nur die Fledermauswesen am Ende des Wohnzimmers lauerten, bevor auch sie genauso ins Nichts verschwanden.
Die Ärzte bezeichneten es als Bewältigungsstrategie, um meinen Dad zu beruhigen. Es wäre nur natürlich, dass sich ein neunjähriges Kind andere Möglichkeiten suchte, um das Verschwinden der eigenen Mutter zu erklären.
Irgendwann, als Dads Sorgenfalten immer tiefer wurden, hatte ich aufgehört, von den Schatten zu erzählen. Ich hatte niemandem mehr davon erzählt. Denn ich hing an dem bisschen Normalität, das ich mir seit der Highschool mühsam erarbeitet hatte. Das würde ich nicht aufgeben. Nie. Wieder.
»Ich will unabhängig sein, Jake. Das hat rein gar nichts mit Stolz zu tun«, erklärte ich ihm so ruhig wie möglich und umrundete die Theke. »Ich muss jetzt zum Theater. Wir sehen uns.«
Als ich am nächsten Abend mein kleines Apartment betrat, schrie ich vor Frust laut auf. Meine Wohnung lag in völliger Dunkelheit vor mir, egal, wie oft ich den Lichtschalter kippte. Außerdem war es so kalt, als hätte ich eine Woche nicht geheizt. Verdammter Oktober.
Für einen Moment überlegte ich, ob ich mich einfach in mein Bett legen und mich in meine Decke einwickeln sollte. Aber wahrscheinlich würde ich dabei noch erfrieren. Ich kam also um eine Konfrontation nicht herum. Obwohl erfrieren sicherlich angenehmer wäre.
Wütend stapfte ich von meiner Wohnung eine Etage tiefer und hämmerte mit der Faust an die Tür meines Vermieters. Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete sie sich einen Spalt breit. Sein aufgedunsenes Gesicht kam im Halbdunkeln zum Vorschein.
»Was gibt’s?« Der beißende Geruch von Alkohol schlug mir entgegen, doch ich verzog keine Miene. Er sollte mir nicht anmerken, wie mich sein alkoholisiertes Auftreten einschüchterte.
»Meine Wohnung hat keinen Strom, und die Heizung ist aus.« Es war nicht das erste Mal, dass er so etwas abzog. Aber im Sommer war es immerhin erträglicher als kurz vor Wintereinbruch. »Ich habe dir die Miete pünktlich überwiesen, du hast also keinen Grund, mir beides abzustellen.«
»Miete hat sich erhöht.«
»Seit wann das denn?«
Er ließ seinen Blick über mich gleiten, leckte sich schmatzend über die Lippen und zuckte nur mit den Schultern. »Seit heute.«
»Was?« Ich riss die Augen auf und spürte, wie sich mein Puls beschleunigte. Das musste ein Scherz sein.
»Hundertfünfzig mehr und du kannst bleiben. Bis nächste Woche hab ich das Geld, oder du bist raus.« Noch ein Blick über meinen Körper. Am liebsten hätte ich ihm dafür die Augen ausgekratzt. »Bis dahin bleibt es so, wie es ist.«
»Das kann nicht dein Ernst –« Mit einem lauten Knall schlug er mir die Tür vor der Nase zu. »Hey!«, brüllte ich. »Mach die verdammte Tür auf. Komm schon!«
Doch nach weiterem an die Tür hämmern und einigen Beleidigungen, die mein Vermieter mir durch die Tür entgegenblaffte, gab ich auf. Geschlagen lief ich wieder in mein Apartment und fröstelte. Ich hasste die Dunkelheit. Sie verbarg zu viele Details. So vieles, was ich nicht einschätzen konnte.
Ich lehnte mich gegen meine geschlossene Wohnungstür und atmete ein paar Mal tief ein und aus. Bis die dunklen Ecken in meinem Zimmer nicht mehr ganz so beängstigend wirkten. Nur langsam beruhigte sich mein Herzschlag.
Die Angst ist nicht real. Ich bin stärker als die Angst.
Ich wiederholte die Worte so lange, bis ich sie selbst glaubte. Trotzdem verließ mich die Anspannung nicht ganz. Ich ließ den Kopf nach hinten sinken und schloss die Augen. Wie sollte ich nur so viel Geld in einer Woche beschaffen? Das war unmöglich. Das Geld für mein Studium war tabu. Ich hatte es über die Jahre hinweg angespart. Bei Dad konnte ich nicht wieder einziehen. Seitdem er allein wohnte, schien es ihm so viel besser zu gehen. Das konnte ich ihm nicht vermiesen. Bei Jake einzuziehen war auch tabu. Nicht ohne Grund hatte ich immer darauf geachtet, dass er diese eine Grenze nicht unbeabsichtigt übertreten würde. Denn das, was er dahinter sehen würde … Er würde mich genauso ansehen wie meine anderen Freunde – wenn man sie überhaupt als solche bezeichnen konnte. Dad und Jake waren alles, was ich hatte. Das würde ich mir nicht vermiesen.
Was sollte ich nur tun?
Vielleicht brauchte ich erst mal etwas mehr Licht. Das wäre zumindest ein Anfang.
Ich lief zu meiner Kommode und zog die Schubladen auf. Der Geruch der dutzend Duftkerzen schlug mir sofort entgegen. Jake hatte sie nach seiner intensiven Sammelphase bei mir abgeladen, weil ihm allein der Gedanke daran Kopfschmerzen bereitet hatte. Seitdem mussten wir auch jedes Mal einen großen Umweg um Bath & Bodyworks-Shops machen.
Als ich in der letzten Schublade fündig wurde, vibrierte mein Telefon. Ich seufzte, als ich Jakes Namen aufleuchten sah, und nahm den Videoanruf an. Er schien einen sechsten Sinn dafür zu haben, wann er mich am allerwenigsten anrufen sollte. Sobald er mitbekam, wie der Zustand meiner Wohnung war, würde er mir wieder einen Vortrag darüber halten, dass ich hier kündigen sollte.
»Rio?« Jake hielt sein Gesicht nah an die Kamera, als würde er mich suchen.
»Ja, hi«, begrüßte ich ihn umständlich, während ich mit einer Hand das Telefon aufstellte und mit der anderen versuchte, die Kerzen anzuzünden.
»Was ist los? Warum ist es so dunkel bei dir?«
Ich seufzte. Ich sollte ihm gleich die Wahrheit sagen, dann würde er meinen katastrophalen Wohnzustand vielleicht am Ende des Telefonats vergessen haben. Nur die Mieterhöhung würde ich rauslassen. Nachher würde Jake noch auf die Idee kommen, mir Geld andrehen zu wollen. »Hab keinen Strom und kein warmes Wasser.«
»Rio …« Vortrag in drei, zwei … »Du solltest aus dieser Wohnung raus. Wer weiß, welchen Dreck der Typ noch am Stecken hat. Ich könnte mit meinem Vermieter sprechen, und du könntest vorübergehend bei mir einziehen. Du weißt, dass eine WG viel sinnvoller wäre. Außerdem –«
»Jake, bitte«, unterbrach ich ihn. »Ich weiß, okay? Ich werde mir nächste Woche eine neue Wohnung suchen.«
Jake stöhnte, als ich das Handy in die Hand nahm und endlich genügend Kerzen angezündet hatte, um die lästigen Schatten zu vertreiben. »Ich verstehe es nicht, Rio. Wir kennen uns eine halbe Ewigkeit. Du und ich, wir sind eine Familie. Wieso ziehst du nicht bei mir ein?«
Weil du nicht mitbekommen sollst, was für ein Freak ich bin. Weil ich dir mit meiner Anwesenheit nur zur Last fallen würde. Weil …
»Ich bin lieber allein, Jake. Und eine WG mit dir ist dafür nicht gerade geeignet.«
Verletzt verzog Jake den Mund, und augenblicklich taten mir meine Worte leid. Er meinte es nur gut, und ich wusste, wie schwer es ihm fiel, allein zu sein. Aber es ging einfach nicht. Auch wenn es sicher die klügere Entscheidung wäre. Schon allein vom finanziellen Aspekt her. Doch ich hielt ihn lieber auf Abstand. Ich wollte schlicht und einfach die Rio für ihn bleiben, die eigenbrötlerisch war, weil sie eine Künstlerin war, und nicht weil sie seltsame Wesen sah und sich im Dunkeln fürchtete wie ein kleines Kind.
»Okay«, gab sich Jake endlich geschlagen und wechselte das Thema. »Fährst du nächstes Wochenende zu deinem Dad?«
Ich nickte. »Ich habe sogar schon sein Geschenk.«
»Zeig!« Aufgeregt lehnte Jake sich vor und stützte seine Unterarme auf seine Knie.
Mit einem zaghaften Lächeln zog ich die alte Schallplatte hervor, die mit Pfingstrosen und einer Schwanzmeise von einer Künstlerin bemalt worden war.
»Und? Was sagst du?«
»Das ist großartig, Rio!« Jake betrachtete mein Geschenk mit großen Augen. »Dein Dad wird sich unheimlich darüber freuen.«
Das hoffte ich. Es war das Mindeste, was ich für ihn tun konnte. Ich schluckte und versuchte, zu lächeln, als Jake sein Geburtstagsgeschenk für meinen Dad in die Kamera hielt. Ein antikes Besteckset, das er sich – warum auch immer – von ihm gewünscht hatte. Jake war für meinen Dad wie der Sohn, den er nie hatte. Mir sollte es recht sein, denn Jake war wie ein Bruder für mich. Ein Grund mehr, weshalb ich wollte, dass alles zwischen uns so blieb, wie es war. Normal eben.
3
Rio
Das Golden Years war keines der besonders guten Theater am Off-Broadway. Mit den neunundneunzig Sitzplätzen konnten wir froh sein, nicht zum Off-off-Broadway zu gehören, und das auch nur wegen des einen Klappstuhls in der hinteren Reihe. Doch bei jeder Aufführung steckte jeder der Mitarbeitenden so viel Liebe und Mühe hinein, dass ich diesen Job nicht aufgeben wollte. Auch wenn ich wusste, dass ein anderes Theater meiner Karriere eine bessere Zukunft bieten würde. Dort würde ich zumindest auch mal auf die Bühne können.
Die Vorstellung von Dina und ihre Katze Luna, ein Stück über eine moderne Frau, die sich, durch eine postapokalyptisch ausgelöste Technologieseuche, ihren Weg durch das Leben bahnte, war gerade vorbei, und die letzten Gäste verließen den kleinen Vorsaal. Ich nickte ihnen zum Abschied zu. So schräg dieses Stück auch war, so großartig war es gleichzeitig. Die Autorin war eine junge Libanesin, die sich und ihr Leben in diesem Stück parodierte, aber genau damit einen Nerv traf. Es war verdammt schwer, heutzutage den richtigen Weg zu finden, wo alles und nichts möglich war.
Ich schloss die Theaterkasse und packte meine letzten Sachen zusammen, als Jessica, die Intendantin des Theaters, an meine Tür klopfte.
»Hey, Jess. Es lief heute gut, oder?«
»Rio, meine Liebe.« Sie schloss mich in eine feste Umarmung, ließ von mir ab und lehnte sich gegen den Tisch. Das Golden Years machte gerade eine schwierige Zeit durch. Einige der wirklich guten Schauspielerinnen und Schauspieler wurden vor Kurzem von anderen Theatern abgeworben – eines davon mit über dreihundert Sitzen. Es war ein herber Verlust, vor allem, da dem Theater langsam das Geld ausging. »Das fand ich auch.« Jess seufzte, doch das Lächeln auf ihren Lippen erstarb nicht. »Besser als die letzten Wochen. Bridget hat nicht einmal den Text vergessen, und das Publikum saß bis zum Schluss drin.«
Ich grinste. Bridget spielte die Rolle der Katze. »Ein Erfolg auf ganzer Linie.«
»Absolut.« Jess steckte sich ihre blonden Locken hinters Ohr und wurde ernst. »Ich wollte aber eigentlich über etwas anderes sprechen, Schätzchen.«
Ich hielt die Luft an und wappnete mich für das, was folgen würde. Ich wusste, wie leicht ich zu ersetzen war.
»Ich weiß, dass du nebenbei noch woanders arbeitest und dein Studium viel Zeit beansprucht. Dieser Job ist auch nicht unbedingt das, was du dir von der Arbeit in einem Theater erhofft hast, darum –«
O Gott. Sie würde mich feuern. Ich wusste es. Die Rachegeister waren wie immer die Ankündigung gewesen. Letztes Mal wurde ich von einem Fahrradfahrer angefahren und musste eine Woche lang auf das Tanztraining verzichten. »Ich weiß, ich habe nicht die wichtigste Position hier, Jess. Aber bitte, schmeiß mich nicht raus. Ich brauche das Geld, wirklich.«
Ein bedauernder Ausdruck entstand auf Jess’ Gesicht. »Es tut mir leid, Schätzchen. Mir bleibt keine andere Möglichkeit.«
Meine Schultern sackten nach vorn. Ich starrte auf meine Schuhe, um die Tränen hinter meinen Augen zu verdrängen. Jess strich mir beruhigend über den Arm, was es umso schwerer machte, mich zusammenzureißen.
»Ich würde dich so gern hierbehalten, Rio. Aber vielleicht ist das hier nicht der richtige Ort für dich, und das Schicksal hält etwas Besseres für dich bereit.«
Schicksal, ja klar.
Ich zog die Kapuze meiner violetten Regenjacke über meinen Kopf, als ich das Theater verließ, und starrte einen Moment auf die Pfützen auf dem Bordstein, als könnte ihre Reflexion mir eine Antwort geben.
Was sollte ich jetzt nur tun? Wie sollte ich nur das Geld für meine Miete beschaffen? Selbst mit meinem Job im Theater hatte ich schon jeden Penny umdrehen müssen.
Das Golden Years war wie mein zweites Zuhause gewesen, ich kannte jede Ecke – selbst jeden Kaugummi, der unter den alten Theaterstühlen klebte.
Es gab keinen besseren Ort für mich. Außerdem war es fast unmöglich, in New York an Theaterjobs zu kommen.
Und Schicksal, wie Jess es nannte, war es erst recht nicht. Daran glaubte ich nicht. Das war nur eine billige Erklärung, um Verantwortung abzugeben, wenn man etwas vergeigt hatte. Aber man selbst bestimmte über sein Leben. Niemand sonst.
Ich streckte meinen Rücken durch, der nach dem langen Sitzen im Theater ganz verspannt war, und zog mein Handy aus der Tasche. Mit kalten Fingern, vom einsetzenden Regen, schrieb ich Jake eine kurze Nachricht, ob ich noch etwas mitbringen sollte, bevor ich mich bei ihm breitmachen würde. Natürlich hatte er mich heute Vormittag im Café überreden können, wenigstens für zwei Tage bei ihm zu übernachten, und mindestens so lange, bis die Temperaturen wieder ein wenig hochgehen würden. Ich war eingeknickt. Schließlich brauchte ich dringend eine heiße Dusche.
Das Display leuchtete nach nur wenigen Sekunden wieder auf, nachdem ich die Nachricht verschickt hatte. Ich stöhnte genervt auf, als ich Jakes Nachricht sah.
Jake: Bringst du etwas von Nonono mit?
Ich: Ernsthaft? Der Laden ist völlig überteuert, und ich muss bis zur Upper East Side fahren.
Jake: Sieh es als Bezahlung für ein warmes Bett und Essen an.
Ich: Das Essen bezahle ich doch schon.
Jake: Ich nehme die Shoyu Ramen. Lieb dich.
Als Antwort schickte ich ihm drei Mittelfinger und ein Herz-Emoji, machte mich dann jedoch auf den Weg Richtung Madison Avenue.
Nach einer halben Ewigkeit verließ ich das Nonono mit vier Styroporbechern in meinen Händen. Zwei für die Suppen. Zwei für die Nudeln samt Gemüse.
Ein weiterer Grund, weshalb der Laden überteuert war. Es gab noch nicht mal Tüten, wodurch ich mir an den Bechern fast die Finger verbrannte.
Obwohl ich mich beeilen sollte, damit ich nicht noch nasser wurde, verlangsamte ich meine Schritte. Immerhin konnten so die Styroporbecher abkühlen.
Die Bürgersteige der breiten Einkaufsmeile, an denen sich ein Geschäft an das nächste reihte, waren trotz des miesen Wetters völlig überfüllt. Ich musste ständig aufpassen, dass ich niemanden anrempelte, und trotzdem genoss ich es, im Strom der Menschen fast zu verschwinden. So konnte ich mir wenigstens für einen Moment einreden, dass ich normal war.
Das laute Hupen der gelben Taxis, in denen sich die Fahrer über den langsamen Verkehr aufregten, gepaart mit dem leichten Prasseln des Regens auf meiner Kapuze bildeten das perfekte Hintergrundrauschen, damit ich meine Gedanken ein bisschen ordnen konnte.
Es hätte mir klar sein müssen, dass etwas Schlechtes passieren würde. Die Begegnung mit diesen seltsamen Fledermauswesen war definitiv ein Anzeichen dafür gewesen. Gleichzeitig wurde ich das Gefühl nicht los, dass es noch nicht alles war. Dass meine Kündigung nur ein weiterer Vorbote war, ein weiteres Omen, das eine Katastrophe ankündigte.
Statt mich den negativen Gedanken hinzugeben, versuchte ich, sie umzulenken. Wie meine Therapeutin es mir empfohlen hatte, als die Dunkelheit nicht nur meine Erinnerungen, sondern auch meine Gedanken überlagerte, versuchte ich, mich auf die positiven Dinge in meinem Leben zu konzentrieren und auf mein Ziel, das mich antrieb, jeden Morgen aus meinem Bett aufzustehen. Auf Dad und Jake und meine Wunschvorstellung, irgendwann vor ihnen auf der Bühne zu stehen. In eine Rolle zu schlüpfen, die mich vergessen ließ, wer ich war. Ich konnte nichts gegen die Bilder tun, die in meinen Kopf schossen. Mein stolzer Dad im Publikum, Jake neben ihm, vielleicht mit Blumen in der Hand. Wie wir danach zu dritt essen gehen würden. Und für einen Moment erlaubte ich es mir, das wohlige Gefühl in meinem Bauch vollständig zuzulassen, das mich dabei durchflutete. Auch wenn ich wusste, dass es gefährlich war, sich etwas von ganzem Herzen zu wünschen. Der Schmerz, wenn der Wunsch nicht in Erfüllung ging, war danach nur viel schlimmer. Und die Realität, dass ich mich von meinem Wunsch heute mehrere Meilen entfernt hatte, schlug zu wie eine gewaltige Abrisskugel.
Ich balancierte umständlich die Becher in einer Hand, um mein Handy aus der Jackentasche zu ziehen, als mich jemand von hinten anrempelte.
Die Suppen rutschten mir aus der Hand und ergossen sich über den betonierten Fußweg. Ich stolperte, hielt mein Handy fest umklammert und hob den Blick, um nachzuschauen, wer keine Augen im Kopf hatte.
»Hey, pass doch –«
Die Worte blieben mir im Hals stecken, als ich einen Lufthauch spürte. Da sah ich sie. Lange lederne Flügel. Kahle Köpfe und Klauen so spitz, dass sich alles in mir verkrampfte. Mein Körper drückte die Pausetaste. Ich war unfähig, mich zu bewegen, obwohl mich Angst antrieb, sofort davonzulaufen. Aber es war der Schock, der mich wie angewurzelt stehen bleiben ließ. Es waren nicht die Wesen, die mich angerempelt hatten. Es war ein Mann. Und dieser Mann floh gerade vor meinen persönlichen Rachegeistern.
4
Taru
Ein Jahr hatte ich nach ihr gesucht. Jetzt hatte ich sie gefunden. Endlich.
5
Rio
Dieser Typ rannte in eine Sackgasse und geradewegs in seinen Tod. Die drei unheimlichen Riesenfledermäuse folgten ihm dabei langsam, fast schon gemächlich. Als wüssten sie, dass er verloren war. Als ließen sie sich extra viel Zeit, um ihr Opfer für einen Moment in Sicherheit zu wiegen.
Wie von selbst setzte ich mich in Bewegung, doch hielt abrupt inne. Mein Herz schlug so laut, dass sein Hämmern in meinen Ohren widerhallte, während ich mein Handy so fest umklammert hielt, dass meine Handfläche schmerzte.
Was sollte ich tun? Ich konnte ihm nicht helfen – womit auch? Ich hatte noch nie gesehen, wie sie jemanden verfolgten. Sie hatten immer nur gelauert, sich nie bewegt.
Die Polizei konnte ich ebenfalls nicht anrufen. Was sollte ich ihnen denn auch sagen? Dass ein Mann von gefährlichen Kreaturen verfolgt wurde, von denen ich glaubte, sie entstammten nur meinem Geist, und die plötzlich real geworden waren? Genauso gut hätte ich mich direkt selbst in eine psychiatrische Klinik einweisen können.
Panisch sah ich mich um. Vielleicht hatte noch jemand diese Situation beobachtet. Doch die Menschen liefen genauso unbeteiligt um mich herum wie vor wenigen Sekunden. Ich war die Einzige, die davon etwas mitbekommen hatte. Natürlich.
Ein lautes Kreischen erklang aus der Gasse. Ich warf meine Sorgen über Bord und rannte los. Über die Ausmaße, was geschehen würde, sollten diese Kreaturen wirklich echt sein, könnte ich mir später noch Gedanken machen. Ich drängte mich an Passanten mit vollen Einkaufstüten vorbei, ignorierte empörte Rufe, weil ich mich rücksichtlos durch die Menge drückte. Mein Ziel war nur noch ein Schritt entfernt.
Stolpernd kam ich zum Stehen. Die Gasse lag in dunklen Schatten vor mir. Nur das Licht der Straßenlampen und der beleuchteten Büros einige Etagen darüber erhellte die schmale Sackgasse. Auf der rechten Seite stapelten sich die Müllsäcke auf den überfüllten Tonnen, gefolgt von unzähligen leeren Glasflaschen. Direkt daneben schwebten die ersten zwei Wesen.
Über deren große ledrige Flügel, die an den Enden scharfe Spitzen trugen, floss der Regen hinab. Das dritte Wesen drängte den Mann immer näher gegen die Hauswand und breitete dabei drohend die Flügel aus. Ein entsetzliches Knurren erklang von ihr. »Du kannst uns nicht entkommen, Schattenprinz.«
Ich hielt den Atem an. Diese Stimme war zu menschlich, zu real.
Das war kein Traum, keine Halluzination oder eine Bewältigungsstrategie, von der meine Therapeuten immer gesprochen hatten. Das musste die Realität sein, denn diese Stimme und das schwere Atmen des Mannes, das ich zu deutlich hörte – niemals konnte das meinem Kopf entspringen. Außerdem hatte ich gesehen, wie der Typ vor den Wesen davongelaufen war, was bedeutete, er hatte sie gesehen. Und wenn ein anderer Mensch diese Ungeheuer sehen konnte, dann mussten sie real sein. Dann waren sie nicht mehr nur in meinem Kopf.
»Ladys, wir können das auch anders regeln. Wie wäre es –«, setzte der Mann an, doch nur, damit ihm das Wort abgeschnitten wurde, als das Wesen ihn am Hals packte und gegen die Hauswand schleuderte. Ich keuchte auf und presste mir im gleichen Moment die Hand vor den Mund. Rechnete damit, dass die anderen beiden sich auf mich stürzen würden. Nur der Mann hob ruckartig seinen Kopf. Als er mich entdeckte, entstand ein breites Grinsen auf seinem Gesicht. Vielleicht hätte ich ihm doch lieber nicht folgen sollen.
»Bist du tatsächlich so töricht und glaubst, ein Lächeln könnte dich retten, kleiner Schattenprinz?«, zischte das Wesen, die Klaue immer noch in der Luft erhoben.
»Sicher doch, meine Damen. Heute bin ich ein richtiger Glückspilz«, gab er lässig zurück, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Findet ihr nicht auch, dass die Menschen definitiv zu viel Müll produzieren?« Sein Blick huschte zu den Tonnen neben mir. Ich konnte mich immer noch nicht rühren.
Eines der anderen Wesen lachte gackernd auf. »Er ist verrückt geworden. Wir sollten ihn endlich verspeisen.«
»Megaira, zügle dich«, gab das erste Wesen unwirsch zurück und drehte leicht den Kopf in die Richtung der beiden anderen. »Das ist nicht unsere Aufgabe. Er gehört vor die Götter.«
Götter? Mein Herz setzte aus, und für einen Moment glaubte ich, sie hätte mich gesehen. Doch ihr Blick glitt über mich hinweg, als wäre ich nicht da.
Eines der Wesen zischte genervt, als wäre es ganz und gar nicht glücklich darüber, das potenzielle Abendessen verloren zu haben. Der Mann schnaubte nur belustigt auf. »Ärger im Paradies?«
Mein Blick zuckte wieder zu dem Typen, der immer noch gegen die Hauswand gepresst wurde. Eine rote Spur lief seinen Hals hinab. Doch sein Grinsen erlosch nicht.
»Sei still.« Das Wesen holte mit ihrer Klaue aus und vergrub sie im Magen des Mannes. Ich stolperte einen Schritt zurück, die Augen weit aufgerissen. Der Mann stöhnte auf. Noch immer sah er nur mich an.
»Aber mal ehrlich, wäre es nicht eine Schande, wenn es keine Müllbeutel geben würde? Der ganze stickende, vergammelte Inhalt wäre einfach überall. Was für eine schreckliche Ablenkung das auf den Straßen geben würde.« Noch einmal sah er zu den Tonnen, diesmal deutete er sogar mit einem leichten Kopfnicken zu mir. Und ich verstand. Er bat mich um Hilfe. Zeigte mir, was ich tun sollte.
Schmerzhaft verzog er das Gesicht, als das Wesen die Klaue aus ihm herausriss. Er warf der Kreatur einen tödlichen Blick zu. Aber er rührte sich nicht. Er machte keine Anstalten, sich zu befreien.
Übelkeit stieg in mir auf, als sie mit ihrer spitzen Zunge über das Blut an ihrer Klaue leckte. Ich musste etwas tun. Jetzt.
Ich dachte nicht mehr darüber nach, sondern stürmte zu der Tonne, in der sich die Müllsäcke bereits über deren Rand stapelten, und zog zwei volle Säcke herunter. Mit ganzer Kraft warf ich sie auf die ersten Wesen. Adrenalin gemischt mit Freude über meinen Treffer rauschten durch meinen Körper. Die Riesenfledermäuse kreischten auf und zuckten zusammen, als hätten sie es tatsächlich nicht kommen sehen. Sie wirbelten herum, um den Grund zu sehen, während die Beutel zerrissen und sich der Inhalt überall verteilte. Die Freude verflog so schnell, wie sie gekommen war. Ich hielt den Atem an, blieb ganz starr.
»Was war das? Was soll das?«
Aufgeregt schwangen sie mit ihren Flügeln, und ein ekelhafter Gestank ließ mich beinahe würgen. Ich sah zu dem Mann, der nur nickte, als wollte er sagen: Mach weiter!
Also nahm ich noch mehr Müllbeutel und schleuderte sie den Wesen weiter entgegen, bis sie rasend vor Wut waren. Glasflaschen zerschellten an ihren Köpfen und landeten in den Pfützen zu ihren Füßen, die Reste von verschimmeltem Essen blieben an ihren Flügeln hängen. Ich warf immer weiter.
»Haltet still!«, schrie das Wesen, das den Mann gegen die Wand drückte. Sie drehte sich zu ihren Gefährten um. Ein Fehler. In diesem Moment rammte der Mann ihr eine Faust in den Bauch. Kurz darauf schlug er seinen Kopf gegen ihren. Die Kreatur lockerte die Klaue, taumelte sogar ein paar Schritte nach hinten.
Diese Chance nutze er. Er bewegte sich so schnell an der linken Seite der Gasse entlang, dass ich glaubte, er würde mit den Schatten verschwimmen.
Ein wütendes Kreischen ließ mich zusammenfahren.
»Wo ist er hin?« Das Wesen, das ihn zuvor noch gegen die Wand gedrückt hatte, drehte sich im Kreis. Rasend vor Wut schlug sie die Flügel zusammen. Sie sah nun direkt in meine Richtung. Und direkt durch mich durch. Warum sah sie mich nicht?
»Du hast dir ganz schön Zeit gelassen.« Ich zuckte zusammen, als der Mann neben mir auftauchte. Sein Hals war blutverschmiert. In seinem Blick lag ein aufgeregtes Funkeln, und das Grinsen schien noch breiter zu werden, als er meine Fassungslosigkeit bemerkte.
»Was –?«
»Erklärungen gibt’s später.« Er warf einen kurzen Blick über die Schulter, wo die Kreaturen kreischend im Kreis flogen und immer noch versuchten, sich vom Müll zu befreien, den ich auf ihnen verteilt hatte. Sie schrien, weil sie ihr Opfer verloren hatten. Weil ich es ihnen gestohlen hatte. Ein ungutes Gefühl beschlich mich.
»Ich glaub es nicht. Es hat wirklich funktioniert«, murmelte der Typ und strahlte dabei, als würde er zwei Welpen beim Herumtollen zuschauen. Er wandte sich wieder zu mir um, ergriff meine Hand und lächelte mir verschwörerisch zu. »Komm mit!«
Erst nach einer gefühlten Ewigkeit, als meine Lungen schon kurz vor dem Bersten waren, hielten wir am Ende des Central Parks auf der Fünften an. Ich zog meine Hand von dem Typen, die er die ganze Zeit gehalten hatte – wahrscheinlich, weil er dachte, ich würde schon nach drei Blocks kollabieren.
Schwer atmend stützte ich mich mit meinen Händen auf den Knien ab und versuchte, meinen Körper davon zu überzeugen, dass er genug Sauerstoff bekam. Ich sah zu dem Typen, der wirkte wie das blühende Leben. Er drehte sich im Kreis und betrachtete staunend den nächtlichen Südeingang zum Central Park, die geschlossenen Hotdog-Stände und die beleuchteten Hochhäuser, als würde er alles zum ersten Mal sehen. Dabei war er derjenige von uns, der verletzt war.
Als sich sein fast schon entzückter Blick auf mich legte, richtete ich mich auf. Ich fuhr mir mit dem Handrücken über meine verschwitzte Stirn. Trotz des kalten Oktoberregens, der sich zum Glück langsam legte, war mir furchtbar warm.
»Was zum Teufel war das?«
Der Typ kicherte kurz, als hätte ich einen Witz gemacht, den nur er verstand. Doch als ich nicht darauf reagierte, fuhr er sich mit einer Hand durch sein nasses schwarzes Haar und zuckte unbeeindruckt mit den Schultern. »Erinnyen, ganz unangenehme Zeitgenossinnen, wenn sie auf dich angesetzt wurden.« Er trat einen Schritt auf mich zu. Neugierde lag in seinem Blick. Ich wich zurück, und sofort hielt er inne. »Aber dank dir sind sie jetzt kein Problem mehr für mich.«
»Erinnyen?« Ich schluckte und ignorierte das Letzte, was er sagte.
»Ihr Menschen würdet sie wohl eher als Furien bezeichnen, finde ich auch ganz nett. Die Damen können durchaus garstig werden, wenn man sie reizt.« Er verzog leicht den Mund. Garstig. Ja, klar. Mir würde ein ganz anderes Wort einfallen.
»Furien«, wiederholte ich. »Wie aus Percy Jackson?«
Er nickte und lächelte leicht. »Genau, obwohl der gute Percy aus dem Film kaum etwas mit seinem Namensvetter zu tun hat. Perseus war ein grauenhaftes Balg, und er gehört in die Tiefen des Tartaros, wenn man mich gefragt hätte.« Wieder zuckte er mit den Schultern. »Hat man aber nicht.«
»Ich muss verrückt sein«, hörte ich mich sagen und wich immer weiter vor ihm zurück. Mein Atem beschleunigte sich. Meinen Herzschlag konnte ich beinahe auf meiner Zungenspitze spüren. Ich hätte diese Gasse niemals betreten sollen. Ich hätte einfach weitergehen sollen. »Das, was eben geschehen ist, war nicht real, oder? Du bist nicht real. Das ist alles nur in meinem Kopf. Das –«
»Hey. Okay. Sieh mich an.« Plötzlich stand er direkt vor mir und legte seine Hände auf meine Schultern. Das beruhigende Gewicht half mir, mich auf meinen Atem zu konzentrieren. »Das hier ist real. Spürst du den Regen auf deiner Haut? Meine Hände auf deinen Schultern? Das hier –« Er deutete mit einem Nicken zwischen uns hin und her. »Wir sind echt.«
Er sah mir so fest in die Augen, dass ich nicht wagte zu blinzeln. Aus Angst, er würde verschwinden und ich mir eingestehen musste, dass noch mehr Sachen mit mir nicht stimmten.
»Das könntest du auch sagen, wenn du nicht real wärst«, gab ich leise zurück, als sich mein Herz etwas beruhigte.
»Das stimmt.« Er nickte nachdenklich, ließ mich jedoch keinen Moment aus den Augen. »Aber genau genommen kannst du dir nie sicher sein, ob es real ist. Hast du Matrix gesehen? Ich fand diesen Ansatz ziemlich überzeugend –«
»Das ist nicht hilfreich!«, unterbrach ich ihn und fuhr mir mit den Händen über mein Gesicht. Dabei rutschten seine Hände von meinen Schultern. »Okay, mal angenommen, das eben hat sich nicht nur in meinem Kopf abgespielt, müssen wir in ein Krankenhaus.« Ich begann damit, auf und ab zu laufen. Irgendwie meine Gedanken zu ordnen. Er war echt. Verdammt. Das hätte ich mir nicht einbilden können, oder? »Vielleicht ist ein Krankenhaus auch eine schlechte Idee«, überlegte ich weiter, um mich von den eigentlichen Gedanken abzulenken. »Sie könnten denken, ich wäre der Täter. Wie soll ich ihnen erklären, was passiert ist? Obwohl es auch nicht wirklich typisch ist, dass ein Täter sein Opfer ins Krankenhaus bringt. Ich meine …«
»Warum willst du in ein Krankenhaus?«, unterbrach er mich neugierig. Er hatte sich auf die hüfthohe Steinmauer gesetzt. Mit den Beinen überkreuzt betrachtete er mich und legte den Kopf schief.
»Was?« Ich stolperte beinahe über meine eigenen Füße und starrte ihn verdattert an.
»Warum willst du in ein Krankenhaus?«, wiederholte er seine Frage.
»Weil … Weil du verletzt bist?« Ich deutete auf seinen Hals, an dem immer noch dunkelrotes Blut auf seiner hellen Haut klebte.
Als hätte er diesen Umstand vergessen, zog er überrascht die Augenbrauen hoch und wischte über seinen Hals. »Ach das. Nicht der Rede wert.« Er wischte genug Blut weg, dass ich seine unverletzte Haut darunter sehen konnte, als ich näher trat. »Schon wieder verheilt, siehst du?«
»Aber die … dein Bauch?«
Er hob den dunklen Pullover. Wieder wischte er mit der Hand über die Haut. Unter dem Blut war keine Wunde zu sehen.
Ich stolperte einen Schritt zurück. Mein Herz rutschte eine Etage tiefer. »Das ist nicht real. Das kann nicht real sein. Definitiv nicht. Ich habe gesehen wie … Das … das …«
»Ich dachte, das hätten wir schon.« Er seufzte und erhob sich. Kam wieder auf mich zu und blieb einige Zentimeter vor mir stehen, sodass ich den Kopf leicht in den Nacken legen musste, um in sein Gesicht sehen zu können. Der Geruch von Honig und einer anderen süßen Note drang in meine Nase. Das konnte ich mir nicht eingebildet haben. So real konnten meine Halluzinationen nicht sein. »Also, ich mach es kurz.« Er verschränkte die Arme und setzte wieder dieses entzückte Lächeln auf, mit dem er den Central Park begutachtet hatte. »Mein Name ist Taru. Ich bin ein Totenrichter und wurde von den Göttern bestraft. Die Erinnyen, vor denen wir geflohen sind …« Er deutete mit einem Daumen hinter sich. »Diese durchaus reizenden Damen hat man mir auf den Hals gehetzt, sollte ich mich nicht an die Regeln meiner Strafe halten. Ich erspar dir die Details. Aber ich brauche deine Hilfe und biete dir einen Job an. Als … mein persönlicher Begleitschutz.« Ein Grinsen entstand auf seinem Gesicht und enthüllte eine Reihe weißer Zähne. »Natürlich mit geeigneter Bezahlung. Ihr Menschen steht auf dieses Geld. Obwohl ich mir nicht sicher bin, wie menschlich du bist, aber das ist eine andere Sache. Also: Was sagst du?«
Niemals. In. Meinem. Ganzen. Leben.
Ein letzter Blick in sein Gesicht, und ich wirbelte herum und lief. Ich rannte so schnell ich konnte. Immer weiter, immer schneller. Ich ignorierte das Brennen in meinen Lungen, das mich schon nach zwei Blocks überkam. Ich ignorierte die beißende Angst, die mir im Nacken saß.
Je weiter ich lief, desto mehr konnte ich mir einreden, dass es nicht echt war.