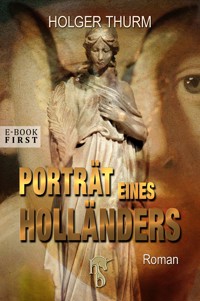
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks: e-book first
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem Amsterdamer Museum stößt Willem Voss auf ein verschollenes Porträt aus dem 17. Jahrhundert. Der Mann auf dem Gemälde gleicht ihm bis aufs Haar. Als Willem herausfindet, dass der Porträtierte ermordet worden ist, will er die Tatumstände ans Licht bringen. Doch ein unbekannter Verfolger hindert ihn plötzlich daran und trachtet ihm nach dem Leben. Immer mehr wird Willem klar, dass seine Ähnlichkeit mit dem Porträt kein Zufall ist. Das ahnt auch die Restauratorin Sophie Thijssen, die vom Anblick des Bildes mehr als nur angezogen ist. Sie will das reale Abbild der Gegenwart unbedingt finden. Denn ein wichtiges Detail auf dem Gemälde wurde übermalt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Holger Thurm
Porträt eines Holländers
Roman
»Mensch, geh nur in dich selbst! Denn nach dem Stein der WeisenDarf man nicht allererst in fremde Lande reisen.«
Angelus Silesius, Das große Buch der Mystiker
I
Amsterdam (Gegenwart).
Das Haus in der Amsterdamer Keizersgracht barg ein Geheimnis, das es fast vier Jahrhunderte geschafft hatte, unentdeckt zu bleiben. An diesem sonnigen Septembervormittag sollte es gelüftet werden. Der Hammer des Bauarbeiters prallte unablässig gegen die Wandvertäfelung im Kaminzimmer des baufälligen Palais. Splitternd gab das morsche Holz nach. So legte der Mann Schlag um Schlag die Wand frei, die sich seit Jahrhunderten dahinter verborgen hatte. Er dachte nicht groß nach über diese Tätigkeit, die ihm sein Vorarbeiter aufgetragen hatte. Und doch brachte sie ihn und damit die Öffentlichkeit mit jedem Schlag dem Geheimnis näher.
Einst war das Palais mit seiner Backsteinfassade und seinem reich verzierten Eingangsportal der ganze Stolz einer jüdischen Amsterdamer Kaufmannsfamilie gewesen. Sie hatte es im 18. Jahrhundert als Wohnsitz bauen lassen. Die Jahreszahl 1756 prangte noch immer eingemeißelt über dem Türstock. Doch seit dem Zweiten Weltkrieg war das Haus schwer vernachlässigt worden. Die Fassade bröckelte. Der Putz hatte Risse. Das Treppengeländer war verrostet.
Zweimal musste das Geheimnis des Hauses vor heranrückenden Feinden versteckt werden: 1806, als die Truppen Napoleons Amsterdam besetzten, und 1940, als die Deutschen einmarschierten. Die jüdische Bankiersfamilie wurde erst enteignet, dann verhaftet und schließlich nach Westerbork deportiert. Ihre Spur verliert sich im Osten Polens, im Vernichtungslager Sobibor. Und da nun niemand mehr übrig war, der darum wissen konnte, lag das Geheimnis des Hauses vergessen und verborgen wie in einer der Zeit entrückten Parallelwelt.
Nach dem Krieg konnten amerikanische Erben ausfindig gemacht werden, die das Haus allerdings nie bewohnten, geschweige denn pflegten. Immer wieder hatten Kraaker, Amsterdamer Hausbesetzer, das leer stehende Palais besetzt und in den Salons und Stuben gewohnt. Das Haus verkam auch im Inneren mehr und mehr. Schließlich erwarb die Stadt das Palais und begann mit der Sanierung. Das einstige Schmuckstück in der Keizersgracht sollte wieder eines werden. So wurde das Palais im Sommer schließlich endgültig geräumt. Nachfolgend zogen die Bautrupps vor das Gelände, errichteten Gerüste vor der graffitibesprühten Fassade und ihren eingeschlagenen Fensterscheiben. Sie stemmten den Putz von den Wänden und entfernten die alten Fensterrahmen. Sie entkernten das Innere, rissen die rostigen Rohre heraus und mit ihnen gleich auch die marode Verkabelung. Sie schliffen die schimmeligen Tapeten ab, brachen die Bodendielen auf und zertrümmerten Sanitäreinrichtungen, Kacheln und Fliesen. Der Schutt der Jahrhunderte fiel durch die Schläuche herab in Container auf dem Gehweg und wirbelte staubige Wolken in die Amsterdamer Sommerluft.
Das holzgetäfelte Kaminzimmer im ersten Stock war einmal der Salon der Familie gewesen. Über sechs Generationen hinweg hatte die Familie die kalten Abende vor dem Kaminfeuer verbracht. Das jeweilige Oberhaupt des Hauses durfte hier so manches einträgliche Geschäft bei einem Glas Portwein abgeschlossen haben. Kinder mochten hier im Schein des neunarmigen Leuchters am Chanukka-Fest ihre Geschenke ausgepackt und gleich mit ihnen gespielt haben. Doch von den vielen Erlebnissen und Erinnerungen, vom Gelächter und vom Streit, von den geflüsterten Liebesworten, den elterlichen Ermahnungen an die Kinder und vom Klingen der Portweingläser war nicht mehr übrig geblieben als ein Häuflein Asche im Kamin.
Als der Hammer sich einmal im Holz verkeilte und der Bauarbeiter Schwierigkeiten hatte, ihn aus der Täfelung zu ziehen, da erblickte er im Lichtstrahl, der durch das frisch geschlagene Loch drang, ein großes, flaches Paket. Es bestand aus schmutzigen Stoffdecken, die mit Seil umwickelt worden waren. Neugierig schlug der Bauarbeiter weiter. Nach etwa zehn Minuten hatte er es soweit freigelegt, dass er es greifen konnte. Zu seiner Überraschung jedoch war das Paket so schwer, dass er es nicht alleine herausziehen konnte. Er rief zwei Bauarbeiter im Nachbarraum zu Hilfe. Drei Mann waren notwendig, das Paket aus seinem Versteck zu zerren. Der Vorarbeiter wurde hinzugerufen. Und als schließlich sechs weitere Bauarbeiter das Paket umringten und bestaunten, entschied der Vorarbeiter, es zu öffnen.
Mit einem Schnitt seines Teppichmessers löste er einige der Schnüre und schlug die Stoffdecke zurück. Was die Bauarbeiter an jenem Vormittag als Erstes erblickten, war ein verschnörkelter barocker Bilderrahmen, der golden glänzte und ein Gemälde umfasste, das bald als Sensationsfund gehandelt werden sollte. Noch wussten die Bauarbeiter nicht um die Tragweite ihrer Entdeckung. Doch war ihnen klar, dass sie nun die Bauleitung informieren mussten und etwas früher Pause machen konnten.
*
Rotterdam.
Willem Voss saß in einem Konferenzraum im Hochhaus der Veendam-Gruppe zusammen mit knapp zwanzig Männern und Frauen an einem langen Tisch. Ein großes Panoramafenster gab den Blick auf die Werft- und Hafenanlagen Rotterdams frei. Willem bemerkte zwar die schöne Aussicht vom obersten Stockwerk der Veendam-Zentrale, doch genoss er sie nicht. Vielmehr gaben ihm die mächtigen Bau- und Trockendocks, die Ladekräne des Hafens sowie die Abertausenden von bunten Frachtcontainern aus aller Welt, die sich auf dem Gelände stapelten, einen Eindruck von der Dimension des Geschäfts, das die Damen und Herren in ihren Kostümen und dunklen Anzügen an diesem Tag abzuschließen gedachten. Sie alle an diesem Tisch gehörten einer Elite an, die im Wirtschaftsleben tonangebend war: Investoren, Anwälte, Banker und Topmanager. Sie saßen beieinander und besprachen nichts weniger als die Zukunft einer der größten Reedereien und Werftbetriebe Europas.
Willem las wieder und wieder in den Unterlagen, die er selbst zusammengestellt hatte, überflog Organigramme und Kennzahlen. Zur Veendam-Gruppe gehörte die Reederei mit über sechshundert Schiffen, zwei Werften in Rotterdam und eine in Singapur. Hinzu kamen Handelsniederlassungen in über einhundert Ländern der Erde, vorrangig in Asien, Nord- und Südamerika. Die Aktiengesellschaft hatte rund vierzigtausend Mitarbeiter und verzeichnete Umsätze von über dreißig Milliarden Euro jährlich. Die Veendam-Gruppe war eine Aktiengesellschaft, doch waren nur knapp dreißig Prozent der Aktien in Streubesitz, weitere zwanzig Prozent in der Hand von Investoren und satte fünfzig Prozent plus eine Aktie in der Hand der Gründerfamilie Veendam, die das Unternehmen seit dem 18. Jahrhundert führte. Ihr jüngster Spross war Marcus Veendam, der den Vorsitz des Aufsichtsrates führte.
Am Konferenztisch saßen Mitglieder des Vorstandes, Topmanager und Juristen der Veendam-Gruppe, einige Finanzexperten niederländischer und französischer Banken, adrett anzusehende Vertreter einer großen Amsterdamer Anwaltskanzlei und Investoren, die bei Veendam einzusteigen gedachten. Unglücklicherweise hatte sich die Führung des Veendam-Konzerns in einer Weise verspekuliert, wie sie in der Geschichte des Traditionsunternehmens einmalig gewesen war. In der Absicht, den größten europäischen Konkurrenten, eine dänische Reederei, zu übernehmen, hatte sich Veendam hoffnungslos verschuldet. Ein Umstand, der im Falle der Übernahme rasch vergessen gewesen wäre. Doch machte die Banken- und Finanzkrise den Herren Reedern einen Strich durch die Rechnung. Die Übernahme der Dänen scheiterte. Die Schulden blieben. Dieser Entwicklung wollte ein großer Investor nicht länger tatenlos zusehen und beschloss, Kasse zu machen. Dies wiederum weckte das Interesse von Willems Arbeitgeber, einer Private-Equity-Firma namens Tribary Invest Europe. Der Ableger der New Yorker Tribary Invest hatte seinen Firmensitz in Amsterdam. Und als deren Vertreter saßen nun Willem und sein Chef Gerard Bols mit am Tisch.
»Unsere Wirtschaftsprüfer werden etwa drei Monate brauchen, aber wir denken an ein Übernahmeangebot für dreißig Prozent an Veendam, zehn Prozent mehr als Ihr bisheriger Investor an Anteilen innehatte«, referierte Gerard Bols. Willem betrachtete seinen Chef von der Seite. In seinem sportlich geschnittenen Zweireiher machte der Mittvierziger mal wieder eine gute Figur, wenngleich seine etwas große Nase, die Tränensäcke unter den blassen Augen und sein schütteres Haupthaar den Gesamteindruck etwas trübten. Er war wohl das, was man wohlmeinend einen Charakterkopf nannte, dachte Willem. Gerard war von jener Hässlichkeit, die um ihrer selbst nicht wusste, und gleichzeitig mit einem Selbstbewusstsein ausgestattet, das gerade gegenüber Frauen mit Vehemenz zum Tragen kam.
Wie anders war dagegen er selbst, Willem Voss. Er war ein hübscher blonder Mann von fünfunddreißig Jahren, durchaus eitel, aber weniger darauf bedacht, sich in Szene zu setzen. Er besaß schmale Wangen, eine gerade Nase und, wie ihm Frauen des Öfteren versichert hatten, sinnlich geschwungene Lippen. Seine wasserklaren, blauen Augen unter den ausgeprägten Brauen, sein markantes Kinn und sein kräftiger Bartwuchs verliehen ihm eine kühne Männlichkeit, derer er sich hie und da mit einem gezielten Blick in den Spiegel vergewisserte. Er besaß, das wusste er, eine Ausstrahlung, die binnen Sekunden zu überzeugen vermochte und keines übertrieben zur Schau getragenen Selbstbewusstseins bedurfte.
Er war von einer gewinnenden, zupackenden Art, zurückhaltend in der Rede, aber keineswegs schüchtern, besaß ein charmantes Lächeln und war sich der Wirkung seiner Grübchen, wenn er lachte, durchaus bewusst. Er war die Nummer zwei bei Tribary, gleich nach Gerard, und vermochte diese Rolle glaubhaft auszufüllen. Er schwieg und überließ Gerard das Reden. Denn eines hatte er bereits gelernt: Im Windschatten des Vordermannes radelte es sich leichter.
»Ein solcher Anteil bedeutet allerdings, dass die Veendam-Familie etwa zehn Prozent abgeben und die Mehrheit am eigenen Unternehmen verlieren würde«, wandte ein Vorstandsmitglied ein. »Sie hingegen erwerben eine Sperrminorität.«
Gerard Bols, der sich gerne hilflos gab, wenn man ihm Berechnung unterstellte, vermittelte auch nun den Eindruck, als läge ein gewisses Fatum über dem Konzern, dem er sich wie alle anderen beugen müsste. »Das ist der Preis, befürchte ich. Ich muss das Investment begründen. Und ohne eine machtvolle Mitsprache können wir so hohe Summen, wie sie für die Aufrechterhaltung Ihrer Liquidität notwendig scheinen, nicht gegenüber unserem Mutterhaus vertreten. Aber wir verstehen uns als strategischer Investor, der das Tagesgeschäft gerne jenen überlässt, die davon etwas verstehen. Erwarten Sie von uns Rat und Hilfe, aber keine Besserwisserei.«
Willem nickte innerlich, denn es waren seine Worte, die er Gerard zuvor aufgeschrieben hatte. So konzentriert er auch dessen Rede folgte, konnte ihm dennoch die kleine Kamera in einer Ecke des Raumes knapp unterhalb der Decke nicht entgehen, die langsam in seine Richtung schwenkte. Lautlos drehte sich das Objektiv, bis es genau auf Willem zu ruhen schien. Doch schenkte er diesem Umstand schon nach wenigen Sekunden keine Beachtung mehr.
»Nach Abschluss der Buchprüfungen machen wir Ihnen ein Angebot«, fuhr Gerard fort. »Dieses wird sich angesichts Ihres Entgegenkommens sicher leicht über dem Marktwert bewegen. Bis dahin öffnen Sie unseren Wirtschaftsprüfern Ihren Datenraum. Wir werden gemeinsam mit Ihren Juristen und unserer Kanzlei einen Vertragsentwurf ausarbeiten, der für alle Seiten ein Höchstmaß an Fairness und Sicherheit gewährleistet. Closing wäre der 1. Dezember.« Gerard setzte sich. Er hatte gesprochen. Auch wenn es Willems Worte gewesen waren.
*
In einem Büro im gleichen Stockwerk saß zeitgleich inmitten wertvoller asiatischer und afrikanischer Kunstgegenstände der Aufsichtsratsvorsitzende der Veendam-Gruppe, Marcus Veendam, an seinem Schreibtisch und blickte auf einem Monitor in das Gesicht von Willem Voss, der während des gesamten Gesprächs still und stumm wie schmückendes Beiwerk neben Gerard Bols gesessen und allerhöchstens einmal einer Anwältin auf der gegenüberliegenden Tischseite ein Lächeln geschenkt hatte. Mit einer Fernsteuerung zoomte Veendam Willems Gesicht noch weiter heran und betrachtete es mit einem Ausdruck des Interesses, wie er es sonst nur für seine Kunstsammlung aufbrachte.
*
Amsterdam.
Der Raum im Keller des Amsterdamer Reichsmuseums wurde grell von Neonröhren an der Decke erleuchtet. Zwei Wachmänner standen abseits eines Werktisches, auf dem das tags zuvor entdeckte Gemälde in seinem goldenen Rahmen lag, befreit von den staubigen Decken, die es rund siebzig Jahre vor Licht und Schmutz mehr schlecht als recht geschützt hatten. Die Restauratorin Sophie Thijssen und ihre Assistentin Marijke saßen auf Stühlen unweit der Stahltür, die den Raum hermetisch abschließen konnte, um hier lagernde Kunst vor Diebstahl zu schützen.
So sehr Sophie auch die Blicke der Wachmänner zu ignorieren versuchte, so wenig konnte sie ihre innere Anspannung angesichts der bevorstehenden Begutachtung des Gemäldes verbergen. Sie besah prüfend ihr Spiegelbild in der blank polierten Stahltür. Sie war eine sportliche Frau mit langen dunkelblonden Haaren, die meist etwas wirr nach oben gesteckt waren. Einzelne Haarsträhnen fielen immer wieder in Gesicht und Nacken, so auch jetzt. Rasch versuchte Sophie ihre Frisur zu ordnen. Sie war der Typ handfeste Jeansträgerin mit Farbflecken auf den Oberschenkeln, die vom Herumexperimentieren mit Chemikalien oder Farbresten stammten. Ihre gute Figur, die sie auch in einer befleckten Jeans machte, blieb den beiden Wachleuten offensichtlich nicht verborgen. Unentwegt starrten sie zu Sophie herüber. Ihre Assistentin Marijke war vielleicht nicht ganz so sportlich wie Sophie. Optisch passte sie eher in das Beuteschema eines Peter Paul Rubens. Marijke war aber einem Flirt grundsätzlich nicht abgeneigt, das wusste Sophie. Leider bewiesen die beiden uniformierten Männer im Raum so viel Kenntnis von weiblicher Psyche wie sie Kunstverstand besaßen.
»Wer ist denn der Typ auf dem Bild?«, fragte einer von ihnen, wohl um endlich ein Gespräch zu beginnen und die Stille im Raum zu durchbrechen. »Der sieht ja lustig aus.«
Sophie setzte das künstlichste Lächeln auf, dessen sie fähig war. »So hätten Sie auch ausgesehen, hätten Sie im 17. Jahrhundert gelebt.«
»Wow, so lange her, was?«, antwortete der Wachmann.
Das Gespräch war beendet, ehe es in Gang gekommen war. Doch lange dauerte das Schweigen im Raum nicht mehr an. Die Stahltür schwang auf. Herein traten Museumsdirektor Jan de Boer, ein hochgewachsener, hagerer Mann, sowie Adriaen Gijsbert Nisius, Professor am Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Universität von Amsterdam. Professor Nisius hatte keine Eile. Gemessenen Schrittes betrat er nach de Boer den Raum, trotz des warmen Sommertages im Trenchcoat, unter dem ein dunkler Nadelstreifenanzug sichtbar wurde. Der Krawattenknoten war akkurat gebunden. Sophie und Marijke erhoben sich von ihren Plätzen. Nisius nahm seinen Hut ab und drückte ihn einem der Wachmänner kommentarlos in die Hand.
Er näherte sich dem Gemälde, während er seinen Mantel öffnete, zog ein Brillenetui hervor und nahm eine Lesebrille heraus, die er gegen seine altmodische Hornbrille eintauschte. Seine Erscheinung erinnerte Sophie jedes Mal, wenn sie ihn sah, an jenen Professor Siletsky aus dem Ernst-Lubitsch-Film »Sein oder Nichtsein« von 1942, der als Doppelagent die polnischen Untergrundkämpfer an die Nazis zu verraten drohte.
Nisius trat an den Rand des Werktisches und beugte sich über das Gemälde. Museumsdirektor de Boer trat seitlich neben ihn und betrachtete mal das Fundstück, mal das Gesicht des Professors. Auch de Boer schien angespannt zu sein. Nisius dagegen blieb zunächst ohne Regung, schnaufte ein paar Mal und fuhr sich mit der Hand prüfend über den Kinnbart. Dann griff er nach einer Lupe, die seitlich des Rahmens auf dem Tisch lag. In langsamen Bahnen fuhr sein Blick durch das Glas das Gemälde von oben bis unten ab.
»Da gibt es für mich gar keinen Zweifel«, durchbrach er plötzlich das Schweigen.
Sophie und Marijke warfen sich vielsagende Blicke zu und lächelten. Nisius verharrte mit der Lupe in einer Ecke des Porträts über drei Buchstaben.
»›B L T‹ – Baltens. Ein verschollener Baltens.«
Ein Frohlocken huschte über das Gesicht von Museumsdirektor de Boer.
Nisius tauschte in aller Ruhe seine Brillen wieder aus, packte die Lesebrille ins Etui und steckte es zurück in die Innentasche seines Mantels. »Ein Meisterwerk! Wirklich ein Meisterwerk!«
*
Aus einem Konferenzraum im Amsterdamer Firmengebäude von Tribary Invest Europe quoll wenige Tage später eine Vielzahl von Herren in dunklen Anzügen. Gemeinsam mit Gerard Bols hatte Willem Voss an einer Sitzung von Wirtschaftsprüfern und Anwälten teilgenommen, um erste Schritte für einen möglichen Erwerb von Anteilen an der Veendam-Reederei zu besprechen. Wie immer hatte Gerard als Leiter des Projekts einen Großteil der Redezeit für seine Ziele beansprucht und Willem die Detailaspekte in der letzten halben Stunde überlassen. Gerard hielt sich mit den notwendigen Kleinigkeiten nie gerne auf, das hatte Willem schon früh in ihrer Zusammenarbeit bemerkt. Gerard sah sich als den Visionär, den Antreiber, den Takt- und Impulsgeber. Aber er brauchte Willem als denjenigen, der seine Visionen durchdachte und in umsetzbare Projekte überführte. Gerard wusste mit Sicherheit, was er an Willem hatte. Er gerierte sich gerne als Mentor und Förderer. Er hatte Willem wiederholt die Partnerschaft im Unternehmen in Aussicht gestellt, aber auf eine Weise, wie man einem Esel eine Karotte vor die Nase hielt, damit er weitertrabte.
Willem hatte dieses Prinzip verstanden. Er war gewillt, Partner bei Tribary Invest zu werden und dafür noch ein bis zwei große Projekte abzuwickeln. Mit Mitte dreißig sah er den natürlichen Zeitpunkt gekommen, ganz oben mitzumischen und das große Geld zu verdienen. Nicht dass Willem wenig verdiente, im Gegenteil: Er besaß eine Eigentumswohnung in Amsterdam, fuhr einen Jaguar, hatte ein Boot am Nieuwe Meer im Südwesten der Stadt und ein Strandhaus an der Nordsee. Willem verdankte Gerard bereits viel, aber eigentlich war er der Vater von Gerards Erfolgen. Mit zunehmender Ungeduld erwartete er seine Belohnung.
Die Besprechung hatte länger gedauert als erwartet, fast zwei Stunden länger. Willem war in Eile. Die meisten seiner Termine, auch die abendlichen, waren geschäftlicher Natur. Doch ausgerechnet heute hatte er einen privaten Termin, zu dem er gerne pünktlich erschienen wäre und der sich auch partout nicht aufschieben ließ. Doch Gerard schien einen Riecher dafür zu haben und durchkreuzte seine Pläne. »Willem, wir müssen noch kurz mit den New Yorkern telefonieren. Bobbie wollte ein Update nach dem Meeting.«
Willem blickte besorgt auf das Display seines Handys und sah nach der Uhrzeit. »Ich kann von unterwegs eine Mail schreiben, aber ich muss jetzt dringend los. Anouk …«
»Ein Telefonat geht doch viel schneller als eine Mail. Dort ist es gleich vierzehn Uhr, das passt hervorragend. Und überhaupt, willst du einen halben Tag freimachen oder was?« Gerard lachte über seinen Scherz.
»Um acht ist Premiere im Theater Carré. Anouk spielt mit. Ich hab ihr versprochen, wenigstens einmal bei einer Premiere …«
»Ich fasse es nicht. Unser New Yorker Partner fragt extra um eine Telefonkonferenz an, um den Stand im Veendam-Projekt zu erfahren. Und du willst ins Theater? Seit wann interessierst du dich überhaupt für so etwas?« Gerard zog Willem in sein Büro, der sich nur halbherzig wehrte.
*
Es war zwanzig Minuten nach acht, als Willem gehetzt die Treppen zum Zuschauersaal im Theater Carré hochspurtete. Er rannte einen Gang entlang und sah abwechselnd auf seine Eintrittskarte und auf die Beschilderung über den Türen zum Zuschauerraum. Ein Theaterangestellter sprang von seinem Stuhl im Gang auf. Als Willem eine Tür öffnen wollte, stellte er sich ihm in den Weg. »Sie können da jetzt nicht rein. Das Stück läuft bereits.«
Willem blickte den Mann mit Verwunderung an. »Meine Freundin Anouk Cramer spielt da mit. Sie ist die Ophelia.«
Der Saaldiener ließ sich davon nicht beeindrucken. »Dennoch müssen Sie bis zum Ende des ersten Aktes warten. Ich kann Sie nicht während der laufenden Vorstellung hineinlassen.«
Willem blickte genervt hin und her. Der Saaldiener sah ihn mit stoischer Gelassenheit an.
»Hören Sie«, erwiderte Willem schließlich, griff in seine Jacketttasche und holte ein Portemonnaie hervor, »das muss sich doch regeln lassen.« Er machte Anstalten, dem Saaldiener einen Fünfzigeuroschein zuzustecken. Doch der Mann machte eine abwehrende Geste.
»Nein, das geht nicht. Sie müssen sich gedulden!«
*
Auf der Bühne gelobte Shakespeares Hamlet, der Prinz von Dänemark, dass er das Andenken seines ihm erschienenen toten Vaters, des Königs, stets hochhalten werde: »Ja, du armer Geist, solang Gedächtnis haust – in dem zerstörten Ball hier. Dein gedenken?«
Anouk Cramer, die Darstellerin der Ophelia, blickte enttäuscht vom Bühnenrand aus auf die Szene. Vergeblich hatte sie zuvor ihren Freund Willem im Publikum gesucht. Dabei hatte er versprochen, dieses Mal pünktlich zu sein. Sogar einen der vorderen Plätze hatte sie ihm reservieren lassen. Doch der Platz blieb verwaist.
Auf der Bühne lief Hamlet auf und ab und setze seinen Schwur fort: »Von der Tafel der Erinn’rung will ich wegwischen alle törichten Geschichten, aus Büchern alle Sprüche, alle Bilder, die Spuren des Vergang’nen …«
*
Vor der Saaltür lief unterdessen Willem auf und ab und hörte dumpf die Stimme des Prinzen. Er verstand durch die geschlossenen Türen kein einziges Wort. Vermutlich hätte er auch nicht viel mitbekommen, hätte er im Publikum gesessen. Theater war seine Sache nicht. Es war ihm schon bei den wenigen Vorstellungen, die er in seiner Kindheit erlebt hatte, schwergefallen, auf diesen Klappsesseln wach zu bleiben. So einschläfernd wirkte Theater auf ihn, dass er selbst im tristen Foyer in Bewegung bleiben musste, wollte er nicht auf einem der Stühle im Gang einnicken. Inständig hoffte er, Anouk würde den leeren Platz in Reihe vier nicht bemerken, wenn sie auftrat.
*
Noch war Ophelia nicht auf der Bühne erschienen. Noch zweifelte Horatio die Erzählung seines Freundes Hamlet an, dass sich der Geist des toten Königs am helllichten Tage zeigen würde: »Bei Sonnenlicht, dies ist erstaunlich fremd.«
Anouk sah von ihrem Standort seitlich der Bühne aus, wie Hamlet die Arme ausbreitete.
»So heiß als einen Fremden es willkommen.« Der Prinz an der Grenze zwischen Schwermut und Wahnsinn setzte sich in ernste Pose und schmetterte die Worte ins Publikum: »Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt, Horatio.«
*
Im Flur hatte sich Willem erschöpft vom Auf-und-ab-Gehen schließlich doch auf einen der Stühle gesetzt. Mittlerweile nahm er auch das Risiko in Kauf, einzunicken und die gesamte Vorstellung zu verschlafen. Und tatsächlich, schon nach wenigen Minuten stellten sich die ersten wirren Gedankengänge ein, die ihn in die Welt des Unbewussten herübertragen wollten. Doch kaum hatte sich sein Kinn erstmals auf die Brust gesenkt, tippte ihn der Saaldiener an. Willem schreckte hoch.
Der Mann legte die Finger auf die Lippen. »Jetzt können Sie. Aber seien Sie leise, es ist noch keine Pause.« Der Mann öffnete die Tür einen Spalt und Willem schlüpfte hindurch.
*
Ophelias trauriger Blick war nicht sonderlich gespielt, denn Anouk musste sich nicht künstlich in einen Zustand der Melancholie versetzen. Mittlerweile sah sie Willem zwar in Reihe vier sitzen, doch vermochte sie dieser Umstand nicht darüber hinwegzutrösten, dass Willem es nicht einmal zu ihrem Bühnendebüt im Theater Carré geschafft hatte, pünktlich zu erscheinen. Nun saß er da mit gelangweiltem Blick und verfolgte ihr Bühnenspiel.
»Fräulein, soll ich in Eurem Schoße liegen?« Der Hamlet-Darsteller warf sich gekonnt zu Anouks Füßen. Anouk, schlank, feingliedrig und mit hellblondem Haar, sah auf ihn herab. Willem hatte sie ihrer Zartheit wegen oft geneckt und sie mit jenen ätherischen Schönheiten verglichen, die als Prinzessinnen oder geknechtete Stieftöchter in tschechischen Märchenverfilmungen aufgetreten waren. Manchmal hasste sie ihre Aura unwirklicher Schönheit und vergänglicher Noblesse. Doch in der Rolle der Ophelia, eines liebenden, doch unterdrückten Wesens inmitten eines degenerierten Hofstaats, kam ihr dieses Erscheinungsbild sehr zugute.
Mit dem gepflegten Ausdruck eines blaublütigen Ennuis antwortete Anouk alias Ophelia: »Nein, mein Prinz.«
Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Willem ein herzhaftes Gähnen unterdrückte und auf die Uhr sah.
»Ich meine, den Kopf auf Euren Schoß gelehnt«, präzisierte Hamlet sein Anliegen.
»Ja, mein Prinz.« Ophelia blickte in die Ferne über die Köpfe des Publikums hinweg. Sie stellte sich dabei vor, dass am Horizont ein Vogel einsam seine Kreise zöge und allemal bedeutsamer wäre als ein dänischer Thronfolger zu ihren Füßen.
»Ein schöner Gedanke, zwischen den Beinen eines Mädchens zu liegen«, schmeichelte der Prinz.
Anouk sah zu Willem hinüber. Dieser verzog das Gesicht zu einem gequälten Lächeln.
*
Anouks Stöckelschuhe hallten auf dem Betonboden der Hochgarage, in der Willem sein Auto geparkt hatte. Sie lief mit erfrorener Miene voran.
Willem schlurfte genervt und mit den Händen in den Manteltaschen hinter ihr her. »Ich habe gesagt, es hat mir gefallen.«
Anouk lief erbarmungslos weiter. »Ach ja? Ab dem zweiten Akt vielleicht.«
»Anouk, es tut mir leid. Gerard wollte noch mit New York telefonieren, und das Meeting hatte Stunden gedauert. Ich kam da einfach nicht weg.«
»Gerard, New York, das Meeting – alles wichtiger als die Premiere der eigenen Freundin.«
»Ich glaube nicht, dass du das verstehst«, stichelte Willem zurück. »Wir steigen bei einem Unternehmen mit Zigtausenden von Mitarbeitern ein, es geht um Hunderte von Millionen Euro. Logisch, dass da ein paar Abende länger werden.«
»Ein paar Abende! Wie viele meiner Premieren hast du besucht? Ich sag’s dir, bevor du nachdenken musst: keine einzige!«
»Veendam baut Schiffe, schafft Abertausende von Arbeitsplätzen, setzt Milliardenbeträge um, transportiert mit seiner riesigen Flotte Waren über alle Weltmeere. Das ist die Wirklichkeit! Nicht irgendwelche Geister und durchgeknallte Prinzen!«
Anouk blieb stehen und trat – nicht sehr damenhaft, wie Willem fand – mit dem Fuß auf. Fast wäre ihr ein Pfennigabsatz abgebrochen.
»Das ist Shakespeare! Das ist Theaterkunst! Menschen brauchen Theater! Geistige Nahrung! Etwas, was ihrem Leben Sinn und Halt gibt – wie die Kunst. Aber davon hast du ja keine Ahnung!«
Willem drückte auf den Autoschlüssel. Der Jaguar blinkte kurz und entriegelte die Türen. »Wie soll das bitte Menschen Halt geben? Tote, die wiederkehren! Wahnsinnige, die morden! Das ist doch Schwachsinn! Und dieser Hamlet, wie der dich angräbt! Ich sage nur: ›Kopf zwischen den Beinen!‹ Der meint wohl auch, im Schutze der Bühne könne er alle Register ziehen.«
»Das ist doch nur Text! Das ist Shakespeare!« Anouk stieg ein und schmiss die Beifahrertür zu.
*
Schweigend fuhren Anouk und Willem durch das nächtliche Amsterdam. Anouk blickte demonstrativ zum Seitenfenster hinaus. Willem sah zeitweise zu ihr hinüber, um sich dann kopfschüttelnd wieder dem Straßenverkehr zu widmen. »Bist du immer noch Ophelias Leiche oder schweigst du nur?«
Anouk schwieg.
»Ich meine, du bist sehr überzeugend – auch als Leiche. Ich frage mich nur, wie dich dieser Theaterkram auf Dauer am Leben erhalten soll.«
Anouk schwieg weiter. Offenbar musste Willem schwerere Geschütze auffahren, um sie zum Reden zu bringen. »Du hättest den Job in dieser Werbeagentur …«
»Hör auf damit!«
Willem hatte es geschafft. Madame sprach wieder mit ihm. »Was fasziniert dich so am Theater? Das ist doch tote Zeit. Da kommt nichts Produktives dabei heraus. Außer vielleicht das Eintrittsgeld.«
»Du denkst immer nur in Kategorien wie produktiv und effektiv. Menschen brauchen mehr als das.« Anouk brauchte eine Weile, ehe sie fortfuhr. »Sie wollen das Leben und den Tod begreifen. Die Tragik und Komik des Daseins. Sie wollen in sich hineinhorchen. Einen Draht zur Schöpfung spüren.«
Willem verdrehte die Augen. »Und das tun sie, wenn sie Hamlet auf der Bühne sehen?«
»Shakespeare hat das vor über vierhundert Jahren aufgeschrieben. Vor vierhundert Jahren die gleichen Gefühle, die gleichen Konflikte, die gleichen Leiden, wie sie Menschen heute auch erleben. Das ist …«, Anouk zuckte mit den Schultern, »… ewig. Shakespeare hat das in Worten verewigt. Und wir machen das Geschriebene wieder lebendig. Die Zuschauer leiden und spüren mit – auf die gleiche Weise wie vor Jahrhunderten. Das fasziniert mich!«
»In dieser Werbeagentur hättest du auch kreativ sein können. Aber du hättest wenigstens gutes Geld verdient.«
»Als ob das alles wäre! Diese verlogene Werbewelt! Glaubst du, ich will so werden wie du? Tag und Nacht Zahlen, Daten, Analysen, Ausschau halten nach Unternehmen, die ihr kaufen, aussaugen und wieder abstoßen könnt?«
»Alles Klischees! Unsere Investments …«
»Ich weiß, ihr habt schon viele Unternehmen gerettet, blabla … Ich kenne deinen Gerard. Wenn der Typ mir nicht gerade auf die Titten starrt, erzählt er ja nur, wie Tribary ein Unternehmen nach dem anderen rettet. Dann schaut er demonstrativ auf seine teure Uhr. Da kann einem doch nur schlecht werden! Und du bist auf dem besten Wege, genauso zu werden. Das Auto, das Boot …«
»Ach ja«, unterbracht Willem gereizt, »aber Auto, Boot, Wohnung und Strandhaus, das nutzt du doch auch alles gern. Glaubst du, du könntest dir das alles leisten ohne mich?«
»Deswegen bin ich jedenfalls nicht bei dir. Ich weiß nicht, warum ich es überhaupt noch bin. Schau dir dein Leben doch an! Was hast du von deinem Wohlstand? Du arbeitest den ganzen Tag, bist gehetzt, bist gereizt, verpasst die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Wo ist da der Sinn?«
Willem gab ein verächtliches Lachen von sich. »Jetzt kommt das wieder. Das Leben hat keinen Sinn.«
Anouk schüttelte den Kopf und guckte aus dem Seitenfenster. Die Lichter Amsterdams zogen im Dunkeln an den beiden vorüber.
»Mit der Einstellung kann man sich ja gleich begraben lassen«, seufzte Anouk.
»Ich nutze mein Leben ja«, erwiderte Willem. »Ich nutze es effektiv. Ich schaffe Werte, ich sorge vor, ich lebe gut.«
»Wann? Irgendwann! Du lebst nicht erst in Zukunft. Du lebst hier und heute. Du behandelst dein Leben wie ein Arbeitszeitkonto. Du reibst dich auf, rennst der Kohle hinterher, umgibst dich mit sinnlosem Zeug. Weil du es dir leisten kannst. Und irgendwann, wenn du dein Leben dann genießen könntest, dann weißt du gar nicht mehr, wie das geht. Dann bist du alt oder …«, sie fuchtelte erregt mit den Händen, »… tot und hast nichts von deinem vielen Geld. Wir sollten doch alle im Jetzt und Heute leben und es genießen. Und uns damit auseinandersetzen, was Leben eigentlich heißt, woher es kommt, wohin es geht, warum wir da sind …«
»Aber Anouk, wir sind nur ein Haufen zufällig entstandener Kohlenstoffverbindungen in einem planlosen Universum. Und wenn wir tot sind, zerfallen wir wieder. Chemie. Physik. Mehr nicht.«
Anouk seufzte schwer. »Reizende Vorstellung!«
*
Wieder schwiegen sie eine ganze Weile. Sie fuhren über Brücken und entlang der erleuchteten Grachten durch die Stadt. Anouk hatte das Gefühl, einen völlig fremden Mann neben sich sitzen zu haben. War ihr Gespräch schon unangenehm genug, war es das Schweigen erst recht. Anouk fühlte sich einsam, unverstanden und innerlich leer. Es war das gleiche Gefühl, das sie als Ophelia auf der Bühne in sich hervorrief, an der Seite eines veränderten Hamlet, der ihr zusehends fremder wird. Das Gemälde »Ophelia« aus dem 19. Jahrhundert kam ihr in den Sinn, auf welchem eine junge hübsche Frau in vollgesogenen Kleidern blütenbedeckt im Fluss treibt und ertrinkt. Anouk rief sich die Worte von Gertrude, Hamlets Mutter, in Erinnerung:
GERTRUDE
… Doch lange währt’ es nicht,Bis ihre Kleider, die sich schwer getrunken,Das arme Kind von ihren MelodienHinunterzogen in den schlamm’gen Tod.
Die Worte, die Shakespeare Hamlets Mutter in den Mund gelegt hatte, klangen sanft in Anouk nach. Die Trauer, die sie dabei empfand, war schwer und süßlich-sanft zugleich. Kohlenstoffverbindungen in einem planlosen Universum konnten solche Empfindungen nicht entwickeln!
Anouk sah in der Dunkelheit, wie sich die Lichter der Straßenlaternen auf der Wasseroberfläche der Kanäle spiegelten; wie die Bäume sich im ersten Herbstwind wiegten; wie Menschen in ihren Wohnungen hin- und hergingen, möglicherweise ein Glas Wein eingossen oder die Heizungen anstellten. Hinter jedem hellen Fenster verbarg sich mindestens eine Lebensgeschichte, dachte Anouk, Glück und Unglück vereint hinter steinernen Fassaden. Manche dieser Häuser waren jahrhundertealt und hätten vermutlich viel zu erzählen. Wenn sie nur reden könnten, ging es Anouk durch den Kopf. Und die Menschen zuhören würden …
»Alles kann man nicht mit Chemie oder Physik erklären«, schloss sie trotzig.
*
An diesem Abend Anfang Oktober hatte sich der Lesesaal des Amsterdamer Reichsmuseums in einen Vortragssaal verwandelt. Die Bibliothek war eine Stunde früher geschlossen worden. Die große Glasvitrine mit Exponaten und die Tische des Lesesaals waren verschwunden. Stattdessen waren Stühle für rund fünfzig geladene Gäste und eine Projektionswand aufgestellt worden.
Hinter den letzten Stuhlreihen standen die Restauratorin Sophie Thijssen und ihre Assistentin Marijke. Sie beobachteten, wie die Vertreter der Stadt, der Universität und der Medien, Freunde und Förderer des Museums sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den Saal strömten und sich bei Häppchen und Champagner unterhielten.
Sophie ließ ihre Blicke schweifen. Das Amsterdamer Reichsmuseum barg die größte kunsthistorische Bibliothek des Landes. Ihr Lesesaal mit einer drei Ebenen hohen Wendeltreppe und umlaufenden Galerien, die meterhohe Buchregale miteinander verbanden, erstreckte sich unter einer gemauerten Gewölbedecke, die dem Mittelschiff einer Kathedrale würdig gewesen wäre. Tag für Tag pilgerten wissbegierige Studenten, Forscher und Kunstinteressierte in diese heiligen Hallen der Kunstgeschichte. Sophie konnte sich noch gut an ihre eigenen Studien in diesem Lesesaal erinnern. Doch an diesem Abend wurde hier die Sonderausstellung über den Barockmaler Pieter Baltens eröffnet. Das Museum hatte zu einem Vortrag mit Professor Nisius und zu einer Begehung der Ausstellung geladen. Gleichzeitig hatte Museumsleiter Jan de Boer eine Sensation angekündigt: die Vorstellung eines neu entdeckten Gemäldes. Selbstverständlich wollten Sophie und Marijke sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen.
Der Vortrag des Professors begann etwa eine Stunde nach Einlass. Die Gäste hatten Platz genommen und verdauten die Häppchen. Nachdem alle Honoratioren durch Direktor de Boer und nachfolgend noch einmal durch Professor Nisius begrüßt worden waren, präsentierte Letzterer in einem Bildvortrag die berühmtesten Werke des Malers und erläuterte ihre Entstehungsgeschichte im Zusammenhang mit der Biografie ihres Schöpfers.
Nisius zeigte auf das Porträt einer jungen Frau. »Leider ist kein einziges Selbstporträt von Pieter Baltens erhalten geblieben«, erklärte er, »wohl aber von Familienmitgliedern. Dies ist Anna Christina Baltens, die einzige Tochter des Meisters. Sie sehen an diesem Beispiel sehr schön, warum Baltens gerne als der ›Maler der Seele‹ bezeichnet wird«, führte der Professor aus. »Die Leichtigkeit im Wesen dieser jungen Frau fängt der greise Künstler genauso anrührend ein wie die Schwermut ihres nahen Todes, der sich im Hintergrund andeutet in dem Licht- und Schattenspiel, wie es so typisch ist für die Malerei im 17. Jahrhundert und für das Vanitas-Motiv des Barocks insgesamt. Der Blick Anna Christinas scheint uns auch heute noch in der gleichen Lebendigkeit zu treffen, wie es die belebten Augen der jungen Frau im Jahre 1634 getan hätten.«
Nisius legte eine Hand geballt zur Faust auf den Rücken und schritt mit gesenktem Blick vor der Projektion auf und ab, während er weitersprach. Sophie kannte Nisius’ mitunter zu Dramatik neigendes Auftreten bereits und musste schmunzeln.
»1634 ist das annus horribilis für Pieter Baltens, ein schreckliches Jahr. Seine Tochter stirbt nach einem Sturz an inneren Blutungen. Er selbst verfällt in schwere Depressionen und nachfolgend auch in Wahnvorstellungen, die auf eine schwere Psychose infolge des unerwarteten Verlustes schließen lassen. Die Schaffenskraft des Sechsundsiebzigjährigen scheint allerdings ungebrochen. Denn er malt plötzlich wie ein Besessener ein Bild nach dem anderen. Von seinen über achtzig Bildern entsteht fast ein Viertel erst in seinem letzten Lebensjahr.«
Im Hintergrund wurde ein Gemälde eingeblendet, das einen Tisch mit alchimistischen Aufbauten in einer düsteren Dachkammer zeigte. An dem Tisch stand der Alchimist, eingehüllt in einen dunklen Mantel, mit einem Glaskolben in den Händen und betrachtete den rötlich leuchtenden Inhalt des Kolbens, dessen Licht das Gesicht des Experimentierenden kaum erhellte.
»›Die Alchimistenstube‹ aus dem Jahr 1633 bildet den Auftakt zu einer Reihe rätselhafter Bilder im letzten Schaffenszyklus Pieter Baltens’. Es ist zwar noch vor dem Tod seiner Tochter entstanden, aber es deutet bereits voraus auf eine Phase der Wirklichkeitsentfremdung. Die Szenerie stellt ein chemisches Experiment dar und unterstreicht die Vielseitigkeit des Malers, der sich an seinem Lebensabend selbst ausgiebig mit der noch jungen Wissenschaft der Alchimie beschäftigte.«
Nisius wandte sich wieder direkt seinem Publikum zu. »Heute würde man sagen: Er erlag einem Trend. Denn im 17. Jahrhundert griff das Experimentieren mit Chemikalien unter den Gelehrten und auch unter manchen Künstlern Europas geradezu um sich, oft verbunden mit grotesken okkulten Zügen oder zumindest unter dem Einfluss einer schwärmerischen Mystik-Verehrung. Kein seltenes Motiv war auch die Gier. So mancher Alchimist strebte schlicht danach, aus allen möglichen Metallen Gold zu machen. Eine Methode, die bis heute unbekannt geblieben ist – sehr zum Leidwesen unseres Finanzministers und des städtischen Beigeordneten für Finanzen, wie ich annehme.«
Gelächter erhob sich im Publikum. Marijke sah Sophie schmunzelnd an.
Wieder wechselte das Bild. Eingeblendet wurde nun ein Gemälde, das eine alte Frau zeigte, die während ihrer Bibel-Lektüre im Bett verstorben war.
»Die ›Alte Frau im Totenbett‹ stammt aus dem Jahr 1634. Es ist das erste Bild, das wir nicht mehr in Bezug zu Baltens’ Leben setzen können. Während sich alle vorherigen Werke mit Interessen, Erlebnissen oder mit realen Personen aus dem Umfeld des alten Meisters in Verbindung bringen lassen, ist uns in diesem Fall gänzlich unbekannt, wer diese alte Frau sein könnte und in welchem Zusammenhang Baltens diese Szene malte. Sie sehen, die arme Frau stirbt mit der Bibel in der Hand. Eine schwach leuchtende Öllampe erhellt die Situation nur unvollständig. An der Wand über dem Bett hängt ein Holzkreuz. Näher kann man seinem Schöpfer im Augenblick des Todes vermutlich nicht sein.«
Das Bild wechselte. Auf der Projektionswand erblickten die Gäste nun einen von Zorn erfüllten Bettler in zerrissener Kutte, die an die Tracht eines mittelalterlichen Mönchs erinnerte.
»Auch dieses Bild gibt uns Rätsel auf«, fuhr Nisius fort, »da wir hier ebenfalls keinerlei Verbindung zu Baltens oder zu seinem Umkreis erkennen können. Wer ist dieser Bettelmann und warum ist er so wütend? Hadert er mit seinem Schicksal? Oder beschimpft er jemanden? Oder ist er schlichtweg verrückt?«
Nisius trat zurück an das Rednerpult, das er zu Beginn seines Vortrags verlassen hatte. »Es gibt noch weitere Gemälde dieser Art, mit denen ich Sie an dieser Stelle allerdings verschonen möchte. All diese Meisterwerke des großen Pieter Baltens können Sie hier im Reichsmuseum bewundern. Und selbstverständlich werden Sie sie gleich in natura auch in unserer Sonderausstellung wiedertreffen.«
In vorderster Reihe erblickte Sophie Museumsdirektor Jan de Boer. Dieser schien besonders aufmerksam zuzuhören und nickte.
»Insgesamt umfasst die Ausstellung über dreißig Werke des Künstlers, darunter auch Bilder aus dem Nachlass, der nach dem Selbstmord Baltens’ 1635 versteigert wurde. Achtzehn Bilder sind uns aus dem überlieferten Auktionskatalog namentlich bekannt. Doch nur siebzehn von ihnen sind in den vergangenen vier Jahrhunderten seit Baltens’ Tod aufgetaucht. Sie sind heute in Museen über den ganzen Erdball verstreut und für diese von langer Hand geplante Sonderausstellung eigens wieder zusammengetragen worden. Alle bis auf eines.«
Nisius machte eine Kunstpause, die ihren dramaturgischen Effekt nicht verfehlte. »Das achtzehnte Bild, das sogenannte ›Bildnis des Jaap Terhoeven‹, blieb bis in unsere Zeit verschollen.«
Ein Raunen erhob sich im Publikum, als sich im Hintergrund eine der Seitentüren auftat und ein paar Wachmänner ein großes Gemälde auf einer Staffelei, verhängt durch ein einfaches weißes Tuch, hereinrollten. Sophie legte gespannt eine Hand an ihr Kinn. Wie würde das Publikum wohl auf die bevorstehende Enthüllung reagieren?
»Vor rund zwei Wochen wurde bei Sanierungsarbeiten in einem Haus in der Keizersgracht ein gerahmtes Gemälde gefunden, das sich offenbar in jüdischem Privatbesitz befunden hatte. Vermutlich war es beim Einmarsch der Deutschen 1940 hinter einer Holzwand versteckt worden.«
Nisius stellte sich unmittelbar neben die Staffelei auf dem Podium und nahm einen Tuchzipfel in die Hand. Fotografen und Kameraleute erhoben sich in Ahnung der baldigen Enthüllung und stauten sich vor einer Kordel unmittelbar zu Füßen des Podiums, auf dem der Professor bereitwillig eine fotogene Pose einnahm.
»Wir haben das Werk eingehend untersucht und mit zeitgenössischen Beschreibungen verglichen. Wir können heute sicher sein: Es ist das verschollene achtzehnte Gemälde des Meisters Pieter Baltens. Es ist das ›Bildnis des Jaap Terhoeven‹.« Mit diesen Worten zog Nisius in einer raschen Handbewegung das Tuch von der Staffelei.
Der verschnörkelte barocke Rahmen erstrahlte golden im Blitzlichtgewitter, das schlagartig losbrach. Stimmengewirr erhob sich unter den Gästen, gefolgt von Applaus. Viele hielt es nicht mehr auf den Stühlen. Alle wollten sie einen Blick auf das Bildnis werfen.
Da viele Gäste aufgestanden waren, ging Sophie an der Seite des Saales weiter nach vorne. Marijke folgte ihr.
Professor Nisius stand neben dem Gemälde und sonnte sich im flimmernden Schein der Blitzlichter. Offenbar mehr als zufrieden mit seinem Auftritt grinste er breit in alle Objektive, die sich ihm entgegenstreckten. Bereitwillig gab er in den nächsten Minuten Fernsehinterviews und bezeichnete das wiederentdeckte Porträt als die wohl spektakulärste Entdeckung der niederländischen, wenn nicht sogar der europäischen Kunstgeschichte, als »männliche Mona Lisa der Niederlande« und als Krönung des Baltens’schen künstlerischen Wirkens.
Museumsdirektor de Boer stand, ob seiner Größe leicht vornübergebeugt, anscheinend sehr zufrieden daneben und ließ sich ebenfalls mit dem Porträt und dem Professor fotografieren. Sein Museum, dachte Sophie, würde von nun an mehr denn je zur Pilgerstätte von Kunstliebhabern und Touristen auf der ganzen Welt werden.
Sophie nickte ernst. »Nun ist es mit der Ruhe vorbei, Jaap Terhoeven.«
*
Das Treffen mit Marcus Veendam war für den 24. Oktober in Willems Kalender eingetragen. Fünf Wochen später sollten die Buchprüfungen im Konzern beendet werden. Willem hatte Veendam nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen, seitdem Tribary Invest sich um die Anteile beworben hatte. Als Willems Assistentin Hermien ihm und Gerard eröffnet hatte, dass der große und mächtige Reeder Willem persönlich und allein zu treffen wünschte, waren bei Gerard zunächst alle Sicherungen durchgebrannt. »Wieso dich? Warum nicht mich? Ich leite das Projekt, ich gehe hin!«, hatte Gerard gezetert.
Doch Willems Assistentin Hermien, eine resolute Mittvierzigerin, hatte langsam und bestimmt wiederholt: »Er hat ausdrücklich darum gebeten, Willem Voss und keinen anderen zu treffen. Allein. Im Reichsmuseum. Um fünfzehn Uhr.«
»Scheinst ja mächtig Eindruck gemacht zu haben. Versau es nicht!«
Willem hatte das puterrote Gesicht seines Chefs mit einer Mischung aus Sorge und Belustigung betrachtet und zur Entschärfung der Lage betont: »Mach dir keine Sorgen. Ich lasse mich auf nichts ein. Er wird mir auch nichts entlocken. Und ich werde dir hinterher ausführlich berichten.«
Warum aber hatte Veendam tatsächlich nach ihm und nicht nach Gerard verlangt, wunderte sich Willem immer noch, als er über den Museumplein lief, vorbei an dem Wasserbassin, dessen Oberfläche sich im Herbstwind kräuselte. Willem zog den Mantel enger und beschleunigte seine Schritte. Er wollte Veendam nicht warten lassen.
Rasch näherte sich Willem dem Backstein-Portal des Museums, über dem ein großes Transparent gespannt war. Es trug die Aufschrift: »Sonderausstellung: Pieter Baltens – der ›Maler der Seele‹«. Willem las den Titel der Ausstellung nur flüchtig im Vorübergehen. Eilig lief er weiter Richtung Eingang.
*
Marcus Veendam stand in der Halle. Er war ein schlanker, hochgewachsener Mann in den Sechzigern mit einem Hang zu etwas altmodischer Kleidung. In seinem Gehrock, der ihm einen schneidigen Ausdruck verlieh, sah er aus wie ein Industrieller des 19. Jahrhunderts, fand Willem. Die dunklen Haare hatte er stramm nach hinten gekämmt, eine markante graue Strähne zog sich vom Haaransatz an der Stirn bis zum hinteren Wirbel. Unter den kräftigen Brauen zeugten zwei tiefbraune Augen, denen nichts zu entgehen schien, von einem messerscharfen Verstand. Lippen und Kinn verrieten Entschlossenheit und die Fähigkeit zur Härte, worüber auch der akkurat gestutzte Kinnbart nicht hinwegtäuschen konnte. Veendams stolze Haltung repräsentierte die fleischgewordene, jahrhundertealte Tradition einer Reeder- und Kaufmannsfamilie, die über viele Generationen hinweg Schiffe gebaut und Handel mit allen Teilen der Erde getrieben hatte, von Curaçao bis Sumatra. Er herrschte über ein Imperium. Er war der Souverän. Und er war pleite.
Veendam lächelte, als Willem näher kam. Sein Lächeln empfand Willem weniger als freundlich denn als Respekt einflößend, fast dämonisch.
»Herr Voss«, hörte er Veendams tiefe Stimme zur Begrüßung. Willem ergriff Veendams ausgestreckte Hand und spürte die Energie dieses Mannes, der mit Sicherheit nicht gewohnt war, auf Hilfe angewiesen zu sein. Es war eine seltsame Aura, die von ihm ausging, eine Art Magnetismus, die in Menschen Begeisterung wie Beklommenheit auslöste, weil man sich dieser Kraft einerseits gerne hingab, andererseits aber das unangenehme Gefühl hatte, sich ihrer gar nicht entziehen zu können.
»Herr Veendam, sehr angenehm!«, erwiderte Willem.
Fast väterlich klopfte Veendam Willem auf die Schulter. »Lügen können Sie nicht sonderlich gut. Den wenigsten ist es angenehm, mich zu treffen. Sie bilden da gewiss keine Ausnahme.« Er führte Willem ins Innere des Reichsmuseums. »Ich danke Ihnen dennoch, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hierherzukommen.«
Willem nickte höflich, während er noch über Veendams jüngste Bemerkung nachdachte. »Ein ungewöhnlicher Ort für eine Besprechung«, entgegnete er.
»Ich bevorzuge eine weniger geschäftliche Atmosphäre«, meinte Veendam und sah Willem von der Seite an: »Kunst und Kultur sind ein viel besserer Rahmen für ein gutes Gespräch. Aber lassen Sie uns hineingehen.«
Veendam zeigte einem Museumsbediensteten am Eingang einen Ausweis und zog Willem in die erste Ausstellungshalle. »Ich habe hier eine Dauereintrittskarte, müssen Sie wissen. Ich spende dem Museum jedes Jahr eine ansehnliche Summe Geldes. Wenn ich die Zeit habe, wandele ich sehr gern durch diese Hallen. Sehen Sie nur diese Fülle an Kunst, die unsere Vorfahren hier zusammengetragen haben.« Veendam breitete die Arme aus und drehte sich im Kreis.
Willem betrachtete einzelne der groß- und kleinformatigen Bilder in ihren barock verzierten Rahmen, wie sie an den farbigen Wänden der Halle im Licht der Glaskuppeln hingen. Doch konnte er für diese Kunst weder Interesse noch Enthusiasmus entwickeln. Er sah lediglich die aus seiner Sicht zu düster geratenen Stillleben, Obst in silbernen Schalen, ein Glas Portwein daneben, ein Bündel Weizenähren davor. Alte Frauen und Männer in holländischer Tracht starrten ihn aus ihrer erhöhten Position mit teilnahmslosen Augen an, längst verstorbene und in ihren Gräbern verfaulte Menschen, deren Lebensgeschichte oder gesellschaftliche Bedeutung Willem egal waren, gemalt von Künstlern, die ihn noch weniger interessierten.
Das größte Gemälde der Halle stellte einen holländischen Dreimaster an der ostindischen Küste dar. Veendam blieb andächtig davor stehen. »Diese alten Meister stammen aus dem ›Goldenen Zeitalter‹. Die Niederländer waren auf allen Weltmeeren zu Hause. Gewürz- und Tuchhandel haben das Land reich gemacht. Denken Sie nur an die Oostindische Compagnie! Die Kolonien! Holland als Handelsgroßmacht! Und die Kaufleute waren Kunstmäzene.«
»Ich habe es nicht so mit der Kunst«, gestand Willem.
Veendam drehte sich zu ihm um. »Sehen Sie, ich liebe die Kunst! Sie ist unvergänglich. Im Gegensatz zum Menschen.« Veendam beugte sich zu Willem und hob eine Augenbraue. »Sie sind nicht sonderlich interessiert an der Vergangenheit, nicht wahr?«
»Ich bin eher ein Mann der Gegenwart«, erwiderte Willem. »Ich war schon in der Schule schlecht in Geschichte. Das Abfragen von Jahreszahlen, wer mit wem welche Kriege geführt hat … wozu soll dieses Wissen heute schon gut sein?«
Veendam nickte. »So schätze ich Sie ein, mein lieber Herr Voss. Sie gehen von der Selbstverständlichkeit der Gegenwart aus.«
Diese eher didaktische Bemerkung Veendams ging Willem nun doch zu weit. Wozu dieser Schulausflug? Was führte Veendam im Schilde? Dass er etwas im Schilde führte, schien Willem außer Frage. »Warum haben Sie mich eigentlich hierherbestellt?«, wollte er wissen. »Warum nicht Gerard Bols? Glauben Sie, Sie könnten mir leichter Informationen entlocken? Erst einmal müssen die Wirtschaftsprüfer urteilen.«
Veendam betrachtete weiter den Dreimaster. »Dreißig Prozent. Sie erwerben damit eine Sperrminorität. Zusammen mit den Aktien in Streubesitz könnten Sie sogar die Mehrheit übernehmen. Künftig würde bei Veendam jedenfalls nichts mehr entschieden ohne Tribary Invest. Nicht dass ich gegen die Beteiligung wäre. Ich brauche das Geld. Aber wem vertraue ich mich an?« Veendam deutete auf den Dreimaster. »Sehen Sie, solche Schiffe haben meine Vorfahren auch gebaut. Sie sind damit bis ans Kap der Guten Hoffnung und weiter nach Indonesien gesegelt. Ohne Dreimaster wie diesen würden wir heute auch keine Kreuzfahrtschiffe bauen.«
Sie durchschritten die restliche Halle und betraten den nächsten Raum. »Das Reichsmuseum beherbergt eine ganze Menge von Meisterwerken: Hals, Vermeer, Baltens, Rubens und natürlich Rembrandt«, klärte Veendam Willem weiter ungefragt auf. »Kulturerbe der ganzen Menschheit.«
»Das ist alles sehr hübsch«, versuchte sich Willem zu beherrschen, »und ich bewundere Ihr Zeitmanagement. Sie können nach Belieben Museen besuchen. Ich kann das nicht. Daher sagen Sie mir doch, warum Sie mich so kurz vor Ende …«
»Sie sind ein Mann von Verstand, lieber Herr Voss«, unterbrach ihn Veendam, »aber was ist mit Ihrem Herzen? Ich möchte sicherstellen, dass Tribary Invest nicht heimlich die Zerschlagung der Veendam-Gruppe betreibt. Ich weiß, dass Ihre Berater Ihnen nahegelegt haben, die lukrativen Werften eines Tages einzeln zu verkaufen und die übrigen Geschäftsbereiche abzuwickeln. So macht man schnelles Geld, und nur daran sind Sie doch interessiert. Das hieße, mein Lebenswerk zu zerstören.« Veendam stoppte abrupt. »Das wäre überaus unklug!«
Willem war erstaunt über Veendams plötzlich wechselnden Ton. Nach einer kurzen Pause antwortete er beschwichtigend: »Glauben Sie mir, Tribary agiert lieber im Hintergrund. Wir mischen uns nicht ein ins Tagesgeschäft. Wir haben schon zahlreiche Akquisitionen vorgenommen, die sich alle prächtig entwickeln. Die Reederei hat großes Potenzial.«
Veendam musterte Willem einen Augenblick. In seinem mitleidigen Lächeln glaubte Willem einen Anflug von Ironie auszumachen. »Wussten Sie, dass das griechische Wort ›oikonomia‹ im kirchlich-orthodoxen Sinne einmal für den göttlichen Heilsplan zur Rettung der Menschen stand? Ich kann nicht erkennen, dass Ökonomie heute noch das gleiche Ziel verfolgt. Profit im biblischen Sinne war gemeint als der Vorteil für die Seele. Heute ist Profit eher seelenlos, nicht wahr?« Veendam nickte Willem zu, als ob er Zustimmung erwartete. »Sind Sie bibelfest? Sie sind Atheist, nehme ich an.«
»Meine Bibel stammt von Adam Smith: ›Der Wohlstand der Nationen‹«.
Veendam schmunzelte. »Es kann nicht schaden, sich ab und an mit der Heiligen Schrift zu befassen. Sie enthält viele Beispiele menschlicher Irrungen und Ängste – und ist gleichzeitig ein guter Wegweiser.« Veendam deutete in Richtung des nächsten Saals. »Kommen Sie, ich zeige Ihnen etwas.«
Willem schüttelte innerlich den Kopf. Was für ein kauziger Typ!
Die beiden schlenderten in den nächsten Ausstellungsraum. Dieser war überfüllt von Menschen, sodass die beiden sich ihren Weg bahnen mussten.
»Das ist die Baltens-Sonderausstellung. Kennen Sie Pieter Baltens?«
»Nicht persönlich.«
Veendam lachte. »Ach ja, Kunst ist ja Zeitverschwendung für Sie.«
Am Ende des Raumes hatte sich eine Menschentraube rund um eine hohe Stele gebildet. Museumswärter mussten ständig Touristen ermahnen, keine Fotos, erst recht keine mit Blitzlicht, zu schießen. Dumpfes Gemurmel herrschte im Saal. Die Besucher versuchten einen Blick auf das Gemälde zu werfen, das erhöht auf der Stele an der Wand unter einem schützenden Glaskubus ausgestellt war. Was auch immer auf der Stele ausgestellt wurde, Willem war nicht erpicht darauf, deswegen seinen Hals zu recken.
»Dabei sehen Sie hier eine Sensation«, fuhr Veendam weiter fort, »ein verschollenes Gemälde von Baltens, das erst kürzlich wiederentdeckt wurde.«
Willem, dem der ganze Menschenauflauf zu viel wurde, stand desinteressiert abseits und besah sich seine Schuhspitzen, während er mit den Sohlen über das Parkett streifte. Veendam hingegen sah ehrfurchtsvoll hinüber zu dem Gemälde. »Das Bildnis des Jaap Terhoeven!«
»Veendam, hören Sie …«
»Die ganze Schönheit dieses jungen Mannes in vollkommener Kunst verewigt und der Vergänglichkeit entrückt.« Veendam wandte sich mit prüfendem Blick zunächst Willem, dann wieder dem Porträt zu. »Er sieht Ihnen sogar ähnlich.«
Willem ließ sich auf das Ablenkungsmanöver Veendams nicht ein. »Was Ihre Reederei betrifft …«
Aber Veendam ließ nicht locker. »So sehen Sie nur!«
Willem drehte beiläufig den Kopf. Mit einem absichtlichen Ausdruck der Langeweile warf er einen Blick auf das Bildnis. Doch seine skeptisch in Falten gelegte Stirn glättete sich. Er öffnete unwillkürlich den Mund.
Willem blickte mit seinen wasserklaren, blauen Augen in ein ebensolches Augenpaar: wasserklar und blau. Darüber erhoben sich Augenbrauen, die ihm wie aus dem Gesicht geschnitten schienen. Willem blickte auf eine Nase, die der seinen vollkommen glich, und auf einen Mund, der sich von dem seinen nicht im Geringsten unterschied, auf ein Kinn, das aussah, als ob es sein Kinn wäre, ja sogar auf einen Leberfleck an der Wange, wie er exakt an gleicher Stelle einen besaß.
Er erblickte das Gesicht eines jungen, hübschen Mannes in seinem Alter, gekleidet in holländische Tracht des 17. Jahrhunderts, äußerst lebendig und detailreich gebannt in Öl auf Leinwand, in einem goldenen barocken Rahmen unter einer gläsernen Haube. Er sah sein Gesicht wie in einem Spiegel. Es war ihm, als sähe er sich selbst.
»Wirklich erstaunlich!«, entfuhr es Veendam. Der Reeder wandte sich belustigt Willem zu, der weiter starr das Porträt betrachtete. »Ist das ein Vorfahr von Ihnen?«
Willem hörte sich selbst wie aus weiter Ferne antworten: »Ich … ich weiß es nicht.«
»Nun, ich muss gestehen, diese Ähnlichkeit ist fast schon unheimlich. Sind Sie die Kopie oder ist er es?«
Willem sah sich um. Die Menschen blickten gebannt in Richtung des Porträts. Nur eine junge Frau mit hellen, blonden Haaren hatte Willem unweit von sich entdeckt. Sie beäugte ihn unumwunden. Hatte sie Willems Ähnlichkeit mit dem Porträt etwa auch erkannt? Willem drehte sich sofort zur Seite und senkte den Kopf. Er wollte den Saal verlassen, doch Veendam fasste ihn an der Schulter und hielt ihn auf.
»Wie Sie sehen, ist die Vergangenheit sehr lebendig, mein lieber Voss! Es lohnt sich zurückzublicken, um die Gegenwart zu verstehen. Begreifen Sie, was ich Ihnen sagen will? Mein Unternehmen ist das Produkt von Generationen, die jahrhundertelang ihren Fleiß, ihre Lebenskraft, ihre ganze Existenz in dieses Werk eingebracht haben. Ich werde nicht dulden, dass irgendwelche Heuschrecken dieses Erbe zerschlagen.«
Willem fasste sich langsam. Ihm schien, als ob Veendam die Begegnung mit dem Porträt absichtlich herbeigeführt hätte. »Dann hätten Sie sich besser nicht verspekuliert, mein Herr.« Irritiert sah er sich im Saal um, immer noch in Sorge, jemand könnte außer ihm und Veendam die Ähnlichkeit mit dem Porträt bemerkt haben. Die blonde Frau schien verschwunden zu sein. Er konnte sie nirgends im Saal mehr ausmachen. Oder hatte sich Willem die hübsche Erscheinung nur eingebildet?
Veendam betrachtete Willem einen Augenblick lang ernst. »Sie haben mich verstanden!«, erwiderte er.
»Wollen Sie mir etwa drohen?«, fragte Willem.
Veendam lächelte, lockerte seinen Griff um Willems Schulter und klopfte sie erneut gönnerhaft. »Das habe ich nicht nötig. Ich prüfe die Menschen. Aber unterschätzen Sie mich nicht. Am Ende bekomme ich, was ich will.« Mit einem Seitenblick auf das Porträt fügte er hinzu: »Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, wen Sie vor sich haben.« Mit diesen Worten nickte Veendam zum Abschied, wandte sich ab und verließ zügigen Schrittes den Saal.
Willem blieb zurück, zu keinem klaren Gedanken fähig, und sah ein weiteres Mal auf das Bildnis inmitten der Menschenmenge. Es schien ihn ebenfalls fest im Blick zu haben. War es ein Doppelgänger? Eine Laune der Natur? Nicht der Hauch eines Unterschieds – wie war das möglich? Der Erschütterung dieser Begegnung hielt Willem nicht länger stand. Benommen wie nach dem Erwachen aus einem skurrilen Traum schlich er aus der Halle. War das noch die Wirklichkeit? Sie fühlte sich so unwirklich an.
II
Summend lief Anouk durch ihre kleine Wohnung im Amsterdamer Westen, suchte sich ein paar Kleidungsstücke für den Abend zusammen, verwarf die biedere Bluse und entschied sich für eine etwas tiefer ausgeschnittene, besah sich prüfend im Spiegel, setzte ihre Kontaktlinsen ein, schminkte sich dezent, steckte ihre Haare hoch, legte etwas Schmuck an und suchte verzweifelt nach passenden Schuhen. Das Telefon klingelte zur Unzeit. In fünf Minuten wurde sie abgeholt. Sie konnte schlecht ohne Schuhe aus dem Haus.
Es war Willem. »Kein Theater heute?«
»Der Montag ist aufführungsfrei. Montag ist mein Sonntag, wie du weißt.«
»Ich dachte, wir könnten etwas essen gehen.«
Anouk sah auf die Uhr. Gleich war es acht. »Um die Uhrzeit bist du schon zu Hause? Bist du krank?«
»Ich hatte nachmittags einen Termin. Ich bin danach direkt zur Wohnung. Mir geht’s nicht gut.«
Anouk probierte verschiedene Schuhpaare aus. »Was hast du?«
»Ach nichts, es war ein verrückter Tag. Ich bin irgendwie nicht fit. Was ist jetzt mit dem Essen?«
»Ich kann nicht«, antwortete Anouk. »Maud holt mich gleich ab. Sie wollte um acht hier sein. Deswegen bin ich etwas in Eile.«
»Wann sehen wir uns?«, hörte sie ihn fragen.
Gedanklich immer noch mit der Auswahl von Schuhen beschäftigt, entgegnete Anouk ohne große Überzeugung: »Wir sehen uns schon. Ist gerade viel los. Ich melde mich.«
An der Tür klingelte es.
»Ich muss Schluss machen. Maud ist da. Mach’s gut!«
Anouk legte auf. Willem hatte noch etwas sagen wollen, aber es war schon zu spät gewesen. Rasch entschied Anouk sich für ein Paar Stiefeletten und zog sie über. Sie hastete zur Tür und öffnete.
Im Türstock stand Hamlet, der Prinz von Dänemark, in Jeans und Lederjacke, und schenkte Anouk sein strahlend weißes Lächeln. »Bereit zum ersten Vorhang?«
*
Willem lag in der Abenddämmerung auf seinem Bett und spielte mit dem Autoschlüssel, während er seine andere Hand mit dem Smartphone langsam auf das Laken sinken ließ. Am Telefon hatte er sich zwar enttäuscht gezeigt, innerlich jedoch war er erleichtert. Er hatte sich verpflichtet gefühlt, Anouk anzurufen und ein Angebot für den Abend zu machen. Doch wenn er ganz genau in sich hineinhörte, wurde ihm klar, dass er an diesem Abend nicht mehr brauchte als seine Wohnung in der Dämmerung, das Bett, auf dem er lag, und vielleicht noch den Autoschlüssel, mit dem er spielte. So einen Augenblick des Nichtstuns hatte er seit Langem nicht mehr gehabt. Und heute schien er ihm besonders nötig. Seine Gedanken kreisten ständig um die unheimliche Begegnung mit dem Porträt vom gleichen Nachmittag.
Willem sah aus dem Fenster auf die im Dunkeln liegende Straße. Gerard hatte ihn am frühen Abend zweimal angerufen. Willem hatte weder abgehoben noch zurückgerufen. Nach der Begegnung mit Veendam fühlte er sich kraftlos und nicht in der Lage, Gerards nervige Nachfragen, wie es denn gelaufen sei, zu ertragen. Das konnte bis zum nächsten Tag warten. Was nicht warten konnte, war die Beantwortung der Frage, warum der Typ auf diesem Baltens-Gemälde im Reichsmuseum so ausgesehen hatte wie Willem selbst. Das konnte ja nur ein Zufall sein. Oder eine optische Täuschung. Ja, das war es vermutlich. Das Gemälde hatte weit entfernt auf dieser Säule an der Wand gestanden. Auf die Entfernung konnte jeder blonde Mann seines Alters ihm ähneln, zumal klare blaue Augen nun auch nicht gerade eine Seltenheit unter Niederländern waren.
Wie oft hatte Willem schon gehört von Freunden, sie hätten einen Doppelgänger von ihm gesehen. Sie wären fest davon überzeugt gewesen, dass es Willem gewesen wäre, bis sie sich demjenigen bis auf ein zwei Meter genähert hätten. Erst dann hätten sie die kleinen Unterschiede erkannt und wären gerade noch um eine peinliche Begrüßung eines völlig Fremden herumgekommen. Und nun war es Willem eben selbst so ergangen, nur nicht mit einer lebendigen Person, sondern mit einem leblosen zweidimensionalen Porträt.
Willem schob sich eine Tiefkühlpizza in den Ofen. Eine ganze Weile starrte er durch das Glas, wie der Käse langsam auftaute und zu schmelzen begann. Es war ein Zufall, wenn auch ein ziemlich verrückter, dachte er. Wie leicht sich ein Mensch doch kurzfristig aus der Bahn werfen ließ, sagte er zu sich selbst und schüttelte den Kopf. Doch nach ein paar Stunden stellte sich das Gefühl für die Realität normalerweise wieder ein. Es war wie die Rückkehr ins Leben nach einem Kinofilm, der einen völlig vereinnahmt hatte. Nichts liebte Willem mehr als die Realität. Die Normalität des Alltags, wenn alles seinen geregelten Gang ging, war für ihn kein Schrecknis, sondern der erstrebenswerte Zustand. Surreales und Unbewusstes, die innere, abgründige Welt der Psyche – das alles mied er, hielt es für ungesund und schadhaft. Und er misstraute Spiel und Träumereien, die er für substanzlos und ineffektiv hielt. Davon konnte man sich nichts kaufen. Darauf ließ sich kein Leben aufbauen.
Es ließ sich ja ganz leicht überprüfen, schoss es Willem durch den Kopf. Er setzte sich an seinen Rechner am Schreibtisch und öffnete den Browser. Ein so berühmtes Gemälde dürfte ja wohl auch im Internet zu sehen sein. Willem tippte »Terhoeven Baltens« bei Google ein. Unzählige Suchergebnisse wurden aufgelistet. Zahlreiche Zeitungsberichte über das Fundstück waren darunter. Willem tippte wahllos auf eines der ersten Ergebnisse. Die Schlagzeile lautete »Sensationsfund in Amsterdam«. Rasch überflog Willem den Artikel: Experten seien sich sicher, ein lange Zeit verschollenes Bild des Barockmalers Pieter Baltens wiederentdeckt zu haben. Das Gemälde sei bei Sanierungsarbeiten in der Keizersgracht aufgetaucht. Es zeige einen jungen Mann in niederländischer Kaufmannstracht des 17. Jahrhunderts, offenbar ein Freund des Malers. Laut Auktionskatalog aus Baltens’ Todesjahr 1635 hieß der Porträtierte Jaap Terhoeven.
Mit einem gewissen Unbehagen betrachtete Willem eine Abbildung des Porträts inmitten des Artikels. Die Bildunterschrift lautete: »Vergessen hinter einer Holzwand: das Bildnis des Jaap Terhoeven«. Willem steuerte den Mauszeiger über das Bild. Der Zeiger verwandelte sich in eine Lupe. Willem zögerte. Dann klickte er das Bild größer. Er zoomte es noch weiter heran und besah sich die Einzelheiten: Augen, Nase, Mund, Kinn, Ohren. Ein eiskalter Schauder ergriff ihn. Das war keine Ähnlichkeit. Das war vollkommene Identität! Und um die ging es: um seine Identität. Wer war Willem, wenn nicht Willem? Wer war dieser Mann? Was hatte er mit Willem zu tun? Zwischen Terhoeven und ihm lagen knapp vier Jahrhunderte.
Willem schloss mit einem Mausklick den Browser. Der schwarze Bildschirmhintergrund wurde sichtbar. Willem sah sein sich spiegelndes Gesicht im Monitor. Eine ganze Weile lang betrachtete er nachdenklich sein Spiegelbild. Erst der Geruch einer verbrennenden Pizza holte ihn in die Wirklichkeit zurück.
*
Nicht nur Willem Voss lag noch lange grübelnd wach in jener Nacht. Auch die Restauratorin Sophie Thijssen in ihrer kleinen Wohnung in der Amsterdamer Bloemgracht tat es. Sophie hatte das Fenster weit aufgemacht und die Vorhänge beiseitegezogen. Sie wollte die frische Herbstluft hineinlassen und von ihrem Bett aus auf die andere Seite der Gracht mit ihren schmalen, hohen und teils schief stehenden alten Häusern schauen. Sie lag in ihrem Bett und hatte ihre Decke bis ans Kinn gezogen. Wie sie es gerne mochte, hatte sie die Decke an beiden Seiten unter ihren Körper gesteckt, sodass sie ganz eingerollt war und das Gewicht des Stoffes rundherum spüren konnte. Das verschaffte ihr das Gefühl von Geborgenheit.
Denn danach sehnte sich Sophie in diesem Augenblick. So gerne sie sich auch einredete, dass es ein durchaus erstrebenswerter Zustand sei, allein zu leben, weil man auf niemanden Rücksicht nehmen und auch keine weiteren Enttäuschungen erleben musste, so fehlte ihr doch mitunter genau jene Wärme, die ihr die Bettdecke nun ersatzweise spendete, jene umgebende Nähe, die nicht nur ein anderer Körper, sondern auch die simple Anwesenheit eines liebenden Menschen in einer Wohnung auszustrahlen vermochte. Mimte Sophie nach außen hin auch oft die toughe Frau, in ihrem Innern hatte sie es manchmal satt, die Alleskönnerin zu sein.





























