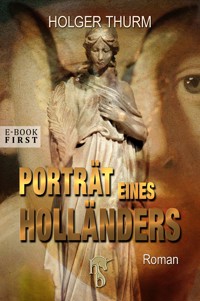6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks: e-book first
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was hat die Wehrmacht 1942 in gotischen Gräbern auf der Krim entdeckt? Weshalb schleppt sie den Fund quer durch Europa? Und warum verschwinden Ladung und Geleittrupp bei Kriegsende spurlos? Jahrzehnte später soll Beutekunstexperte Sebastian Varland diese Fragen klären. Doch ein mysteriöser Harlekin verfolgt ihn und tötet letzte Zeitzeugen. Zur gleichen Zeit bemüht sich die Journalistin Marie Gold, illegale Experimente eines Schweizer Pharmakonzerns aufzudecken. Die Wege der beiden kreuzen sich in einer Villa am Brienzersee. Der Bewohner der Villa scheint alle Antworten zu kennen. Doch auch er fürchtet den Harlekin. Als Marie und Varland das dunkle Geheimnis lüften wollen, wecken sie auf, was schon die Wehrmacht besser hätte ruhen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Holger Thurm
Wolf und Harlekin
Roman
»Den Teufel spürt das Völkchen nie,Und wenn er sie beym Kragen hätte.«Johann Wolfgang von GoetheFaust. Der Tragödie erster Teil, Vers 2181 f. / Mephistopheles
Prolog: Das neunte Grab
Mangup Kale, Halbinsel Krim (Juli 1942).
Die Skelette strahlten, als ob sie der Regen der Jahrhunderte reingewaschen oder die Julisonne ausgebleicht hätte. Sie lagen gekrümmt im Boden, vollständig freigelegt, nur noch umgeben von zerfallenen Kleidungsresten und allerlei bunt glänzenden Grabbeigaben. Auf Anhieb konnte Otto Körber goldene Gürtelschnallen, Edelsteinketten und Amulette in Vogelform erkennen. Manche Schädel trugen auch Stirnreife aus Gold oder Bronze. Die Gräber selbst waren mit Schnüren abgesteckt. Ins Erdreich hatte man neben Knochen und Schmuck Schildchen mit Nummern gesteckt.
Otto Körber, ein neunzehnjähriger Wehrmachtssoldat, legte ein Messer und einen Ast beiseite, aus dem er gerade eine kleine Figur schnitzte. Er nahm den Stahlhelm ab und wischte sich über den verschwitzten, kahlgeschorenen Kopf. Er hatte die Aufgabe erhalten, bei glühender Mittagshitze auf dem Hügel an den Gräbern Wache zu halten, bis die Gäste aus Deutschland auf der Krim eingetroffen waren. Die Abordnung einer SS-Forschungsgruppe war über Krakau nach Sevastopol geflogen und wurde für den Nachmittag erwartet, angeblich Historiker und Anthropologen, die die Gräber begutachten wollten.
»Allet Arier, wat hier so liegt, wa?«, fragte ein stark berlinernder junger Soldat, den Otto nicht weiter kannte. Er kam auf ihn zu und bot ihm eine Zigarette an.
Otto nahm sie dankend und ließ sich Feuer geben.
»Weeßte, die kommen da extra aus Berlin, um sich so olle Knochen anzusehen. Nur um zu beweisen, dett wir Germanen eijentlich schon immer hier war’n.«
Otto nahm einen kräftigen Zug und spürte, wie er sich entspannte, als sich der Rauch in seiner Lunge ausbreitete. »Das sollen Germanen sein?«
»Na klar! Nur weil se keenen Hitler-Jruß machen, heeßt det noch lange nich’, dett die vom Iwan sind, verstehste?« Er tippte sich auf seine uniformierte Brust. »Wir war’n zuerst hier!«, fügte er hinzu und zog sich mit dem Zeigefinger ein Augenlid nach unten. »Wer et globt, wird selig!«
Am Horizont kündigten Staubwolken auf der Sandpiste den Konvoi aus Kübelwagen an. Und wenig später ließen sich auch die Motorgeräusche der sich nähernden Kolonne vernehmen. Befehle hallten über den Platz.
Ein Oberleutnant, sein Name war Schröter, trat aus einem Zelt und lief strammen Schrittes auf den jungen Soldaten und auf Otto zu. Er blickte in Richtung der Fahrzeuge. »Da sind sie ja, die Herren Reichsleichenfledderer. Dann mal antreten lassen!«
Eine halbe Stunde später hatte sich rund um die Gräber, acht an der Zahl, eine Gruppe von Forschern der Schutzstaffel in ihren schwarzen Uniformen versammelt. Unter sie mischten sich einzelne Wehrmachtsoffiziere und Soldaten. Die Gäste aus dem Reich betrachteten Skelette und Fundstücke, deuteten mit dem Finger auf einzelne Grabbeigaben und unterhielten sich kopfnickend. Einige Wortfetzen konnte Otto Körber, der abseits stand und die Szenerie beobachtete, auffangen.
»Zweifelsohne gotischer Herkunft. Sehen Sie die Adlerfibeln?« Ein SS-Hauptsturmführer mit kleinen Knopfaugen schob sich die Schirmmütze mit dem Totenkopf-Zeichen der SS in den Nacken. »Gotische Fürstengräber. Vermutlich viertes oder fünftes Jahrhundert.«
»Jedenfalls sehr gut erhalten. Wer hat sie entdeckt?«, fragte ein weiterer, hochgewachsener Offizier. Schulterklappen und Kragenspiegel nach zu urteilen, war er ein höheres Tier im Rang eines SS-Sturmbannführers. Am Kragen prangte ein Eisernes Kreuz erster Klasse. Um seinen Hals hatte er einen Fotoapparat hängen.
Oberleutnant Schröter schaltete sich ein. »Das waren Einheimische, schon vor einem Jahr. Aber die halten den ganzen Hügel für einen verfluchten Ort und haben das alles so gelassen, wie es war. Ausgegraben hat das die Wehrmacht.«
»Und alles zertrampelt mit ihren Stiefeln, was?«, brummte der Sturmbannführer mit der Kamera. Er hatte offensichtlich innerhalb der anwesenden SS-Offiziersriege das Sagen. Er löste sich aus der Gruppe, begab sich in die Hocke und machte Fotos von Gräbern und Beigaben.
»Ich will, dass alles sauber dokumentiert wird. Bevor das Wetter dreht, verpacken wir Skelette und Schmuck und transportieren alles nach Krakau. Ich möchte die Schädel und Beckenknochen zunächst vermessen. Außerdem sollten die Grabbeigaben gesäubert und untersucht werden. Ein vorläufiger Bericht muss morgen nach Berlin. Brandstätter?«
Der SS-Offizier mit den Knopfäuglein schien auf den Namen zu hören. Er nickte.
»Und wer übernimmt den Transport?«, fragte Oberleutnant Schröter und sah entgeistert von Gesicht zu Gesicht.
Der hochgewachsene SS-Forscher erhob sich, lief auf den Offizier zu und klopfte ihm auf die Schulter. »Na, die Wehrmacht, Herr Oberleutnant!« Er wollte sich schon wieder abwenden, da fiel sein Blick auf ein neuntes Grab, das etwas abseits der anderen an der Hügelkuppe lag. Es war nur unvollständig freigelegt.
»Was ist damit?«
Oberleutnant Schröter zuckte mit den Schultern. »Da waren einheimische Hilfsarbeiter dran und haben dann abgebrochen. Wohl aus Angst. Wir haben noch nicht weitergemacht. Wir wollten erst Ihre Ankunft abwarten.«
Der Sturmbannführer stand auf und ging ein paar Schritte die Anhöhe in Richtung des Erdlochs hinauf. Grillen zirpten ringsherum in der Nachmittagssonne. Vor dem Loch blieb der Mann stehen. Nach einer Weile drehte er sich zur Gruppe hinter sich um. »Einen Spaten!«
Einer der Wehrmachtsoffiziere bedeutete Otto mit einer Kopfbewegung, er solle den verlangten Spaten holen. Otto nickte, hastete den Hügel hinab und rannte zu einem Laster, auf dessen Ladefläche eine Reihe von Spaten lag. Rasch ergriff er einen davon und eilte den Hang wieder hinauf.
Der Sturmbannführer nahm Otto zu seiner Überraschung den Spaten aus der Hand und trug selbst vorsichtig dünne Erdschichten ab. Mit dem Metallblatt fuhr er schließlich die freigelegten Knochen entlang. Dann begab er sich hinab, stützte sich auf ein Knie und beugte sich vor. Mit der Hand im Lederhandschuh wischte er Erde und Reste einer Fellmütze vom Schädel des Toten. Otto konnte erkennen, dass einzelne Holzpflöcke mitten unter den Knochen aus dem Erdreich ragten. Der Mann war mit dem Gesicht nach unten begraben und zusätzlich mit den Pflöcken festgesteckt worden. Otto erschauderte und fragte sich, warum.
»Sehen Sie das?«, fragte der Sturmbannführer und deutete auf einen Gegenstand, der neben dem Toten lag.
SS-Offizier Brandstätter trat näher. »Was ist das?«, fragte er verblüfft.
Sein Vorgesetzter hob den Fotoapparat und blickte durch den Messsucher. Es klickte satt und vernehmlich, als er den Auslöser drückte. »Das«, erwiderte er, »ist der Grund, warum dieses Grab so abseits der anderen Gräber liegt.«
Otto Körber lockerte den Helmriemen, kaum dass die SS-Forscher den Hügel wieder hinabgelaufen waren, und griff nach Schnitzmesser und Ast. Ihm waren die Skelette in den Gräbern nicht geheuer. Wer auch immer die Toten gewesen sein mochten, Otto Körber hoffte nur eines: dass er nicht so bald in einem Grab enden möge. Er wollte zurück in die Heimat und dort alt werden. Er war fest entschlossen, den Krieg zu überleben. Dennoch spürte er, dass sein Schicksal von nun an mit diesen Skeletten verbunden sein würde. Insbesondere mit jenem aus dem neunten Grab. Otto beschlich die seltsame Ahnung, dass sein Todestag noch in weiter Ferne lag, aber dennoch bereits feststand.
I
Sankt Petersburg (Gegenwart).
Unablässig prasselte der Regen gegen die Fensterscheiben der Intensivstation des Mariinskij Hospitals. Anatol Ivancyk sah zu, wie die Tropfen immer wieder aufs Neue Wasserfäden bildeten. Wie Adern erstreckten sie sich über die Glasfläche und schienen im Sturmwind zu pulsieren. Es war Nacht. Im Hintergrund hörte Ivancyk das unregelmäßige Piepsen eines Geräts, das den Herzschlag seines Vaters überwachte. Anatol sah hinüber zum Monitor, der neben dem Bett Vladimir Ivancyks stand und die Herzfrequenz mit spitzen Ausschlägen anzeigte. Allerlei Messwerte flimmerten auf dem Bildschirm, die wohl Blutdruck, Sauerstoffsättigung des Blutes oder Atemfrequenz anzeigten. Anatol hatte aufgehört, die Werte zu betrachten, da er doch nicht verstand, was sie über den Zustand seines Vaters aussagten.
Vladimir atmete in seinem Bett flach und röchelnd. Sein Oberkörper hob und senkte sich kaum noch sichtbar. Sein Gesicht, übersät von Altersflecken, verriet die Anstrengung, die ihm jeder Atemzug abverlangte. Die wenigen grauen Haare lagen wirr über das Kissen verstreut. Angetrockneter Speichel verklebte seine von der jüngsten Beatmungsaktion aufgerissenen Mundwinkel. Zwei Schläuche mündeten in seine Nasenlöcher, ein weiterer Schlauch verband einen Tropf mit seinem Unterarm. Die Augen hatte Vladimir geschlossen, so als ob er schlafen würde.
Doch Anatol wusste, dass sein Vater nur in einer Art Dämmerzustand lag und dem Tod entgegensah. Die Ärzte, die noch vor zwanzig Minuten an dem Bett gestanden hatten, waren wenig zuversichtlich gewesen, dass der Patient die Nacht überstehen würde. Sie hatten Anatol angerufen und kurz darüber aufgeklärt, dass sie lebensrettende Maßnahmen nun unterlassen würden, da immer mehr Organe ihren Dienst versagten und keine Aussicht mehr auf Besserung bestünde.
»Ihr Vater bekommt Morphium und kreislaufstabilisierende Mittel«, hatte ein junger Arzt ausgeführt. »Er atmet schwer, aber er hat sonst keine Schmerzen.«
Anatol hatte noch gefragt, ob sein Vater bei Bewusstsein sei.
»Die meiste Zeit über nicht«, hatte er zur Antwort erhalten.
So saß Anatol nun schon seit vier Stunden am Bett seines sterbenden Vaters im grellen Licht der Intensivstation. Draußen fegte ein Herbststurm. Eine zur Dramatik des Augenblicks passendere Wetterlage hätte sich sein Papka nicht aussuchen können, dachte Anatol. Er trat an das Bett heran und sah mit Tränen in den Augen auf den Todkranken hinab, der nun einundvierzig Jahre lang sein Vater gewesen war, der ihn trotz seiner beschränkten Möglichkeiten liebevoll großgezogen und bis ins hohe Alter unterstützt hatte.
Anatol spürte das Verlangen, seinen Vater anzufassen, ihn wissen zu lassen, dass er in diesen schweren Stunden an seiner Seite stand. Er griff vorsichtig nach dem Arm des Sterbenden und fuhr ihm über die faltige Haut, immer darauf bedacht, dem dort befestigten Schlauch nicht zu nahe zu kommen. Als er den Unterarm behutsam drehte, fiel ihm zum wiederholten Mal in seinem Leben die dünne, blaue Tätowierung einer sechsstelligen Ziffernfolge am Handgelenk auf. Es war die Nummer, die Vladimir als Häftling im Konzentrationslager Auschwitz gestochen bekommen hatte. Über die Zeit im KZ hatte sein Vater stets geschwiegen. Geschrieben hatte er wohl darüber, so hatte das Anatols Mutter berichtet, auf seiner alten Schreibmaschine. Aber er hatte alles streng unter Verschluss gehalten.
So viel aber wusste Anatol, dass sein Vater als Siebzehnjähriger Anfang 1945 von der Roten Armee befreit, doch dann, denunziert als Kollaborateur, für weitere zwei Jahre in einem Arbeitslager der Sowjets eingesperrt worden war. Unter den Mitgefangenen befanden sich angeblich auch einige seiner ehemaligen Peiniger, die ihn in den letzten Kriegsjahren zur Zwangsarbeit eingesetzt hatten. Nach seiner Entlassung aus der sowjetischen Gefangenschaft ohne jede Erklärung oder Entschädigung wollte Vladimir zurück auf die Krim. Von dort stammte er. Doch die Krimtataren waren aus Rache für die ihnen unterstellte Zusammenarbeit mit den Deutschen unter Stalin nach Zentralasien zwangsumgesiedelt worden. Erst nach dem Tod des Diktators war Vladimir nach Moskau, später dann nach Leningrad gekommen. Hier war Anatol zur Welt gekommen.
Nun schien nach siebenundachtzig langen Jahren das Ende dieses bewegten Lebens gekommen zu sein. Liebevoll tätschelte Anatol die Wange seines Vaters. Sollte die ganze Geschichte seines Leidens, sollten seine Erlebnisse und Erinnerungen mit diesem Körper einfach spurlos von der Erdoberfläche verschwinden? Nein, beschloss Anatol, nach dem Tod des Vaters wollte er, der Sohn, die unter Verschluss gehaltenen Memoiren des Vladimir Ivancyk ausführlich studieren und das Andenken an seinen Vater hochhalten.
Als Anatol die Hand von der Wange zum Hals gleiten ließ, fiel ihm die dünne silberne Kette auf, die Vladimir selbst auf dem Sterbebett nicht abgelegt hatte. Seit Anatol denken konnte, hatte sein Vater diese Kette getragen und weder zum Waschen noch zum Schlafen abgenommen. An ihrem Ende hatte stets ein Schlüssel gebaumelt, wenn sich Anatol recht erinnerte. Er zog vorsichtig an der Kette, bis ein alter, matt glänzender Schlüssel mit einem komplizierten Schlüsselbart zum Vorschein kam.
Vladimirs Augen öffneten sich schlagartig. Sein Arm hob sich langsam. Die Hand wanderte in Richtung Brust. Anatol bemerkte, wie sein Vater zu sich kam, und sah mit großem Erstaunen, wie dessen Hand mit ungeahnter Zielstrebigkeit den Schlüssel umfasste und energisch zurück an die Brust zog.
Die Augen des Sterbenden blickten in Richtung Zimmerdecke ins Leere. Seine schwache Stimme erhob sich. »Der Teufel!«, hauchte er mit letzter Kraft. Der Monitor zeigte einige heftige, unregelmäßige Herzschläge. Dann flachten die Kurven plötzlich ab. Die Augen brachen. Die Hand um den Schlüssel erschlaffte. Die Linien auf dem Monitor flimmerten ohne jeden Ausschlag. Das Gerät ging von einzelnen Piepstönen zu einem Dauerton über. Ein Alarmsignal setzte ein.
»Treten Sie bitte zurück!«, rief eine Schwester, als sie ins Zimmer eilte, einen Arzt im Schlepptau. Anatol ließ die Kette los und entfernte sich ein stückweit vom Bett. Er fühlte sich wie betäubt, als er den Arzt beobachtete, der mit der Hand über die Augenlider Vladimir Ivancyks fuhr und das Gerät neben dem Bett ausschaltete. Der Monitor wurde schwarz. Der Alarmton brach ab.
»Ihr Vater ist tot«, richtete der Arzt das Wort an Anatol, »mein Beileid!«
Anatol nickte stumm und wischte sich eine Träne von der Wange.
»Wenn Sie einen Augenblick draußen warten, können Sie noch einmal von ihm Abschied nehmen. Ich entferne nur die Schläuche.«
Als Anatol wenige Minuten später vor seinem toten Vater stand, der auf einer Bahre lag und von einem weißen Tuch bis zum Hals bedeckt war, hatte er immer noch nicht begriffen, was Tod eigentlich hieß und wo der geliebte Mensch nun war, dessen leblose Hülle er gerade betrachtete. Aber er erinnerte sich an die letzte Geste seines Vaters: den Griff nach dem Schlüssel. Erneut zog Anatol an der Kette, holte sie unter dem Laken hervor und nahm sie dem Leichnam vom Hals. Der Schlüssel baumelte an ihrem unteren Ende. Anatol nahm ihn und betrachtete ihn in der hohlen Hand.
Aus seinem Leben vor der Entlassung aus KZ und Straflager hatte Vladimir Ivancyk stets ein Geheimnis gemacht. Vielleicht war dieser rätselhafte Gegenstand im wahrsten Sinne des Wortes der Schlüssel dazu?
*
Berlin.
Der Hörsaal im Hauptgebäude der Humboldt-Universität war prall gefüllt. Keiner der Klappsessel war leer geblieben, und selbst auf den Stufen des Mittelgangs drängten sich die Studierenden. Sebastian Varland, Professor für Neueste Geschichte, blickte zufrieden auf die Menge der Zuhörer, die seiner ersten Vorlesung seit seiner Rückkehr an die Universität lauschen wollten. Varland stand im dunklen Nadelstreifenanzug am Pult, das Manuskript seines Vortrags in den Händen. Die akkurat gebundene Krawatte, passend gewählt zum perfekt gefalteten Einstecktuch, ließ nicht einen Millimeter Luft zwischen dem Hemdkragen und der Haut seines Halses.
Varland hatte den Hörsaal betreten und sich sogleich zum Pult begeben. Augenblicklich war jedes Gemurmel erstorben. Der Professor ließ seinen Blick durch den Saal schweifen und setzte ein Lächeln auf, in das sich ein Hauch von Genugtuung über die Tatsache einschlich, dass er auch nach einem Jahr Pause noch einen großen Hörsaal füllen konnte.
»Herzlich willkommen zu Beginn dieses Wintersemesters«, hub Varland mit fester Stimme an. »Es freut mich, dass so viele von Ihnen hierher gefunden haben. Es geht um ein spannendes Thema der Beutekunstforschung: den systematischen, organisierten und wissenschaftlich legitimierten Kunstraub des NS-Staates auf sowjetischem Boden im Zweiten Weltkrieg …«
Während Varland begann, über den Kunstraub durch die Nazis im besetzten Osten zu referieren, öffnete sich noch einmal die Tür zum Vorlesungssaal. Aus dem Augenwinkel sah Varland einen blässlichen Mann hereinschlüpfen, er mochte Ende zwanzig sein, mit rundem Gesicht und breiter Stirn, über die eine bieder wirkende Haarsträhne fiel. Er trug ein verschlissenes Cordsakko und eine altmodische Krawatte. Der junge Mann stellte sich weiter hinten seitlich der Sitzreihen hin, scheu und linkisch um sich schauend.
Varland warf dem späten Neuankömmling einen missbilligenden Blick zu und versuchte, ihm keine weitere Beachtung mehr zu schenken. Er verließ das Pult und lief davor auf und ab. »Die Wehrmacht transportierte aus den besetzten Gebieten tonnenweise Kulturgüter, die ideologisch umgedeutet wurden zu Beweisen einer überlegenen arischen Zivilisation in grauer Vorzeit. Viele Wissenschaftler beteiligten sich an den Plünderungsaktionen in Museen und privaten Sammlungen, besuchten archäologische Grabungen und ließen die als ›herrenlos‹ angesehenen Fundstücke ins Deutsche Reich abtransportieren.«
Der Zuhörer seitlich der Stuhlreihen räusperte sich hörbar. Varland bemerkte, dass der junge Mann andächtig nach oben blickte und dabei lächelte, als ob ihm die Ausführungen des Professors nicht neu wären. Varland versuchte, sich wieder auf seinen Vortrag zu konzentrieren.
»Zur Tarnung hatte man Historiker, Archäologen und Kunstexperten, auch Anthropologen und Rassenforscher, in Uniformen gesteckt, mit einem militärischen Rang versehen und im Windschatten des Ostfeldzugs auf Beutefang geschickt. Beteiligt waren Einheiten der Wehrmacht und des Sicherheitsdienstes, aber auch die SS. Eine dieser Forschungsgruppen nannte sich Deutsches Ahnenerbe. Sie war Heinrich Himmler direkt unterstellt.«
Wieder machte der Mann im Cordsakko auf sich aufmerksam. Mit einem zustimmenden Brummen nickte er. Varland blickte ihn irritiert und leicht verärgert an. Er atmete tief durch und fuhr fort.
»1942 bis 1944 war die Forschungsgruppe Ahnenerbe besonders in Südrussland, in der Ukraine und auf der Halbinsel Krim aktiv. Archäologische Funde und Kunstwerke sowie ganze Bibliotheken und Archive wurden abtransportiert. Eine Vielzahl dieser in den Kriegsjahren in den Westen verbrachten Kulturgüter wurden bis auf den heutigen Tag nicht wiedergefunden.«
Gegen Ende der Vorlesung legte Varland seine Manuskriptseiten in eine Mappe. Manche der Studierenden, die ihn von früheren Semestern her kannten, passierten ihn auf dem Weg zum Ausgang und grüßten ihn – die einen zurückhaltend, die anderen herzlicher, aber immer mit einer spürbaren Portion Anteilnahme. Eine Studentin, Hanna Siemers, kannte Varland von der Arbeit an der Universität. Sie kam direkt auf ihn zu.
»Es ist schön, dass Sie wieder bei uns sind«, bekannte die hübsche junge Frau, die Varland in seinen Seminaren aufgefallen war. Beeindruckt von ihrer ersten Seminararbeit hatte er sie als Hilfskraft angestellt, etwa ein Jahr bevor er seine Lehrtätigkeit hatte unterbrechen müssen. Als Hilfskraft hatte sie ihre Recherchefähigkeiten unter Beweis gestellt. Doch waren Varland ihre Blicke nicht entgangen, die sie ihm in Vorlesungen und Seminaren zugeworfen hatte. Das hatte ihn irritiert, ja, aber im tiefsten Inneren auch neugierig gemacht, zumal sich Hanna mit ihrer schlanken Figur und ihren kurzen hellblonden Haaren mehr als einmal in seine Tagträume geschlichen hatte. Eine Neugierde, die er sich allerdings als verheirateter Mann stets verboten hatte.
»Danke, Hanna, ich freue mich, jetzt wieder aktiv in das Universitätsgeschehen eingreifen zu können«, erwiderte Varland etwas steif. »Wie ich sehe, sind Sie der Zeitgeschichte treu geblieben.«
Hanna Siemers lächelte. »Ich muss gestehen, die beiden Semester ohne Sie waren hart. Ihre Vertretung hatte wenig Interessantes zu bieten. Und auch die Arbeit am Lehrstuhl war langweilig.« Sie trat näher an Varlands Pult heran, sah zu ihm auf und legte sanft ihre Hand auf die seine. »Das mit Ihrer Frau tut mir leid!«
Varland zuckte zusammen und zog die Hand zurück. Er quälte sich ein Lächeln ab, obwohl ihre Worte ihn ins Mark trafen. Die junge Studentin errötete. Sie wandte sich zum Gehen, sah aber noch einmal zu Varland zurück und lächelte.
Varland nickte ihr zu und steckte seine Mappe in eine Ledertasche.
*
Sankt Petersburg.
Zögerlich öffnete Anatol Ivancyk spät abends die Wohnungstür seines Vaters. Der Flur lag im Schein des Treppenhauslichts vor Anatol. Sein Schatten zeichnete sich auf dem fleckigen und abgewetzten Nadelfilz ab.
Anatol drückte die Tür auf, betrat die Wohnung und tastete nach dem Lichtschalter. Erstmals in seinem Leben hatte er nicht geklingelt und auf das Schlürfen des alten Mannes auf der anderen Seite der Tür gewartet. Erstmals hatte Papka Ivancyk nicht durch den Türspion gelugt, mit zittrigen Händen die Kette gelöst und die Tür geöffnet. Anatol stand im Flur unter der Lampe mit dem Plastikschirm und hörte die Stille, die erdrückende Stille. Es lief weder das Radio noch der Fernseher. Hier war niemand mehr zu Hause.
Im Inneren der Wohnung roch es nach abgestandener Luft. Anatol riss die Fenster auf und ließ für einige Minuten den kalten Herbstwind hinein. Er schaltete den Fernseher ein, um Hintergrundgeräusche in den väterlichen vier Wänden zu erzeugen. Es lief eine Spielshow. Dann verschaffte Anatol sich einen Überblick über die spärlich vorhandenen Lebensmittel im Kühlschrank, über die Inhalte von Badezimmerregalen und Nachttischschubladen, öffnete den Kleiderschrank seines Vaters, um die Wäsche zu begutachten, und sah am Schreibtisch die Post der vergangenen Wochen durch, ob sich darin irgendetwas verbergen mochte, das nun er, der Sohn, erledigen müsste.
Unmittelbar vor Anatol stand ein Schwarz-Weiß-Foto von ihm und seinem Vater auf der Schreibtischplatte. Es mochte aus den frühen Siebzigerjahren stammen und zeigte den kleinen Anatol mit Wollstrickmütze und dunklen Kulleraugen auf dem Arm seines Papka, der ihn stolz lächelnd betrachtete. Aufgenommen hatte das Foto Anatols Mutter Irina, eine Schneiderin aus Kasachstan, die Vladimir nach seiner Zwangsumsiedlung kennengelernt hatte. Von ihr hatte Anatol seinen dunklen Teint und das lockige, schwarze Haar, das nun bis auf einen Haarkranz verschwunden war. Irina Ivancyk war an Krebs gestorben, ehe ihr Sohn das elfte Lebensjahr vollendet hatte. Ab diesem Zeitpunkt waren Anatol und Vladimir allein.
Anatol hielt das Foto in den Händen und spürte, wie ihm die Tränen kamen. Rasch stellte er das Bild wieder an seinen Platz und wischte sich mit dem Handrücken über beide Wangen. Nachdem er sich gefasst hatte, drehte er den Schlüssel des Schreibtischschranks herum und öffnete die Tür, um zu erfahren, was sich dahinter verbergen mochte. Im oberen Fach wurde eine Reihe von Ordnern sichtbar. Anatol erblickte Ordnerrücken mit krakeliger Handschrift, die Titel teilweise durchgestrichen und neue darüber gekritzelt. Der Beschriftung nach zu urteilen befanden sich in den Heftern nur Rechnungen und Dokumente, darunter Unterlagen zur Wohnung, Briefe des Sozialamts und Kontoauszüge. Im schmaleren Fach darunter fand Anatol hingegen eine Metallkassette mit rostigem Griff. Verwundert zog er sie hervor. Der Schlüssel fehlte. Anatol griff nach dem Schlüssel, den er seinem toten Vater abgenommen hatte und der noch immer in seiner Hosentasche lag, aber dieser war viel zu groß für das Schloss. Enttäuscht legte er ihn beiseite.
Anatol öffnete weitere Schubladen und durchsuchte sie nach einem kleineren Schlüssel. Da seine Suche erfolglos geblieben war, begann er, mit einem Taschenmesser im Schloss der Metallkassette herumzufuhrwerken. Fluchend und schwitzend versuchte er, den nicht allzu komplizierten Mechanismus gewaltsam zu überwinden. Zwar brach darüber die Spitze des Taschenmessers ab, doch konnte Anatol den Riegel schließlich unterhalb des Deckels so weit drehen, dass er den Inhalt der Kassette freigab.
Anatol hob den Metalldeckel an. Ein dicker Stapel Papier lag darunter verstaut, eng beschrieben mit Schreibmaschinenbuchstaben. Zwischen den Papieren lagen immer wieder Zeitungsausschnitte und handschriftliche Notizen. Anatol überflog die ersten Seiten nur, ahnte er doch, dass dies die unter Verschluss gehaltenen Lebenserinnerungen seines Vaters sein mussten, von welchen Mamka ihm als kleinem Jungen erzählt hatte, und dass deren Lektüre mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, als Anatol sich an diesem Abend zugestehen wollte. Doch lenkten einzelne Sätze Anatols Aufmerksamkeit tiefer in die Erzählung. Er zog die Stirn kraus und blätterte eine Seite zurück. Bald schon las er konzentriert Seite für Seite, Zeile für Zeile.
So vergingen die Stunden. Längst war es tiefe Nacht geworden, das Fernsehen zeigte einen alten Western, und noch immer zogen Anatol die Lebenserinnerungen seines Vaters in ihren Bann. Er besah sich auch die Zeitungsartikel, die allesamt jüngeren Datums waren und meist von Forschungen über Nazi-Verbrecher und von den Büchern ihrer Jäger handelten. Die letzten Artikel hatten jedoch wiederholt die Rückgabe von Kunstgegenständen zwischen Deutschland und Russland zum Inhalt.
In einem der Zeitungsberichte war ein Mann in Anzug und Krawatte abgebildet. Er blickte ernst in die Kamera. Auf seinem Oberschenkel ruhte ein Gemälde von Christus am Kreuz. Laut Bildunterschrift handelte es sich um ein lange verschollenes und auf einem Moskauer Dachboden wiedergefundenes Cranach-Gemälde, das nun an Deutschland zurückgegeben werde. Entdeckt hatte es der Mann, der es auf dem Foto präsentierte: Professor Sebastian Varland aus Berlin. Vladimir Ivancyk hatte den Namen nicht nur unter dem Bild, sondern auch im Artikel angestrichen.
Anatol prägte sich das Gesicht dieses Mannes genau ein. Nach der Lektüre verstand er, warum gerade dieser Professor für seinen Papka von Bedeutung gewesen war und wie hilfreich er hätte sein können, wenn der Vater noch am Leben und in seinem hohen Alter zu einer Reise fähig gewesen wäre. Er hätte diesem Deutschen von einem ganz besonderen Kunstwerk erzählen können, das ebenfalls seit Langem verschollen war. Er hatte es nicht getan. Vielleicht deswegen nicht, weil dieses Kunstwerk, wenn es nach dem Willen seines Vaters gegangen wäre, für immer und ewig hätte verschollen bleiben sollen.
Anatol nahm noch einmal die maschinegeschriebenen Aufzeichnungen zur Hand. Er suchte den Absatz heraus, in welchem Papka von dem unheimlichen neunten Grab erzählt hatte, und las ihn ein weiteres Mal.
»Der Teufel …«, murmelte er in Erinnerung an Vladimirs letzte Worte.
Der Morgenhimmel hellte sich langsam auf. Die Kreuzung vor dem Hochhaus war bereits vielbefahren. Nachdenklich betrachtete Anatol den Schlüssel auf der Schreibtischplatte. Er nahm ihn in die Hand und führte ihn nah vor Augen. Irgendetwas war darauf eingraviert. Doch es war schwer lesbar. Anatol kramte in einer der Schubladen, in der er zuvor eine Lupe gesichtet hatte. Kaum hatte er diese gefunden, hielt er sie über den Schlüssel. Mit dem Daumen rieb Anatol leicht über die von Schmutz und Talg verdeckte Gravur des Schlüsselgriffs. Er erkannte eine mehrstellige Ziffernfolge darauf und eine Umschrift. Sie lautete: »Kantonalbank von Bern, Confoederatio Helvetica«.
Im Fernsehen liefen die Morgennachrichten. Von Anatol völlig unbeachtet, berichtete der Nachrichtensprecher von Auseinandersetzungen am Vorabend im russischen Parlament, in deren Verlauf es auch zu Handgreiflichkeiten zwischen den Abgeordneten gekommen sei. Anatols Blicke schweiften unterdessen zwischen dem Schlüssel und den Aufzeichnungen seines Vaters hin und her.
Anatol glaubte, verstanden zu haben. Zunächst hatte der Kalte Krieg seinem Vater einen Strich durch die Rechnung gemacht, später dann die Gesundheit. Doch ihn, Anatol, sollte nun nichts mehr daran hindern, die Pläne seines Vaters fortzuführen.
*
Berlin.
Nachmittags war die Sonne herausgekommen. Varland zog den Reißverschluss seiner Vließjacke zu. Seit mehr als einem Jahr war er nicht mehr laufen gewesen. Spontan hatte er sich entschlossen, den vorlesungsfreien Tag zu nutzen, zeitig nach Hause zu fahren und eine Runde im Park zu drehen. Er hatte das früher regelmäßig und diszipliniert getan. Es war Mitte Oktober und dämmerte bereits zeitig. Eile war geboten, wollte er nicht im Dunkeln laufen.
Als er im Park angekommen war, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Kurz erinnerte er sich des Wegs, den er mit Thea immer genommen hatte, verbat sich jedoch traurige Gedanken an die Vergangenheit und lief los. Aber auch die laute Musik in den Kopfhörern und die Konzentration auf den Rhythmus seiner Laufschritte halfen nicht. Immer wieder zogen ihn seine Gedanken in die Zeit zurück, in der er hier mit seiner Frau gewesen war.
Bilder von gemeinsamen Spaziergängen durch den Park schossen ihm durch den Kopf, von den Sonnenuntergängen am Brunnen mit seinen sprudelnden Fontänen oder auf der Parkbank vor dem kleinen See, an dem er gerade vorbeilief. Da war die Welt noch in Ordnung gewesen.
Laufen, rief Varland sich in Gedanken selbst zu, laufen!
Andere Jogger kamen Varland entgegen, darunter attraktive Frauen, die in der Dämmerung seine Blicke suchten, um sich dann wieder abzuwenden, wenn er sie bemerkte. Sie trugen eng anliegende Sportbekleidung und brachten ihre Figuren zur Geltung. Aus dem Augenwinkel nahm Varland diese Reize durchaus wahr, doch er widerstrebte dem Impuls, diese Frauen anzuschauen. Das war er Theas Andenken schuldig, schärfte er sich ein.
Als er eine Anhöhe genommen hatte, spürte er sein Herz wie wahnsinnig rasen. Der Schweiß floss ihm das Gesicht hinunter. Sein Atem ging schwerer und schwerer. Verbissen hielt Varland das selbst auferlegte Tempo. Sein Durchhalten sollte eine Art Strafe für die Nachlässigkeit der vergangenen Monate sein, in denen er aufgrund der Ereignisse wie gelähmt gewesen war und keinen Sport betrieben hatte.
Varland hörte seinen Herzschlag im Staccato in den Ohren pochen. Ein Grauschleier legte sich vor seine Augen. Der Brustkorb hob und senkte sich heftig. Varland spürte, wie es ihn gnadenlos zu Boden zog. Es fühlte sich so an, als ob er gegen sein eigenes Gewicht angesichts einer plötzlich ansteigenden Schwerkraft nicht mehr ankommen konnte. Die Muskeln in den Beinen versagten ihren Dienst. Das schwache Licht der Dämmerung verschwand vollends. Als er mit dem Gesicht voraus im Gras landete, hatte er bereits das Bewusstsein verloren.
»Soll ich einen Krankenwagen rufen?«, hörte Varland eine weibliche Stimme aus einiger Entfernung. Er schlug die Augen auf.
Ein Mann beugte sich über ihn und sah ihn prüfend an. »Nein, warte! Er kommt schon wieder zu sich.« Er tippte Varland an die Schulter. »Hallo? Alles in Ordnung mit Ihnen?«
Varland fasste sich an die schweißnasse Stirn. »Ja, ich denke schon«, antwortete er. »Ich muss kurz weggekippt sein.«
Der Passant nickte. »Nur ein paar Sekunden. Meine Freundin und ich waren sofort zur Stelle.«
Die Frau neben ihm nickte. Sie hielt ein Handy in der Hand.
Varland richtete sich langsam auf. »Vielen Dank! Ich bin jetzt lange nicht gelaufen. Wahrscheinlich habe ich mir einfach zu viel zugemutet.«
»Ich würde an Ihrer Stelle jetzt aber nicht mehr weiterlaufen«, riet der Mann.
»Oder sollen wir nicht doch einen Arzt rufen?«, fragte seine Freundin besorgt nach.
Varland winkte ab. »Nein, es geht wieder. Wirklich! Und Sie haben recht, ich gehe besser nach Hause.«
Das Paar verabschiedete sich und setzte seinen Spaziergang fort.
Varland sah auf die Uhr und blickte zum Himmel, der immer dunkler wurde. Was war geschehen, wunderte er sich. Er legte seine Hand aufs Herz und spürte, wie sich der Muskel wieder beruhigte.
Doch der Gedanke, dass etwas mit ihm nicht stimmte, ließ Varland nicht mehr los. Als er unter der Dusche stand, spukten in seinem Kopf Fantasien von plötzlichen Herzinfarkten oder Schlaganfällen herum, Bilder, wie man ihn erst nach Tagen tot unter der laufenden Dusche fände, weil das gestaute Wasser durch den Fußboden in die untere Wohnung tropfte. Varland schüttelte den Kopf über diese Ängste, lehnte sich vornüber, so dass ihn das warme Wasser ganz umspülte, und schloss die Augen. So verharrte er minutenlang. Doch wirklich entspannen konnte er sich nicht. Zu sehr hatte ihn die Sorge um seine Gesundheit im Griff.
Varland verbrachte die Abende oft mit Arbeit, zu der er tagsüber nicht kam: das Korrigieren von Seminararbeiten etwa oder das Feilen an Vorträgen und Buchmanuskripten. An diesem Abend schrieb er an einem Beitrag über die Forschungsgruppe Deutsches Ahnenerbe der SS. Zahlreiche Bücher standen sauber aufgereiht nebeneinander auf dem Schreibtisch. Daneben stapelten sich aus Zeitschriften und Büchern kopierte Artikel und ein paar Ordner.
Vor Varland lag ein alter Artikel, der sich mit der Forschungsgruppe befasste. Immer wieder las er einzelne Passagen, tippte weiter, unterbrach und wandte sich wieder dem Artikel zu. Doch bei einer Fußnote mit Quellenangaben stutzte er. »Krim-Expedition«, murmelte er, »archäologische Grabungen bei Dori. Bericht der Heeresgruppe Süd, Juli 1942.« Varland pochte nachdenklich mit der Stiftspitze auf der Fußnote herum. »Wonach haben die denn da gegraben?«, wunderte er sich leise. Er blickte in den Text. Demnach war eine Forschergruppe im besagten Sommer zur Halbinsel Krim aufgebrochen, um gotische Siedlungsspuren bei Dori nahe Sevastopol zu begutachten. Beteiligt waren neben Archäologen und Kunsthistorikern auch Anthropologen. Der Artikel verriet nicht, warum. Offensichtlich ging es auch hier nicht nur um Archäologie, sondern auch um rassenkundliche Untersuchungen.
Spannend, befand Varland. »Diesen Bericht sehen wir uns mal an«, sprach er zu sich selbst. Er machte sich eine Notiz und legte den Stift beiseite. Er würde gleich morgen versuchen, Akteneinsicht zu erhalten. Vielleicht fand er noch weitere Informationen, die er verwerten konnte.
Rasch hatte sich Varland wieder in seinen eigenen Beitrag vertieft. Doch mit der Zeit ließ seine Konzentration nach. Dann ertappte er sich dabei, dass er minutenlang auf den zuletzt getippten Satz gestarrt hatte, ohne dessen Inhalt zu erfassen. Oder dass er zum wiederholten Male aus dem Fenster geguckt und beobachtet hatte, wie Nachbarn im gegenüberliegenden Haus Lichter an- und ausmachten, mit einem Baby auf dem Arm in der Wohnung hin und her liefen oder am Herd standen und in einem Topf rührten.
Des Öfteren blieb Varlands Blick auch an einem Cello haften, das in einer Wohnzimmerecke stand. Es war Theas Cello. Die warme Farbe des Holzes und die sanft geschwungene Form des Korpus’ hatten eine beruhigende Wirkung auf Varland und entführten ihn immer wieder in die Vergangenheit, als seine Frau noch auf diesem Instrument gespielt hatte.
Aus jeder dieser Absencen konnte sich Varland selbst befreien. Er schalt sich dann kopfschüttelnd für seine Unkonzentriertheit und machte sich wieder an die Arbeit. Schließlich wurde die Müdigkeit zu stark. Die Konzentrationsschwäche verwandelte sich in eine bleierne Schwere des Geistes. Die Augenlider fielen herab. Das Kinn sank auf die Brust, wurde wieder ruckartig angehoben, ehe es von Neuem sank. Es dauerte nicht lang, und Varlands Kampf gegen den Schlaf war verloren.
*
Varland träumte. Es roch nach chlorhaltigem Reinigungsmittel. Der Linoleumboden war frisch gewischt und quietschte unter seinen Gummisohlen. Das Licht war diffus, als würde er die Welt durch ein milchiges Objektiv betrachten. Er hörte Stimmen, die ihn durch den Flur verfolgten.
»Warten Sie!«, rief eine Frau. Die Worte hallten von den Wänden wider. »Entschuldigen Sie?«
Varland ließ sich nicht beirren. Er eilte die Flucht der Zimmertüren entlang.
Ein Mann in grünem Kittel mit Mundschutz trat ihm in den Weg. »Sie können da jetzt nicht hinein!«
Varland umrundete den Arzt und ließ ihn hinter sich. Vor einer Tür blieb Varland stehen. Zimmer 214. Er drückte die Klinke und öffnete die Tür. Unendlich grelles Licht flutete ihm entgegen. Geblendet wandte er sich ab.
»Ihre Frau …«, hörte er eine männliche Stimme, »… es tut mir leid! Hat Sie denn niemand angerufen?«
Varland verspürte ein heftiges Herzklopfen. Schweiß rann ihm in Strömen die Stirn hinunter. Dieses grelle Licht!
»Ihre Frau …«, echote es in seinem Kopf.
*
Varland schreckte von der Schreibtischplatte hoch. Offensichtlich war er während der Arbeit eingeschlafen. Er fasste sich mit zittrigen Händen an die feuchte Stirn und sah sich um. Vor sich fand er die Bücher und kopierten Artikel, den aufgeklappten Laptop und eine kalt gewordene Tasse Tee.
Wie spät war es, um Gottes Willen? Varland sah auf die Uhr auf dem Tisch. Gleich einundzwanzig Uhr. Er erhob sich ruckartig. Er war zu spät. Auch das noch! Wie hatte er nur einschlafen können?
Varland hatte das Gefühl, er spüre jede einzelne Nervenbahn in seinem Körper. Er eilte ins Bad, wusch sich kurz das Gesicht und kramte fieberhaft im Badezimmerschrank. Die Packung, die er gesucht hatte, fiel ihm in die Hände. Es war eine hellgraue Schachtel. Darauf stand gedruckt »Curapetrazin«. Varland nahm ein Briefchen heraus, drückte eine der Tabletten in die Hand und schluckte sie. Danach atmete er einmal tief durch.
Er hastete zur Wohnungstür, schnappte sich im Vorübergehen seinen Mantel und warf ihn über, als er den Garderobenspiegel passierte. Er hielt kurz inne und betrachtete prüfend sein Erscheinungsbild. Kopfschüttelnd zog er den Mantel noch einmal aus, holte aus dem Schlafzimmer eine Krawatte und stellte sich vor den Spiegel im Flur. Mit einigen routinierten Handgriffen band er sich einen schmalen Knoten, dessen Sitz er noch einige Male durch Ziehen und Drücken korrigierte. Mit Daumen und Zeigefinger fuhr er noch einmal das obere Ende seines Einstecktuchs entlang und zupfte es gerade. Er nickte zufrieden seinem Spiegelbild zu.
»So viel Zeit muss sein!«, stellte er fest.
Er nahm den Mantel und eilte zur Tür hinaus.
Als Sebastian Varland hektisch das Restaurant betrat, sah er sich unschlüssig um. Eine junge Dame nahm ihm den Mantel ab.
Ein rundlicher Mann winkte ihm. »Sebastian!«, rief er und erhob sich von seinem Tisch, an dem noch eine Reihe weiterer Gäste saßen. »Ich dachte schon, du kommst nicht mehr.«
Varland lachte und lief zum Tisch. »Joachim«, grüßte er, »tut mir leid, ich bin zu spät.«
»Kein Problem!«, gab Joachim Grotjahn zur Antwort. »Nimm gleich hier Platz.« Er deutete auf einen Stuhl neben sich.
Varland setzte sich und wurde der Runde vorgestellt. Grotjahn, ein Mittsechziger, der an diesem Abend seinen Geburtstag feierte, legte seine Hand auf Varlands Schulter. Sein Hemd, das er am Kragen offen trug, spannte sich unter dem Bauch, den sich der Fotograf über die Jahre seines Erfolgs zugelegt hatte. »Das«, hub er an, »ist Sebastian, Sohn meines leider früh verstorbenen Studienfreundes Valentin. Und jetzt wie mein eigener Sohn. Er ist so eine Art Indiana Jones der Historikerszene.«
»Nana«, beschwichtigte Varland, dem der Vergleich mit einem Filmhelden übertrieben erschien.
»Ist doch so«, tat Grotjahn die Bescheidenheit seines Freundes ab. »Ein ganz großer Schatzsucher, der nebenbei noch an der Uni lehrt. Und er sieht besser aus als Harrison Ford.« Und zu Varland gewandt: »Nur, dass du keine Peitsche schwingst.«
Die anderen Gäste stimmten in Grotjahns Gelächter mit ein.
»Schatzsucher?«, fragte eine dunkelblonde Frau, die neben Varland saß. Ihr üppiges Dekolleté glänzte.
»Ich beschäftige mich vorwiegend mit verschollenen Kunstschätzen«, erläuterte Varland höflich. »Ich forsche zum Thema Beutekunst des Zweiten Weltkriegs, und … naja, auf diesem Wege ist eben auch einiges wieder aufgetaucht.«
Das Glitzerdekolleté wandte sich ihm weiter zu. »Was haben Sie denn schon entdeckt?«
»Zum Beispiel das Quedlinburger Reliquienkreuz. Ich habe es auf dem Dachboden eines ehemaligen GIs wiedergefunden. Er hatte es nach Kriegsende einfach im Gepäck, als er in die Heimat zurückkehrte. Er hat nie gewusst, was für eine Kostbarkeit er da besaß.«
»Unglaublich!«
»Manchmal muss man auch gar nicht so sehr in die Ferne schweifen. Im Keller einer Berliner Bäckerei lagerten jahrzehntelang Säcke mit Gold- und Silberschmuck der Hohenzollern versteckt. Der Schmuck war nach Kriegsende aus einem Flakturm geborgen, dann aber gestohlen worden. Der Dieb wurde gefasst und brachte sich in der Haft um, ohne zu verraten, wo er die Beute versteckt hatte. Danach gerieten die Säcke in Vergessenheit.«
»Und wie haben Sie sie dann gefunden?«
»Ich hatte die Adresse des Diebes herausgefunden. Er wohnte zuletzt in einem zerbombten Haus oberhalb der Bäckerei. Der Keller und das Erdgeschoss allerdings waren vollständig erhalten geblieben. Also habe ich alle Kellerräume gründlich durchsucht. Und siehe da …«
»Erzähl’ das mit dem Christus-Bild!«, forderte Grotjahn.
Varland fasste sich in gespielter Verlegenheit an die Nase. In Wahrheit gefiel es ihm, derart im Mittelpunkt zu stehen. »Ach, da waren die Russen ein bisschen sauer, fürchte ich.«
Die Dame in weinrot näherte sich Varland ein stückweit. »Warum, nun sagen Sie schon!«
»Es hat Widerstand gegeben, das Gemälde zurück nach Deutschland zu bringen. Der Christus am Kreuze von Cranach war von den Sowjets nach Moskau geschafft worden. Jahrzehnte lagerte das Bild im Keller eines Kirchenmuseums. Die Museumsleitung wusste sehr wohl um das kostbare Kunstwerk. Aber herausrücken wollte sie es nicht.«
»Wie also haben Sie es geschafft?«, fragte die Dame.
»Politischer Druck«, entgegnete Varland. »Damals ließ sich so eine Rückgabe noch von Politikern als Aktion des guten Willens verkaufen. Hinter den Kulissen hat man dafür Vorteile ausgehandelt. Es gab großen Widerstand, insbesondere im russischen Parlament. Dort sitzen viele Nationalisten, die Beutekunst als Eigentum der Siegermacht Sowjetunion ansehen.« Varland schwenkte sein Rotweinglas in der Hand. »Die Rückführung des Bildes hat mir viele Schlagzeilen eingebracht. Beliebt habe ich mich nicht gemacht. Die Dresdener Gemäldegalerie aber hat sich gefreut.«
»Eines Tages findet er noch das Bernsteinzimmer!«, fügte Grotjahn hinzu.
Varlands Sitznachbarin schien beeindruckt von seiner Erscheinung und seinen Erzählungen zu sein. »Welchen Schatz heben Sie als Nächstes?«, fragte sie mit warmer Stimme. Dabei legte sie zwei Fingerkuppen auf den Oberschenkel des Historikers.
Varland, der immer noch das Glas in der Hand hielt, legte langsam einen Oberschenkel über den anderen. Die Fingerspitzen der Dame glitten vom Stoff. »Ich habe jetzt ein gutes Jahr pausiert. Nun werde ich mich verstärkt wieder Forschungsthemen widmen«, erwiderte er ein wenig steif. Er nickte seiner Nachbarin zu und vermied, dass sein Blick abwärts auf ihren Ausschnitt fiel. Um von sich abzulenken, hob er das Glas. »Auf das Geburtstagskind!«
Die Gäste prosteten dem Gastgeber zu. Grotjahn aber sah Varland stirnrunzelnd an. Ob er an die Rechnung dachte? Varland sah die vielen Rotwein- und Champagnerflaschen auf dem Tisch. Aber Grotjahn war ein wohlhabender Fotograf und Galerist, der überdies reich geerbt hatte. Das konnte es nicht sein. Er war außerdem großzügig, stets gut gelaunt und hilfsbereit. Dem Alkohol sprach er genauso gerne zu wie gutem Essen. Wie es angesichts dieser Umstände um seine Gesundheit bestellt sein mochte, konnte Varland nur mutmaßen. Er hoffte für seinen Freund das Beste, stellte aber fest, dass Grotjahn gerade in den vergangenen Jahren erheblich an Gewicht gewonnen hatte. Die Häufigkeit seiner Affären mit schönen Frauen nahm dabei erstaunlicherweise in gleichem Maße zu wie der Umfang seines Bauches.
Warum aber hatte ihn Joachim so ernst gemustert?
Die Gesellschaft amüsierte sich prächtig. Gelächter schallte von einem zum anderen Ende des Tisches. Sebastian unterhielt sich mit seinem Gegenüber. Aber das Gespräch stockte. Zielsicher hatte sich Varland eine Spaßbremse als Konversationspartner ausgesucht. Das war ihm aber angenehmer, als mit der Frau neben ihm zu reden, obwohl oder eben weil sie Erotik nur so zu versprühen schien.
Als Varland aufstand, um die Waschräume aufzusuchen, erhob sich auch Grotjahn von seinem Platz und zog ihn beiseite.
»Viviana scheint dir nicht so zuzusagen, was? Ich hatte euch extra nebeneinander gesetzt.«
Varland erblasste. »Merkt man das so sehr?«
Grotjahn nickte. »Meinst du nicht, ein Jahr nach Theas Tod könntest auch du dich mal wieder dem Leben öffnen? Nicht immer nur an die Vergangenheit denken, sondern einfach den Augenblick genießen? Eine Frau wäre da ein guter Anfang.«
»Aber ich öffne mich ja. Ich habe jetzt wieder an der Uni angefangen …«
»Arbeit, du stürzt dich in Arbeit, wie du es früher getan hast. Arbeit ist dein Narkotikum. Was hat sich geändert?«
»Der Mensch braucht doch Arbeit«, rechtfertigte sich Varland. »Ohne Arbeit und Diszplin ist er nichts.«
»Sagt wer? Ich habe mein ganzes Leben keinen Hauch Disziplin besessen. Und? Ich lebe noch.« Er klopfte Varland auf die Schulter. »Ich meine ja nur, dass Arbeit dich auch nicht glücklicher macht. Du hast dich seit jeher in deine Bücher gestürzt. Was soll das Ganze?«
»Die Arbeit gibt mir Halt, Joachim«, entgegnete Varland ernst, »sie strukturiert mir den Tag. Weißt du, wie das ist in einer leeren Wohnung – jeden Morgen, jeden Abend? Wenn alle sagen: ›Schone dich! Geh’ nicht gleich wieder so hart ran!‹ Und du keine Aufgabe hast? Das war ich einfach leid!«
Grotjahn nickte. »Du sollst ja deiner Arbeit nachgehen. Forschen, lehren, das ist dein Element! Ich will nur nicht, dass du darüber zu leben vergisst. Höre in dich hinein! Was willst du wirklich? Atme einmal tief ein, tief aus und höre dir selber zu!«
Varland verzog die Miene. Dieser Ratschlag war ihm nicht konkret genug. »Ich habe nun wirklich jeden Tag seit Theas Tod nachgedacht, habe innegehalten und gegrübelt, ja, mir das Hirn zermartert, was mir das alles sagen will. Aber da will mir nichts und niemand etwas sagen. Es ist einfach passiert. Und ein Jahr Stillstand ist genug! Ich will nun das Leben wieder anpacken, gestalten, nach vorne schauen.«
»Nach vorne schauen? Kann man das denn? Du weißt doch nicht, was kommt.«
Varland seufzte nachgiebig lächelnd. »Auf diese Diskussion lasse ich mich nicht ein. Natürlich kann man Weichen stellen, Pläne schmieden, etwas erreichen. Ich muss mein Leben wieder in den Griff kriegen.« Er wartete ein Signal des Verständnisses ab. Da es ausblieb, fügte er hinzu: »Etwas auf die Beine stellen, weißt du? Das machen doch alle Menschen.«
Sein Gegenüber nickte. »Ich habe dich beobachtet. Du machst da weiter, wo du vor Theas Tod aufgehört hast – auf die gleiche Weise. Nur ohne sie.«
Varland schluckte und wollte widersprechen, doch Grotjahn hob beschwichtigend die Hand. »Ich rede auch nicht von Stillstand, wie du das tust, Sebastian, ich rede von bewusstem Leben. Was hat sich denn geändert? Kannst du Thea wirklich loslassen? Immer noch leidest du an der Vergangenheit und versuchst, einem Glück in der Zukunft hinterherzujagen. Du wirst die Zukunft niemals einholen! Zufriedenheit ist hier, in diesem Augenblick, wenn du das willst. Auf Erlösung in der Zukunft zu hoffen, ist Blödsinn!«
Grotjahn lächelte Varland an und rüttelte ihn am perfekt sitzenden Krawattenknoten. »Leben findet jetzt statt!«, raunte er ihm zu, als ob er ihm ein großes Geheimnis verriete, und verwies mit einer kurzen Kopfbewegung in Richtung Viviana, die Dame im weinroten Kleid. Dann ließ er Varland stehen, nicht ohne ihn mit einem Augenzwinkern zu bedenken.
Varland nickte nur und blickte ins Leere, als Grotjahn an ihm vorbeiging. Seine Hand wanderte zum gelockerten Krawattenknoten und zog ihn wieder fest.
*
Der Videostream war wackelig. Marie Gold sah das Gesicht ihres Gesprächspartners auf dem Bildschirm mal scharf konturiert, mal in pixeliger Auflösung. Auch die sonore Stimme von Greg Kershner am anderen Ende der Leitung wurde hie und da in ihre binären Einzelteile zerlegt. Dennoch war er besser zu verstehen als zu sehen.
Marie, eine rot gelockte Berliner Journalistin mit einem zarten, alabasterfarbenen Teint und einer Reihe reizvoller Sommersprossen im Gesicht, hatte einen Ordner so neben ihrem Bildschirm positioniert, dass das Sonnenlicht sich nicht auf dem Bildschirm spiegelte. Sie zog ihre ebenfalls mit kleinen braunen Pünktchen überzogene Nase kraus und ärgerte sich über die schlechte Internetverbindung in ihrer Redaktion.
Greg Kershner sprach fließend Deutsch mit einer Mischung aus amerikanischem Akzent und Schwyzerdütsch. »Es ist hart«, hörte Marie ihn sagen, »die deutschen Medien sind viel abhängiger von ihren Anzeigenkunden. Mit meinen Storys ecke ich überall an. In Zürich war das noch einfacher.«
»Selber schuld«, antwortete Marie. »Warum musstest du auch nach Berlin ziehen? Noch dazu, wenn du hier Steuern zahlen musst.«
»Das Leben hier ist einfach viel billiger«, rechtfertigte sich Greg, nahm sein Käppi ab und fuhr sich durch die wirren blonden Haare. »Ich habe eine große, helle Wohnung in Schöneberg. So etwas würde ich in Zürich nie bezahlen können.«
»Die Wohnung ist wirklich schön«, gab Marie zu und spielte mit einem Stift im Mund. »Hast du mittlerweile ein paar Möbel mehr?«, nuschelte sie.
»Wozu? Ich brauche nur wenig. Das meiste habe ich zurückgelassen.«
»Ein mutiger Schritt, einfach alle Zelte abzubrechen und in einem anderen Land neu anzufangen.«
»Ich bin Weltbürger. Schweizer, Deutscher, Amerikaner. Ich bin in meinem Leben schon so oft umgezogen. Ich fange gerne neu an von Zeit zu Zeit.«
»Ja, aber ich meine, du hast ja nicht einmal eine Festanstellung. Als Blogger wie du würde ich das nie wagen. Da denke ich viel zu sehr an meine Sicherheit.«
»Berlin ist der richtige Ort für mich. Hier gibt es viele Kreative. Und mein Blog ist das meistgelesene Pharma-Blog in Europa«, erwiderte Greg nicht ohne Stolz. »Ich habe schon mein Auskommen. Und den besten Chef der Welt: mich selbst. Wie ist es bei dir?«
»Hier ist es nicht so leicht«, seufzte Marie und legte ihren Kopf schräg, so dass ihre roten Locken vom Rücken über die Schulter fielen. »Dem Verlag geht’s schlecht. Das Gerücht macht die Runde, dass die Wirtschaftsredaktionen der einzelnen Titel zusammengelegt werden. So viel zur journalistischen Vielfalt. Um ehrlich zu sein, ich habe ein bisschen Angst um meinen Job. Ich bin noch nicht so lange dabei, außerdem eine Frau Anfang dreißig, keine Kinder …«
»Das lässt sich ändern«, entgegnete Greg und grinste frech.
Marie zerknüllte einen Zettel und warf ihn mit gespieltem Zorn gegen die Bildschirmkamera. »Ich meine es ernst, Greg! Die Zeiten sehen nicht rosig aus. Mein Standing hier ist nicht das beste. Ich habe das Gefühl, ich brauche einmal wieder eine richtig große Story!«
»Aber deswegen rufe ich dich ja an«, gab Greg zur Antwort und machte ein geheimnisvolles Gesicht.
»Schieß los!«, forderte Marie ihn auf und rutschte auf ihrem Stuhl herum.
Greg kratzte sich unter seinem T-Shirt, so dass Marie einen Teil seines muskulösen Körpers zu sehen bekam. Sie schmunzelte und bedauerte den kurzen Einblick nicht. Greg war ein sportlicher Typ, locker im Auftreten und sehr charmant, insbesondere Frauen gegenüber. Leider bei allen Frauen, wie Marie hatte feststellen müssen. Sie hatte einmal mit dem Gedanken gespielt, mit ihm zu schlafen. Doch wusste sie, dass sie dann seinem jugendlichen Charme erliegen und sich nur unglücklich machen würde. Die Flüchtigkeit eines intimen Moments war es also nicht, was sie abschreckte, sondern vielmehr die Angst vor einer schmerzhaften Phase danach.
»Also gut, hör zu: In den Wissenschaftsforen geht seit Tagen ein Gerücht um, einem großen Schweizer Pharmakonzern sei der endgültige Durchbruch in der Krebsbekämpfung gelungen.«
Marie machte ein enttäuschtes Gesicht. »Das ist toll. Aber ich bin keine Medizinjournalistin. Was ich brauche, sind Wirtschaftsthemen, am besten Skandale oder so etwas: veruntreute Gelder, korrupte Manager oder gefälschte Bilanzen.«
»Nun warte doch mal«, beschwichtigte Greg. »Das Unternehmen heißt Grau Cura. Und ich habe es schon lange auf dem Kieker.«
Marie öffnete parallel ein Browserfenster und gab den Namen der Firma in einer Suchmaschine ein. »Warum?«
Greg fuhr fort: »Ich glaube, dass Grau Cura unerlaubte Substanzen in der Forschung einsetzt und überdies Präparate in Afrika an wehrlosen Menschen testet – ohne jegliche Genehmigungen oder sonstige Aufsicht von Ärzten oder Gesundheitsbehörden. Mir liegen Papiere über Kontobewegungen vor, Zahlungen an irgendwelche Subalternen in afrikanischen Ministerien, and so on.«
Marie las derweil den Wikipedia-Eintrag zum Pharmakonzern Grau Cura. »Schmiergelder? Hast du da handfeste Beweise?«
»Das ist es ja«, räumte Greg ein und massierte sich mit beiden Händen die Nackenmuskulatur. »Die meisten Beweise verschwinden, genauso wie meine Informanten.«
»Informanten aus dem Konzern?«
Greg nickte. »Hast du schon einmal etwas von synthetischer Biologie gehört?«
»Du meinst, das künstliche Verändern von Organismen?«
»Oder von Erbgut, das man theoretisch auch zu neuen Organismen zusammenfügen kann. So weit ist die Wissenschaft im Grunde bereits. Aber es geht auch um DNA-Bausteine, die erbgutverändernd wirken können.« Er lehnte sich vor in Richtung Kamera. »Mir sind Unterlagen zugespielt worden, wonach bei Grau Cura systematisch DNA-Stränge eingesetzt werden, deren Auswirkungen auf den menschlichen Organismus überhaupt noch nicht erforscht, geschweige denn getestet worden sind.«
Marie blieb skeptisch. »Was für Unterlagen?«
»Rechnungen zumeist. Grau Cura hat über Jahre hinweg bei einem Biolabor in Regensburg künstlich hergestellte DNA-Sequenzen bestellt, die sich verschieden kombinieren lassen.«
»Das ist doch nicht verboten«, entgegnete Marie, während sie gleichzeitig den Wikipedia-Artikel weiterlas.
»Du kannst damit heilsame Medikamente herstellen oder aber tödliche Bio-Bomben. Und selbst wenn du nur das Ziel hast, Menschen zu heilen, niemand weiß, wie diese Sequenzen das Erbgut verändern. Die Konsequenzen für die menschliche Spezies sind auf Jahrzehnte nicht absehbar.«
Marie schüttelte den Kopf. »Das ist mir zu weit hergeholt. Rechnungen über bestellte DNA-Sequenzen, die man ganz legal herstellen kann, sind doch kein Beweis für unlautere Machenschaften. Ich lese hier, dass Grau Cura seit über fünf Jahrzehnten bahnbrechende Medikamente entwickelt hat, darunter äußerst erfolgreiche Präparate gegen Alzheimer, Impfstoffe gegen HIV und Gebärmutterhalskrebs sowie Antibiotika, gegen die der Körper keine Resistenzen aufbauen kann. Und jetzt gibt es offenbar ein Mittel gegen Krebs. Das ist doch fantastisch!«
»Marie …«
»Der Firmengründer«, fuhr sie fort, »Heinrich Grau, bekommt in ein paar Wochen den Nobelpreis für Medizin. Er wird geehrt für seine Forschungen auf dem Gebiet der Molekularbiologie. Mein Gott, ist der Typ alt!«
Marie klickte auf ein Bild, das sie im Internet gefunden hatte. Das Foto wurde vergrößert angezeigt. Ein altersgebeugter Greis mit dünnem, grauem Haar saß in einem Rollstuhl und hob müde lächelnd die Hand zum Gruß. Er hatte kleine Augen, untermalt von dicken Tränensäcken, und trug eine randlose Brille. Sein Gesicht war übersät mit Altersflecken. Hautlappen hingen ihm unter dem Kinn vom dürren Hals, der den Hemdkragen kaum auszufüllen vermochte.
»Heinrich Grau, Mediziner, Biologe, Genetiker. Er ist im April einhundert Jahre alt geworden und forscht immer noch. Wenn das mal nicht ein Beweis für die Wirksamkeit seiner eigenen Medikamente ist«, scherzte Marie.
Sie führte den Mauszeiger über einen Videolink, doch Gregs Stimme hielt sie ab.
»Das an sich ist schon ein Skandal! Die Sache stinkt zum Himmel!«, ereiferte sich der Blogger. »Dieser Heinrich Grau hat sein Unternehmen fest im Griff. Obwohl er die Firmenleitung längst abgegeben hat, hält er noch alle Fäden in der Hand. Er ist die ›graue Eminenz‹. Alle fürchten ihn.« Greg beugte sich abermals vor. »Der Mann geht über Leichen. Meine Quelle, ein Genetiker, der bei Grau Cura gearbeitet hat, ist spurlos verschwunden, nachdem er mir Informationen gegeben hat. Weg! Er ist einfach wie vom Erdboden verschluckt. Sie müssen ihm auf die Schliche gekommen sein. Und er ist nicht der Einzige!«
Marie musste lächeln über so viel verschwörungstheoretische Fantasie. »Es gibt ja sicher so etwas wie einen Werkschutz. Selbstverständlich werden Menschen, die Unternehmensgeheimnisse preisgeben, aus dem Konzern entfernt. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie um die Ecke gebracht werden.«
»Jedenfalls ist er für mich nicht mehr erreichbar. Was schade ist, denn der Mann hatte sich ernsthafte Sorgen gemacht um die Entwicklung bei Grau Cura. Er hatte angedeutet, die würden erbgutverändernde Substanzen bedenkenlos einsetzen und seien drauf und dran, erstmals in der Geschichte der Menschheit lebende, mehrzellige Organismen selbst herzustellen. Aus dem Nichts!«
»Aber Medikamente, die auf den Markt kommen, werden doch streng getestet«, wunderte sich Marie.
»Zumindest in der Theorie. Aber was geschieht, bis sie die Medikamente anmelden? Auf welche Weise sind diese Präparate und Substanzen überhaupt zustande gekommen? Und vor allem: Was kann man mit synthetisch hergestellten DNA-Strängen noch für Kombinationen herstellen?«
»Manchmal neigst du zu etwas abstrusen Thesen«, urteilte Marie.
Doch Greg ließ sich nicht bremsen. »Glaube mir, ich kenne die Pharmabranche wie meine Westentasche. In den Labors dieser Welt wird seit Jahrzehnten herumexperimentiert, etwa mit Polioviren oder mit dem Erreger der Spanischen Grippe von 1918 – alles Krankheiten, die eigentlich von der Erdoberfläche verschwunden sind. Diese Forscher höhlen harmlose Bakterien aus, versehen sie mit einer komplett neuen DNA, damit sie Wasserstoff oder Ethanol herstellen. Aber was noch? Wer weiß, um Himmels willen, was die da noch alles in ihren Kühlschränken haben?« Greg lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. »Mittlerweile ist die synthetische Biologie vermutlich so weit, dass sie ganze Organismen bauen kann. Gott hat Konkurrenz bekommen!«
Marie konnte angesichts dieses vorgebrachten Elans zunächst nichts erwidern. Schweigend betrachtete sie Greg, der in seinem Schreibtischstuhl lässig vor- und zurückwippte. Schließlich schüttelte sie erneut den Kopf. »Das ist mir alles zu weit hergeholt, Greg. Für eine Story ist das doch zu dünn. Ein Pharmakonzern mit einem tadellosen Ruf und Forschern, die den Krebs bekämpfen wollen, dessen Gründer den Nobelpreis für Medizin bekommt – ausgerechnet dieses Unternehmen soll heimlich Organismen bauen und Mitarbeiter verschwinden lassen, Ministerien und Behörden bestechen und unschuldige Menschen in Afrika für Versuchszwecke missbrauchen? Und du hast nur ein paar Rechnungen und mündliche Aussagen?«
»Oh, ich habe noch mehr Materialien«, warf Greg ein. »Aber es geht um doch etwas viel Größeres: Was machen die in ihren Labors, die so geschützt sind wie die Hochsicherheitstrakte der CIA in Langley? Wer kontrolliert sie? Der Mensch ist ein megalomanisches Wesen. Wenn er etwas bewundert wie die Evolution, dann will er seine Kräfte damit messen. Ich nenne das ›Armdrücken mit Gott‹.«
»Ich kann deine ethischen Bedenken gegen diese Art von Forschung ja verstehen«, gab Marie zu, »aber darauf kann ich keine Story aufbauen. Wenn du etwas Belastendes gegen Grau Cura hast, ich meine, etwas wirklich Belastendes, dann will ich die Unterlagen haben.«
»Wait a minute«, unterbrach Greg und lächelte, »noch ist das meine Story. Ich brauche noch etwas Zeit und ein paar Dokumente mehr. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay?«
»Na, wenn du meinst?«
»Marie, ich bin da einer ganz großen Sache auf der Spur. Du kannst auch aufmerksam mein Blog verfolgen, da schreibe ich auch immer wieder etwas dazu.«
»Bis du Ärger kriegst.«
Greg grinste breit und jungenhaft. »Das ist mein Lebenselexier!«
Auf Maries Bildschirm öffnete sich plötzlich ein Fenster mit einem Foto. Es zeigte Marie in ihrem Büro, wie sie vor dem Schreibtisch saß und an ihrem Stift nagte. Es war ein Screenshot, den Greg während ihres Videotelefonats angefertigt und ihr nun zugeschickt hatte.
»Wie gemein!«, rief sie aus. »Und dann auch noch so ein unvorteilhaftes Foto!«
Greg kam aus dem Grinsen nicht mehr heraus und winkte zum Abschied.
Rasch machte auch Marie noch ein Bildschirmfoto. »Na, warte!« Den Screenshot vom winkenden Greg schickte sie ihm sogleich zu.
»Mach’s gut, Greg!«, grüßte sie.
Greg sah das Foto noch kurz an und lachte. Dann kappte er die Verbindung. Das Bildschirmvideo erstarrte kurz, dann wurde es schwarz.
Marie lächelte noch einen Augenblick. Dann besann sie sich und schloss das Browserfenster. Dahinter tauchten wieder der Wikipedia-Eintrag über Grau Cura und der Link zu dem Video von Heinrich Grau auf. Marie klickte auf den Link.
Das Video eines Nachrichtensenders war vier Tage alt und zeigte Grau in seinem Rollstuhl an einem Konferenztisch, auf dem eine Reihe von Mikrofonen verschiedener Hörfunk- und Fernsehstationen stand. Blitzlichtgewitter durchzuckte den Raum und spiegelte sich in Graus Brille. Die Stimme des Nachrichtensprechers verkündete, dass Grau im Dezember in Stockholm den Nobelpreis für Medizin erhalten werde.
»Ich freue mich«, hub der Greis mit wackeliger Stimme an, »dass meine jahrzehntelange Forschungsarbeit zur Bekämpfung des Krebs nun auch die Anerkennung des Nobelkomitees erhält. Das ist die größte Ehre, die mir in meinem langen Leben zuteilgeworden ist.« Der alte Mann machte eine kurze Pause, ehe er fortfuhr: »Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt: ›Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren.‹« Grau nahm seine Brille ab. »Aber je mehr der Mensch forscht, desto mündiger wird er.« Mit Stolz schloss der Greis: »Und desto weniger muss er verehren.«
Das Video endete. Marie blickte nachdenklich auf den Bildschirm. Was hatte Greg gesagt? Der Mensch sei ein megalomanisches Wesen.
*
Bern.
Anatol legte den Kopf in den Nacken und blinzelte in den stahlblauen Himmel, den er gut zwei Stunden zuvor noch durchkreuzt hatte. An diesem kalten Herbsttag war die Berner Luft von einer nahezu diamantenen Reinheit. Laut Stadtplan in Anatols Hand stand er vor dem Bundeshaus, dem Sitz von Regierung und Parlament der Schweiz. Östlich des Gebäudes mit der Grünspankuppel lag die Nationalbank der Schweiz, westlich hatte die Berner Kantonalbank ihren Sitz. Dort wollte er hin. Anatol wandte sich nach Westen und blickte auf die graue Gebäudefassade. Die hohen Glasscheiben in den Rundbogen glänzten in der Sonne. Anatol drehte sich zurück zum Bundeshaus. Wie nahe doch Geld und Politik beieinander lagen, ging es ihm durch den Kopf.
Mit Herzklopfen ging Anatol über den Platz auf die Eingangstür der Kantonalbank zu. Er fasste an den Schließfachschlüssel, der nun um seinen Hals baumelte, als zöge er aus dem Schlüssel Kraft wie aus einem magischen Amulett. Er hatte den ersten Flug nach Bern gebucht und einen Großteil seiner Ersparnisse dafür ausgegeben. Die Reise durfte nicht umsonst gewesen sein!
Anatol wusste nicht, ob sich die Tresorräume im Hauptgebäude befanden. Doch vermutete er, an diesem Ort würde er noch am ehesten erfahren, was es mit dem Schlüssel seines Vaters auf sich hatte oder an wen er sich zu wenden habe. Das Gebäude jedenfalls schien alt genug zu sein, um in den Jahren vor 1945 bereits gestanden zu haben. Mit einem tiefen Seufzer schritt er hinein in die Halle.
Der Bankangestellte drehte und wendete den Schlüssel in seiner Hand hin und her. Dabei sah der hagere Mann über seine Nase hinweg immer wieder zu Anatol hinüber, als wäre der Schlüssel ein Passbild, das man mit dem Gesicht des Passinhabers vergleichen müsse. In seinem Anzug und mit seinem strengen Blick schien der Mann Anatol das personifizierte Schweizer Bankgeheimnis zu sein.
»Das ist sehr ungewöhnlich«, gab der Bankangestellte in einem Englisch mit schweizerischem Akzent von sich. »Solche Schlüssel werden schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt«, meinte er kopfschüttelnd. »Aber zweifelsohne, manche unserer Schließfächer verfügen noch über solche Schlösser.«
Anatol versuchte, sich ein Lächeln abzuringen.
Der dürre Mann tippte ein paar Zahlen auf der Rechnertastatur. Offensichtlich gab er die Schließfachnummer ein. »Dieses Schließfach ist seit fast siebzig Jahren nicht mehr besucht worden«, stellte er fest. »Zuletzt im Juli 1945. Aber die Gebühren dafür werden immer noch bezahlt. Anonym. Und es ist auch noch eine Schlüsselvollmacht hinterlegt worden.« Der Banker kam aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus. »Das ist alles sehr sehr ungewöhnlich!«
Abermals sah er zu Anatol hinüber und bat ihn schließlich um seinen Reisepass. Er entschuldigte sich kurz und ging mit dem Dokument in den Nachbarraum. Mehrmals, so schien es Anatol, ratterte ein Kopiergerät. Doch als der Bankangestellte, er trug laut Schildchen am Revers den Namen Buri, wieder in sein Büro kam, hatte er nur eine Kopie in der Hand.
»Der Vermerk im System ist eindeutig«, betonte er. »Wer den Schließfachschlüssel hat, darf das Fach öffnen. Wenn Sie mir hier noch unterzeichnen, dass Sie sich den Schlüssel nicht auf illegale Weise angeeignet haben, führe ich Sie zu unseren Tresorräumen.«
Anatol nickte und unterschrieb das Papier, das ihm Herr Buri über die Schreibtischplatte hinschob.
Der Mann nahm das Papier wieder entgegen, erhob sich und schloss den mittleren Knopf seines Jacketts. »Folgen Sie mir bitte!«
*
Berlin.
An diesem Morgen wirkte Varland zerstreut, als er sein Büro betrat, an seiner Sekretärin Frau Mokisch vorbeisauste und ihr einen Morgengruß zuwarf. Er war nicht nur in Gedanken versunken, er hatte auch einen ordentlichen Kater von Grotjahns Geburtstagsfeier am Abend zuvor. Nachdem er seinen Mantel aufgehängt hatte, durchsuchte er mit fahrigen Handbewegungen alle Taschen seines Anzugs, fand schließlich in der Gesäßtasche einen Notizzettel und hielt ihn Frau Mokisch hin.
»Könnten Sie mir diese Aktenbestände beim Bundesarchiv vormerken lassen und nach einem Termin anfragen? Ich würde die Akten gerne, wenn möglich, schon heute Nachmittag anschauen und denke, ich benötige zur Durchsicht zwei bis drei Stunden.«
Lydia Mokisch nahm den Zettel entgegen und nickte. Als Varland in sein Büro trat, rief sie ihm hinterher: »Wollen Sie Ihre Post gleich mitnehmen?«