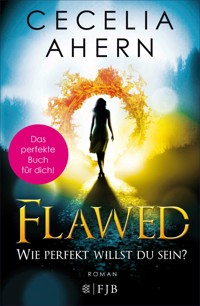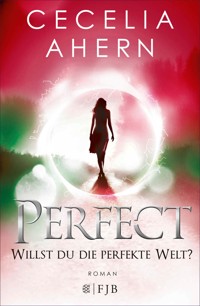9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Greif nach den Sternen. Einen davon wirst du bestimmt erwischen.« Das ergreifende Meisterwerk von Cecelia Ahern: ein tief bewegender Roman darüber, wozu wir da sind und was von uns bleibt. Die überraschende Fortsetzung des Weltbestsellers »P.S. Ich liebe Dich«, aber auch ganz unabhängig davon zu lesen. Vor sieben Jahren ist Holly Kennedys geliebter Mann Gerry viel zu jung an Krebs gestorben. Er hat ihr ein wunderbares Geschenk hinterlassen: eine Reihe von Briefen, die sie durch die Trauer begleitet haben. Holly ist stolz darauf, dass sie sich inzwischen ein neues Leben aufgebaut hat. Da wird sie von einer kleinen Gruppe von Menschen angesprochen, die alle unheilbar krank sind. Inspiriert von Gerrys Geschichte, möchten sie ihren Lieben ebenfalls Botschaften hinterlassen. Holly will nicht in die Vergangenheit zurückgezogen werden. Doch als sie beginnt, den Mitgliedern des »P.S. Ich liebe Dich«-Clubs zu helfen, wird klar: Jeder von uns kann seinen ganz eigenen Lebenssinn finden. Und die Liebe weitertragen. Wenn wir uns nur auf die Frage einlassen: Was will ich heute noch sagen und tun, falls ich morgen nicht mehr da bin? »Postscript« ist ein eigenständiger, tief berührender Roman über die essentiellen Lebensfragen: Wie können wir sinnvoll und glücklich leben, obwohl wir einmal sterben müssen? Was können wir unseren Liebsten mitgeben? Und was bleibt von uns? Ergreifend, humorvoll und inspirierend schreibt Cecelia Ahern über das Leben und den Tod; über Schmerz, Liebe und Glück; über das Hier und Jetzt und die Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cecelia Ahern
Postscript - Was ich dir noch sagen möchte
Roman
Über dieses Buch
»Greif nach den Sternen. Einen davon wirst du bestimmt erwischen.«
Die überraschende Fortsetzung des Millionen-Bestsellers »P.S. Ich liebe Dich«.
Vor sieben Jahren ist Holly Kennedys geliebter Mann Gerry viel zu jung an Krebs gestorben. Er hat ihr ein wunderbares Geschenk hinterlassen: eine Reihe von Briefen, die sie durch die Trauer begleitet haben. Holly ist stolz darauf, dass sie sich inzwischen ein neues Leben aufgebaut hat. Da wird sie von einer kleinen Gruppe von Menschen angesprochen, die alle unheilbar krank sind. Inspiriert von Gerrys Geschichte, möchten sie ihren Lieben ebenfalls Botschaften hinterlassen.
Holly will nicht in die Vergangenheit zurückgezogen werden. Doch als sie beginnt, den Mitgliedern des »P.S. Ich liebe Dich«-Clubs zu helfen, wird klar: Jeder von uns kann seinen ganz eigenen Lebenssinn finden. Und die Liebe weitertragen. Wenn wir uns nur auf die Frage einlassen: Was will ich heute noch sagen und tun, falls ich morgen nicht mehr da bin?
»Postscript« ist ein eigenständiger, tief berührender Roman über die essentiellen Lebensfragen: Wie können wir sinnvoll und glücklich leben, obwohl wir einmal sterben müssen? Was können wir unseren Liebsten mitgeben? Und was bleibt von uns?
Ergreifend, humorvoll und inspirierend schreibt Cecelia Ahern über das Leben und den Tod; über Schmerz, Liebe und Glück; über das Hier und Jetzt und die Zukunft.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
25 Millionen weltweit verkaufte Bücher und ein Ausnahmetalent: Was Cecelia Ahern als Schriftstellerin auszeichnet, ist ihre Phantasie, mit der sie den Alltag wunderbar macht und Geschichten erzählt, die Herzen berühren. Und sie ist vielseitig wie wenige andere: Cecelia Ahern schreibt Familiengeschichten genauso wie Liebesromane und Jugendbücher, sie verfasst Novellen, Storys, Drehbücher, Theaterstücke und TV-Konzepte. Ihre Werke erobern jedes Mal die Bestsellerlisten, viele davon wurden verfilmt, so zum Beispiel »P.S. Ich liebe Dich« mit Hilary Swank oder »Für immer vielleicht« mit Sam Claflin. Cecelia Ahern wurde 1981 geboren, hat Journalistik und Medienkommunikation studiert und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im Norden von Dublin.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Postscript« bei HarperCollins, London
© 2019 Cecelia Ahern
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung und -abbildung: nach einer Idee von Holly Macdonald @ HarperCollinsPublishers Ltd 2019 unter Verwendung einer Abbildung von Shutterstock
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491105-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für die Fans von
P.S. Ich liebe Dich
überall auf der Welt,
in großer Dankbarkeit
Prolog
Greif nach den Sternen,
einen davon wirst du bestimmt erwischen.
Dieser Satz steht auf dem Grabstein meines Mannes. Er hat ihn sehr oft benutzt, überhaupt setzte er auf seine typische, optimistisch-fröhliche Art gern positive Selbsthilfethesen in die Welt, als wären sie eine Form von Lebensenergie. Allerdings wirkte positive Verstärkung bei mir nie. Erst als Gerry tot war und aus dem Grab zu mir sprach, erreichten mich seine Worte, ich hörte, fühlte und glaubte sie tatsächlich.
Für mich lebte mein Mann noch ein ganzes Jahr nach seinem Tod weiter, denn er schickte mir einmal im Monat einen Überraschungsbrief. Sie waren alles, was ich noch hatte. Zwar konnte er nicht mehr mit mir sprechen, aber er schenkte mir seine Worte, niedergeschriebene Gedanken, entstanden in seinem Kopf, in seinem Gehirn, das einen lebendigen Körper mit einem lebendigen Herzen gesteuert hatte. Diese Briefe bedeuteten Leben, und ich griff nach ihnen, hielt sie fest, bis meine Knöchel weiß wurden und meine Nägel sich in meine Handflächen gruben. Ich klammerte mich an sie wie an einen Rettungsanker.
Heute ist der 1. April, es ist sieben Uhr abends, und ich genieße die Helligkeit. Die Abende werden länger, langsam, aber sicher vertreibt der sanfte Frühling den garstigen Biss der Winterkälte. Früher habe ich diese Jahreszeit gefürchtet. Mir war der Winter lieber, denn er bot mir unendliche Möglichkeiten, mich zu verkriechen. In der Dunkelheit hatte ich das Gefühl, hinter einem Schleier zu existieren, anwesend, aber nur schemenhaft, beinahe unsichtbar. Das war mir gerade recht. Ich zelebrierte die kurzen Tage, die langen Nächte, der dunkler werdende Himmel war mein Countdown zum Winterschlaf. Doch jetzt stelle ich mich dem Licht, ich brauche es, um nicht wieder in den Sog der Dunkelheit zu geraten.
Meine Metamorphose ähnelte dem Schock, den der Körper durchmacht, wenn er in kaltes Wasser getaucht wird. Bei der ersten Berührung verspürt man den überwältigenden Drang, laut kreischend wieder herauszuspringen, aber je länger man untergetaucht bleibt, desto mehr gewöhnt man sich daran. Wie die Dunkelheit, so wird auch die Kälte irgendwann zu einer tröstlichen Decke, die man nicht mehr missen möchte. Doch ich bin trotzdem wieder aufgetaucht. Strampelnd und rudernd habe ich mich durchs Wasser gekämpft, kam mit blauen Lippen und klappernden Zähnen an die Oberfläche, taute auf und trat wieder hinaus in die Welt.
Zwischen Tag und Nacht, zwischen Winter und Frühling, eine Zwischenwelt. Obwohl der Friedhof allgemein als Stätte der letzten Ruhe angesehen wird, ist es unter seiner Oberfläche weniger ruhig als darüber. Unter der Erde vollzieht die Natur an den menschlichen Körpern in ihren Särgen unablässig ihr Werk der Zersetzung, auch im Tod sind sie einem ständigen Wandel ausgesetzt.
Kinderlachen durchbricht die Stille, vielleicht in Unkenntnis der Zwischenwelt, auf der sie stehen, vielleicht von ihr unbeeinträchtigt. Die Trauernden sind stumm, doch ihr Schmerz ist es nicht. Die Wunde mag im Inneren sein, doch man hört sie, sieht sie, fühlt sie. Wie ein unsichtbarer Mantel umhüllt der Schmerz den Körper, seine Last beugt die Schultern, trübt die Augen, verlangsamt den Schritt.
Wenn mich in den Wochen und Monaten nach dem Tod meines Mannes wie ein unerträglicher Durst das Bedürfnis überfiel, mich wieder vollständig zu fühlen, versuchte ich verzweifelt, eine spirituelle Verbindung zu ihm herzustellen. Umgekehrt spürte ich an Tagen, an denen ich einigermaßen funktionierte, gerade dann, wenn sich seine Präsenz hinterrücks an mich heranschlich und mir auf die Schulter tippte, plötzlich eine unerträgliche Leere. Als wäre mein Herz verdorrt. Trauer lässt sich nicht beherrschen und nicht kontrollieren, niemals.
Gerry wollte verbrannt werden. Seine Asche befindet sich in einer Urne, die in einem Kolumbarium steht. Seine Eltern haben die Nische daneben für sich reserviert. Die leere Stelle neben der Urne meines Mannes ist für mich bestimmt. Ich habe das Gefühl, dem Tod ins Gesicht zu starren. Als er starb, hätte ich dieses Gefühl begrüßt – damals wäre mir alles recht gewesen, was mich wieder mit ihm vereint hätte. Am liebsten wäre ich in diese Nische gekrochen, hätte mich zusammengekauert wie eine Schlangenfrau und seine Asche mit meinem Körper umschlungen.
Er befindet sich in dieser Mauer. Aber er ist weder hier noch dort. Er ist fort. Energie, anderswo. Zersetzte Materie, irgendwo um mich herum. Wenn ich könnte, würde ich eine Armee anheuern, um Jagd auf jedes einzelne seiner Atome zu machen und ihn wieder zusammenzusetzen. Aber auch der König mit seinem Heer konnte ihn retten nimmermehr … wir lernen es von Anfang an, aber was es bedeutet, begreifen wir erst am Ende.
Wir beide genossen das Privileg, nicht nur einmal, sondern zweimal Abschied voneinander nehmen zu können. Auf die lange Krebskrankheit folgte nach dem Tod meines Mannes noch ein Jahr mit seinen Briefen. Er ist in dem Wissen von mir gegangen, dass ich mich nicht nur an Erinnerungen würde festhalten müssen. Er hatte eine Methode gefunden, wie er noch nach seinem Tod gemeinsame Erinnerungen für uns erschaffen konnte. Magie. Adieu, meine große Liebe, und noch einmal adieu. Es hätte genug sein müssen. Ich dachte, es wäre genug. Vielleicht kommen Menschen hauptsächlich deshalb auf den Friedhof, weil sie sich noch einmal verabschieden wollen. Vielleicht geht es um den Trost des Abschiednehmens, um das stille, friedliche, von allen Schuldgefühlen unbelastete Auseinandergehen. Nicht immer erinnern wir uns daran, wie wir uns begegnet sind, aber sehr oft wissen wir genau, wie wir voneinander Abschied genommen haben.
Es wundert mich, dass ich wieder hier bin, an diesem Ort, in dieser Verfassung. Sieben Jahre sind seit Gerrys Tod vergangen. Sechs, seit ich seinen letzten Brief gelesen habe. Ich habe mich weiterentwickelt, mich der Zukunft zugewandt, aber die Ereignisse der letzten Zeit haben an meinen Grundfesten gerüttelt, mich im Innersten erschüttert. Ich muss weitergehen, vorwärts, aber ich spüre einen hypnotischen Sog, fast so, als würde seine Hand nach mir greifen und mich zurückziehen.
Ich betrachte seinen Grabstein und lese den Satz noch einmal.
Greif nach den Sternen,
einen davon wirst du bestimmt erwischen.
So ist es dann wohl. Er und ich, wir haben nach den Sternen gegriffen. Und einen erwischt. Und was ich jetzt habe, alles, was ich jetzt bin, dieses ganze neue Leben, das ich mir in den letzten sieben Jahren aufgebaut habe, ohne Gerry – so sieht es vermutlich aus, wenn man einen Stern erwischt hat.
Kapitel 1
Drei Monate früher
«Die langmütige Penelope, Frau des Odysseus, des Königs von Ithaka. Eine ernste, fleißige Person, eine hingebungsvolle Ehefrau und Mutter. Zwar wird sie von Kritikern oft nur als Symbol ehelicher Treue abgetan, aber in Wirklichkeit ist Penelope eine hochkomplexe Frau, die ihre Geschichten ebenso gekonnt spinnt, wie sie ihre Stoffe webt.« Der Museumsführer macht eine Kunstpause und lässt den Blick suggestiv über die Zuhörer wandern, die ihm gespannt lauschen.
Gabriel und ich sehen uns im National Museum eine Ausstellung an. Wir haben uns, etwas entfernt von den anderen, ganz nach hinten gestellt, als würden wir nicht dazugehören. Allerdings wollten wir auch nicht riskieren, etwas zu verpassen. Dazu sind wir nicht cool genug. Ich höre dem Museumsführer zu, während Gabriel neben mir in der Broschüre blättert. Trotzdem wird er nachher garantiert den gesamten Vortrag Wort für Wort wiedergeben können. Er liebt dieses Thema. Ich liebe das Thema als solches nicht so sehr wie die Tatsache, dass er es liebt. Gabriel gehört zu den Menschen, die etwas mit ihrer Zeit anzufangen wissen, und als ich ihn kennengelernt habe, hat mich das mit am meisten zu ihm hingezogen. Denn ich habe eine Verabredung mit dem Schicksal. In maximal sechzig Jahren bin ich mit jemandem im Jenseits verabredet.
»Penelopes Ehemann Odysseus zieht in den Trojanischen Krieg, der erst zehn Jahre später zu Ende ist, und er braucht weitere zehn Jahre für den Rückweg nach Ithaka. Penelope ist in einer prekären Lage, denn sie kann sich vor Heiratsanträgen kaum retten – insgesamt halten angeblich hundertacht Männer um ihre Hand an. Zum Glück ist Penelope clever und hält die Freier hin, indem sie zwar jedem verspricht, sein Angebot in Betracht zu ziehen, aber keinem endgültig zusagt.«
Auf einmal fühle ich mich befangen. Gabriels Arm, den er locker um meine Schulter gelegt hat, fühlt sich viel zu schwer an.
»Penelopes Webstuhl, den wir hier sehen, ist ein Beispiel für die raffinierten Tricks der Königin. Penelope war dabei, das Totenhemd für ihren Schwiegervater Laertes zu weben, und behauptete, sie würde einen Ehemann erwählen, sobald sie mit diesem fertig sei. Tagsüber saß sie nun im Thronsaal an ihrem großen Webstuhl und arbeitete fleißig, aber nachts trennte sie heimlich alles, was sie am Tag produziert hatte, wieder auf. Das ging drei Jahre gut, danach musste sie sich andere Listen ausdenken, um die Bewerber hinters Licht zu führen, bis Odysseus, auf den sie so geduldig wartete, endlich zurückkam.«
Mir geht das irgendwie gegen den Strich. »Hat er denn auch auf sie gewartet?«, rufe ich.
»Wie bitte?«, fragt der Museumsführer und blickt suchend über die Menge, um die Eigentümerin der Stimme ausfindig zu machen. Die Gruppe teilt sich, alle wenden sich mir zu und starren mich an.
»Penelope ist der Inbegriff ehelicher Treue, aber wie steht es mit ihrem Ehemann? Hat er sich dort draußen im Krieg auch zwanzig Jahre lang für sie aufgespart?«
Gabriel kichert leise in sich hinein.
Der Museumsführer lächelt und erwähnt dann kurz neun Kinder, die Odysseus auf seiner langen Reise vom Trojanischen Krieg zurück nach Ithaka mit fünf anderen Frauen gezeugt hat.
»Damit ist meine Frage wohl mit einem Nein beantwortet«, sage ich leise zu Gabriel, während die Gruppe weiterzieht. »Ziemlich blöd von Penelope.«
»Aber die Frage war hervorragend«, erwidert er, und ich höre die Belustigung in seiner Stimme.
Nachdenklich wende ich mich erneut dem Gemälde von Penelope zu, Gabriel blättert wieder in der Broschüre.
Bin ich die langmütige Penelope? Trenne ich nachts wieder auf, was ich tagsüber gewebt habe, führe ich meinen gutaussehenden, treuen Liebhaber in die Irre, während ich darauf warte, endlich mit meinem Ehemann wiedervereint zu werden? Ich schaue zu Gabriel empor. Seine blauen Augen glitzern ausgelassen, anscheinend kann er meine Gedanken nicht lesen. Erstaunlicherweise lässt er sich von mir an der Nase herumführen.
»Sie hätte sich die lange Wartezeit doch damit vertreiben können, mit dem einen oder anderen Bewerber ins Bett zu gehen«, sagt er. »Eine echte Spaßbremse, unsere prüde Penelope.«
Ich lache und lege meinen Kopf an seine Brust. Er schlingt den Arm um mich, zieht mich an sich und küsst mich auf den Kopf. Gabriel ist solide gebaut, ich würde gern in seiner Umarmung wohnen. Groß, breit, kräftig, wie er ist, verbringt er seine Arbeitstage meist im Freien und klettert auf Bäume – er ist Baumchirurg beziehungsweise Baumpfleger, wenn man die von ihm bevorzugte Berufsbezeichnung benutzen möchte. Er ist Höhe gewohnt, liebt Wind und Regen und eigentlich alle Elemente. Er ist ein Abenteurer, ein Forscher, und wenn er sich gerade mal nicht oben auf einem Baum befindet, sitzt er darunter und steckt die Nase in ein Buch. Abends nach der Arbeit riecht er nach Wasserkresse.
Wir haben uns beim Chicken Wing Festival in Bray kennengelernt. Er stand neben mir an der Theke und hielt die Schlange hinter uns auf, indem er einen Cheeseburger bestellte. Er erwischte mich in einem guten Moment, sein Humor gefiel mir, er hatte sofort meine volle Aufmerksamkeit, und darauf hatte er es ja abgesehen. Vermutlich war das seine Art von Anmache.
Mein Kumpel möchte gern wissen, ob du mal mit ihm ausgehst.
Ich hätte gern einen Cheeseburger, bitte.
Für schlechte Anmachsprüche habe ich eine große Schwäche, aber ich habe einen guten Geschmack, was Männer angeht. Gute Männer, tolle Männer.
Ich ziehe Gabriel weg von der prüden Penelope, obwohl er eigentlich in die andere Richtung will. Aber ich habe genug von ihren Blicken, sie begafft mich schon die ganze Zeit, wahrscheinlich meint sie, dass sie in mir ihren Frauentyp wiedererkennt.
Aber das stimmt nicht. Ich bin nicht wie Penelope und will auch nicht sein wie sie. Ich werde mein Leben nicht für eine vage Zukunft in der Warteschleife verbringen.
»Gabriel?«
»Holly?« Er passt sich meinem ernsten Ton an.
»Was deinen Vorschlag betrifft.«
»Gegen die verfrühten Weihnachtsdekorationen zu demonstrieren? Wir haben sie gerade weggeräumt, garantiert erscheinen sie bald wieder.«
Er ist so groß, dass ich mich strecken und den Kopf in den Nacken legen muss, um ihm ins Gesicht sehen zu können. Seine Augen lächeln.
»Nein, ich meine den anderen Vorschlag. Den mit dem Zusammenziehen.«
»Aha.«
»Lass es uns probieren.«
Er reckt die Faust in die Luft und stößt einen dezenten Stadionmassenjubel aus.
»Unter der Bedingung, dass wir uns einen Fernseher anschaffen und dass du jeden Tag, wenn ich aufwache, so aussiehst wie jetzt.«
Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, um näher an sein Gesicht zu kommen, lege die Hände auf seine Wangen, fühle sein Lächeln unter dem Balbo-Bart, den er sich zurzeit wachsen lässt und wie ein Profi trimmt und pflegt – der Baum-Mann, der sein eigenes Gesicht veredelt.
»Das ist die Grundvoraussetzung dafür, meine Mitbewohnerin zu sein.«
»Mitdirschläferin«, sage ich, und wir kichern beide etwas kindisch.
»Warst du schon immer so romantisch?«, fragt er und nimmt mich in die Arme.
Früher war ich romantisch. Überhaupt war ich ganz anders. Naiv vielleicht. Als ich Gabriels Umarmung erwidere und den Kopf an seine Brust lege, bemerke ich wieder Penelopes kritischen Blick. Doch ich recke hochmütig das Kinn. Soll sie doch glauben, sie würde mich durchschauen. Es stimmt trotzdem nicht.
Kapitel 2
«Bist du bereit?«, fragt meine Schwester Ciara mich leise, als wir unter dem Gemurmel des erwartungsvollen Publikums unsere Plätze ganz vorn im Laden einnehmen. Wir sitzen auf Sitzsäcken im Schaufenster von Ciaras Vintage- und Secondhandshop namens Magpie, in dem ich seit drei Jahren ebenfalls arbeite. Wieder einmal haben wir den Laden in eine Eventlocation verwandelt, wo ihr Podcast »Wie sprechen wir über …?« vor Publikum aufgenommen wird. Doch heute Abend stehe ich nicht an meinem üblichen sicheren Platz hinter dem Wein- und Cupcake-Tresen. Seit Monaten hat mich meine Schwester bestürmt, bis ich mich ihrem Wunsch gebeugt habe, als Gast in der Folge mit dem Titel »Wie können wir über den Tod sprechen?« mitzumachen. Die Zusage war noch nicht ganz aus meinem Mund, als ich sie schon bereute, und jetzt, wo ich vor unserer kleinen Zuhörerschaft sitze, hat meine Reue astronomische Ausmaße angenommen.
Wir haben alle Ständer und Auslagen mit Klamotten und Accessoires an die Wand geschoben, und jetzt füllen fünf Reihen mit jeweils sechs Klappstühlen die Ladenfläche. Damit Ciara und ich etwas erhöht sitzen, haben wir das Schaufenster leergeräumt, und die Leute, die draußen von der Arbeit nach Hause eilen, mustern im Vorübergehen neugierig die beiden lebendigen Schaufensterpuppen auf ihren Sitzsäcken.
»Danke, dass du das für mich tust«, sagt Ciara leise und drückt meine feuchtkalte Hand.
Ich lächle schwach und versuche abzuschätzen, wie schlimm es wäre, einfach aufzustehen und davonzulaufen. Ich komme zu dem Schluss, dass es sich nicht lohnt zu kneifen. Schließlich war es meine Entscheidung, und ich muss zu ihr stehen.
Ciara streift die Schuhe ab und zieht die nackten Füße unter sich auf den Sitzsack. An diesem Ort fühlt sie sich wie zu Hause. Ich räuspere mich, und das Geräusch verbreitet sich durch die Lautsprecher im ganzen Laden. Dreißig erwartungsvolle, neugierige Gesichter starren mich an. Ich drücke meine schwitzigen Hände aneinander und schaue auf die Notizen, die ich akribisch wie eine fleißige Studentin zusammengetragen habe, seit Ciara mich zu diesem Auftritt genötigt hat. Gedankenfragmente, hastig aufs Papier gekritzelt, wenn die Inspiration mich überkam, die mir im Moment vollkommen sinnlos erscheinen. Ich sehe weder, wo ein Satz anfängt, noch, wo er aufhört.
In der vordersten Reihe sitzt Mum, ein paar Plätze weiter meine Freundin Sharon, direkt am Gang, wo sie einigermaßen Platz für ihren Doppelbuggy hat. Unter der Decke lugt ein Paar winziger Kinderfüße hervor, an denen sich mit letzter Kraft eine Socke festklammert, während die andere den Kampf bereits aufgegeben hat. Auf dem Schoß hält Sharon ihr sechs Monate altes Baby, neben ihr sitzt ihr sechsjähriger Sohn Gerard, die Augen gebannt auf sein iPad gerichtet, die Ohren unter Kopfhörern verborgen, während sein vierjähriger Bruder demonstrativ seine Langeweile auslebt und auf seinem Stuhl so weit nach unten gerutscht ist, dass er praktisch auf der Sitzfläche liegt. Vier Jungs in sechs Jahren – ich bin sehr dankbar, dass Sharon gekommen ist. Jeden Morgen steht sie in aller Herrgottsfrühe auf, und ich weiß, wie lange es dauert, mit vier Kindern das Haus zu verlassen, und wie nervig es ist, wenn man dreimal zurückrennen muss, weil man etwas vergessen hat. Trotzdem ist sie heute hier, meine kampferprobte Freundin, und lächelt mir ermutigend zu. Am Rande der Erschöpfung und trotzdem für mich da.
»Willkommen, liebe Gäste, ich begrüße euch alle zur vierten Folge des Magpie-Podcasts«, beginnt Ciara. »Einige von euch sind ja inzwischen Stammgäste hier – danke, Betty, dass du uns immer so nett mit deinen leckeren Cupcakes versorgst, und danke, Christian, für den Käse und den Wein.«
Ich blicke über die Gäste und suche Gabriel, aber ich bin eigentlich sicher, dass er nicht da ist. Schließlich habe ich ihm ausdrücklich verboten zu kommen – obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Als Mensch, der seine Intimsphäre lieber für sich hat und seine Gefühle unter Kontrolle hält, war es ihm unbegreiflich, dass ich bereit bin, mein Privatleben vor wildfremden Menschen auszubreiten. Natürlich haben wir lange darüber debattiert, aber in diesem Moment bin ich mehr denn je seiner Meinung.
»Ich bin Ciara Kennedy, die Eigentümerin von Magpie, und habe vor kurzem beschlossen, dass es eine gute Idee wäre, eine Reihe von Podcasts zum Thema ›Wie sprechen wir über …‹ zu machen, und dabei die Wohlfahrtsorganisationen vorzustellen, die prozentual an den Erlösen dieses Ladens beteiligt sind. Heute werden wir über den Tod reden, vor allem über Trauer und Verlust. Zu Gast bei uns ist Claire Byrne von Bereave Ireland. Außerdem begrüße ich einige der Menschen, denen die wunderbare Arbeit dieser Trauerhilfeorganisation zugutekommt. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und die großzügigen Spenden gehen direkt an Bereave. Später werde ich mit Claire über ihre unermüdliche und so wichtige Arbeit sprechen, bei der sie diejenigen unterstützt, die einen geliebten Menschen verloren haben. Aber zuerst möchte ich euch meinen speziellen Gast vorstellen, nämlich Holly Kennedy, die zufällig meine Schwester ist. Endlich bist du hier!«, ruft Ciara, und das Publikum applaudiert.
»Stimmt.« Ich lache nervös.
»Schon seit dem ersten Podcast letztes Jahr liege ich meiner Schwester in den Ohren, sie soll mitmachen, und ich bin sehr froh, dass sie sich dazu durchgerungen hat. Danke, Holly.« Sie greift nach meiner Hand und hält sie fest. »Deine Geschichte hat mein Leben zutiefst berührt, und ich bin sicher, dass sehr viele Menschen davon profitieren werden, wenn sie von der Reise hören, die du hinter dir hast.«
»Danke, ich hoffe es.«
Ich merke, dass die Notizen in meiner Hand zittern, und lasse Ciara los, um die Hand besser stillzuhalten.
»Wie können wir über den Tod sprechen? Das Thema ist alles andere als einfach. Über unser Leben zu reden, darüber, wie wir leben, wie wir besser leben können, fällt uns nicht schwer, aber oft ist es uns unangenehm, ja beinahe peinlich, über den Tod zu sprechen. Deshalb lassen wir meist lieber die Finger davon. Doch ich kenne niemanden, mit dem ich dieses Gespräch über die Trauer lieber führen würde. Holly, bitte erzähle uns doch von deiner Begegnung mit dem Tod.«
Ich räuspere mich und beginne: »Vor sieben Jahren habe ich Gerry, meinen Mann, durch eine Krebserkrankung verloren. Er hatte einen Hirntumor und ist mit dreißig Jahren gestorben.«
Ganz gleich, wie oft ich darüber spreche, ich habe immer einen Kloß im Hals. Dieser Teil der Geschichte ist noch immer real, er brennt in mir, hell und heiß. Hilfesuchend schaue ich zu Sharon, die dramatisch die Augen verdreht und gähnt. Ich grinse. Ja, ich schaffe das.
»Wir sind hier, um über Trauer zu sprechen, aber was soll ich euch darüber erzählen? Ich bin nichts Besonderes, der Tod betrifft uns alle, und viele von denen, die heute hier sind, wissen aus eigener Erfahrung, wie komplex Trauer ist. Wir können sie nicht kontrollieren, im Gegenteil. Meistens fühlt es sich an, als habe sie uns fest im Griff. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist die Art, wie wir mit ihr umgehen.«
»Du meinst, du bist nichts Besonderes«, sagt Ciara, »aber die persönliche Erfahrung jedes Einzelnen ist doch etwas Besonderes, und wir können viel voneinander lernen. Für den Schweregrad eines Verlusts gibt es natürlich keine Rangfolge, aber kannst du dir vorstellen, dass du den Verlust vielleicht stärker erlebt hast, weil Gerry und du zusammen aufgewachsen seid? Schon seit ich klein war, gab es Holly nicht ohne Gerry und Gerry nicht ohne Holly.«
Ich nicke und erzähle, wie Gerry und ich uns kennengelernt haben. Um es mir leichter zu machen, sehe ich nicht ins Publikum, sondern tue so, als würde ich mit mir selbst sprechen, genau so, wie ich es zu Hause unter der Dusche einstudiert habe. »Wir sind uns in der Schule begegnet, als ich vierzehn war. Von da an war ich immer Gerry und Holly. Gerrys Freundin. Gerrys Frau. Wir sind zusammen aufgewachsen, wir haben voneinander gelernt. Mit neunundzwanzig Jahren habe ich ihn verloren und wurde Gerrys Witwe. Und ich habe nicht nur ihn und auch nicht nur einen Teil meiner selbst verloren, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich mich verloren hatte. Ich wusste gar nicht, wer ich war. Ich musste mich komplett neu aufbauen.«
An einigen Stellen wird genickt. Die meisten Leute wissen Bescheid, und diejenigen, die es noch nicht wissen, werden es bald erfahren.
»Kack-a«, sagt eine Stimme aus dem Buggy und kichert. Sharon bringt ihr Krabbelkind zum Schweigen, greift in ihre riesige Tasche und holt eine Reiswaffel mit Erdbeerjoghurt-Glasur heraus. Die Waffel verschwindet im Buggy. Das Kichern verstummt.
»Wie hast du es geschafft, dich wieder aufzubauen?«
Weil es mir seltsam vorkommt, Ciara etwas zu erzählen, das sie mit mir durchlebt hat, wende ich mich dem Publikum zu und konzentriere mich auf diejenigen, die nicht dabei waren. Als ich in die Gesichter blicke, legt sich in meinem Inneren ein Schalter um. Hier geht es nicht um mich. Gerry hat etwas Besonderes getan, und das werde ich diesen wissbegierigen Menschen um seinetwillen erklären. »Vor allem hat Gerry mir dabei geholfen. Bevor er gestorben ist, hat er heimlich einen Plan ausgeheckt.«
»Trommelwirbel, Tusch, tadadaa!«, ruft Ciara und erntet lautes Gelächter. Auch ich grinse und schaue wieder in die erwartungsvollen Gesichter.
Ich werde immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn ich davon erzähle, denn es ist jedes Mal eine Erinnerung daran, wie einzigartig das Jahr nach Gerrys Tod war, auch wenn die Bedeutsamkeit im Lauf der Zeit in meinem Gedächtnis etwas verblasst ist. »Er hat mir zehn Briefe hinterlassen, die ich in den Monaten nach seinem Tod öffnen sollte, und jeder davon war unterschrieben mit ›P. S. Ich liebe Dich‹.«
Die Zuhörer sind sichtlich bewegt, schauen einander an, fangen an, miteinander zu flüstern – das gespannte Schweigen ist gebrochen. Sharons Baby fängt an zu weinen. Sie versucht es zu beruhigen, wiegt es im Arm, klopft leise auf seinen Schnuller, einen fernen Ausdruck in den Augen.
Ciara spricht etwas lauter, um das Babygeschrei zu übertönen. »Als ich dich gebeten habe, bei diesem Podcast mitzumachen, Holly, da hast du sehr deutlich gemacht, dass du dich nicht auf Gerrys Krankheit konzentrieren, sondern über das Geschenk reden möchtest, das er dir gemacht hat.«
Ich nicke nachdrücklich. »Richtig. Ich möchte heute nicht über Krebs reden, nicht über die Qualen, die Gerry durchmachen musste. Wenn ihr meinen Rat hören mögt – versucht, euch nicht so auf die Dunkelheit zu fixieren. Davon gibt es mehr als genug. Ich möchte lieber über die Hoffnung sprechen.«
Ciara sieht mich an, und ihre Augen leuchten stolz. Mum presst die Hände ineinander.
»Ich habe mich irgendwann entschieden, den Fokus darauf zu richten, was Gerry mir geschenkt hat. Dadurch, dass ich ihn verloren habe, habe ich mich selbst gefunden. Ich fühle mich nicht minderwertig, und ich schäme mich auch nicht zuzugeben, dass ich nach Gerrys Tod zusammengebrochen bin. Aber seine Briefe haben mir geholfen, mich selbst wiederzufinden. Um einen Teil von mir selbst zu entdecken, den ich bisher nicht kannte, musste ich ihn erst verlieren.« Inzwischen bin ich richtig in Fahrt, ich will sagen, was ich zu sagen habe. Diese Menschen hier müssen es erfahren. Wenn ich vor sieben Jahren im Publikum gesessen hätte, hätte ich es auch gebraucht. »Zu meiner großen Überraschung fand ich eine Stärke in mir, die ich vorher nie erwartet hätte. Sicher, ich fand sie an einem dunklen, einsamen Ort. Aber ich habe sie gefunden – leider finden wir die meisten Schätze unseres Lebens ja an genau solchen Stellen. Wenn wir lange genug in Schmutz und Dunkelheit gewühlt und gegraben haben, stoßen wir endlich auf etwas Handfestes. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Tiefpunkt tatsächlich auch ein Sprungbrett sein kann.«
Angeführt von Ciara applaudiert das Publikum begeistert.
Inzwischen nörgelt Sharons Baby nicht mehr, sondern brüllt, ein ohrenbetäubendes, hohes, schrilles Kreischen. Das Krabbelkind wirft seine Reiswaffel nach ihm. Sharon steht auf, schaut entschuldigend in unsere Richtung, nimmt das Baby auf den Arm, lässt die beiden älteren Jungen in der Obhut meiner Mutter zurück und versucht, mit der freien Hand den Zweierbuggy durch den Gang zur Tür zu bugsieren. Dabei kracht sie jedoch gegen einen Stuhl, mäht in den Gang ragende Taschen nieder, und die Räder des Buggys verfangen sich in Trageriemen und Henkeln. Verzweifelt rangiert sie zurück und steuert den Buggy hektisch und Entschuldigungen murmelnd weiter zum Ausgang.
Ciara wartet mit der nächsten Frage, bis Sharon draußen ist.
Doch bei dem Versuch, die Tür zu öffnen, rammt Sharon den Buggy dagegen. Ciaras Mann Mathew eilt ihr zu Hilfe und will ihr die Tür aufhalten, aber der Doppelbuggy ist zu breit, und in ihrer Panik knallt Sharon mehrmals gegen den Türrahmen. Das Baby kreischt wie am Spieß, der Buggy malträtiert den Türrahmen, bis Mathew endlich dem Ganzen ein Ende bereitet und den Riegel unten an der Tür löst. Mit gequältem Gesicht schaut Sharon zu uns herüber, aber als ich ihr Augenrollen und Gähnen von vorhin imitiere, lächelt sie dankbar und ergreift dann die Flucht.
»Diesen Teil können wir später rausschneiden«, scherzt Ciara. »Holly, kannst du uns sagen, ob du Gerrys Anwesenheit außer durch die Briefe, die er dir hinterlassen hat, auch noch an anderen Punkten gespürt hast?«
»Du meinst, ob ich seinen Geist gesehen habe?«
Ein paar Gäste kichern, andere warten vermutlich gespannt auf ein Ja.
»Seine Energie«, erklärt Ciara. »Wie immer man es nennen möchte.«
Ich denke einen Moment nach und beschwöre das Gefühl in mir herauf. »Seltsamerweise hat der Tod tatsächlich eine körperliche Präsenz. Manchmal fühlt es sich an, als wäre der Verstorbene im Zimmer. Die Lücke, die ein geliebter Mensch hinterlässt, seine Abwesenheit, ist zweifellos sichtbar. Es gab Augenblicke, in denen Gerry mir lebendiger erschien als die Menschen um mich herum.« Ich rufe mir die einsamen Tage und Nächte in Erinnerung, in denen ich zwischen Realität und innerer Wahrnehmung gefangen war. »Erinnerungen können übermächtig sein. Manchmal sind sie eine wunderbare Fluchtmöglichkeit, ein schöner, tröstlicher Ort. Die Erinnerungen an Gerry haben ihn zu mir zurückgebracht. Aber man sollte vorsichtig sein – manchmal werden sie auch zu einem Gefängnis. Ich bin dankbar, dass Gerry mir die Briefe hinterlassen hat, denn er hat mich aus all diesen schwarzen Löchern herausgeholt und wurde wieder lebendig. Dadurch konnten wir gemeinsam neue Erinnerungen erschaffen.«
»Und jetzt? Sieben Jahre später? Ist Gerry immer noch bei dir?«
Wie ein hypnotisiertes Kaninchen im Scheinwerferlicht starre ich meine Schwester an. Ich habe den Boden unter den Füßen verloren und kann die Frage nicht beantworten. Ist Gerry noch bei mir?
»Ich bin sicher, dass Gerry immer ein Teil von dir bleiben wird«, sagt Ciara schließlich leise. »Er wird immer bei dir sein«, fügt sie hinzu, als ahne sie meine Unsicherheit, als müsste sie mir etwas in Erinnerung rufen, das ich vergessen habe.
Asche zu Asche, Staub zu Staub. Zerfallene, verstreute Partikel umgeben mich.
»Absolut«, antworte ich mit einem gezwungenen Lächeln. »Gerry wird immer bei mir sein.«
Der Körper stirbt, die Seele, der Geist bleibt zurück. Im Jahr nach Gerrys Tod gab es Tage, an denen ich seine Energie in mir spürte. Sie baute mich auf, stärkte mich, verwandelte mich in eine Festung. Ich war zu allem fähig. Ich war unberührbar.
An anderen Tagen spürte ich seine Energie und löste mich in eine Million Einzelteile auf. Es war die Erinnerung an das, was ich verloren hatte. Ich kann nicht. Ich will nicht. Das Universum hat mir den wichtigsten Teil meines Lebens geraubt, vielleicht wird es mir bald auch noch den Rest entreißen. Und mir wird klar, wie kostbar all diese Tage waren, denn jetzt, sieben Jahre später, habe ich überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass Gerry bei mir ist.
Versunken in die Lüge, die ich soeben ausgesprochen habe, frage ich mich, ob meine Behauptung ebenso leer geklungen hat, wie sie sich anfühlte. Zum Glück bin ich fast fertig. Ciara lädt das Publikum ein, Fragen zu stellen, und ich entspanne mich ein bisschen, weil ich weiß, dass das Ende in Sicht ist.
Die erste Frage kommt von einer Frau in der dritten Reihe, fünfter Platz vom Gang, zerknülltes, zusammengerolltes Taschentuch in der Hand, verschmierte Mascara um die Augen.
»Hi, Holly, ich bin Joanna. Mein Mann ist vor ein paar Monaten gestorben, und ich wünsche mir so, er hätte mir auch solche Briefe hinterlassen. Können Sie uns erzählen, was in seinem letzten Brief stand?«
»Mich würde interessieren, was in allen zehn drinstand«, ruft jemand anderes, und es gibt zustimmendes Gemurmel.
»Wir haben genug Zeit, über alle zehn zu sprechen, wenn Holly dazu bereit ist«, sagt Ciara und sieht mich fragend an.
Ich hole tief Luft und atme langsam aus. Über den Inhalt der Briefe habe ich schon lange nicht mehr nachgedacht. Als Idee, als Gesamtkonzept schon, aber nie im Einzelnen, der Reihe nach, präzise. Wo soll ich anfangen? Bei der neuen Nachttischlampe, dem neuen Outfit, dem Karaokeabend, den Sonnenblumenkernen, der Geburtstagsreise mit meinen Freundinnen …? Wie sollen diese Leute einschätzen können, wie wichtig diese scheinbar unwichtigen Dinge für mich waren? Aber der letzte Brief …
Ich lächle. Der letzte ist leicht. »In Gerrys letztem Brief stand: ›Hab keine Angst davor, dich wieder zu verlieben.‹«
Ein wunderschönes Beispiel, damit können alle etwas anfangen. Ein gutes und mutiges Ende von Gerrys Seite. Doch Joanna ist nicht so gerührt wie die anderen. Ich sehe Enttäuschung und Verwirrung in ihren Augen. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Sie steckt noch tief in der Trauerphase, sie will das jetzt nicht hören. Sie hält ihren Mann noch fest, warum sollte sie darüber nachdenken, ihn loszulassen?
Ich weiß ganz genau, was sie denkt. Es ist völlig ausgeschlossen, jemals wieder jemanden zu lieben. Jedenfalls nicht so.
Kapitel 3
Als der Laden sich langsam leert, taucht Sharon wieder auf, immer noch ziemlich aus der Fassung. Das Baby ist im Wagen eingeschlafen, Alex, der Zweitkleinste, klammert sich mit hochroten Wangen an ihre Hand.
»Hallo, Großer«, sage ich und beuge mich zu ihm hinunter.
Er ignoriert mich.
»Sag hallo zu Holly«, ermahnt Sharon ihn sanft.
Er ignoriert auch sie.
»Alex, sag gefälligst hallo zu Holly«, fährt sie ihn an, und ihre Stimme klingt auf einmal so fuchsteufelswild, dass sowohl Alex als auch ich erschrocken zusammenzucken.
»Hallo«, sagt er.
»Guter Junge«, lobt ihn seine Mutter und klingt wieder lieb und nett.
Ich starre sie mit großen Augen an – über die unheimliche zweite Persönlichkeit, die gelegentlich aus ihr hervorbricht, seit sie Mutter geworden ist, kann ich immer wieder nur staunen.
»Es ist mir so peinlich«, sagt sie leise. »Es tut mir echt leid, ich stifte nur Chaos.«
»Es muss dir nicht leidtun. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Und du bist toll. Schließlich sagst du selbst immer, dass das erste Jahr das schwerste ist. Es dauert doch nur noch ein paar Monate, dann feiert dieser kleine Mann hier schon seinen ersten Geburtstag. Du hast es fast geschafft.«
»Aber das Nächste ist schon unterwegs.«
»Was?«
Mit tränenfeuchten Augen sieht sie mich an. »Ja, ich bin schon wieder schwanger. Ich weiß, ich bin ein Idiot.«
Sie richtet sich auf und versucht, Stärke zu zeigen, obwohl sie fix und fertig aussieht. Erledigt, am Ende. Bei jeder von Sharons Schwangerschaften steigt mein Mitgefühl, während die Feierstimmung deutlich abnimmt.
Wir umarmen uns und sagen wie aus einem Munde: »Erzähl bloß Denise nichts davon.«
Ich beobachte Sharons Aufbruch mit ihren vier Jungs und gerate schon beim Zusehen in Stress. Außerdem bin ich selbst erschöpft nach der Anspannung des Tages, was noch dadurch verstärkt wird, dass ich die letzte Nacht nicht viel geschlafen habe. Und gerade habe ich eine ganze Stunde lang ausführlich über sehr persönliche Erfahrungen gesprochen. Jetzt bin ich völlig erledigt, aber Ciara und ich müssen warten, bis alle weg sind, und den Laden dann wieder in Normalzustand bringen und abschließen.
»Das war absolut wundervoll«, unterbricht Angela Carberry meine Gedanken. Angela ist eine große Unterstützerin des Ladens und spendet regelmäßig ihre Designerklamotten samt Taschen und Schmuck. Sie ist einer der Hauptgründe, dass Ciara Magpie überhaupt am Laufen halten kann. Im Spaß sagt meine Schwester oft, dass Angela ihre schicken Sachen vermutlich nur kauft, um sie uns zu spenden. Wie immer sieht sie sehr elegant aus mit ihrem rabenschwarzen Bob, ihrer zierlichen Figur und der Perlenkette über der großen Schleife ihres Seidenkleids.
»Angela, wie nett, dass Sie gekommen sind«, begrüße ich sie, und sie nimmt mich zu meiner Überraschung in den Arm.
Über ihre Schulter hinweg sehe ich, dass auch Ciara große Augen macht, als sie diesen für die sonst so nüchterne Angela höchst ungewöhnlichen Gefühlsausbruch beobachtet. Sie drückt mich so fest an sich, dass ich ihren knochigen Körper an meinem spüre. Sonst ist sie überhaupt kein impulsiver Typ und meidet Körperkontakt eher, als dass sie ihn sucht. Wenn sie uns die Kisten mit ihren Klamotten in den Laden bringt – die Schuhe immer in Originalkartons, die Taschen in ihren ursprünglichen Schutzhüllen – wirkt sie eher zugeknöpft. Für jedes Stück erklärt sie uns ganz genau, wo wir es ausstellen und welchen Preis wir dafür verlangen sollen, obwohl sie nie auch nur einen Cent vom Erlös haben will.
Als sie mich endlich wieder loslässt, sind ihre Augen feucht. »Sie sollten so etwas öfter machen. Die Menschen sollten Ihre Geschichte hören.«
»O nein«, lache ich. »Das war eine einmalige Sache, und ich habe in erster Linie deshalb mitgemacht, weil ich meine Schwester zum Schweigen bringen wollte.«
»Haben Sie es denn nicht gemerkt?«, fragt Angela überrascht.
»Was meinen Sie?«
»Was für eine Kraft in Ihrer Geschichte steckt. Wie das Publikum reagiert hat, wie tief Sie das Herz jedes Einzelnen in diesem Raum berührt haben.«
Verlegen schaue ich auf die Menschenschlange, die sich hinter ihr gebildet hat. Alle diese Leute wollen mit mir sprechen.
Angela packt mich am Arm und drückt ihn für meinen Geschmack viel zu heftig. »Sie müssen Ihre Geschichte unbedingt öfter erzählen.«
»Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Ermutigung, Angela, aber ich habe das alles nur einmal erlebt, deshalb möchte ich es auch nicht öfter als einmal erzählen. Jetzt bin ich fertig damit.« Meine Worte sind nicht barsch, aber ich höre in ihnen eine Härte, die ich selbst nicht erwartet habe. Als hätte sich blitzschnell ein stachliger Schutzpanzer um mich herum gebildet. Angela lockert ihren Griff, als hätte sie sich an meinen Stacheln gestochen. Sie scheint sich zu erinnern, wo sie ist, und dass auch andere Leute mit mir reden wollen, und lässt mich widerwillig los.
Als ihre Hand weg ist, verschwinden auch meine Stacheln, aber etwas von ihrem Kneifzangengriff bleibt zurück, eine Art unsichtbarer blauer Fleck.
Später krieche ich zu Gabriel ins Bett. Das Zimmer dreht sich, weil ich mit Ciara und Mum noch viel zu lange in Ciaras Wohnung über dem Laden gesessen und zu viel Wein getrunken habe.
Gabriel dreht sich zu mir und schlägt die Augen auf. Er schaut mich einen Moment prüfend an und grinst dann über meinen Zustand.
»War es ein guter Abend?«
»Sollte ich je auf die Idee kommen, so was noch mal zu machen, dann hindere mich bitte daran«, murmle ich, während ich die Augen schließe und das Karussell in meinem Kopf zu ignorieren versuche.
»Mach ich. Aber jetzt hast du es überstanden, bist die Schwester des Jahres und kriegst vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung.«
Ich schnaube nur verächtlich.
»Jedenfalls hast du es hinter dir.« Er schmiegt sich an mich und küsst mich.
Kapitel 4
«Holly«, brüllt Ciara zum wiederholten Mal. Ihr Ton hat sich von geduldig zu besorgt und schließlich zu purem, schrillem Ärger entwickelt. »Wo zur Hölle steckst du?«
Ich bin im Lager, habe mich hinter den Kisten zusammengekauert, vielleicht auch ein paar Klamotten darüber gebreitet und mir eine Art Höhle gebaut. Vielleicht verstecke ich mich.
Als ich aufblicke, sehe ich Ciara zu mir hereinspähen.
»Was soll denn der Unsinn? Versteckst du dich etwa?«
»Nein. Sei nicht albern.«
Sie wirft mir einen Blick zu, dem ich entnehme, dass sie mir nicht glaubt. »Ich rufe schon die ganze Zeit nach dir. Angela Carberry hat nach dir gefragt, sie wollte dich unbedingt sprechen, und ich habe ihr gesagt, du machst nur kurz Kaffeepause. Eine Viertelstunde hat sie auf dich gewartet, du weißt ja, wie sie ist. Was soll das, Holly? Jetzt stehe ich da, als wüsste ich nicht, wo meine Angestellten sich herumtreiben. Was leider der Wahrheit entspricht.«
»Oh. Na ja, jetzt weißt du es ja. Tut mir leid, dass ich sie verpasst habe.« Seit dem Podcast ist ein Monat vergangen, und Angela Carberry bequatscht mich ständig, meine Geschichte noch öfter zu erzählen. Meiner Meinung nach grenzt das schon an Stalking. Ich stehe auf und strecke ächzend die Beine.
»Was geht denn da ab zwischen dir und Angela?«, fragt Ciara besorgt. »Hat es etwas mit dem Laden zu tun?«
»Nein, überhaupt nicht. Mit dem Shop hat es gar nichts zu tun, keine Sorge. Hat sie nicht grade erst einen ganzen Sack mit Klamotten gebracht?«
»Vintage Chanel«, antwortet Ciara und entspannt sich etwas. Aber dann kehrt die Verwirrung zurück. »Aber was ist dann los? Warum versteckst du dich vor ihr? Glaub ja nicht, ich hätte es nicht bemerkt – als sie letzte Woche vorbeigekommen ist, bist du auch verschwunden.«
»Du kannst viel besser mit ihr umgehen. Ich kenne sie kaum und finde sie schrecklich herrschsüchtig.«
»Das ist sie ja auch. Aber sie hat jedes Recht dazu, immerhin spendet sie uns Sachen im Wert von mehreren Tausend Euro. Ich würde jederzeit nackt auf einem Rodeo-Bullen ihre Halsketten präsentieren, wenn sie es wollte.«
»Das will doch niemand.« Ich drängle mich an ihr vorbei.
»Ich würde es aber sehr gern sehen«, ruft Mathew aus dem Nebenraum.
»Sie hat mich gebeten, dir das hier zu geben.« Ciara streckt mir einen Umschlag entgegen.
Irgendetwas daran löst ein unangenehmes Gefühl bei mir aus. Umschläge und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit. Es ist zwar nicht das erste Mal nach sechs Jahren, dass ich einen Umschlag öffne, aber bei diesem hier schwant mir nichts Gutes. Vermutlich handelt es sich um eine Einladung zu einem von Angela organisierten Charity-Frauenfrühstück, bei dem ich über Trauer reden soll. Oder so ähnlich. Sie hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, meinen »Vortrag« fortzusetzen oder vielleicht ein Buch zu schreiben. Bei jedem ihrer Besuche im Laden hat sie mir eine Telefonnummer von einem Eventmanager oder einem Literaturagenten zugesteckt. Die ersten paar Male habe ich mich höflich bedankt, aber bei unserer letzten Begegnung habe ich sie so direkt abblitzen lassen, dass ich nicht sicher war, ob sie jemals wieder auftauchen würde. Ich nehme Ciara den Umschlag ab, falte ihn zusammen und stopfe ihn in meine Gesäßtasche.
Ciara starrt mich böse an. So kommen wir nicht weiter.
Zum Glück erscheint Mathew an der Tür. »Gute Neuigkeiten: Die Downloadstatistik zeigt, dass ›Wie können wir über den Tod sprechen?‹ die bisher erfolgreichste Folge war und häufiger runtergeladen wurde als alle anderen zusammen. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei.« Er hebt die Hand, um uns beiden High Five zu geben.
Aber Ciara und ich starren uns nur weiter erbost an – ich bin sauer, weil ihr Podcast mich zum Opfer von Angelas zwanghafter Aufmerksamkeit gemacht hat, und Ciara ist wütend, weil ich aus unerfindlichen Gründen das Risiko eingehe, ihre größte Unterstützerin zu vergraulen.
»Na super, lasst ihr mich jetzt etwa hängen?«
Halbherzig klatscht Ciara ihn ab.
»So habe ich mir das nicht vorgestellt«, sagt er, sieht mich besorgt an und senkt die Hand. »Entschuldige, war das unsensibel von mir? Ich klatsche ja nicht Gerry ab, weißt du …«
»Ich weiß«, erwidere ich und ringe mir ein Lächeln ab. »Das ist es nicht.«
Ich kann mich nicht über den Erfolg des Podcasts freuen. Ich wünschte, niemand hätte ihn sich angehört, ich wünschte, ich hätte nicht mitgemacht. Nie wieder will ich etwas von Gerrys Briefen hören oder über sie sprechen.
Gabriels Haus in Glasnevin – ein einstöckiges viktorianisches Reihenhaus, das er mit viel Geduld und sehr liebevoll selbst renoviert und zu neuem Leben erweckt hat – ist im Gegensatz zu meinem ein richtig gemütliches Zuhause mit ausgeprägtem, unverkennbarem Charakter. Wir haben es uns in einem riesigen Samtsitzsack auf dem Langflorteppich bequem gemacht und trinken Rotwein. Das Wohnzimmer ist ein innenliegender Raum, daher strömt Licht, und sei es auch nur trübes Februarlicht, durch ein großes Dachfenster. Gabriels Mobiliar ist eine Mischung aus antik und modern, er hat alles Mögliche gesammelt, was ihm zu einer bestimmten Zeit gefallen hat. Ohne besonders aufregend oder wertvoll sein zu müssen, haben doch alle Stücke ihre Geschichte und stammen von unterschiedlichen Orten der Welt. Der zentrale Punkt des Zimmers ist der offene Kamin. Es gibt keinen Fernseher, für Unterhaltung sorgt entweder die größtenteils unbekannte Musik, die Gabriel auf seinem Plattenspieler hört, oder eins der Bücher aus seiner umfangreichen Sammlung. Zurzeit studiert er einen Kunstband mit dem Titel »TwentySix Gasoline Stations« mit Schwarzweißfotografien von Tankstellen in den Vereinigten Staaten. Die derzeit von ihm bevorzugte Musikrichtung stammt von Ali Farka Touré, dem malischen »König des Wüstenblues«. Ich blicke durch das Oberlicht hinauf in den Abendhimmel. Wundervoll, einfach wundervoll. Gabriel ist genau das, was ich brauche.
»Wann ist die erste Hausbesichtigung?«, fragt er, ein bisschen ungeduldig, weil sich die Dinge seit unserer Entscheidung vor einem Monat bisher nur sehr langsam entwickeln. Aber der Podcast hat mich völlig aus der Bahn geworfen.
Mein Haus ist noch nicht offiziell auf dem Markt, aber ich bringe es nicht über mich, ihm das zu gestehen, sondern antworte: »Ich treffe mich morgen mit der Maklerin.« Ich hebe den Kopf, um einen Schluck Wein zu trinken, und kuschle mich dann wieder auf Gabriels Brust. Das reicht an Anstrengung für den heutigen Tag. »Dann gehörst du mir, ganz und gar«, verkünde ich von dort mit einem etwas übertriebenen Lachen.
»Das tue ich doch schon längst. Übrigens habe ich das hier gefunden.« Er stellt sein Glas ab und zieht einen zerknitterten Umschlag aus einem windschiefen Bücherstapel beim Kamin.
»Ach ja, danke.« Ich falte ihn wieder zusammen und stopfe ihn hinter meinen Rücken.
»Was ist das denn?«
»Ein Typ hat mich im Laden reden hören. Jetzt denkt er, ich bin eine attraktive Witwe, und hat mir seine Nummer gegeben.« Mit ernstem Gesicht nippe ich wieder an meinem Wein.
Sein Stirnrunzeln bringt mich zum Lachen.
»Eine Frau, die bei der Podcastveranstaltung im Publikum war, möchte, dass ich meine Geschichte öfter erzähle, und drangsaliert mich, noch mehr solche Veranstaltungen zu machen. Oder ein Buch zu schreiben.« Ich lache. »Na ja, sie ist einfach eine aufdringliche reiche Frau, die ich nicht besonders gut kenne, und ich habe ihr gesagt, dass ich an ihren Vorschlägen kein Interesse habe.«
Neugierig sieht er mich an. »Ich habe mir den Podcast neulich im Auto angehört. Du hast sehr bewegend erzählt, und ich bin ganz sicher, dass du einer Menge Leuten damit geholfen hast.« Zum ersten Mal sagt er etwas Positives über meinen Beitrag. Vermutlich hat er darin nicht viel Neues über mich erfahren, denn in unseren ersten gemeinsamen Tagen und Wochen haben wir ziemlich viel Zeit damit verbracht, unsere Seelen zu erforschen. Dabei haben wir uns recht gut kennengelernt, aber ich will das alles hinter mir lassen.
»Ich habe es nur getan, um Ciara zu helfen«, wehre ich deshalb ab und blende sein Kompliment lieber aus. »Keine Sorge, ich fange nicht an, meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, dass ich Geschichten über meinen Exmann erzähle.«
»Ich habe mir auch keine Sorgen gemacht, dass du von ihm erzählst. Ich frage mich nur, wie es dir damit gehen würde, wenn du diese ganze Geschichte immer wieder durchleben würdest.«
»Das wird nicht passieren.«
Er dreht und wendet sich auf dem Sitzsack, bis er den Arm um mich legen kann. Ich denke, er will kuscheln, doch stattdessen schiebt er eine Hand unter mich, greift nach dem Umschlag und zieht ihn hervor.
»Du hast ihn ja nicht mal aufgemacht. Weißt du, was drin ist?«
»Nein. Weil es mir vollkommen egal ist.«
Er mustert mich. »Das stimmt nicht.«
»Doch. Denn wenn es mir nicht egal wäre, hätte ich ihn ja geöffnet.«
»Nein, anders herum. Wenn es dir egal wäre, hättest du ihn aufgemacht.«
»Es kann sowieso nichts Wichtiges sein. Sie hat ihn mir schon vor Wochen gegeben. Ich hatte ihn total vergessen.«
»Darf ich wenigstens mal reinschauen?« Er reißt den Umschlag auf, ohne meine Antwort abzuwarten.
Bei dem Versuch, ihn Gabriel wieder wegzunehmen, verschütte ich Wein auf den Teppich. Stöhnend befreie ich mich aus seinen Armen, hieve mich vom Sitzsack und laufe in die Küche, um einen Lappen zu holen. Während ich ihn unter den Wasserhahn halte, höre ich, wie Gabriel den Umschlag öffnet. Mein Herz klopft. Wieder bilden sich die kratzbürstigen Stacheln auf meiner Haut.
»Mrs Angela Carberry, ›P. S. Ich liebe Dich‹-Club«, liest er vor.
»Wie bitte?!«
Er schwenkt die Karte durch die Luft, ich komme näher, weil ich sie lesen will, und der nasse Lappen tropft auf seine Schulter.
»Holly!«, ruft er verärgert und rückt ein Stück weg.
Ich entreiße ihm die Karte. Es ist eine kleine Visitenkarte mit eleganter Schrift. »›P. S. Ich liebe Dich‹-Club«, lese ich laut und fühle mich zugleich neugierig und wütend.
»Was bedeutet das?«, fragt er und versucht, sich die Sauerei von der Schulter zu wischen.
»Keine Ahnung. Ich meine, ich weiß schon, was ›P. S. Ich liebe Dich‹ bedeutet, aber … ist sonst noch was in dem Umschlag?«
»Nein, bloß die Karte.«
»Jetzt reicht’s mir aber mit diesem Unsinn. Das wird ja immer mehr zum Stalking.« Ich greife nach meinem Handy, das auf dem Couchtisch liegt, und entferne mich ein Stück. »Oder Diebstahl geistigen Eigentums.«
Er lacht über meinen plötzlichen Stimmungsumschwung. »Wenn es auch nur ansatzweise in diese Kategorie fallen soll, hättest du es irgendwo aufschreiben müssen. Aber versuch, ihr auf die nette Art zu sagen, dass sie sich verpissen soll, Holly.« Dann wendet er seine Aufmerksamkeit wieder seinem Kunstbuch zu.
Es klingelt sehr lange, ich trommle ungeduldig mit den Fingern auf die Theke, während ich überlege, wie ich Angela am besten beibringen kann, dass sie mich augenblicklich in Ruhe lassen, sich verpissen und mich nicht mehr belästigen soll. Was immer es mit diesem Club auf sich hat, ich will nichts damit zu tun haben und möchte, dass er aufgelöst wird. Ich habe meiner Schwester geholfen und mich danach hauptsächlich erschöpft und ausgenutzt gefühlt. Außerdem steht es ihr nicht zu, Gerrys Worte zu benutzen, sie gehören ihm und mir. Mit jedem Klingeln wird meine Wut intensiver, aber gerade, als ich auflegen will, meldet sich eine Männerstimme.
»Hallo?«
»Hallo, kann ich bitte Angela Carberry sprechen?«
Ich spüre Gabriels Blick auf mir, und als ich mich umdrehe, flüstert er prompt wieder: »Sei nett.« Ich wende ihm den Rücken zu.
Die Männerstimme am anderen Ende klingt gedämpft, vermutlich spricht der Mann nicht direkt ins Telefon. Im Hintergrund höre ich Stimmen, und ich weiß nicht, ob er mit ihnen redet oder mit mir.
»Hallo? Sind Sie noch dran?«
»Ja, ja, ich bin da. Aber Angela nicht mehr. Sie ist gestorben. Heute Morgen.«
Seine Stimme bricht.
»Die Leute vom Beerdigungsinstitut sind gerade hier«, fährt er schließlich fort, »wir sind mitten in der Planung. Deshalb habe ich bisher auch noch keine Informationen für Sie.«
Zeit für eine Notbremsung, sonst lande ich im Graben. Meine Wut löst sich in Luft auf. Ich versuche, tief durchzuatmen.
»Oh, das tut mir leid. Das tut mir sehr leid«, stammle ich, und als ich mich hinsetze, merke ich, dass Gabriel mich aufmerksam beobachtet. »Was ist denn passiert?«
Die Stimme des Mannes kommt und geht, mal höre ich sie kaum, dann wieder etwas lauter, aber verzerrt, mal weit weg, dann wieder ganz nah. Ich spüre seine Orientierungslosigkeit. Seine Welt ist aus den Fugen geraten. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann überhaupt ist, und doch ist sein Verlust so greifbar, dass er schwer auf meinen Schultern lastet.
»Am Ende ging alles so schnell, darauf waren wir nicht vorbereitet. Wir dachten, sie hätte noch ein bisschen Zeit, aber der Tumor hat sich ausgebreitet, und das war … nun ja.«
»Krebs?«, flüstere ich. »Sie ist also an Krebs gestorben?«
»Ja, ja. Ich dachte, Sie wüssten das … entschuldigen Sie, mit wem spreche ich überhaupt? Haben Sie mir das schon gesagt? Tut mir leid, aber ich kann einfach nicht klar denken …«
Er redet einfach weiter und klingt dabei ziemlich konfus. Ich denke an Angela, dünn und bedürftig, wie sie meinen Arm umklammert. Ich fand sie merkwürdig, und sie hat mich genervt, dabei war sie verzweifelt. Sie wollte unbedingt, dass ich sie besuche, und ich habe ihr diesen Wunsch nicht erfüllt. Nicht einmal angerufen habe ich sie. Überhaupt habe ich mir nie wirklich Zeit für sie genommen. Natürlich hat mein Vortrag sie berührt, sie hatte ja selbst Krebs, sie war todkrank. An diesem Abend hat sie meinen Arm umklammert, als klammere sie sich ans Leben.
Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Laut von mir gegeben, denn auf einmal kniet Gabriel neben mir, und der Mann am anderen Ende der Leitung sagt: »Ach du liebe Zeit, das tut mir leid. Ich hätte mich besser ausdrücken sollen, nur habe ich damit gar keine Erfahrung … das ist alles so neu für mich und …«
»Nein, nein«, versuche ich ihn zu beruhigen. »Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie ausgerechnet in so einem Moment gestört habe. Mein herzliches Beileid für Sie und Ihre ganze Familie«, sage ich schnell.
Dann beende ich den Anruf.
Und löse mich endgültig in Tränen auf.
Kapitel 5
Natürlich habe ich Angela nicht umgebracht. Das weiß ich, aber ich weine, als wäre ich schuld an ihrem Tod. Ich weiß, dass ich mit einem Anruf, mit einem Besuch oder der Einwilligung, an ihren Veranstaltungen teilzunehmen, ihr Leben höchstwahrscheinlich nicht hätte verlängern können, und trotzdem weine ich, als hätte dazu eine Chance bestanden. Ich weine um all die irrationalen Gedanken, die mir durch den Kopf gehen.
Da Angela den Laden so großzügig unterstützt hat, fühlt Ciara sich verpflichtet, zu ihrer Beerdigung zu gehen, und obwohl Gabriel anderer Ansicht ist, finde ich, dass ich sogar noch mehr Grund dazu habe. In den Wochen vor Angelas Tod habe ich mich vor ihr versteckt und sie wiederholt abgewimmelt. Wir erinnern uns oft nicht daran, wie wir uns begegnet sind, aber meistens wissen wir noch genau, wie wir voneinander Abschied genommen haben. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich auf Angela nicht den besten Eindruck gemacht, deshalb will ich mich jetzt wenigstens richtig verabschieden.
Ihre Bestattung findet in der Church of the Assumption in Dalkey statt, einer malerischen Kirche an der Hauptstraße des Orts, direkt gegenüber des Dalkey Castle. Ciara und ich bahnen uns einen Weg durch die Menschen, gehen direkt in die Kirche und setzen uns auf eine Bank ganz hinten. Die Trauergäste folgen dem Sarg und der Familie, die Kirchenbänke füllen sich rasch. An der Spitze des Zuges geht ein einzelner Mann, Angelas Ehemann, der Mann, mit dem ich auch am Telefon gesprochen habe. Ihm folgen weinende Familienmitglieder und Freunde. Ich bin froh, dass er nicht allein ist, dass die Menschen hier traurig sind und Angela vermissen und dass ihr Leben ganz offensichtlich von Liebe erfüllt war.
Zwar wird deutlich, dass der Pfarrer Angela nicht sehr gut kannte, aber er gibt sein Bestes. Er hat, wie eine Elster, die von glänzenden Gegenständen angezogen wird, alle grundlegenden Informationen gesammelt und spricht einfühlsam und freundlich über sie. Für die Trauerrede tritt eine Frau ans Rednerpult, und ein Fernsehbildschirm mit Kabeln und allem Zubehör wird in die alte Kirche geschoben.
»Hallo, mein Name ist Joy. Ich würde sehr gern ein paar Worte über meine Freundin Angela sagen, aber sie hat es mir strikt verboten. Denn sie wollte das letzte Wort haben. Wie üblich.«
Gelächter.
»Bist du bereit, Laurence?«, fragt Joy.
Ich kann die Reaktion von Angelas Ehemann weder sehen noch hören, aber im nächsten Moment erwacht der Bildschirm zum Leben, und Angelas Gesicht erscheint auf dem Bildschirm. Sie ist sehr dünn, die Aufnahme stammt eindeutig aus ihren letzten Lebenswochen, aber sie strahlt übers ganze Gesicht.
»Hallo, ihr alle, ich bin’s!«
Überall um mich herum schnappen die Menschen erstaunt nach Luft, und auch Tränen fließen.
»Ich hoffe, ihr habt überhaupt keinen Spaß, ohne mich muss das Leben doch schrecklich langweilig sein. Tut mir leid, dass ich nicht mehr da bin, aber was soll man machen? Wir müssen nach vorn blicken. Hallo, meine Lieblinge – mein Laurence, meine Jungs, Malachy und Liam. Hallo, meine Babys. Ich hoffe, ihr habt keine Angst vor eurer Grandma, ich wollte euch die Sache nämlich ein bisschen leichter machen. Also legen wir doch am besten gleich los. Hier sind wir in meinem Perückenraum.«
Ein Kameraschwenk, und nun sehen wir die Perücken, ein ganzes Regal voll, in allen möglichen Formen, Farben und Stilen, jede ordentlich einem Schaufensterpuppenkopf übergezogen.
»Wie ihr ja wisst, benutze ich ja schon seit einiger Zeit diese Haare, und ich danke Malachy, dass er mir diese hier von einem Musikfestival mitgebracht hat«, erklärt sie und zoomt auf eine Irokesenperücke, die sie dann von ihrem Puppenkopf holt und aufsetzt.
Alle lachen unter Tränen. Taschentücher kommen zum Einsatz, werden aus Handtaschen gekramt und durch die Bänke weitergereicht.
»Also, meine lieben Jungs«, fährt Angela fort, »ihr seid mir die liebsten Menschen auf der ganzen weiten Welt, und ich bin noch nicht bereit, mich endgültig von euch zu verabschieden. Deshalb habe ich unter jede Perücke auf diesen Puppenköpfen einen Briefumschlag geklebt. Ich möchte, dass ihr jeden Monat einen Kopf herunterholt, die Perücke aufsetzt, den Umschlag öffnet und an mich denkt. Ich bin immer bei euch. Ich liebe euch alle und danke euch für das glücklichste, erfüllteste Leben, das eine Frau, Ehefrau, Mutter und Großmutter sich nur wünschen könnte. Danke für alles.«
Sie hält kurz inne und fügt dann mit einer Kusshand hinzu: »P. S. Ich liebe euch.«
Ciara packt meinen Arm und dreht sich langsam zu mir um. »Ach du meine Güte …«, flüstert sie.
Der Bildschirm wird schwarz, alle weinen, selbst diejenigen, die ihre Tränen bisher zurückgehalten haben. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sich Angelas Familie nach diesem Abschied fühlt. Und ich kann Ciara nicht ansehen. Mir ist übel, mir ist schwindlig, ich kriege keine Luft mehr. Niemand schenkt mir die geringste Aufmerksamkeit, aber mir ist das alles so peinlich, als wüsste jeder Bescheid über mich und über das, was Gerry für mich getan hat. Wäre es unhöflich, wenn ich die Kirche jetzt verlasse? Ich sitze so nahe bei der Tür, und ich muss unbedingt an die Luft, ins Licht, raus aus dieser beengenden Szenerie. Sonst ersticke ich. Leise stehe ich auf, halte mich kurz an der Rückenlehne der Bank fest, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, und gehe zur Tür.
»Holly?«, flüstert Ciara hinter mir.
Endlich bin ich draußen und kann tief Luft holen, aber es reicht nicht, ich will weg von hier, nur weg.
»Holly!«, ruft Ciara, die mir gefolgt ist. »Ist alles in Ordnung mit dir?«
Ich bleibe stehen und schaue sie an. »Nein. Gar nichts ist in Ordnung mit mir.«
»Scheiße, das ist meine Schuld. Tut mir echt leid, Holly. Ich habe dich so gedrängt, bei meinem Podcast mitzumachen, obwohl du nicht wolltest. Ich habe dich praktisch dazu gezwungen, und das tut mir so leid. Alles ist meine Schuld. Kein Wunder, dass du Angela aus dem Weg gegangen bist. Jetzt verstehe ich es endlich. Und es tut mir total leid, ehrlich.«