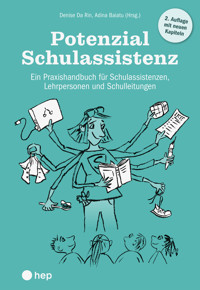
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: hep verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Sind Sie als Schulassistenz tätig, oder planen Sie den Einsatz einer Schulassistenz? Dieses Praxishandbuch zeigt mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten sowie anhand von Forschungsergebnissen auf, wie die Zusammenarbeit mit Schulassistenzen in Schule und Unterricht gestaltet werden kann und welche Risiken bestehen. Die erweiterte Neuauflage bietet Ihnen praktische Checklisten und vermittelt neu Basiswissen zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und Schüler*innen im Autismus-Spektrum. Sie erhalten ausserdem wichtige Hinweise zu Anstellungsbedingungen, Verantwortlichkeiten und Haftungsfragen und erfahren, welche Rolle Schulassistenzen in kooperativen Lernsettings einnehmen, was eine wirksame Lernbegleitung auszeichnet und wie Schulassistenzen die überfachlichen Kompetenzen von Schüler*innen unterstützen können. Dieses E-Book enthält Bildbeschreibungen zu allen Grafiken. Es wird empfohlen, einen E-Reader zu verwenden, auf dem die Bilder vergrössert werden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Denise Da Rin, Adina Baiatu (Hrsg.)
Potenzial Schulassistenz
Ein Praxishandbuch für Schulassistenzen, Lehrpersonen und Schulleitungen
ISBN Print inkl. digitaler Ausgabe: 978-3-0355-2884-8
ISBN E-Book: 978-3-0355-2885-5
ISBN digitale Ausgabe: 978-3-0355-2967-8
Illustrationen: Claudia de Weck
2., erweiterte und aktualisierte Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© 2025 hep Verlag AG, Bern
hep Verlag AG
Gutenbergstrasse 31 | Postfach | CH-3001 Bern
[email protected] | hep-verlag.ch
Weitere Materialien
Die Checklisten aus Kapitel 3 und 5 sowie das Kapitel 8 sind verfügbar unter: hep-verlag.ch/potenzial-schulassistenz
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vorwort zur zweiten und erweiterten Auflage
Einleitung
Denise Da Rin, Adina Baiatu
Anmerkungen
Teil 1 Rolle und Funktion von Schulassistenzen
1Empfehlungen für den Einsatz von Schulassistenzen
Adina Baiatu, Denise Da Rin
1.1Der zielgerichtete Einsatz von Schulassistenzen
1.2Handlungsfelder von Schulassistenzen
1.2.1Das Handlungsfeld Unterricht
1.2.2Das Handlungsfeld Schule
1.2.3Kombinationsmöglichkeiten und weitere Tätigkeitsfelder
Anmerkungen
2Aus der Praxis: Interview mit einer Schulleiterin
Adina Baiatu, Denise Da Rin
Anmerkungen
3Checkliste für Schulleitungen
Anmerkungen
4Stellungnahme des SchulAssistenzVerbands
Nadja Mayer, Judith Scheidegger
4.1Zielsetzung und Einsatz von Schulassistenzen
4.2Anforderungsprofil
4.3Einsatz und Planung
4.4Aus der Praxis
4.5Unsere Vision
5Checkliste für Schulassistenzen
6Häufig gestellte Fragen
Karin Fehr Eisinger, Benjamin Blum
6.1Fragen zu Anstellungsbedingungen
6.1.1Vor Beginn der Anstellung
6.1.2Während der Anstellung
6.1.3Beendigung der Anstellung
6.2Fragen zur Verantwortlichkeit von Schulassistenzen
Anmerkungen
Teil 2 Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulassistenzen
7Erfolgsfaktoren für die multiprofessionelle Zusammenarbeit
Denise Da Rin, Frank Brückel
7.1Die Entwicklung multiprofessioneller Teams
7.2Die Rolle der Schulleitung
7.3Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Lehrperson, um den Schulassistenzen eine professionelle Arbeitsgrundlage zu bieten
7.4Die Rolle der Schulassistenz
Anmerkungen
8Zusammenarbeit gestalten
Annina Truniger, Bea Zumwald
8.1Zentrale Aspekte bei der Gestaltung der Zusammenarbeit
8.1.1Anleitung
8.1.2Monitoring
8.1.3Feedback
8.2Begleitung und Betreuung von Schüler*innen – Gefahr der Inselbildung
8.3Formen der Zusammenarbeit im gemeinsamen Unterricht
8.3.1Empfohlene Formen der Zusammenarbeit
8.3.2Bedingt empfohlene Form der Zusammenarbeit
8.3.3Nicht empfohlene Formen der Zusammenarbeit
8.4Reflexionsfragen für die weitere Zusammenarbeit
Anmerkungen
9Aus der Praxis: Eine Lehrperson und eine Schulassistenz berichten über ihre Zusammenarbeit
Adina Baiatu, Denise Da Rin
Anmerkungen
Teil 3 Konkrete Unterstützung im Unterricht
10Das heutige Lern- und Unterrichtsverständnis
Denise Da Rin, Adina Baiatu
10.1Was ist guter Unterricht?
10.2Qualitätsmerkmale eines guten Unterrichts
Anmerkungen
11Die Schulassistenz in kooperativen Unterrichtssettings
Adina Baiatu, Denise Da Rin
11.1Merkmale des kooperativen Lernens
11.2Think – Pair – Share
Anmerkungen
12Unterstützung bei der Förderung überfachlicher Kompetenzen
Adina Baiatu, Denise Da Rin
12.1Die überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 im Überblick
12.1.1Personale Kompetenzen
12.1.2Soziale Kompetenzen
12.1.3Methodische Kompetenzen
12.2Das Zusammenspiel zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen
12.3Einflüsse auf die Entwicklung überfachlicher Kompetenzen
12.4Praktische Hinweise
12.4.1Unterstützung bei der Entwicklung personaler Kompetenzen
12.4.2Unterstützung bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen
12.4.3Unterstützung bei der Entwicklung methodischer Kompetenzen
12.4.4Unterstützung der Konfliktfähigkeit mittels Konfliktmoderation
Anmerkungen
13Lernbegleitung von Schüler*innen
Adina Baiatu, Denise Da Rin
13.1Das Grundverständnis von Lernbegleitung
13.2Schritte der Lernbegleitung
13.2.1Lern- und Unterstützungsbedarf feststellen
13.2.2Lern- und Unterstützungsmaterialien zusammenstellen
13.2.3Lernaufgaben und Materialien übergeben
13.2.4Lernprozess begleiten
13.2.5Lernprozess auswerten
Anmerkungen
14Auffälliges Verhalten im Schulalltag – Handlungsmöglichkeiten der Schulassistenz
Thomas Lustig unter Mitarbeit von Denise Da Rin und Adina Baiatu
14.1Einleitung
14.2Definition von auffälligem Verhalten
14.3Erscheinungsformen von Verhaltensauffälligkeiten
14.4Verständnis und Erklärung von auffälligem Verhalten
14.4.1Interaktionales Verständnis
14.4.2Ökosystemisches Verständnis
14.5Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten
14.5.1Die Bedeutung von erlernten und verinnerlichten Mustern
14.5.2Die Bedeutung von zwischenmenschlichen Erfahrungen und Emotionen
14.6Handlungsmöglichkeiten der Schulassistenz: Sonderpädagogische Prinzipien
14.6.1Beziehungsgestaltung
14.6.2Orientierung durch Strukturierung
14.6.3Rhythmisierung von Anspannung und Entspannung
14.7Pädagogische Handlungsmöglichkeiten
14.7.1Vermittlung stärkender Botschaften
14.7.2Lernerfolge aufzeigen
14.7.3Unterstützung bei der Emotions- und Verhaltensregulation
14.7.4Banking Time
14.8Zusammenfassung
Anmerkungen
15Schulassistenz für Schüler*innen im Autismus-Spektrum
Patricia Lötscher
15.1Ein Fallbeispiel aus dem Schulalltag
15.2Diagnose und Begriffsklärung von Autismus
15.3Autismus verstehen
15.3.1Schwache zentrale Kohärenz
15.3.2Exekutive Funktionen
15.3.3Theory of Mind
15.4Unterstützung durch die Schulassistenz
15.4.1Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Fachpersonen für schulische Heilpädagogik (SHP)
15.5Strategien für den Schulalltag
15.5.1Handlungsstrategien
15.5.2Kommunikationsstrategien
15.6Umgang mit Wahrnehmungsbesonderheiten
15.7Unterstützung der Interaktion mit Peers
15.8Zusammenfassung
Anmerkungen
Schlusswort
Denise Da Rin, Adina Baiatu
Literatur
Autor*innen
Vorwort
Es vergeht kaum ein Tag, an dem das Thema Schule und die vielfältigen Herausforderungen, mit denen ihre Akteur*innen konfrontiert sind, nicht in der Öffentlichkeit aufgegriffen und mit unterschiedlich fundierten Argumenten kontrovers diskutiert werden. Auch der Einsatz von Schulassistenzen ist davon betroffen: Diese werden von den einen als «Helping Hands» willkommen geheißen und überaus geschätzt und von anderen als Vorboten einer Deprofessionalisierung im Schulfeld kritisch betrachtet. Ungeachtet dieser unterschiedlichen Standpunkte sind Schulassistenzen an Schulen längst Realität. Sie leisten Wertvolles und bringen ein breites Erfahrungsspektrum in die Schulen ein. Die Realität zeigt aber auch, dass Schulassistenzen um Anerkennung kämpfen, sei es im sozialen Schulgefüge, bezüglich der Wertschätzung ihrer geleisteten (Beziehungs-)Arbeit oder im Hinblick auf ihre zum Teil unbefriedigenden Anstellungsbedingungen.
Das vorliegende Handbuch geht auf wichtige Herausforderungen beim Einsatz von Schulassistenzen ein und zeigt auf, wie das Potenzial von Schulassistenzen für alle Beteiligten sinnstiftend und lernwirksam genutzt werden kann.
Ein solches Buchprojekt ist nicht ohne das Zutun vieler «Helping Hands» realisierbar. An dieser Stelle sei deshalb allen sehr herzlich gedankt, die zum Entstehen dieses Handbuches beigetragen haben – sei es in Form von redaktionellen Beiträgen, der Weitergabe ihrer Praxiserfahrungen, Interviewbeiträgen oder der kritisch-konstruktiven Durchsicht des Manuskripts: Karin Fehr und Benjamin Blum, Annina Truniger und Bea Zumwald, Yvonne Wild, Ariane Nikolic sowie Heidi Heiz, Claudia Schranz, Nadja Mayer und Judith Scheidegger. Tatjana Straka vom hep Verlag danken wir für das stets offene Ohr und die unkomplizierte Zusammenarbeit und Claudia de Weck, dass sie mit ihren Illustrationen mitgeholfen hat, das Buch lebendig werden zu lassen.
Denise Da Rin und Adina Baiatu
Vorwort zur zweiten und erweiterten Auflage
Seit dem ersten Erscheinen dieses Handbuchs im Jahr 2023 ist die Anzahl an Schulassistenzen an Schulen weiter gestiegen. Auch wenn es noch immer keine offizielle gesamtschweizerische Statistik zur Anzahl Schulassistenzen an Schweizer Volksschulen gibt, weisen die verfügbaren Kennzahlen einzelner Kantone, die kontinuierlich wachsende Mitgliederzahl des 2019 gegründeten schweizerischen SchulAssistenzVerbands, die seit Jahren stetige Nachfrage nach Weiterbildungsangeboten für Schulassistenzen sowie das Interesse an diesem Praxishandbuch darauf hin, dass das Potenzial von Schulassistenzen in vielen Schulen genutzt wird.
Mitte Mai 2025 veröffentlichte der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz ein Positionspapier zum Tätigkeitsfeld von Schulassistenzen. Darin wird gefordert, dass es sprachregional oder gar national einheitliche Regelungen zu Umfang und Inhalten der «Ausbildung von Schulassistenzen» geben soll. Darüber hinaus wird eine Harmonisierung der Angebote gewünscht. Nun sollen auch Schulassistenzen eine adäquate pädagogische Qualifikation erhalten. Damit revidiert der Dachverband seine Position aus dem Jahr 2017. Zudem wird konstatiert, dass Schulassistenzen «über Jahre angestellt (werden), ohne dass ihr Beruf oder ihre Weiterbildung im Berufsbildungssystem anerkannt wären.» Dies sei ein «unwürdiger Zustand», und das auch noch «ausgerechnet im Schweizer Bildungswesen». Der Dachverband kommt zum Schluss, dass eine Anerkennung und Integration dieses «Berufs» in die Systematik des Schweizer Bildungswesens, in die kantonalen Bildungssysteme und in die Praxis an den Schulen benötigt wird. Das ist erfreulich, denn so werden dem «Wildwuchs» der vergangenen Jahre Mindeststandards entgegengehalten und der Qualitätsanspruch der Schulen hochgehalten.
Erfreulich sind auch die Entwicklungen der Anstellungsbedingungen für Schulassistenzen: Waren sie zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses Handbuchs vielfach noch herausfordernd bis prekär, so erhalten Schulassistenzen mittlerweile immer häufiger Festanstellungen und klar geregelte Arbeitszeiten. Sie werden zunehmend in Schulteams integriert und an Weiterbildungsmöglichkeiten beteiligt. Und sie sind aufgrund vielfältiger Entwicklungen vermehrt auf allen Bildungsstufen (Zyklen) der Volksschule tätig.
Die vorliegende zweite und erweiterte Auflage dieses Praxishandbuchs vertieft und ergänzt Themen, die Schulassistenzen, Lehrpersonen und Schulleitungen während ihres Arbeitsalltags immer wieder beschäftigen: die multiprofessionelle Zusammenarbeit, die Klärung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie häufig auftretende (arbeits-)rechtliche Fragen. Wichtige Punkte dieser genannten Themen sind in praktischen Checklisten für Schulleitungen und Schulassistenzen zusammengefasst. In zwei neuen Kapiteln wird auf die Rolle der Schulassistenz in sonderpädagogischen Settings eingegangen. Die beiden Kapitel zeigen auf, wie Schulassistenzen Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten sowie Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum unterstützend begleiten und ihrerseits die multiprofessionelle Zusammenarbeit stärken können.
Nach wie vor gilt: Schulassistenzen leisten Wertvolles und bringen ein breites Erfahrungsspektrum in die Schulen ein, sofern sie sorgfältig in ihre vielfältigen Aufgaben eingeführt und als Teil des Schulteams anerkannt werden. Wenn sie zudem die Möglichkeit erhalten, sich weiterzubilden, können sie aktuelle Herausforderungen in Schule und Unterricht besser verstehen und Lehrpersonen und Schüler*innen wirksamer unterstützen. Die oben genannten Entwicklungen nehmen wir mit der aktualisierten und erweiterten Auflage auf und stellen sie unseren interessierten Leser*innen zur Verfügung, damit das Potenzial von Schulassistenzen weiterhin für alle Beteiligten zum Tragen kommt.
Auch dieses Buch ist das Ergebnis einer multiprofessionellen Zusammenarbeit. Das Wissen und die Erfahrungen verschiedener Expert*innen sind eingeflossen. Allen, die mitgedacht und mitgeschrieben haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt: Frank Brückel, Karin Fehr Eisinger und Benjamin Blum, Nadja Mayer und Judith Scheidegger, Ariane Nikolic, Thomas Lustig, Patricia Lötscher, Astrid Schwarz und Sarah Staub, Yvonne Wild sowie Annina Truniger und Bea Zumwald. Tatjana Straka vom hep Verlag danken wir wiederum für die sehr angenehme Zusammenarbeit – und Claudia de Weck dafür, dass ihre Illustrationen das Geschriebene mit einem Augenzwinkern begleiten.
Zürich, im Mai 2025
Denise Da Rin und Adina Baiatu
Einleitung
Denise Da Rin, Adina Baiatu
Volksschulen sind laufend von zahlreichen Entwicklungen und den damit verbundenen Herausforderungen betroffen. Lehrpersonen und Schulen haben viele unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen: die Etablierung von Tagesschulen, die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf, steigende Schülerzahlen, größere Klassen, Auswirkungen der digitalen Transformation auf Unterricht und Lernen, Lehrpersonenmangel. Die Aufzählung ließe sich fortführen. All diese Entwicklungen haben auch zur Folge, dass Schulen vermehrt Unterstützung von unterschiedlich spezialisiertem und qualifiziertem Personal erhalten, das zur Entlastung in ihrem anspruchsvollen Arbeitsumfeld beiträgt.
Im Zuge dieser Entwicklungen haben sich mehrere Funktionen und Rollen etabliert und zunehmend ausdifferenziert: Fachpersonen für schulische Heilpädagogik (SHP), Fachpersonen mit therapeutischen Qualifikationen für Logopädie oder Psychomotorik, die Schulsozialarbeit, ICT-Fachpersonen, aber auch Betreuungs- und Begleitungspersonal von Hort, Mittagstisch oder Hausaufgabenhilfe, das freiwillige Engagement von Senior*innen sowie in der Schweiz seit 2016 auch vereinzelt Zivildienstleistende, die in Schulen befristet Einsatz leisten.1 Auch Schulassistenzen2 gehören zu diesem sogenannt erweiterten Personal von Schulen.
Im Folgenden wird der Begriff «Schulassistenz» anstelle des in der deutschsprachigen Schweiz ebenfalls häufig verwendeten Begriffs «Klassenassistenz» verwendet, da sich die Einsatzgebiete und Handlungsfelder von Assistenzen in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet haben und sie an Schulen über den Unterrichtsrahmen hinaus Hilfestellungen leisten.
In Sonderschulen sowie im US-amerikanischen Raum hat sich diese Unterstützungsform für Schüler*innen bereits in den 1950er-Jahren etabliert. «Paraprofessionals wurden in der Schule eingesetzt, um LehrerInnen mehr Zeit für die Unterrichtsplanung zu verschaffen und sie zu unterstützen.»3 Zu Beginn verrichteten sie Büroarbeiten wie Unterlagen kopieren und beaufsichtigten Kinder während der (Mittags-)Pausen. Dies änderte sich in den 1970er-Jahren, als Menschen mit Behinderung per Gesetz der freie Zugang zu angemessener Bildung an öffentlichen Schulen ermöglicht wurde. Die Rolle der Paraprofessionals weitete sich im Zuge dieser Entwicklungen auf die Unterstützung von Schüler*innen mit Behinderung in allgemeinbildenden Settings aus. Im deutschsprachigen Raum etablierte sich diese Begleitfunktion Ende der 1980er-Jahre, um Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf in alltagspraktischen Situationen zu unterstützen und ihnen den Unterrichtsbesuch zu ermöglichen.4
Im Zuge der integrierten Sonderschulung an Volksschulen nimmt die Zahl von Schulassistenzen auch in der Schweiz zu. Ihr Einsatzgebiet hat sich hierzulande von medizinisch-pflegerischen Tätigkeiten in Sonderschulen auf praktische und pädagogische Unterstützungshandlungen bei der Alltagsbewältigung und beim Lernen in der Regelschule ausgeweitet.
Die internationale Fachliteratur betrachtet den zunehmenden Einsatz von Schulassistenzen als Ergänzung und Ausgleich von nicht vorhandenem (sonder-)pädagogischem Personal größtenteils kritisch. Allerdings unterscheiden sich die Rahmenbedingungen und Aufgaben von Schulassistenzen in den verschiedenen Ländern, und die Forschungserkenntnisse zur Wirkung dieser Unterstützungsmaßnahme sind je nach Land noch spärlich und aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen nicht durchgehend vergleichbar.5
Für die Schweiz kann festgehalten werden, dass es zum Einsatz von Schulassistenzen in der Volksschule noch keine systematisch erhobenen Daten gibt.6 Die Funktion «Schulassistenz» stellt aktuell keine offizielle Berufsbezeichnung dar und es existiert keine anerkannte Ausbildung für diese Tätigkeit. Die Anstellung wird auf Ebene der Gemeinden geregelt. Dementsprechend haben die einzelnen Gemeinden beim Einsatz von Schulassistenzen in vielen Punkten einen großen Spielraum.
Dieser Spielraum und eine damit einhergehende Unsicherheit seitens der Betroffenen sowie von Schulbehörden und Schulleitungen haben zur Folge, dass sich die Anstellungsbedingungen und Aufgaben von Schulassistenzen von Schulort zu Schulort stark unterscheiden können. Da es für die Tätigkeit der Schulassistenz bislang weder offiziell anerkannte noch allgemeingültige Aus- und Weiterbildungsanforderungen gibt, wirkt dies einer Professionalisierung der Assistenzrolle entgegen (siehe dazu auch die Stellungnahme des SchulAssistenzVerbands in Kapitel 4). Lehrpersonenausbildende sowie Lehrberufsverbände befürchteten zudem lange, dass Schulassistenzen zunehmend Aufgaben von Lehrpersonen übernehmen, wofür sie weder ausreichend ausgebildet sind noch angemessen entlohnt werden. Dies könnte zu einer Deprofessionalisierung des Lehrberufs beitragen.7
Weiter zeigen empirische Erkenntnisse aus der Unterrichtsforschung, dass Schulassistenzen bei der Betreuung und Begleitung von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf oder in disziplinarisch herausfordernden Schulklassen an ihre Grenzen stoßen.8 Die mit dem Einsatz von Assistenzpersonal angestrebten Ziele wie die Entlastung der Lehrpersonen, die Erhöhung des Betreuungsschlüssels, die Gewährleistung einer hohen Unterrichtsqualität sowie die Ermöglichung von Inklusion erfüllen sich denn auch nur teilweise: Die Integration und Selbstständigkeit von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf kann sich durch eine zu enge Betreuung durch eine Schulassistenz sogar erschweren.9
Diese spannungsreiche Ausgangslage und die damit verbundenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Schulassistenzen insbesondere in sonderpädagogischen Settings werfen im Schulalltag immer wieder Fragen auf. Vor diesem Hintergrund ist die Idee für dieses Handbuch entstanden. Es trägt den Titel «Potenzial Schulassistenz. Ein Praxishandbuch für Schulassistenzen, Lehrpersonen und Schulleitungen». Das Handbuch ist ein Nachschlagewerk für alle Interessierten, die die Frage umtreibt, wie Schulassistenzen schüler*innenorientiert und lernwirksam arbeiten können. Es soll Lehr- und Fachpersonen zu mehr Sicherheit in der Zusammenarbeit im Schulteam verhelfen und Schulleitungen dabei unterstützen, ihr Assistenzpersonal ressourcenorientiert einzusetzen. Und es soll Entscheidungsträger*innen empirisch fundierte Hinweise liefern, um das Profil von Schulassistenzen zu schärfen und mögliche Aufgaben dieser Unterstützungsfunktion so zu konkretisieren, dass die oben beschriebenen Herausforderungen und die damit einhergehenden Risiken entschärft werden können. Dies ganz im Sinne einer multiprofessionellen Zusammenarbeit in einer inklusiven Schule und – last but not least – zugunsten einer lernförderlichen Unterstützung aller Schüler*innen.
Das Handbuch ist in drei Teile mit insgesamt fünfzehn Kapiteln gegliedert: Teil 1 widmet sich der Rolle und Funktion von Schulassistenzen. Anhand wissenschaftlicher Untersuchungen und kantonalen Empfehlungen wird in Kapitel 1 aufgezeigt, welche Aufgaben Schulassistenzen in Unterricht und Schule sinnvollerweise übernehmen können. Eine Schulleiterin berichtet in Kapitel 2, worauf sie beim Einsatz von Schulassistenzen achtet. Kapitel 3 bietet eine Checkliste für Schulleitungen mit den wichtigsten Punkten zu Anstellungsmodalitäten und der Einbindung der Schulassistenz ins Team. In Kapitel 4 beschreiben Mitbegründerinnen des schweizerischen SchulAssistenzVerbands ihre Vision und Zielsetzungen. Kapitel 5 enthält eine Checkliste für Schulassistenzen als «Hilfe zur Selbsthilfe» mit wichtigen Hinweisen zu deren Anstellung und Aufgaben. Rechtliche Fragestellungen zur Verantwortlichkeit und Haftung von Schulassistenzen werden in Kapitel 6 behandelt.
Teil 2 und Kapitel 7 sind der multiprofessionellen Zusammenarbeit gewidmet. In Kapitel 8 wird erläutert, wie Schulassistenzen, Lehrpersonen und Fachpersonen für schulische Heilpädagogik (SHP) ihre Zusammenarbeit zielführend gestalten können – und wie sich ihre Verantwortungsbereiche optimalerweise voneinander abgrenzen lassen. Im Anschluss berichten eine Schulassistentin und eine Lehrperson darüber, wie sich ihre Zusammenarbeit entwickelt hat (Kapitel 9).
Teil 3 befasst sich mit den konkreten Unterstützungsmöglichkeiten der Schulassistenz im Unterricht. Nach einer kurzen Einführung in das heutige Lern- und Unterrichtsverständnis und einer Übersicht über die wichtigsten Qualitätsmerkmale guten Unterrichts (Kapitel 10) wird auf relevante Themen und Lernsettings eingegangen, die in der Schulpraxis immer wieder vorkommen: die Arbeit in kooperativen Unterrichtssettings (Kapitel 11), die Förderung überfachlicher Kompetenzen (Kapitel 12) sowie die Lernbegleitung von Schüler*innen (Kapitel 13).
Die beiden abschließenden, neu verfassten Kapitel widmen sich der Rolle der Schulassistenz in sonderpädagogischen Settings: Kapitel 14 behandelt das Thema Verhaltensauffälligkeiten. Es wird aufgezeigt, wie auffälliges Verhalten erklärt werden kann, was Ursachen dafür sein können und wie Schulassistenzen betroffene Kinder und Jugendliche beim Aufbau erwünschter Verhaltensmuster unterstützen können. Kapitel 15 widmet sich dem Thema Autismus. Es werden Handlungs- und Kommunikationsstrategien für Schulassistenzen vorgestellt, die konkrete Anregungen für die Begleitung autistischer Schüler*innen bieten und gleichzeitig die Rolle der Schulassistenz bei der Unterstützung von Schüler*innen im Autismus-Spektrum schärfen.
Um den Lesefluss zu erleichtern, wurden alle Quellenangaben und weiterführenden Hinweise in Endnoten am Schluss der jeweiligen Kapitel unter «Anmerkungen» gesetzt. Sie dienen interessierten Leser*innen zur vertiefenden Lektüre einzelner Aspekte. Am Ende des Buches findet sich ein Literaturverzeichnis mit den vollständigen Quellenangaben zu allen Kapiteln.
Anmerkungen
1
SKBF 2018, Bildungsbericht 2018, 47; SKBF 2023, Bildungsbericht 2023, 42.
2
Im deutschsprachigen und im englischsprachigen Raum existieren unterschiedliche Begriffe für diese Rolle:
Klassenassistenz,
Klassen- oder Unterrichtshilfe,
Schülerhilfe, Lernbegleitung, Schulbegleitung, Integrationshelfer*innen,
Lehrerhilfe
oder
Classroom Assistant,
Teacher’s Aid,
Teacher Assistant, Instructional Aid, Paraprofessionals
u. a. Zu den Begrifflichkeiten für Assistenzpersonen in Schulen vgl. auch Weber 2020, Die Wahrnehmung der Rolle von SchulassistentInnen und ihre Unterstützungsleistung aus Sicht der Kinder, 21 ff.
3
Weber 2020, Die Wahrnehmung der Rolle von SchulassistentInnen und ihre Unterstützungsleistung aus Sicht der Kinder, 21 ff.
4
Böing 2017, «… und dann hab’ ich das ruckzuck fertig gemacht», 19; Weber 2020, Die Wahrnehmung der Rolle von SchulassistentInnen und ihre Unterstützungsleistung aus Sicht der Kinder, 21 ff.
5
In der Forschungsliteratur werden sowohl positive als auch negative Effekte hinsichtlich des Einsatzes von Assistenzpersonal präsentiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, Qualifikationsanforderungen und insbesondere die sorgfältige Einführung und Begleitung von Schulassistenzen einen Einfluss darauf haben, welche Effekte erzielt werden. Im Detail siehe dazu die
Kapitel 1
und
7
bis 9 sowie 11 bis 13 in diesem Handbuch. Weiterführende Literatur: Hemelt, Ladd und Clifton 2021, Do teacher assistants improve student outcomes?; Zumwald et al. 2021, Klassenassistenzen sind keine Selbstläufer; Schindler 2019, Die Entwicklung des Lern- und Sozialverhaltens bei Schülerinnen und Schülern mit Schulassistenz; Lübeck 2017, Unüberblickbares überblicken – Ausgewählte Forschungsergebnisse zu Schulbegleitung;
proEdu.ch
, ProfilQ 2017, Assistenzpersonal an Schulen (27.05.2025).
6
Der Bildungsbericht Schweiz 2018 hält fest, dass an Schulen zunehmend mehr Unterstützungspersonal eingesetzt wird, und kündigte an, dass er künftig dem sogenannten erweiterten Personal an Schulen in der Statistik vermehrt Rechnung tragen wolle (SKBF 2018, Bildungsbericht Schweiz 2018, 47). Im Bildungsbericht 2023 wird festgehalten, dass in nahezu allen Kantonen in den Schulzimmern entsprechende Hilfskräfte aktiv sind (SKBF 2023, Bildungsbericht Schweiz 2023, 42).
7
Dazu u. a. Aebischer 2024, Schulassistenzen – alle brauchen sie, aber kaum jemand hört ihnen zu;
proEdu.ch
, ProfilQ 2017, Assistenzpersonal an Schulen (02.03.2025); Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer 2010, Klassenhilfen an den Volksschulen. Das Positionspapier «Klassenhilfen an den Volksschulen» des LCH wurde am 14.05.2025 durch ein aktualisiertes Positionspapier «Schulassistenzen – Anforderungen an Tätigkeit und Einsatz in der Schule» ersetzt:
https://www.lch.ch/aktuell/detail/schulassistenzen-anforderungen-an-taetigkeit-und-einsatz-in-der-schule
(16.05.2025).
8
Baiatu und Da Rin 2020, Arbeitssituation von Schulassistenzen; Lübeck 2018, Schulbegleitung im Rollenprekariat. Zur Unmöglichkeit der «Rolle Schulbegleitung» in der inklusiven Schule; Heinrich und Lübeck 2013, Hilflose häkelnde Helfer? Zur pädagogischen Rationalität von Integrationshelfer/inne/n im inklusiven Unterricht.
9
Vgl. Czempiel und Kracke 2019, Kann das jeder? Welche Rolle spielt die Qualifikation von Schulbegleiter/innen für die Tätigkeiten und die Zusammenarbeit mit Lehrer/innen?; Lübeck 2018, Schulbegleitung im Rollenprekariat; Zumwald et al. 2021, Klassenassistenzen sind keine Selbstläufer.
Teil 1
Rolle und Funktion von Schulassistenzen
1 Empfehlungen für den Einsatz von Schulassistenzen
Adina Baiatu, Denise Da Rin
Das folgende Kapitel fasst die wichtigsten Empfehlungen für den Einsatz von Schulassistenzen zusammen. Als Grundlage dienen die Empfehlungen des Kantons Zürich. Sie werden ergänzt durch Angaben aus Merkblättern und Handreichungen zum Einsatz von Schulassistenzen anderer Kantone sowie Hinweise aus der Unterrichtsforschung im Zusammenhang mit dem Einsatz von Assistenzpersonal an Schulen.
Der Einsatz von Schulassistenzen erscheint auf den ersten Blick als einfache und niederschwellige Lösung, um Schulen bei der Bewältigung der in der Einleitung angesprochenen Herausforderungen zu unterstützen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die gegenwärtige Situation in Schulen für Schulassistenzen, Lehrpersonen und einzelne Schüler*innen auch Nachteile und neue Herausforderungen mit sich bringen kann: Schulassistenzen arbeiten teilweise unter schwierigen Bedingungen. Sie müssen oftmals herausfordernde Aufgaben übernehmen, was zu Überforderungssituationen führen kann, und sie haben nicht immer geklärte Anstellungsperspektiven.1
Aufgrund vielfältiger Fragen, die sich bei der Anstellung und beim Einsatz von Schulassistenzen ergeben, hat das Volksschulamt des Kantons Zürich 2016 Informationen und Empfehlungen zum Einsatz von Schulassistenzen zusammengestellt, die laufend aktualisiert werden.2 Das Dokument beschreibt, wie Schulassistenzen zielgerichtet eingesetzt werden können, welches Anforderungsprofil3 sie mitbringen sollten, wie bei der Einstellung einer Schulassistenz vorgegangen werden kann und welche Handlungsfelder sich für Schulassistenzen anbieten. Zudem werden personalrechtliche Aspekte rund um die Anstellung geklärt. Auch andere Kantone haben in Merkblättern beschrieben, wie Schulassistenzen sinnvollerweise eingesetzt werden.4 Im Folgenden wird der zielgerichtete Einsatz von Schulassistenzen in Unterricht und Schule am Beispiel der Empfehlungen des Kantons Zürich erläutert.
1.1Der zielgerichtete Einsatz von Schulassistenzen
Einen wichtigen Aspekt für einen längerfristig zielführenden Einsatz von Schulassistenzen stellt die Empfehlung dar, Schulassistenzen mit einer festen Anstellung einen konstanten Platz im Schulteam zu gewähren. Ihre Aufgaben und Pflichten werden klar definiert und festgehalten. Bei der Festlegung der Aufgaben empfiehlt es sich, stets die mit dem Einsatz von Schulassistenzen angestrebten Ziele im Auge zu behalten: Hat der Einsatz von Schulassistenzen die gewünschte Entlastungswirkung? Sind die festgelegten Aufgabenbereiche für alle Beteiligten stimmig? Schulleitungen sollten den Einsatz von Schulassistenzen wenn immer möglich längerfristig planen und auf die Bedürfnisse der beteiligten Klassen, Lehrpersonen und Schulassistenzen abstimmen. Diese vorausschauende Einsatzplanung gewährleistet, dass bei akuten Herausforderungen im Schulalltag eine rechtzeitige Unterstützung vor Ort möglich ist.
Dieser vom Volksschulamt Zürich empfohlene Grundsatz wird auch in der Fachliteratur als eine zentrale Gelingensbedingung für eine nachhaltige Eingliederung von Schulassistenzen in Schulen beschrieben.5 Er gewährleistet Schulassistenzen eine längerfristige Perspektive und unterstützt die Kontinuität in der Zusammenarbeit mit Lehr- und Fachpersonen sowie die Vertrauensbildung der Schüler*innen.
Im Kanton Zürich darf eine Schulassistenz im Falle eines unerwarteten Ausfalls einer Lehrperson eine Klasse kurzfristig beaufsichtigen und betreuen. Sie darf die Klasse jedoch weder unterrichten noch an spezifischen Lernzielen oder Unterrichtsthemen arbeiten.6





























