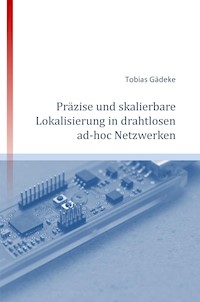
12,99 €
Mehr erfahren.
In dieser Arbeit wird für die ad-hoc Lokalisierung am Beispiel von Katastrophenszenarien ein neuartiges Lokalisierungssystemkonzept auf Basis von kombinierten Signalstärke- und Laufzeitdistanzmessungen sowie der Fusion von Inertialdaten erarbeitet und untersucht. Dabei erfolgt eine grobe, jedoch skalierbare Lokalisierung durch weniger genaue Signalstärkemessungen, die durch präzise, selektive Laufzeitmessungen unterstützt werden. Die zusätzliche Integration von Inertialdaten erlaubt darüber hinaus auch die Lokalisierung ohne verfügbares Netzwerk über einen begrenzten Zeitraum und steigert neben Genauigkeit und Präzision besonders die Skalierbarkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Tobias GädekePräzise und skalierbare Lokalisierung in drahtlosen ad-hoc Netzwerken
Präzise und skalierbare Lokalisierung in drahtlosen ad-hoc Netzwerken
Dissertation, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, 2014
Impressum
© 2014 Tobias Gädeke
1. Auflage
Umschlaggestaltung, Illustration: Tobias Gädeke
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Paperback: 978-3-8495-9414-5
ISBN Hardcover: 978-3-8495-9415-2
ISBN e-Book: 978-3-8495-9416-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Präzise und skalierbare Lokalisierung in drahtlosen ad-hoc Netzwerken
Zur Erlangung des akademischen Grades eines
DOKTOR-INGENIEURS (Dr.-Ing.)
von der Fakultät für
Elektrotechnik und Informationstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) genehmigte
DISSERTATION
von
Dipl.-Ing. Tobias Gädeke
aus Halle/Saale
Tag der mündlichen Prüfung:
15. Juli 2014
Hauptreferent: Prof. Dr. rer. nat. Wilhelm Stork Korreferent: Prof. Dr.-Ing. Heinz Wörn
Vorwort
Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit am Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Für die Betreuung dieser Arbeit gilt mein Dank in erster Linie Prof. Dr. Wilhelm Stork als Hauptreferent. Besonders habe ich während meiner Zeit am ITIV die hohe Eigenverantwortung und Freiheit für meine wissenschaftliche Arbeit geschätzt. Herrn Prof. Dr. Heinz Wörn danke ich für das Interesse an der Arbeit und die Übernahme des Korreferats. Ein Dank gilt ebenso Prof. Dr. Klaus D. Müller-Glaser für zahlreiche Diskussionen und Anregungen, auch über die Dissertation hinaus.
Den Mitarbeitern am KIT und besonders am ITIV danke ich für die erfolgreiche Zusammenarbeit in vielen gemeinsamen Projekten, bei Publikationen sowie in der Lehre. Insbesondere die vielen fachlichen und überfachlichen Diskussionen mit Johannes Schmid, Carsten Tradowsky, Tobias Schwalb, Frank Hartmann und Lukasz Niestoruk trugen zum Gelingen der Arbeit bei.
Alle Studenten, die ich während meiner Zeit am ITIV betreuen durfte, leisteten ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit. Daher gilt allen Studenten ein großer Dank für die Unterstützung und die abwechslungsreiche Teamarbeit, die mir viel Freude bereitet hat.
Für die finanzielle Förderung danke ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Graduiertenkollegs 1194 “Selbstorganisierende Sensor-Aktor-Netzwerke”. Auch dem Karlsruhe House of Young Scientists (KHYS) danke ich für die finanzielle Unterstützung meines Auslandsaufenthaltes an der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) in Sydney, Australien.
Den Kollegen Mark Hedley, Mark Johnson, Marc Durrenberger, Alija Kajan und Dan Popescu vom CSIRO danke ich für die Aufnahme in ihre Arbeitsgruppe sowie die fachliche und praktische Unterstützung bei der Arbeit mit dem WASP System.
Meiner Familie und meinen Freunden danke ich für die Unterstützung bei der Korrektur des Manuskriptes. Ganz besonders danke ich meiner Frau und meinem Sohn für die Geduld, Unterstützung und das aufgebrachte Verständnis, besonders während arbeitsreicher Zeiten.
Karlsruhe, im August 2014
Tobias Gädeke
Zusammenfassung
Die Lokalisierung von Personen und Geräten stellt in vielen Szenarien ohne verfügbare Satellitennavigation noch immer eine große Herausforderung dar. Beispielsweise werden zur effektiven Koordination und Abwicklung von Rettungsaktionen in Katastrophenszenarien Positionsinformationen von Betroffenen, Rettungskräften und deren Messgeräten benötigt.
Distanzmessungen zwischen Knoten eines selbstorganisierenden Sensornetzwerkes einerseits und Inertialnavigationsansätze andererseits stellen mögliche Ansätze zur Lokalisierung in solchen ad-hoc Szenarien dar, wobei heute ein hoher Bedarf in der Erforschung gesamtsystemischer Zusammenhänge besteht.
In dieser Arbeit wird für die ad-hoc Lokalisierung am Beispiel von Katastrophenszenarien ein neuartiges Lokalisierungssystemkonzept auf Basis von kombinierten Signalstärke- und Laufzeitdistanzmessungen sowie der Fusion von Inertialdaten erarbeitet und untersucht. Dabei erfolgt eine grobe, jedoch skalierbare Lokalisierung durch weniger genaue Signalstärkemessungen, die durch präzise, selektive Laufzeitmessungen unterstützt werden. Die zusätzliche Integration von Inertialdaten erlaubt darüber hinaus auch die Lokalisierung ohne verfügbares Netzwerk über einen begrenzten Zeitraum und steigert neben Genauigkeit und Präzision besonders die Skalierbarkeit.
Zur Evaluation erfolgt eine Charakterisierung und Modellierung mehrerer Systeme mit unterschiedlichen Technologieeigenschaften durch experimentelle Messungen, um größere Szenarien simulativ zu erforschen. Anhand der entwickelten Verfahren wird gezeigt, wie sich die untersuchten Fusionsansätze auf die Steigerung der Gesamtsystemparameter Genauigkeit, Präzision und Skalierbarkeit auswirken. Durch die betrachteten hybriden Ansätze lassen sich dabei die Vorteile der Einzelsysteme nutzen, wobei deren Nachteile in den Hintergrund treten.
Insgesamt können die entwickelten Konzepte als vielversprechende Lösung für die steigenden Anforderungen an ad-hoc Lokalisierungssysteme gesehen werden und stellen eine Grundlage für zukünftige Systeme und Anwendungsfelder dar.
Abstract
In many scenarios where no satellite or other infrastructure-based navigation system is available, localization of persons and devices is still challenging. Rescue activities after severe disasters, e.g., earthquakes, flood or fire are an example where position information of victims, rescue team members and all measurement devices is a crucial source of information for effective coordination and management of available resources.
Distance measurements between nodes in a self-organizing wireless network on one hand and inertial navigation on the other are possible approaches in such ad-hoc scenarios. While there has been a variety of different measurement schemes and system concepts there is still a strong need for research in systemlevel aspects and interdependencies between complementary sub-systems within complex localization and communication systems.
In this thesis, a novel localization system concept for ad-hoc scenarios is developed and evaluated. The hybrid system is based on the fusion of received signal strength and time of flight distance measurements as well as inertial navigation approaches. Within this concept, a rough but very scalable position estimate is obtained from received signal strength measurements which is consecutively refined by precise time of flight measurements on selected links within the wireless network. Additionally, the integration of the inertial navigation approach provides short term localization without the need of any network stabilization. Also it improves accuracy, precision and especially scalability.
The evaluation of the novel concepts is based on multiple systems with different characteristics, e.g., localization accuracy, communication range or system costs. Therefore, in experimental measurement campaigns the characteristic features in terms of their distance-dependent error behavior of the systems are evaluated. Based on the so found aspects larger networks and scenarios are evaluated in simulations. The evaluation shows how the developed fusion methods enhance accuracy, precision and especially scalability. With these new hybrid localization concepts, the advantages of each single system are emphasized, while their drawbacks become negligible.
As a conclusion, the developed concepts present very promising approaches for the increasing demand of ad-hoc localization systems. Therefore, they build a basis for future systems and applications.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Motivation und Umfeld
1.2 Lösungsansatz und eigener Beitrag
1.2.1 Lösungsansatz
1.2.2 Eigener Beitrag
1.3 Aufbau der Arbeit
2 Grundlagen
2.1 Systemtheoretische Grundlagen
2.1.1 Zustandsraummodellierung
2.1.2 Stochastische Zustandsschätzung
2.2 Drahtlose Sensornetzwerke
2.2.1 Aufbau und Definition
2.2.2 Selbstorganisation
2.2.3 Hardware
2.2.4 Betriebssysteme
2.2.5 Zeitsynchronisation
2.2.6 Kommunikationsprotokolle
2.2.7 Simulation
2.3 Lokalisierung und Sensorig
2.3.1 Koordinatensysteme
2.3.2 Lagedarstellung
2.3.3 Inertialsensorik
2.3.4 Lokalisierung
2.3.5 Satellitengestützte Navigation
3 Stand von Forschung und Technik
3.1 Distanzmessverfahren in drahtlosen Netzen
3.1.1 Signalstärke
3.1.2 Laufzeit und Laufzeitdifferenzen
3.1.3 Signaleinfallswinkel
3.2 Lokalisierungsverfahren
3.2.1 Stochastische Modelle und Filter
3.2.2 Graphenbasierte Ansätze
3.2.3 Datenbankbasierte Ansätze
3.2.4 Weitere Ansätze
3.3 Inertialnavigation
3.3.1 Lageschätzung und allgemeine Inertialnavigation
3.3.2 Fußgängerinertialnavigation
3.4 Fusionsansätze
3.4.1 Hybride Positions-/Inertialsysteme
3.4.2 Ansätze zur hybriden Signalstärke-/Laufzeitfusion
4 System- und Lokalisierungskonzept
4.1 Ansatz und Vorgehensweise
4.1.1 Anforderungsanalyse und Definition der Randbedingungen
4.1.2 Methodische Vorgehensweise
4.1.3 Einordnung der Arbeit
4.2 Gesamtsystemkonzept
4.2.1 Überblick
4.2.2 Drahtloses Sensornetzwerk
4.2.3 Integration von Laufzeitmessungen
4.2.4 Inertialmesssysteme
4.2.5 Zentrale Datenhaltung und verteilte Mobilgeräte
4.2.6 Simulative Evaluation
5 Lokalisierungssystem
5.1 Sensornetzwerk Hard- und Softwareplattformen
5.1.1 ITIV LocNode Sensornetzwerk
5.1.2 IEEE 802.15.4a UWB Sensorknoten
5.1.3 Time Domain PulsON 410 UWB System
5.1.4 WASP Lokalisierungssystem
5.2 Inertialsensoren
5.2.1 ITIV Bluetooth IMU
5.2.2 InvenSense MotionFit SDK
5.3 Visualisierung und Netzwerkkoordination
5.3.1 Modellbasierte Netzwerkkoordination
5.3.2 Mobile Lokalisierung und Navigation
5.4 Signalstärke- und Laufzeitdistanzmessung
5.4.1 Signalstärkedistanzmessung mit Time Domain UWB Plattform
5.4.2 Signalstärkedistanzmessung mit DecaWave UWB Plattform
5.4.3 Laufzeitdistanzmessung mit IEEE 802.15.4 Hardware
5.4.4 Signalstärke-Distanz Simulationsmodelle
5.4.5 Signalstärke-Distanz Schätzmodelle
5.4.6 Laufzeit-Distanz Simulationsmodelle
5.4.7 Laufzeit-Distanz Schätzmodelle
5.5 Inertialnavigation
5.5.1 Schrittbasierte Fußgängerkoppelnavigation
5.5.2 Strapdown-Navigationsansätze für Personen und Geräte
5.6 Messdatenfusion
5.6.1 Systemmodellierung
5.6.2 Error State Kalman Filter
5.6.3 Messmodell und Sensoreingänge
5.6.4 Verbindungsselektion
6 Systemcharakterisierung
6.1 Distanzmessungen
6.1.1 Signalstärke-Distanz Messung mit ITIV Sensornetzwerk
6.1.2 Signalstärke-Distanz Messung in schwierigen Umgebungen
6.1.3 Laufzeitdistanzmessungen mit ITIV Sensornetzwerk
6.1.4 Distanzmessungen mit Time Domain UWB System
6.1.5 Distanzmessungen mit DecaWave UWB-System
6.1.6 Distanzmessungen mit WASP System
6.1.7 Übersicht Messfehlercharakterisierung
6.2 Schrittbasierte Inertialnavigation
6.2.1 Experimentelle Evaluation
6.2.2 Performanz- und Fehleranalyse
6.3 Fußbasierte Strapdownnavigation
6.3.1 Performanz der Ultra-Low-Cost Sensorik
6.3.2 Lokalisierungsgenauigkeit
6.3.3 Echtzeitperformanz auf Mobilgerät
7 Hybride Lokalisierung
7.1 Hybride Signalstärke-Inertialdatenfusion
7.1.1 Schrittbasierte hybride Personenlokalisierung
7.1.2 Fußbasierte hybride Personenlokalisierung
7.2 Hybride Laufzeit-Inertialdatenfusion
7.2.1 Hybride Gerätelokalisierung
7.2.2 Überbrückung bei nichtverfügbarem Netzwerk
7.2.3 Inertialdatenfusion zur Skalierbarkeitssteigerung
7.3 Fusion von Signalstärken und Laufzeitmessungen
7.3.1 Hybride Lokalisierung einer Person
7.3.2 Hybride Lokalisierung mehrerer Personen
7.3.3 Hybride Gerätelokalisierung mit IEEE 802.15.4a System
7.3.4 Hybride Lokalisierung in mehreren Gebäuden
7.3.5 Fehleranalyse in Abhängigkeit der Knotenanzahl
8 Bewertung und Diskussion
8.1 Bewertung der Ergebnisse
8.2 Diskussion der Ansätze und Ergebnisse
8.3 Zusammenfassung
8.4 Ausblick
Verzeichnisse
Abbildungsverzeichnis
Bildquellenverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literatur- und Quellennachweise
Betreute studentische Arbeiten
Eigene Veröffentlichungen
1 Einführung
1.1 Motivation und Umfeld
Schon immer bestand ein großes Interesse der Menschheit an Lokalisierungs- und Navigationsverfahren. Die Entwicklung globaler Navigationssatellitensysteme (GNSS) im letzten Jahrhundert stellte dabei einen entscheidenden Technologiefortschritt zur weltweiten Lokalisierung dar. Die Freigabe des Navstar Global Positioning System (GPS) für die zivile Anwendung im Jahr 2000 führte zu einem Aufschwung kostengünstiger Lokalisierungssysteme, die damit auch für Endkunden erschwinglich wurden. Auch Smartphone-Applikationen nutzen immer stärker standortbezogene Dienste (Location-based services, LBS), wobei die Anwendungen durch die Nichtverfügbarkeit von GPS in Gebäuden noch immer auf Außenumgebungen beschränkt sind. Während für die Lokalisierung in Gebäuden zunehmend Lösungen erforscht und entwickelt werden, stellen insbesondere ad-hoc Szenarien, in denen vorab keine Infrastruktur aufgebaut werden kann, eine große Herausforderung dar. In diesen Szenarien muss daher ein System in kurzer Zeit zur Verfügung stehen, das zuverlässig eine temporäre Kommunikations- und Lokalisierungsinfrastruktur bereitstellt.
Eine prominente ad-hoc Anwendungsmöglichkeit stellen Katastrophenszenarien dar, bei denen weitere Herausforderungen in der unbekannten Größe des Areals, das von wenigen Metern bis zu mehreren Kilometern reichen kann, in der unbekannten örtlichen Umgebung und der nicht vorhersehbaren Anzahl involvierter Personen und einzusetzendem Hilfsmaterial liegen. Beispielsweise haben große Nuklearkatastrophen wie 1986 in Tschernobyl oder 2011 in Fukushima Auswirkungen über hunderte Quadratkilometer mit mehreren hunderttausend betroffenen Personen, wobei sich die Auswirkungen über Jahrzehnte erstrecken können. Katastrophen aufgrund von Erdbeben können ebenfalls Auswirkungen auf viele Personen und große Flächen haben, sind üblicherweise im Vergleich zu Nuklearkatastrophen jedoch räumlich begrenzter. Es ist jedoch meist davon auszugehen, dass jegliche Infrastruktur und viele Gebäude, wie in Abbildung 1.1 zu sehen, beschädigt bzw. zerstört sind. Somit wird auch vorheriges Wissen, wie es zum Beispiel aus Kartenmaterial hervorgeht, zum Teil obsolet. Die Operationen zur Katastrophenbewältigung spielen sich dabei sowohl in Gebäuden als auch außerhalb ab, so dass die Lokalisierung allein durch satellitengestützte Navigationssysteme nicht ausreichend ist. Weitere Beispiele für ähnliche Katastrophen mit teilweise zerstörter Infrastruktur der letzten Jahre sind der Einsturz des Stadtarchivs in Köln 2009, der Einsturz einzelner Häuser nach Bränden wie beispielsweise in der Altstadt von Konstanz 2010 (vgl. Abbildung 1.1 rechts) oder auch 2012 die Havarie der Costa Concordia (vgl. Abbildung 1.2 links). Die Bewältigung solcher Katastrophen erfolgt heute noch weitgehend manuell und stellt Helfer, Einsatzleiter und Entscheidungsträger durch einen Mangel an Informationen vor große Herausforderungen.
Abbildung 1.1: Links: Rettungsaktivitäten Verschütteter nach Gebäudeeinsturz durch Erdbeben in Sichuan, China. Rechts: Gebäudeeinsturz nach Brand in der Altstadt von Konstanz.
Ähnliche Anforderungen ergeben sich in sicherheitskritischen Applikationen, in denen Werkzeuge, Maschinen und Personen zu Sicherheitszwecken lokalisiert werden müssen. Dies spielt beispielsweise in der Produktion von Schiffen oder Flugzeugen (siehe Abbildung 1.2 rechts) und beim Bau und Abriss von Gebäuden eine zentrale Rolle. Auch hier kann von einem ad-hoc Szenario ausgegangen werden, da während des Einsatzes die Umgebung ständig Änderungen ausgesetzt ist, so dass ein unterstützendes System im Allgemeinen unabhängig von der Umgebung operieren muss. Neben sicherheitskritischen Aspekten kann in den angesprochenen Anwendungen jedoch auch eine deutliche Produktivitätssteigerung durch Vernetzung und Kommunikation von Informationen erreicht werden. Zu nennen ist hier z. B. eine effizientere Warenlogistik, durch die Warte- und Stillstandszeiten vermieden werden können. Zusätzlich lassen sich weitere Optimierungen durch automatische Routenplanung auch für sperrige und große Waren bzw. autonome Roboter erreichen.
Aus heutiger Sicht gibt es bereits eine Vielzahl an unterschiedlichen Lokalisierungssystemen, wobei viele davon für die stationäre Installation vorgesehen sind und dadurch nicht die Möglichkeit bieten, im ad-hoc Fall in kurzer Zeit an die sich verändernde Umgebung angepasst zu werden. Kostengünstige Systeme, die üblicherweise auf Basis von Signalstärkemessungen eines drahtlosen Netzwerkes oder auch Sensornetzwerkes (Wireless Sensor Network, WSN) arbeiten, eignen sich zwar prinzipiell für ad-hoc Szenarien, bieten jedoch meist nicht die benötigte Genauigkeit. Auf der anderen Seite können Systeme, die durch Messung der Signallaufzeit Distanzschätzungen durchführen, deutlich genauere Ergebnisse liefern, sie sind jedoch auch sehr kostenintensiv. Eine weitere Eigenschaft solcher ad-hoc Systeme ist die Nutzung von Zwei-Wege- oder Umlaufmessungen, was einen Verzicht auf eine synchronisierte Infrastruktur erlaubt. Auf der anderen Seite steigt dadurch bei größeren Netzwerken jedoch die Anzahl der benötigten Messungen rapide, so dass die Verfahren ungünstig skalieren.
Abbildung 1.2: Links: Havarie der Costa Concordia nach Kollision mit Felsen in der Nähe von Giglio, Italien. Rechts: Der Bau von Kreuzfahrtschiffen erfordert ein hohes Maß an Sicherheits-, Vermessungs- und Logistikkonzepten.
Des Weiteren bieten sich für die ad-hoc Lokalisierung Inertialnavigationssysteme an, die durch sukzessive mathematische Integration gemessener Beschleunigungen die Position fortschreiben und dabei ohne Infrastruktur auskommen. Durch die bei der Integration kontinuierlich wachsenden Fehler können sie jedoch nur für begrenzte Zeit zuverlässig eingesetzt werden. Zudem werden heute noch verhältnismäßig teure Sensoren verwendet, so dass die Systeme bisher nur in Spezialanwendungen wirtschaftlich eingesetzt werden können.
1.2 Lösungsansatz und eigener Beitrag
1.2.1 Lösungsansatz
Im Zusammenhang der oben beschriebenen ad-hoc Szenarien wird in dieser Arbeit ein hybrides Gesamtsystemkonzept zur Lokalisierung von Personen und Geräten, basierend auf einem drahtlosen Sensornetzwerk und Inertialsensoren, entwickelt und erforscht. Dazu wird im ad-hoc Einsatzfall ein drahtloses selbstorganisierendes Sensornetzwerk vor Ort ausgebracht, das die grundlegende Kommunikations- und Lokalisierungsinfrastruktur bereitstellt. Als wichtiger zu berücksichtigender Aspekt der Arbeit wird neben der Personenlokalisierung auch die Lokalisierung sämtlicher Geräte und Sensoren betrachtet. Die Anforderungen an die Genauigkeit unterscheiden sich dabei in Hinblick auf die systematischen Fehler, die sich durch wiederholte Messung nicht ausgleichen lassen.
Die Lokalisierung der Netzwerkteilnehmer erfolgt durch ein neuartiges hybrides Lokalisierungskonzept, welches die Präzision und Skalierbarkeit der Positionsschätzung im Vergleich zu bisherigen Ansätzen deutlich verbessert. Dazu erfolgt die Lokalisierung im Netzwerk durch kombinierte Signalstärke- und Laufzeitdistanzmessungen, wobei die Signalstärkemessungen sich durch ihre einzigartige Skalierbarkeit auszeichnen. Zusätzliche selektive Laufzeitmessungen auf ausgewählten Netzwerkverbindungen sorgen für eine höhere Genauigkeit und Präzision der Positionsschätzungen. Zur weiteren Optimierung von Genauigkeit, Präzision und Skalierbarkeit kommen Inertialsensoren zum Einsatz, durch die darüber hinaus auch die Lage der Objekte erfasst und die Lokalisierung auch bei nicht verfügbarem Netzwerk gewährleistet wird.
Zur Untersuchung der entwickelten Konzepte werden systemrelevante Teilsysteme aufgebaut und experimentell charakterisiert. Aus der Charakterisierung werden Simulationsmodelle für die Modellierung größerer Szenarien und Fragestellungen abgeleitet. Szenarien, die sich aufgrund von Größe, Komplexität und Kosten mit dem Experimentalsystem nicht untersuchen lassen, werden durch diesen Ansatz simulativ erforscht.
Hierzu werden insbesondere die Distanzmessungen durch Signalstärken und Laufzeitmessungen in unterschiedlichen Umgebungen experimentell durchgeführt und charakterisiert. Die Vielfalt an unterschiedlichen Funksystemen am Markt und in der Forschung führt zu vollkommen unterschiedlichen Eigenschaften bezogen auf die erzielbaren Genauigkeiten, Reichweiten und Kosten der Systeme. Um dennoch die grundlegende Anwendbarkeit und den Gewinn der entwickelten Ansätze aufzeigen zu können, werden Messungen mit ausgewählten charakteristischen Systemen durchgeführt. Der Ansatz unterscheidet sich damit grundlegend von bisherigen Ansätzen, in denen einzelne Systeme oder Abschätzungen durch Simulationen betrachtet wurden. Auf Basis der Charakterisierung und Eigenschaften der Systeme werden mögliche Datenfusionsstrategien diskutiert und anhand des entwickelten Informationsverarbeitungskonzeptes implementiert und untersucht.
Ein weiterer wesentlicher Baustein des Gesamtsystemkonzeptes stellt die Inertialnavigation dar, um auch beim Aufbau des Netzwerkes und schlechter Netzwerkabdeckung die Lokalisierung zu ermöglichen und gleichzeitig Skalierbarkeit und Präzision zu erhöhen. Hierzu wird über den Stand der Technik hinaus erstmals die Integration miniaturisierter Ultra-Low-Cost Inertialsensorik, wie sie bisher im Smartphone Markt eingesetzt wird, zur fußbasierten Fußgängerinertialnavigation untersucht. Bisherige Ansätze nutzen dagegen noch immer Sensorik, deren Kosten üblicherweise über dem 100-fachen der untersuchten Sensoren liegen, so dass die Systeme sich nur für den Einsatz in Spezialanwendungen eignen.
Neben der Lokalisierung stellt auch die Netzwerkkommunikation und -verwaltung sowie die Informationsverarbeitung einen wichtigen Aspekt im Gesamtsystemkonzept dar. Hierbei kommt ein neuartiger modellbasierter Ansatz zur Netzwerkverwaltung zum Einsatz, der die Entwicklung und Steuerung des Systems in einem durchgängigen Entwicklungsfluss erlaubt, wodurch sich Zeit und Kostenersparnisse ergeben. Zur Visualisierung und Kommunikation der mobilen Teilnehmer kommen Mobilgeräte (Smartphones) zum Einsatz, die um die notwendige Hardware zur Integration ins Netzwerk erweitert werden.
1.2.2 Eigener Beitrag
Der Beitrag dieser Arbeit ist die systemische Untersuchung eines neuartigen ad-hoc Lokalisierungssystemkonzeptes. Weitere Beiträge leiten sich aus der Konzeption und Entwicklung der einzelnen Subsysteme und deren Zusammenspiel ab. Die wesentlichen Beiträge der Arbeit liegen einerseits im Gesamtsystemkonzept, andererseits in den untergeordneten Teilsystemen und Evaluationen und lassen sich anhand der folgenden Aspekte verdeutlichen:
Gesamtsystemkonzept In der Arbeit wird ein Gesamtsystemkonzept bestehend aus Hardware- und Softwarekomponenten sowie Datenfusionsstrategien zur Lokalisierung und Kommunikation in ad-hoc Szenarien entwickelt. Darin bildet ein drahtloses Sensornetzwerk die Ausgangsbasis zur Kommunikation und Distanzmessung zwischen beteiligten Sensorknoten. Des Weiteren verfügt ein Sensorknoten über integrierte Inertialsensoren und Algorithmen zur dezentralen Datenfusion.
Selektive Fusion von Distanzmessungen Zur Distanzmessung zwischen den Sensorknoten werden Signalstärken und Signallaufzeiten genutzt, wobei die Fusion der Laufzeitmessungen selektiv auf Basis der dezentralen Positionsschätzung erfolgt. Durch die Selektion zeigt die Arbeit gegenüber Ansätzen des Standes der Technik Verbesserungen in der Skalierbarkeit des Netzwerkes ohne dabei die Genauigkeit zu beeinträchtigen.
Fußgängerinertialnavigation durch Ultra-Low-Cost Sensorik Diese Arbeit zeigt, dass sich mit Ultra-Low-Cost Sensoren, wie sie in aktuellen Smartphones eingesetzt werden, vergleichbare Lokalisierungsergebnisse wie mit bisher eingesetzten, teuren mikro-elektro-mechanischen Sensoren erzielen lassen. Dabei lassen sich die Kosten für die Sensorik um mehr als einen Faktor von 100 senken. Die entwickelte Hardware nutzt dabei über den Stand der Technik hinaus zur Positionsstabilisierung auch einen integrierten barometrischen Drucksensor und die Anbindung an ein drahtloses Sensornetzwerk.
Konzepte zu mobilen und zentralen Benutzerschnittstellen Als Teil des Gesamtsystems werden in dieser Arbeit auch Konzepte zur Benutzerintegration und entsprechenden Schnittstellen betrachtet. Dabei kommen mobile Endgeräte und eine zentrale, modellbasierte Netzwerkkoordination zum Einsatz. Im Zusammenhang von drahtlosen ad-hoc Sensornetzwerken stellt die Einbindung der mobilen Endgeräte einen neuartigen Aspekt dar.
Skalierbarkeitssteigerung durch Inertialnavigation Diese Arbeit untersucht, inwieweit die Inertialnavigation neben der Stützung der Positionsschätzung auch zur Steigerung der Skalierbarkeit beitragen kann. Dabei wird gezeigt, wie durch die Überbrückung eines Zeitraums von mehreren Sekunden bis einigen Minuten die Aktualisierungsrate des Netzwerkes reduziert werden kann. Bei gleichbleibender Lokalisierungsgenauigkeit wird damit die Skalierbarkeit des Gesamtsystems im Vergleich zu aktuellen Ansätzen deutlich erhöht.
Optimierung im Gesamtsystemzusammenhang In bisherigen Arbeiten zu ad-hoc Lokalisierungssystemen stand üblicherweise die Optimierung eines Parameters, vorwiegend der Lokalisierungsgenauigkeit, im Fokus. In dieser Arbeit erfolgt im Rahmen einer Gesamtsystembetrachtung eine multikriterielle Optimierung des Systems, wobei durch die Fusion insbesondere die Faktoren Präzision und Skalierbarkeit im Vergleich zu bisherigen Ansätzen verbessert werden.
Untersuchung und Vergleich anhand von unterschiedlichen Systemen Bisherige Arbeiten untersuchten die entwickelten Konzepte allein an einem Zielsystem. Diese Arbeit hat das Ziel, fundamentale Ansätze für eine Vielzahl möglicher Systeme experimentell und simulativ zu erforschen. Die Evaluation erfolgt daher ebenfalls anhand unterschiedlicher Systeme und Szenarien, um den eigenen Beitrag zu verdeutlichen.
1.3 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist folgendermaßen gegliedert. Kapitel 1 gibt eine Übersicht und Motivation über das Themenfeld der Arbeit. Dabei wird der Lösungsansatz vorgestellt und der eigene Beitrag herausgehoben. In Kapitel 2 werden die in dieser Arbeit verwendeten mathematischen und technischen Grundlagen beschrieben. Dies sind insbesondere systemtheoretische Grundlagen und ein Überblick über drahtlose Sensornetzwerke sowie die benötigten Grundlagen der Lokalisierung und Sensorik. Weiterführend erfolgt in Kapitel 3 eine Betrachtung des aktuellen Standes von Forschung und Technik. Es werden zunächst Ansätze der Distanzschätzung und Lokalisierungsverfahren betrachtet und des Weiteren aktuelle Ansätze der Inertialnavigation und Fusionsstrategien vorgestellt.
Basierend auf dem Stand der Technik erfolgt in Kapitel 4 die Konzeptentwicklung, wobei die Problemstellung konkretisiert und die Herangehensweise konzipiert wird. Dazu zählt eine Anforderungsanalyse, die Definition von Randbedingungen sowie der methodischen Vorgehensweise. Des Weiteren erfolgt die Definition des Gesamtsystemkonzeptes und dessen Subsystemen. Kapitel 5 beschreibt die Umsetzung des Lokalisierungssystems, die sich aus der Hardware, Software und Informationsverarbeitung zusammensetzt. Dies sind im Einzelnen die Komponenten und Plattformen des Sensornetzwerkes zur drahtlosen Distanzmessung und Kommunikation, die entwickelten und verwendeten Inertialsensoreinheiten sowie die zentrale Netzwerkkoordination und Visualisierung. Auf Seiten der Informationsverarbeitung werden die Verfahren der Distanz- und Inertialmessung im Detail beschrieben sowie die detaillierten Fusionsstrategien entwickelt.
Kapitel 6 beschreibt die experimentelle Charakterisierung des Systems und stellt die verschiedenen Distanzmessverfahren und Inertialnavigationsansätze gegenüber. Bei den Distanzmessverfahren wird unterschieden zwischen Signalstärke- und Laufzeitdistanzmessungen mit unterschiedlichen Hardwareplattformen. Bei der Inertialnavigation werden insbesondere Ansätze mit am Fuß bzw. Körper getragenen Inertialsensoren verglichen und deren Anwendbarkeit diskutiert.
Die Fusion der Einzelsysteme wird in Kapitel 7 betrachtet, wobei sich die Untersuchungen in drei zentrale Bereiche einteilen. Dies ist einerseits die hybride Signalstärke-Inertialdatenfusion für Personen, die Laufzeit-Inertialdatenfusion für die Lokalisierung von Geräten und Sensoren sowie die hybride Signalstärke-Laufzeitdatenfusion für Geräte und Personen.
In Kapitel 8 erfolgt eine Diskussion und Bewertung der Ergebnisse in Bezug auf die Anwendungsszenarien und den Stand der Technik. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.





























