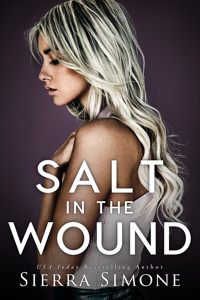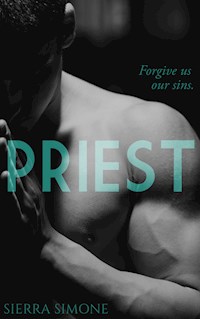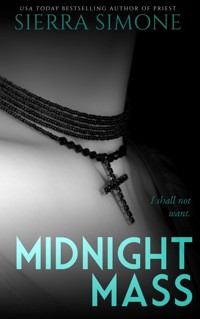6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Der TikTok-Hype-Roman von der New-York-Times-Bestseller-Autorin auf Deutsch!
Es gibt viele Regeln, die ein Priester nicht brechen darf. Ein Priester darf nicht heiraten. Ein Priester darf seine Gemeinde nicht im Stich lassen. Ein Priester darf seinen Gott nicht verlassen. Ich war immer so gut darin, Regeln zu befolgen. Bis sie kam und ich neue Regeln lernte. Mein Name ist Tyler Anselm Bell. Ich bin 29 Jahre alt. Vor sechs Monaten habe ich mein Keuschheitsgelübde gebrochen, auf dem Altar meiner eigenen Kirche. Und so wahr mir Gott helfe, ich würde es wieder tun. Ich bin ein Priester, und das ist meine Beichte.
"Heiß. Wie. Die Sünde." (Lauren Blakely)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Vorwort
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Impressum
SIERRA SIMONE
PRIEST
Eine Liebesgeschichte
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Antje Engelmann
Zu diesem Buch
Es gibt viele Regeln, die ein Priester nicht brechen darf.
Ein Priester darf nicht heiraten. Ein Priester darf seine Gemeinde nicht im Stich lassen. Ein Priester darf seinen Gott nicht verlassen.
Ich war immer so gut darin, Regeln zu befolgen.
Bis sie kam und ich neue Regeln lernte.
Mein Name ist Tyler Anselm Bell. Ich bin 29 Jahre alt. Vor sechs Monaten habe ich mein Keuschheitsgelübde gebrochen, auf dem Altar meiner eigenen Kirche. Und so wahr mir Gott helfe, ich würde es wieder tun.
Ich bin ein Priester, und das ist meine Beichte.
Für die Dirty Laundry Girls und die Literary Gossip Posse – schwer zu sagen, wer von uns den schlechten Einfluss auf die anderen ausübt. Lasst uns so bleiben, wie wir sind.
Und für Laurelin, mit der ich viele theologische Debatten zu später Stunde geführt und so manche Sonntagspredigt besucht habe. Wir sind auf der gleichen Wellenlinie.
Vorwort
Den Großteil meines Lebens war ich gläubige Katholikin, und obwohl ich inzwischen nicht mehr katholisch bin, empfinde ich weiter größte Wertschätzung und Achtung für die katholische Kirche. Zwar gibt es die Stadt Weston wirklich (und sie ist reizvoll), doch die Gemeinde St. Margaret und Pater Bell sind Erfindungen meiner Fantasie.
Dieser Roman ist rein fiktiv und dient nur zur Unterhaltung. Zudem enthält er einige meiner persönlichen Ansichten über die Schnittmenge von Sex und Spiritualität, soll aber weder beleidigen noch provozieren. Dies vorausgeschickt, handelt mein Roman von einem katholischen Priester, der sich verliebt. Es geht darin um Sex und noch mehr Sex, und zweifellos enthält er einiges an Blasphemie.
Sie sind also gewarnt.
Prolog
Es gibt viele Regeln, die ein Priester nicht brechen darf.
Ein Priester darf nicht heiraten. Ein Priester darf seine Gemeinde nicht im Stich lassen, darf das Vertrauen nicht enttäuschen, das sie in ihn setzt.
Diese Regeln erscheinen selbstverständlich, und ich führe sie mir vor Augen, während ich meine Albe schürze. Es sind Regeln, nach denen zu leben ich gelobe, während ich mein Messgewand überstreife und meine Stola zurechtrücke.
Ich war immer gut darin, Regeln zu befolgen.
Bis sie kam.
Mein Name ist Tyler Anselm Bell. Ich bin neunundzwanzig Jahre alt und habe Klassische Philologie und Theologie studiert. Vor drei Jahren wurde ich zum Priester geweiht und bin seitdem in dieser Gemeinde. Es gefällt mir hier sehr.
Vor einigen Monaten habe ich mein Keuschheitsgelübde gebrochen, auf dem Altar meiner eigenen Kirche. Und so wahr mir Gott helfe: Ich würde es wieder tun.
Ich bin ein Priester, und das ist meine Beichte.
1
Die Beichte ist bekanntlich das unbeliebteste Sakrament. Warum das so ist, darüber hatte ich so manche Theorie: weil sie den Stolz verletzt oder lästig ist oder als Verlust geistiger Unabhängigkeit empfunden wird. Aber im Moment neigte ich dazu, den Beichtstuhl selbst für die Unbeliebtheit verantwortlich zu machen.
Ich verabscheute ihn, seit ich ihn gesehen hatte, dieses altmodische, massige Ding aus den dunklen Zeiten vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Meine Kirche in Kansas City, wo ich aufgewachsen bin, hatte ein Beichtzimmer, sauber, hell und geschmackvoll, mit bequemen Stühlen und einem großen Fenster in den Pfarrgarten.
Dieser Beichtstuhl war das krasse Gegenteil jenes Zimmers – beengt und förmlich, aus dunklem Holz und voll von überflüssigem Geschnörkel. Ich bin nicht klaustrophobisch, aber dieser Verschlag könnte mich dazu machen. Mit gefalteten Händen dankte ich Gott für den Erfolg unserer letzten Spendenaktion. Noch zehntausend Dollar, dann würden wir St. Margaret in Weston, Missouri, renovieren und in etwas verwandeln können, das einer modernen Kirche immerhin ähnelte. Dann würde es in der Vorhalle keine auf Holz getrimmten Plastikverkleidungen mehr geben und keinen roten Teppich, der zwar Weinflecken kaschiert, aber eine furchtbare Atmosphäre schafft. Es würde Fenster geben, Licht und Modernität. Zugeteilt wurde ich dieser Gemeinde ihrer quälenden Vergangenheit wegen … und meiner eigenen. Über diese Vergangenheit hinwegzukommen, würde mehr erfordern als die Renovierung des Gebäudes, doch ich wollte den Mitgliedern meiner Gemeinde zeigen, dass die Kirche sich ändern, dass sie wachsen und sich in die Zukunft bewegen konnte.
»Muss ich Buße tun, Pater?«
Ich war in Gedanken gewesen – zugegebenermaßen eine Schwäche von mir. Täglich betete ich darum, sie beheben zu können (sofern ich daran dachte).
»Das dürfte nicht nötig sein.« Obwohl ich durch das verzierte Gitter nicht viel sehen konnte, hatte ich meinen Büßer erkannt, kaum dass er in den Beichtstuhl getreten war: Rowan Murphy, ein Mathematiklehrer mittleren Alters und leidenschaftlicher Polizeifunkhörer. Er war mein einziges Beichtkind, das zuverlässig sein Gewissen erleichtern kam, und seine Sünden reichten von Neid (der Schuldirektor hatte dem anderen Mathelehrer eine Gehaltserhöhung gegeben) bis zu unkeuschen Gedanken (an die Rezeptionistin eines Fitnessstudios in Platte City). Zwar war mir klar, dass einige Geistliche noch immer den alten Regeln für die Buße folgten, doch ich gehörte nicht zu denen, die ihren Schäfchen auftrugen, zwei »Ave Maria« zu beten und am nächsten Morgen in die Messe zu kommen. Rowans Sünden entsprangen seiner Unruhe, seiner Stagnation, und alles Entlanghangeln am Rosenkranz würde nichts fruchten, wenn er sich nicht den Wurzeln seines Zustands zuwandte.
Das wusste ich, weil ich seinen Zustand kannte.
Außerdem mochte ich Rowan. Er war auf verschmitzte, überraschende Weise humorvoll und einer von denen, die Tramper einluden, auf seinem Sofa zu übernachten, und ihnen morgens beim Abschied noch einen Rucksack mit Lebensmitteln und eine neue Decke in die Hand drückten. Ich wollte, dass er guter Dinge und ausgeglichen war, wollte erleben, wie er aus dem, was ihn umtrieb, ein erfüllteres Dasein kelterte.
»Nein, keine Buße, aber eine kleine Aufgabe habe ich für Sie«, sagte ich. »Denken Sie über Ihr Leben nach. Sie haben einen starken Glauben, aber kein Ziel im Leben. Wofür brennen Sie, neben der Kirche? Wofür stehen Sie morgens auf? Was stiftet Ihrem täglichen Tun und Trachten Sinn?«
Rowan antwortete nicht, doch ich hörte ihn auf eine Weise atmen, die von Nachdenken zeugte.
Danach beteten wir das Vaterunser, ich segnete ihn, und dann war Rowan verschwunden, um wieder zu unterrichten. Wie seine Mittagspause war auch meine Beichtstunde fast vorüber. Um mich zu vergewissern, prüfte ich die Uhrzeit auf meinem Handy und wollte schon aufbrechen, da hörte ich die Tür zum Beichtstuhl aufgehen. Jemand setzte sich, und auch ich ließ mich wieder nieder und verkniff mir ein Seufzen. Diesen Nachmittag hatte ich ausnahmsweise frei, und darauf hatte ich mich gefreut. Außer Rowan kam nie jemand zur Beichte. Niemand. Und gerade an diesem Tag, an dem ich endlich mal früh aus dem Dienst kommen und das herrliche Wetter nutzen wollte …
Konzentriere dich, befahl ich mir.
Jemand räusperte sich. Eine Frau.
»Ich, äh, ich hab so was noch nie gemacht.« Ihre Stimme war leise und verführerisch und klang wie ein akustisches Pendant zum Mondschein.
»Ach.« Ich lächelte. »Eine Anfängerin.«
Das trug mir ein kurzes Lachen ein. »Ja, ich schätze, das bin ich. Beichten, das kenne ich nur aus Filmen. Ist nun der Moment, wo ich sage: ›Vergeben Sie mir, Pater, denn ich habe gesündigt‹?«
»Beinahe. Erst schlagen wir das Kreuz. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes …« Ich hörte, wie sie die Worte mit mir sprach. »Und jetzt sagen Sie mir, wann Sie das letzte Mal gebeichtet haben und …«
»Noch nie«, unterbrach sie mich. Sie klang jung, aber nicht zu jung. Als wäre sie in meinem Alter oder etwas jünger. Und ihre Stimme hatte die akzentfreie Eile der Großstadt, nicht den gemütlichen Südstaaten-Tonfall, den man hier im ländlichen Missouri mitunter zu hören bekam. »Ich, äh, ich hab die Kirche gesehen, vom Weinladen gegenüber. Und ich wollte … Na ja, mir liegt einiges auf der Seele. Sonderlich religiös war ich nie, aber ich dachte, vielleicht …« Sie verstummte und holte dann unvermittelt Luft. »Das war dumm von mir. Ich sollte gehen.« Ich hörte sie aufstehen.
»Hier geblieben«, sagte ich und erschrak über mich selbst. Solche Befehle gab ich sonst nie. Nicht mehr jedenfalls.
Konzentriere dich!
Sie setzte sich wieder, und ich hörte sie an ihrer Tasche nesteln.
»Das war nicht dumm von Ihnen«, sagte ich freundlicher. »Wir schließen hier ja keinen Vertrag. Sie versprechen mir nicht, bis an Ihr Lebensende jede Woche in die Messe zu gehen. Dies ist nur ein Moment, in dem Ihnen zugehört wird. Von mir … von Gott … vielleicht sogar von Ihnen selbst. Sie sind gekommen, weil Ihnen daran liegt, und ich kann Ihnen diesen Moment verschaffen. Also bleiben Sie bitte.«
Sie atmete langsam aus. »Aber ich … Die Dinge, die mich belasten … ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt jemandem erzählen soll. Dazu noch jemandem wie Ihnen.«
»Weil ich ein Mann bin? Möchten Sie lieber mit einer Pfarrhelferin sprechen?«
»Doch nicht deshalb.« Ihre Stimme verriet ihr Lächeln. »Sondern weil Sie Priester sind.«
Ich erlaubte mir eine Vermutung. »Sind die Dinge, die Sie belasten, fleischlicher Natur?«
»Fleischlich.« Sie lachte, ein üppiges, melodisches Lachen. Unwillkürlich überlegte ich, wie sie aussehen mochte – ob sie blass oder braun gebrannt war, kurvenreich oder schlank, ob ihre Lippen zart oder voll waren.
Nein. Ich musste mich konzentrieren. Und zwar nicht darauf, wie ihre Stimme mich unvermittelt dazu brachte, mich mehr als Mann denn als Priester zu fühlen.
»Fleischlich«, wiederholte sie. »Das klingt unfassbar beschönigend.«
»Sie können so allgemein bleiben, wie Sie mögen. Egal, was Sie sagen – Sie sollen sich nicht unwohl fühlen.«
»Das Gitter hilft«, gab sie zu. »Es ist angenehmer, Sie nicht zu sehen mit, na ja, mit der Robe und all dem Zeug.«
Nun war ich es, der lachte. »Wir tragen die Robe ja nicht immer.«
»Ach. Wieder geht eine Vorstellung dahin. Was tragen Sie denn gerade?«
»Ein schwarzes, langärmliges Hemd mit weißem Kollar. Wie so ein Stehkragen aussieht, wissen Sie ja aus dem Fernsehen. Und dazu Jeans.«
»Jeans?«
»Ist das so schockierend?«
Ich hörte, wie sie sich an die Beichtstuhlwand lehnte. »Ein bisschen. Es klingt, als wären Sie ein echter Mensch.«
»Nur werktags von neun bis fünf.«
»Gut, dass man Sie nicht unter der Woche ins Gemüsefach des Kühlschranks packt oder so.«
»Man hat es versucht. Aber es gab zu viel Kondenswasser.« Ich hielt inne. »Und falls es Sie beruhigt: Normalerweise trage ich Stoffhosen.«
»Das klingt sehr viel priesterlicher.« Es entstand eine lange Stille. »Was wäre, wenn … Haben Sie manchmal Leute im Beichtstuhl, die etwas wirklich Böses getan haben?«
Darauf gab ich eine vorsichtige Antwort. »Vor Gott sind wir allzumal Sünder. Auch ich. Es geht nicht darum, Ihnen Schuldgefühle zu vermitteln oder das Ausmaß Ihrer Sünden zu quantifizieren, sondern …«
»Kommen Sie mir nicht mit solchem Seminaristengefasel«, unterbrach sie mich barsch. »Ich stelle Ihnen eine echte Frage. Ich habe etwas Böses getan. Etwas wirklich Böses. Und ich weiß nicht, was nun geschieht.«
Ihre Stimme brach beim letzten Wort, und zum ersten Mal seit meiner Priesterweihe hatte ich das Bedürfnis, auf die andere Seite des Beichtstuhls zu gehen und mein Beichtkind in die Arme zu nehmen. In einem modernen Beichtzimmer wäre das möglich gewesen, in dieser altüberkommenen Nische des Todes hingegen hätte es etwas Beunruhigendes und Genierliches gehabt.
Doch in ihrer Stimme … lagen echte Qual, Ungewissheit und Verwirrung. Und ich wollte, dass sie sich besser fühlte.
»Ich muss wissen, dass alles gut wird«, fuhr sie leise fort. »Dass ich mit mir selbst klarkommen werde.«
Unvermittelt zog etwas in meiner Brust. Wie oft hatte ich diese Worte hinauf zur Decke meiner Pfarrhauswohnung geflüstert, wenn ich schlaflos dalag und mich in Gedanken daran verzehrte, was mein Leben hätte sein können? Ich muss wissen, dass alles gut wird.
Ging es denn nicht uns allen so? War das nicht der unterdrückte Schrei unserer gebrochenen Seelen?
Bei der Antwort hielt ich mich nicht mit den üblichen Versicherungen und seelsorgerischen Plattitüden auf, sondern erklärte stattdessen ehrlich: »Ich weiß nicht, ob alles gut wird. Vielleicht nicht. Vielleicht glauben Sie sich jetzt am Tiefpunkt angekommen, und wenn Sie eines Tages aufschauen, stellen Sie fest, dass alles noch viel schlimmer geworden ist.« Ich sah auf meine Hände – Hände, die meine Schwester von dem Seil befreit hatten, mit dem sie sich in der Garage unserer Eltern erhängt hatte. »Gut möglich, dass Sie morgens nie mehr mit dieser Gewissheit aufstehen können. Vielleicht spüren Sie nie wieder einen Moment tiefen Einverständnisses. Sie können nur versuchen, ein neues Gleichgewicht zu finden, einen neuen Ausgangspunkt. Suchen Sie die Liebe, die in Ihrem Leben übrig ist, und halten Sie sich daran fest. Eines Tages sind die Dinge dann nicht mehr so grau und düster. Eines Tages stellen Sie womöglich fest, dass Sie wieder ein Leben haben. Ein Leben, das Ihnen Freude macht.«
Ich hörte sie nach Luft schnappen, als versuchte sie, nicht in Tränen auszubrechen.
»Ich … danke Ihnen«, sagte sie. »Vielen Dank.«
Kein Zweifel: Sie weinte. Ich hörte sie ein Taschentuch aus der Packung nesteln, die dafür im Beichtstuhl lag. Durch das Gitter nahm ich nur verschwommene Bewegungen wahr und glaubte, dunkles, glänzendes Haar und sehr helle Haut auszumachen.
Etwas wirklich Niederträchtiges und Böses in mir wollte ihre Beichte dennoch hören, nicht um ihr bessere Ratschläge zu geben und bessere Beruhigung zu spenden, sondern um zu erfahren, welche fleischlichen Sünden dieses Mädchen zu bereuen hatte. Ich wollte sie diese Dinge mit ihrer rauchigen Stimme flüstern hören, wollte sie in meine Arme nehmen und jede einzelne Träne wegküssen.
Großer Gott, ich wollte sie berühren!
Was war nur los mit mir? Seit drei Jahren hatte ich keine Frau so rückhaltlos begehrt. Dabei hatte ich nicht mal ihr Gesicht gesehen! Und ihren Namen kannte ich auch nicht.
»Ich muss gehen«, wiederholte sie. »Danke für Ihre Worte. Sie haben die Dinge … erschütternd treffsicher auf den Punkt gebracht. Danke.«
»Warten Sie …«, begann ich, doch die Beichtstuhltür ging auf, und weg war sie.
Den ganzen Tag über dachte ich an meine rätselhafte Büßerin: während ich die Predigt für die Sonntagsmesse vorbereitete, während ich die Bibelstunde für Männer abhielt, während ich meine Abendgebete versah. Ich dachte an das kurze Aufblitzen ihres schwarzen Haars, an ihre rauchige Stimme. Etwas an ihr … was war es? Es war ja nicht so, dass mein Leib seit der Priesterweihe abgestorben war – ich fühlte mich durchaus noch immer als Mann. Als ein Mann, der liebend gern gevögelt hatte, bevor ihn seine Berufung ereilte.
Und Frauen nahm ich noch immer wahr, war inzwischen aber ziemlich versiert darin, meine Gedanken von allem Sexuellen fernzuhalten. Das Zölibat war in den letzten Jahren zu einem Zankapfel in der Priesterschaft geworden, doch ich hielt mich weiter streng daran. Besonders angesichts dessen, was meiner Schwester widerfahren war. Und angesichts dessen, was sich in dieser Gemeinde vor meiner Ankunft zugetragen hatte.
Dass ich die Zurückhaltung in Person war, hatte höchste Priorität. Die Art von Priester, die Vertrauen einflößte. Und dazu gehörte, mich öffentlich wie privat ungemein besonnen zu verhalten, wenn es um Sex ging.
Obwohl mir ihr rauchiges Lachen also den Rest des Tages in den Ohren hallte, unterdrückte ich entschlossen jeden Gedanken an ihre Stimme und oblag meinen Pflichten – mit der einzigen Ausnahme, dass ich einen Rosenkranz (oder zwei) für die Frau betete und dabei an ihre flehentliche Bitte dachte. Ich muss wissen, dass alles gut wird.
Ich hoffte, Gott sei mit ihr – wo sie auch steckte – und tröste sie, wie er mich so oft getröstet hatte.
Den Rosenkranz in der Faust, schlief ich ein, als wäre er ein Amulett zur Abwehr unerwünschter Gedanken.
In meiner kleinen, überalterten Gemeinde gibt es ein, zwei Beisetzungen pro Monat, aber nur vier, fünf Hochzeiten im Jahr, fast jeden Tag eine Frühmesse und sonntags mehrere Gottesdienste. Dreimal wöchentlich leite ich Bibelstunden, an einem Abend bin ich bei der Jugendgruppe, und täglich außer Donnerstag habe ich Sprechstunde für die Gemeindemitglieder. Zudem jogge ich jeden Morgen mehrere Kilometer und zwinge mich, täglich fünfzig Seiten zu lesen, in denen es nicht um Kirche oder Religion geht.
Und ich verbringe viel Zeit auf einer The Walking Dead-Website. Zu viel Zeit. Gestern war ich bis zwei Uhr nachts wach und habe mit einem Sonderling diskutiert, ob man einen Zombie mit der Wirbelsäule eines anderen Zombies töten kann.
Natürlich nicht – bei diesen Wesen sind die Knochen ja weitgehend degeneriert.
Für einen Gottesmann in einer verschlafenen Kleinstadt des Mittleren Westens bin ich also ziemlich beschäftigt, und so mag man mir die Überraschung verzeihen, die ich empfand, als die Frau die Woche darauf wieder in meinen Beichtstuhl kam.
Rowan war gerade gegangen, und auch ich wollte den Beichtstuhl verlassen, als die andere Tür aufging und jemand hineinschlüpfte. Ich dachte, es sei noch mal Rowan, der mitunter umkehrte, weil ihm eine weitere lässliche Sünde eingefallen war, die er zu beichten vergessen hatte.
Aber nein. Es war die rauchige, wissende Stimme, die mich in der Vorwoche veranlasst hatte, zusätzliche Rosenkränze zu beten.
»Ich bin’s wieder.« Sie lachte angespannt. »Ähm, die Nichtkatholikin?«
Meine Antwort klang tiefer als beabsichtigt, abgehackter. Diesen Ton hatte ich schon lange keiner Frau gegenüber mehr angeschlagen. »Ich erinnere mich an Sie.«
»Oh.« Sie klang etwas überrascht, als hätte sie damit nicht gerechnet. »Das ist gut, schätze ich.«
Sie setzte sich etwas anders hin, und durch das Gitter sah ich schemenhaft ihr dunkles Haar und ihre helle Haut und ganz kurz roten Lippenstift.
Auch ich setzte mich unwillkürlich etwas anders hin, plötzlich hellwach und übersensibel. Ich fühlte meine maßgeschneiderte Stoffhose (ein Geschenk meiner beruflich erfolgreichen Brüder), das Hartholz, auf dem ich saß, und meinen Stehkragen, der auf einmal zu eng saß, viel zu eng.
»Sie sind Pater Bell, oder?«, fragte sie.
»So ist es.«
»Ich habe Ihr Bild auf der Website gesehen. Nach unserem Gespräch letzte Woche dachte ich, es wäre leichter, wenn ich wüsste, wie Sie heißen und wie Sie aussehen. Um mit einer Person zu sprechen, nicht mit einer Wand.«
»Und, ist es leichter?«
Sie zögerte. »Eigentlich nicht.« Aber sie äußerte sich dazu nicht weiter, und ich fragte sie nicht, vor allem weil ich mich fernhalten wollte von dem Heer ungeheurer Sehnsüchte, die sich in meinem Bewusstsein drängten.
Nein, du darfst sie nicht nach ihrem Namen fragen.
Nein, du darfst ihre Beichtstuhltür nicht öffnen und nachschauen, wie sie aussieht.
Nein, du darfst sie nicht bitten, dir von ihren fleischlichen Sünden zu erzählen.
»Sind Sie bereit?« Ich gab mir alle Mühe, wieder an die anstehende Aufgabe zu denken, die Beichte.
Mach schön Dienst nach Vorschrift, Tyler.
»Ja«, flüsterte sie. »Ich bin bereit.«
2
Poppy
Ich hab also diesen Job. Hatte ihn, sollte ich sagen, denn mittlerweile mach ich was anderes, aber bis vor einem Monat hab ich an einem Ort gearbeitet, den man als … sündig bezeichnen kann. Das ist wohl das richtige Wort, obwohl ich mich bei meiner Arbeit nie sündig fühlte. Vermutlich denken Sie, darum bin ich hier – und in gewisser Hinsicht ist es auch so –, aber das Gefühl, ich müsste das jemandem beichten, kommt eher daher, dass ich nicht das Gefühl habe, es überhaupt beichten zu müssen. Ergibt das Sinn? Ich sollte mich vermutlich für das schämen, was ich getan und womit ich mein Geld verdient habe, aber ich schäme mich ganz und gar nicht, weiß aber, dass das irgendwie falsch ist.
Ich bin übrigens keine Nutte, falls Sie das vermuten.
Wissen Sie, wofür ich mich auch schämen sollte? Dafür, vieler Leute Zeit und Geld verschwendet zu haben. Die Zeit und das Geld meiner Eltern vor allem, aber auch Sie – einen Menschen, den ich nicht kenne –, auch Sie halte ich auf und bringe Sie dazu, meiner Misere zu lauschen und Ihre Zeit und das Geld Ihrer Kirche zu vergeuden. Sehen Sie? Ich bringe Unglück, wohin ich komme.
Mein Problem liegt auch darin, dass es seit jeher einen Teil meiner Persönlichkeit gibt … oder eigentlich keinen Teil, eher eine Schicht, ähnlich dem Jahresring eines Baums. Und egal, wohin ich gehe und was ich tue – diese Schicht ist immer da. Und passte weder zu meinem alten Leben in Newport noch zu meinem neuen Leben in Kansas City. Inzwischen habe ich begriffen, dass sie nirgendwo dazu passt, doch was heißt das? Bedeutet es, dass ich nirgendwohin passe? Sondern dazu bestimmt bin, allein und verabscheuenswert zu sein, weil ich diesen Dämon mit mir rumschleppe?
Seltsamerweise habe ich das Gefühl, es gibt dieses andere Leben, dieses Schattenleben, wo der Dämon sich austoben und ich mich von dem Ring, der Schicht verzehren lassen kann. Aber um den Preis meiner übrigen Persönlichkeit. Als sagte das Universum – oder Gott –, ich könne meinen Willen haben, aber um den Preis meiner Selbstachtung und Unabhängigkeit und des Idealbilds, das ich von mir habe. Aber welchen Preis hat der Weg, den ich stattdessen eingeschlagen habe? Ich bin in eine Kleinstadt geflohen und bringe meine Zeit mit einer Arbeit herum, die mir egal ist, und abends bin ich allein. Ich habe Selbstachtung, ich tue Gutes, aber eines sage ich Ihnen, Pater: Gutes zu tun wärmt abends nicht das Bett, und ich bin erfüllt von furchtbarer Verzweiflung, weil ich nicht beides haben kann, aber beides haben will.
Ich will ein gutes Leben, und ich will Leidenschaft und Liebe. Doch ich wurde erzogen, das eine als Verschwendung, das andere als Geschmacklosigkeit zu sehen – und sosehr ich mich auch mühe, ich werde das Gefühl nicht los, dass »Poppy Danforth« zum Synonym für Verschwendung und Widerwärtigkeit geworden ist, obwohl ich doch alles mir Mögliche getan habe, diesem Gefühl zu entfliehen …
»Vielleicht sollten wir nächste Woche weitermachen.«
Nach ihrem letzten Satz war sie lange still gewesen und hatte zittrig geatmet. Ich brauchte nicht durchs Gitter zu schauen, um zu wissen, dass sie sich kaum noch beherrschen konnte, und wären wir in einem Beichtzimmer gewesen, hätte ich ihre Hand nehmen oder sie an den Schultern umarmen oder irgendwas tun können. Hier jedoch vermochte ich ihr nur mit Worten Trost zu spenden und spürte, dass sie im Moment nicht in der Verfassung war, Worte aufzunehmen.
»Oh. Gut. Hab ich … hab ich zu viel Zeit gebraucht? Tut mir leid, ich kenne die Regeln hier nicht.«
»Aber nein«, erwiderte ich sanft. »Doch wir fangen besser klein an, oder?«
»Ja«, murmelte sie, und ich hörte sie ihre Sachen nehmen und die Tür öffnen, »vermutlich haben Sie recht. Dann gibt es also … keine Buße oder etwas, das ich tun soll? Als ich neulich ›Beichte‹ gegoogelt habe, hieß es, manchmal werden einem Bußen auferlegt und man soll ein ›Ave Maria‹ sagen oder so.«
Unentschlossen verließ auch ich den Beichtstuhl, weil ich dachte, es wäre einfacher, ihr Buße und Reue besser von Angesicht zu Angesicht zu erklären als durch das dumme Gitter, doch dann erstarrte ich.
Ihre Stimme war sexy. Ihr Lachen war noch erregender. Doch sie war umwerfend.
Sie hatte langes dunkles, fast schwarzes Haar und sehr helle Haut, was ihr knallroter Lippenstift noch betonte. Ihre Züge waren zart, ihre Wangenknochen schmal, ihre Augen groß – sie hatte ein Gesicht, wie man es mitunter auf dem Cover von Modemagazinen sieht. Doch es war ihr Mund, der mich anzog, ihre üppigen, leicht geöffneten Lippen, die mich sehen ließen, dass ihre mittleren Schneidezähne etwas größer waren als die anderen – eine Unvollkommenheit, die sie noch begehrenswerter machte.
Und unwillkürlich dachte ich: Ich will meinen Schwanz in diesen Mund schieben.
Ich will, dass dieser Mund meinen Namen stöhnt.
Ich will …
Ich sah zum Altarraum, zum Kruzifix.
Hilf mir, betete ich still. Ist das eine Art Prüfung?
»Pater Bell?«, fragte sie.
Ich holte Luft für ein weiteres Stoßgebet, auf dass sie nicht merke, wie fasziniert ich von ihrem Mund war … oder dass meine Hose zwischen den Beinen plötzlich ziemlich eng wurde.
»Im Moment ist keine Buße nötig. Wiederzukommen und zu reden, das wäre doch schon ein kleiner Akt der Reue, oder?«
Sie verzog den Mund zu einem schmalen Lächeln, und ich wollte dieses Lächeln küssen, bis sie sich an mich drücken und mich anflehen würde, sie zu nehmen.
Verdammt, Tyler. Was denkst du da?
Ich sprach im Stillen ein Ave Maria, während sie an ihrer Handtasche nestelte. »Dann sehe ich Sie also vielleicht nächste Woche?«
Mist. Würde ich das in sieben Tagen noch mal schaffen? Doch dann dachte ich an ihre von Qual und Verwirrung zeugenden Worte und spürte erneut den Drang, sie zu trösten. Ihr einen gewissen Frieden zu geben, eine helle Flamme der Hoffnung, die sie mitnehmen und nähren konnte, auf dass sie ihr in ein neues, besseres Leben leuchte.
»Natürlich. Ich freue mich darauf, Poppy.« Ihren Namen hatte ich nicht nennen wollen, aber nun war er gefallen, und als ich ihn aussprach, tat ich es mit jener Stimme, die ich nicht mehr benutzte, einer Stimme, die Frauen reihenweise auf die Knie hatte sinken und nach meinem Gürtel greifen lassen, ohne dass ich auch nur Bitte sagen musste.
Und prompt ließ ihre Reaktion meinen Schwanz zucken, denn sie bekam große Augen, ihre Pupillen weiteten sich, und ihre Halsschlagader pulsierte. Nicht nur reagierte mein Körper wie losgelassen auf ihren, sie war auch so angezogen von mir wie ich von ihr.
Und das machte alles noch viel schlimmer, denn nun war es bloß noch die schmale Grenze meiner Selbstbeherrschung, die mich davon abhielt, sie über eine Kirchenbank zu legen und ihr den drallen weißen Po zur Strafe dafür zu versohlen, dass sie mich angemacht hatte, obwohl ich nicht erregt sein durfte – und zur Strafe dafür, dass sie mich nur noch an ihren unanständigen Mund denken ließ, obwohl mir an ihrer unsterblichen Seele hätte gelegen sein sollen.
Ich räusperte mich, und nur meine seit drei Jahren eisern geübte Disziplin ließ meine Stimme ungerührt klingen. »Und nur damit Sie es wissen …«
»Ja?« Sie biss sich auf die volle Unterlippe.
»Sie brauchen nicht eigens von Kansas City hierherzukommen und bei mir zu beichten. Bestimmt hört Ihnen auch dort jeder Priester gerne zu. Mein Beichtvater, Pater Brady, ist wirklich gut. Seine Kirche ist mitten in der Stadt.«
Wie ein Vogel legte sie den Kopf etwas schief. »Ich wohne nicht mehr in Kansas City. Sondern hier, in Weston.«
Heiliges Kanonenrohr!
Dienstage. Verdammte Dienstage.
Die Morgenmesse hielt ich in einer fast leeren Kirche – nur Rowan und zwei Großmütter mit Hut waren gekommen –, dann joggte ich meine Runde, wobei ich im Geiste durchging, was ich heute erledigen wollte. Dazu gehörte, für die Reise unserer Jugendgruppe im Frühjahr ein Informationspaket zusammenzustellen und meine Sonntagspredigt zu schreiben.
Weston liegt an einem Gebirgszug, der zum Missouri hin abfällt, und mitunter geht es quälend steil die Berge hoch. In diesem Gelände zu joggen ist brutal und sorgt für einen klaren Kopf. Nach den ersten zehn Kilometern war ich völlig verschwitzt und keuchte schwer, doch ich drehte die Musik lauter, bis Britneys Stimme alles übertönte.
Ich bog auf die Hauptgeschäftsstraße ein. Weil Werktag war, sahen sich kaum Leute die Schaufenster der Kunst- und Antiquitätengeschäfte an. Auf meinem anstrengenden Parcours die steile Straße hinauf musste ich nur einem älteren Paar ausweichen. Meine Oberschenkel- und Wadenmuskeln schmerzten bereits, Schweiß rann mir über Nacken, Schultern und Rücken, mein Haar war tropfnass, jeder Atemzug fühlte sich an wie eine Geißelung, und die Morgensonne sorgte dafür, dass mir die Augusthitze in Wellen vom Asphalt entgegenschlug.
Ich liebte das.
Alles andere verblasste – die anstehende Renovierung der Kirche, die Predigten, die ich zu schreiben hatte, Poppy Danforth.
Vor allem Poppy Danforth. Vor allem sie und das Wissen, dass ich nur an sie zu denken brauchte, und schon stand mein Schwanz.
Ich verabscheute mich ein wenig für das, was am Vortag passiert war. Sie war eindeutig eine gut erzogene, kluge und interessante Frau, und sie war – obwohl nicht katholisch – zu mir gekommen, damit ich ihr mit Worten beistand. Und anstatt in ihr ein Lamm zu sehen, das Orientierung benötigt, hatte ich mich bei unserem Gespräch nur auf ihren Mund konzentrieren können.
Ich war Priester. Ich hatte Gott gelobt, zeit meines Lebens mit niemandem Sex zu haben, nicht mal mit mir selbst, um genau zu sein. Es war also nicht richtig, die Art Gedanken zu haben, die ich über Poppy hatte.
Ich sollte ein Hüter der Herde sein, kein Wolf.
Nicht der Wolf, der an diesem Morgen davon erwacht war, die Hüften in die Matratze zu pressen, weil er einen sehr intensiven Traum gehabt hatte, in dem Poppy und ihre fleischlichen Sünden die Hauptrolle spielten.
Der Gedanke daran erfüllte mich mit quälender Scham.
Ich fahre zur Hölle, dachte ich. Kein Zweifel, ich fahre zur Hölle.
Denn so sehr ich mich schämte, ich wusste nicht, ob ich mich würde beherrschen können, wenn ich sie wiedersah.
Nein, das stimmte nicht ganz. Ich wusste, dass ich es schaffen konnte, aber ich wollte es nicht schaffen. Ich wollte nicht mal darauf verzichten, mir ihre Stimme, ihren Körper, ihre Geschichten immer wieder zu vergegenwärtigen.
Und das war ein Problem. Als ich auf die letzten anderthalb Kilometer meiner Joggingstrecke ging, fragte ich mich, was ich einem Mitglied meiner Gemeinde sagen würde, das sich in der gleichen Lage befände. Was würde ich ihm als meine ehrliche Einsicht in Gottes Willen mitteilen?
Scham ist ein Zeichen deines Gewissens, dass du dich vom Herrn entfernt hast.
Bekenne Gott offen deine Sünde. Bitte ihn um Vergebung und um die Kraft, der Versuchung zu widerstehen, falls sie sich erneut regt.
Und meide schließlich diese Versuchung ganz und gar.
Ich sah Kirche und Pfarrhaus auftauchen und wusste nun, was ich zu tun hatte. Ich würde duschen und eine lange Stunde über beten und um Vergebung bitten.
Und um Willensstärke. Ja, auch darum würde ich bitten.
Und wenn Poppy nächstes Mal käme, würde ich ihr sagen müssen, dass ich nicht länger ihr Beichtvater sein konnte. Dieser Gedanke machte mich seltsam traurig, doch ich war lange genug Priester, um zu wissen, dass mitunter jene Entscheidungen die besten waren, die einen – jedenfalls kurzzeitig – am unglücklichsten stimmten.
Ich blieb an einer Kreuzung stehen, wartete auf Grün und fühlte mich nun, da ich einen Plan hatte, deutlich entspannter. Alles würde gut werden.
»Britney Spears, was?«
Diese Stimme. Obwohl ich sie nur zweimal gehört hatte, war sie mir ins Gedächtnis gebrannt.
Es war ein Fehler, doch ich drehte mich um und nahm meine Ohrhörer raus.
Auch sie joggte, und offenbar war sie ähnlich weit gelaufen wie ich. Sie trug einen Sport-BH und sehr, sehr kurze Laufshorts, die ihren perfekten Hintern nur gerade eben bedeckten. Auch ihr tropfte der Schweiß, und der rote Lippenstift war verschwunden, doch ihr Mund sah ungeschminkt nur noch herrlicher aus. Was mich davor bewahrte, ihn gierig anzuschauen, war nur der Umstand, dass mir auch ihre straffen Schenkel, ihr flacher Bauch und ihre kecken Brüste in aller Schönheit vor Augen standen.
Blut schoss mir in die Leistengegend.
Sie lächelte mich weiter an, und mir fiel ein, dass sie etwas gesagt hatte.
»Wie bitte?« Meine Worte klangen schroff und atemlos, und ich zuckte zusammen, doch ihr schien das egal zu sein.
»Ich habe in Ihnen keinen Britney-Spears-Fan vermutet.« Sie wies auf meinen Bizeps. Dort steckte mein iPhone, dessen Display das Cover von Oops … I did it again zeigte.
Wäre ich wegen des Joggens und der Hitze nicht bereits knallrot gewesen, wäre ich errötet. Ich griff nach dem Gerät, um den Song unauffällig zu wechseln.
Sie lachte. »Schon okay. Ich tu einfach so, als hätten Sie einer Musik gelauscht … die ein Mann Gottes beim Joggen so hört. Aber was wäre das eigentlich? Kirchenlieder? Nein, sagen Sie nichts. Singende Mönche!«
Ich trat einen Schritt näher, und ihr Blick glitt über meinen nackten Oberkörper bis dorthin, wo meine Shorts mir ziemlich tief auf den Hüften hingen. Als sie mir wieder in die Augen sah, war ihr Lächeln ein wenig verblasst. Und ihre Nippel spannten klein und fest unter ihrem Lauf-BH.
Ich schloss kurz die Augen und befahl meinem immer steifer werdenden Schwanz, sich zu beruhigen.
»Aber vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht hören Priester schwedischen Death Metal. Nein? Dann estnischen Death Metal? Oder Death Metal von den Philippinen?«
Als ich die Augen wieder öffnete, bemühte ich mich um möglichst asexuelle Gedanken: an meine Großmutter, an den fadenscheinigen Teppich vor dem Altar, an den Geschmack des schon fast zu Essig gewordenen Messweins.
»Sie mögen mich nicht besonders, oder?« Ihre Frage riss mich mit Gewalt in die Gegenwart zurück. War sie verrückt? Hielt sie es etwa für ein Zeichen von Abneigung, dass ich in ihrer Nähe ständig einen Steifen bekam?
»Sie waren so nett, als ich das erste Mal zu Ihnen kam. Aber inzwischen hab ich das Gefühl, Sie verärgert zu haben.« Sie sah auf ihre Füße, und dieser Blick betonte nur, wie lang und dicht ihre Wimpern waren.
Nun ließen mich schon ihre Wimpern eine Erektion bekommen! Das war ein neuer Rekord für mich, musste ich zugeben.
»Sie haben mich nicht verärgert«, erwiderte ich und merkte erleichtert, dass meine Stimme wieder normaler klang, beherrscht und freundlich. »Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie die Erfahrung der Beichte als wertvoll genug erlebt haben, um erneut in die Kirche zu finden.« Diesem Satz hatte ich die Bitte folgen lassen wollen, sie solle sich einen anderen Ort für ihre Bekenntnisse suchen, doch sie kam mir zuvor.
»Ja, erstaunlicherweise habe ich die Beichte als wertvoll erlebt. Und ich bin froh, dabei ausgerechnet auf Sie gestoßen zu sein. Auf der Website Ihrer Kirche steht, Sie haben Bürozeiten, zu denen man einfach zu Ihnen kommen kann, um mit Ihnen zu sprechen, und ich frage mich, ob ich das mal in Anspruch nehmen kann. Nicht unbedingt zur Beichte …«
Na, Gott sei Dank!
»… sondern, ich weiß nicht, um über andere Dinge zu reden. Ich will einen neuen Lebensabschnitt beginnen, habe aber ständig das Gefühl, dass etwas fehlt. Als sei die Welt, in der ich lebe, zweidimensional, ohne Tiefe. Und nachdem ich zweimal mit Ihnen gesprochen habe, fühle ich mich … leichter. Ich überlege, ob es Religion ist, was ich brauche, aber ich weiß wirklich nicht, ob ich sie brauchen will.«
Ihr Bekenntnis weckte den Priesterinstinkt in mir. Ich holte tief Luft und sagte, was ich schon vielen Menschen gesagt hatte, wovon ich aber noch immer so aufrichtig überzeugt war wie beim ersten Mal. »Ich glaube an Gott, Poppy, aber ich denke auch, dass Spiritualität nicht jedermanns Sache ist. Gut möglich, dass Sie das, wonach Sie suchen, in einem Beruf finden, den Sie mit Leidenschaft ausüben. Oder auf Reisen. Oder in einer Familie oder in allen möglichen Dingen sonst. Oder Sie merken, dass eine andere Religion für Sie geeigneter ist. Sie sollten sich nicht genötigt fühlen, die katholische Kirche aus einem anderen Grund zu erforschen als aus aufrichtigem Interesse und echter Neugier.«
»Und was ist mit einem echt scharfen Priester? Ist das ein vernünftiger Grund, die Kirche zu erforschen?«
Ich muss entsetzt geschaut haben – vor allem wohl, weil ihre Worte an meiner nur mühsam gewahrten Selbstbeherrschung zerrten –, und sie lachte. Es klang fast übertrieben hell und angenehm und wie dazu bestimmt, durch Tanzsäle zu schallen oder neben einem Pool in den Hamptons zu erklingen.
»Entspannen Sie sich«, sagte sie. »Das war ein Witz. Ich meine, Sie sind echt scharf, aber nicht deshalb bin ich interessiert. Jedenfalls …«, sie musterte mich erneut von oben bis unten, und ihr Blick gab mir das Gefühl, in Flammen zu stehen, »… nicht nur deshalb.« Dann sprang die Ampel um, und sie joggte mit einem kleinen Winken davon.
Jetzt saß ich wirklich in der Tinte.
3
Ich lief direkt nach Hause, nahm eine kalte Dusche und blieb so lange unter dem eisigen Wasser, bis meine Gedanken wieder klar waren und meine Erektion endlich, endlich nachließ. Den Erfahrungen der letzten Zeit zufolge würde sie allerdings sofort zurückkehren, wenn ich Poppy auch nur sähe.
Gut, vielleicht vermochte ich mein Verlangen nicht zu ersticken, aber mehr Selbstkontrolle konnte ich mir schon auferlegen. Schluss mit den Fantasien! Nicht wieder morgens aufwachen und feststellen, dass ich feucht von ihr geträumt hatte! Und vielleicht wäre das Gespräch mit ihr genau das Richtige – dann würde ich sie als Individuum wahrnehmen, als verirrtes Lamm auf Gottessuche, nicht als Sex auf zwei Beinen.
Und was für Beinen!
Ich zog eine Hose über meine Boxershorts, glitt in ein frisches schwarzes Hemd und krempelte die Ärmel wie gewöhnlich bis zu den Ellbogen hoch. Ohne Zögern griff ich zum Kollar. Der Stehkragen würde eine nur zu notwendige Mahnung zur Selbstverleugnung sein – und eine Erinnerung daran, wofür ich diese Selbstverleugnung betrieb.
Für meinen Gott.
Für meine Gemeinde.
Für meine Schwester.
Deshalb war Poppy Danforth ja so verwirrend. Ich wollte für meine Gemeinde der Inbegriff sexueller Reinheit sein, wollte, dass meine Gläubigen der Kirche wieder trauten, wollte die Flecken tilgen, mit denen böse Menschen den Namen Gottes beschmutzt hatten.
Und ich wollte mich an Lizzy erinnern können, ohne dass mein Herz vor Schuld, Reue und Ohnmacht in Stücke ging.
Ach was! Ich war dabei, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Alles würde gut werden. Ich fuhr mir durchs Haar und holte tief Luft. Eine Frau, so heiß sie auch sein mochte, würde nicht alles vernichten, was mir am Priestertum heilig war. Sie würde nicht alles zerstören, was zu erschaffen mich so viel Mühe gekostet hatte.
An meinem freien Donnerstag fahre ich nicht jedes Mal nach Hause, obwohl meine Eltern kaum eine Autostunde entfernt wohnen – diese Woche aber schon, weil es mich psychisch wie physisch erschöpft hatte, Poppy morgens beim Joggen zu meiden und binnen zwei Tagen zwanzigmal kalt zu duschen.
Ich wollte einfach dorthin, wo ich kein Kollar tragen musste, Arkham Knight spielen konnte und von meiner Mutter bekocht wurde. Ich wollte ein Bier mit meinem Vater trinken (oder auch sechs oder sieben) und meinen sechzehnjährigen Bruder über das Mädchen jammern hören, mit dem er diesen Monat gerade »irgendwie befreundet« war. Ich wollte an einen Ort, wo die Kirche und Poppy und der Rest meines Lebens weit weg waren und ich mich entspannen konnte.
Mom und Dad enttäuschten mich nicht. Auch meine beiden anderen Brüder, obwohl längst selbstständig und aus dem Haus, waren gekommen, angezogen von den Kochkünsten meiner Mutter und dem nicht exakt bestimmbaren Behagen, das man daheim empfindet.
Nach dem Abendessen machten Sean und Aidan mich am Computer bei Call of Duty nach allen Regeln der Kunst fertig, während Ryan seine neueste Flamme am Telefon zuschwallte. Im ganzen Haus roch es nach Lasagne und Knoblauchbrot. Ein Foto von Lizzy sah von der Wand über dem Fernseher auf uns herab, eine Aufnahme von 2003, die ein schönes Mädchen zeigte – mit blondiertem Haar, schrägem Pony und einem herzlichen Lächeln, hinter dem sich all das verbarg, was wir erst erfuhren, als es zu spät war.
Lange betrachtete ich das Bild, während Sean und Aidan über ihre Arbeit redeten – beide sind im Investmentgeschäft – und Mom und Dad nebeneinander in ihren gemütlichen Sesseln saßen und ein Video-Puzzle spielten.
Es tut mir so leid, Lizzy. Alles tut mir so leid.
Rational war mir klar, dass ich damals nichts hätte tun können, aber das konnte die Erinnerung an ihre bleichen, bläulichen Lippen und an die geplatzten Blutgefäße in ihren Augen nicht tilgen.
Die Erinnerung daran, wie ich in der Garage Batterien für die Taschenlampe hatte suchen wollen und stattdessen die Leiche meiner einzigen Schwester gefunden hatte.
Seans leise Stimme drang in meine düsteren Gedanken, und langsam kehrte ich in die Gegenwart zurück und lauschte dem Quietschen von Dads Fernsehsessel und Seans Worten.
»… nur auf Einladung«, sagte er gerade. »Seit Jahren höre ich Gerüchte darüber, aber erst als ich den Brief bekam, dachte ich, es könnte was dran sein.«
»Und gehst du hin?«, fragte Aidan nicht minder leise.
»Na logisch.«
»Wohin?«, wollte ich wissen.
»Geht dich nichts an, Priesterjunge.«
»Was denn? Kinderpizza-Essen, aber nur mit Einladung? Ich bin ja so stolz auf euch.«
Sean verdrehte die Augen, doch Aidan beugte sich vor. »Vielleicht sollte Tyler davon erfahren. Vermutlich muss er ja … überschüssige Energie loswerden.«
»Es ist nur mit Einladung, du Trottel«, erwiderte Sean. »Er darf also gar nicht hin.«
»Es soll der weltbeste Strip-Club sein«, fuhr Aidan fort, ohne auf Seans Beleidigung einzugehen. »Aber keiner weiß, wie er heißt und wo er ist, sofern er nicht persönlich eingeladen wird. Angeblich lassen die niemanden rein, der pro Jahr nicht mindestens eine Million Dollar verdient.«
»Warum wird Sean dann eingeladen?«, fragte ich. Obwohl er drei Jahre älter war als ich, hatte er sich in seiner Firma noch nicht richtig hochgearbeitet. Zwar verdiente er sehr gut (im Verhältnis zu mir unfassbar gut), aber von der Million pro Jahr war er weit entfernt. Noch jedenfalls.
»Weil ich Beziehungen habe, du Vollpfosten. Vitamin B ist eine verlässlichere Währung als ein gutes Gehalt.«
Aidans nächste Bemerkung kam ihm etwas zu laut über die Lippen. »Vor allem, wenn dieses Vitamin dazu führt, sich die Mädchen aussuchen zu …«
»Jungs«, mahnte Dad unwillkürlich, ohne von seinem Smartphone aufzusehen. »Eure Mutter sitzt hier.«
»’tschuldigung, Mom«, sagten wir wie aus einem Munde.
Sie winkte ab. Über dreißig Jahre mit vier Söhnen hatte sie gegen praktisch alles immun werden lassen.
Ryan kam ins Zimmer geschlurft und bat Dad nuschelnd um den Autoschlüssel, und Sean und Aidan steckten wieder die Köpfe zusammen.
»Ich geh nächste Woche hin«, verriet Sean dem Bruder. »Ich erzähl dir alles.«
Aidan, der zwei Jahre jünger war als ich und sich in der Geschäftswelt erste Sporen verdiente, seufzte. »Wenn ich groß bin, möchte ich du sein.«
»Besser ich als Mr Keuschheit da. Sag mal, Tyler, hast du rechts inzwischen eigentlich ein Karpaltunnelsyndrom?«
Ich warf ihm ein Dekokissen an den Kopf. »Willst du mir etwa zur Hand gehen?«
Sean wich dem Kissen lässig aus. »Wann immer du magst, Süßer. Bestimmt lässt sich dein Öl für etwas Besseres verwenden als für Krankensalbungen.«
Ich ächzte. »Du wirst in der Hölle schmoren.«
»Tyler!«, rief Dad. »So was sagt man nicht zu seinem Bruder.« Noch immer sah er nicht von seinem Smartphone auf.
»Wozu wären all die einsamen Nächte gut, wenn man nicht mitunter jemanden verdammen kann, was?«, meinte Aidan und griff nach der Fernbedienung.
»Vielleicht, du Schwuchtel, sollte ich dich wirklich in den Klub mitzunehmen. Gegen einen Blick auf die Speisekarte ist nichts einzuwenden, solange man nichts bestellt, oder?«
»Sean, ich geh mit dir in keinen Strip-Klub. Egal, wie abgefahren er ist.«
»Prima. Dann kannst du nächsten Freitag ja allein vor deinem Poster des Heiligen Augustinus hocken. Wie immer.«
Ich warf ein zweites Kissen nach ihm.
Meine Businessbrüder fuhren gegen zehn zurück zu ihren Krawattenhaltern und Espressomaschinen, und Ryan war noch unterwegs, um zu erledigen, wofür er das Auto so dringend gebraucht hatte. Dad war im Fernsehsessel eingeschlafen, und ich lag auf dem Sofa, sah mir eine Show mit dem Komiker Jimmy Fallon an und überlegte, welchen Film ich nächsten Monat für die Klausur der Mittelstufe auswählen sollte, da hörte ich in der Küche Wasser ins Spülbecken laufen.
Ich runzelte die Stirn. Die Businessbrüder, ich und ein murrender Ryan hatten nach dem Essen das Geschirr sofort abgewaschen, damit Mom das nicht tun musste. Doch als ich nun aufstand, um nachzuschauen, ob ich ihr helfen konnte, sah ich sie von Dampf umgeben mit wilden Kreisbewegungen den rostfreien Stahl der Spüle schrubben.
»Mom?«
Sie drehte sich zu mir um, und ich sah sofort, dass sie geweint hatte. Rasch warf sie mir ein Lächeln zu, drehte das Wasser ab und wischte die Tränen weg. »Entschuldige, Liebling. Ich bin nur am Saubermachen.«
Es war wegen Lizzy. Das wusste ich. Sobald wir mal alle beisammen waren, die ganze Familie Bell, hatte sie diesen Blick, als stellte sie sich vor, wir säßen mit einem Gedeck mehr am Tisch und müssten auch ein Gedeck mehr abwaschen.
Lizzys Tod hätte mich fast umgebracht – Mom hatte er getötet. Und seither war es jeden Tag gewesen, als hielten wir Mom mit Umarmungen und lustigen Sprüchen, später mit unseren Besuchen, künstlich am Leben, doch mitunter sah man, dass etwas in ihr nie geheilt, nie mehr auferstanden war, und unsere Kirche hatte daran großen Anteil gehabt – erst indem sie Lizzy dazu gebracht hatte, sich umzubringen, dann indem sie uns die kalte Schulter gezeigt hatte, als die Sache publik wurde.
Manchmal hatte ich das Gefühl, auf der falschen Seite zu kämpfen. Aber wer würde die Dinge besser machen, wenn ich es nicht täte?
Ich zog Mom an mich. Kaum hielt ich sie in den Armen, entgleiste ihre Mimik. »Sie ist nun bei Gott«, raunte ich, halb Priester, halb Sohn, ein Fabelwesen aus beidem. »Gott hat sie in sein Reich aufgenommen, das verspreche ich dir.«
»Ich weiß«, sagte sie schniefend. »Ich weiß es ja. Aber manchmal frage ich mich …«
Mir war klar, was sie sich fragte. Auch ich überlegte in meinen düstersten Stunden, welche Zeichen ich übersehen hatte und was mir hätte auffallen müssen; immer wieder schien sie angesetzt zu haben, mir etwas zu erzählen, war dann aber in einen Nebel des Schweigens zurückgesunken.
»Es kann gar nicht anders sein, als dass wir uns Fragen stellen«, sagte ich leise. »Aber du brauchst diesen Schmerz nicht allein zu tragen. Ich möchte ihn mit dir teilen. Und Dad würde das sicher auch tun.«
Sie nickte an meiner Brust, und wir blieben lange so stehen, wiegten uns leise und dachten an die Zeit vor zwölf Jahren – und an den nahe gelegenen Friedhof.
Erst als ich nach Hause fuhr und meiner üblichen Mischung aus grüblerischen Hipstersongs und Britney Spears lauschte, ging mir die Verbindung zwischen Seans Klub und Poppys Beichte auf. Sie hatte einen Klub erwähnt und gesagt, die meisten würden ihn als sündhaft einstufen. Ob es sich um ein und dasselbe Etablissement handelte?
Eifersucht regte sich in mir, doch das wollte ich nicht wahrhaben, während ich mich mit zusammengebissenen Zähnen auf die Autobahn einfädelte. Es war mir egal, dass Sean den Ort zu sehen bekäme, an dem Poppy vermutlich ihren Körper zur Schau gestellt hatte. Total egal war mir das.
Und diese Eifersucht hatte natürlich auch nichts mit meiner spontanen Entscheidung zu tun, Poppy am nächsten Tag wegen ihrer Bitte aufzusuchen, während meiner Sprechstunden auf ein Gespräch vorbeischauen zu dürfen. All das tat ich nur aus Sorge um sie, versicherte ich mir. Und weil ich sie in unserer Kirche willkommen heißen und ihr Trost und Orientierung spenden wollte. Weil ich spürte, dass sie keine war, die sich leicht verirrte oder leicht zu brechen war. Und letztlich auch, weil ich sie in dieses seltsame Beichtmöbel bekommen und zum Weinen bringen wollte … Tja, solche Lasten sollte einfach niemand allein tragen müssen.
Erst recht niemand, der so sexy war wie Poppy.
Hör auf jetzt.
Es war nicht allzu schwer, Poppy aufzuspüren. Eigentlich bin ich nur am Morgen an der offenen Scheune vorbeigejoggt, wo Tabak zum Trocknen aufgehängt wurde, und an der Ecke des Gebäudes prompt in sie hineingelaufen. Sie stolperte, doch ich konnte ihren Sturz verhindern, indem ich sie an meine Brust zog.
»Mist.« Ich zupfte mir die Ohrhörer raus. »Tut mir sehr leid! Alles in Ordnung?«
Sie nickte, hob den Kopf und warf mir ein Lächeln zu, das mich frösteln ließ; es war so herrlich unvollkommen mit den etwas zu großen Vorderzähnen und dem Schweiß im Gesicht. Im selben Moment merkten wir, wie wir dastanden: sie in meinen Armen, bloß im Sport-BH, während mein Oberkörper vollständig nackt war. Ich ließ die Arme sinken und vermisste die Berührung ihres Körpers sofort. Vermisste es, wie ihre Brüste an meine Brust drückten.
In Zukunft nur noch seitliche Umarmungen, nahm ich mir vor und sah mich schon wieder unter der kalten Dusche stehen.
Beiläufig und unschuldig legte sie die Hand auf meine Brust und lächelte mich weiter verhalten an. »Ohne Sie wäre ich gestürzt.«
»Ohne mich wären Sie nicht Gefahr gelaufen zu stürzen.«
»Und doch würde ich nichts daran ändern wollen.« Ihre Berührung, ihre Worte, dieses Lächeln – flirtete sie mit mir? Doch dann weitete sich ihr Lächeln, und ich begriff, dass sie mich bloß spielerisch neckte, wie junge Frauen das mit schwulen Freunden tun. Sie empfand mich als gefahrlos – und warum auch nicht? Schließlich war ich Geistlicher, von Gott zum Hüter seiner Herde bestimmt. Natürlich vermutete sie darum, sie könne mich necken und berühren, ohne meine priesterliche Beherrschung auf die Probe zu stellen. Wie hätte sie wissen sollen, was ihre Worte und ihre Stimme in mir anrichteten? Wie hätte ihr klar sein sollen, dass der Umriss ihrer Hand sich mir gerade in die Brust brannte?
Ihre haselnussbraunen, grün gesprenkelten Augen sahen mich an wie tiefe Teiche der Neugier, Kraft und Intelligenz, die indes Kummer und Verwirrung spiegelten, wenn man lange genug hineinschaute. Das erkannte ich, weil ich nach Lizzys Tod jahrelang diesen Blick gehabt hatte, doch in Poppys Fall vermutete ich, dass sie selbst es war, um die sie trauerte, weil sie sich verloren hatte.
Lass mich dieser Frau helfen, betete ich im Stillen. Lass mich ihr helfen, ihren Weg zu finden.
»Freut mich, dass wir uns sehen.« Ich richtete mich zu voller Größe auf, und sie ließ die Hand sinken. »Vor ein paar Tagen sagten Sie, Sie wollten mit mir sprechen?«
Sie nickte begeistert. »Das wollte ich. Ich meine – das will ich.«
»Bei mir im Büro? Sagen wir, in einer halben Stunde?«
Sie salutierte spöttisch. »Bis dahin, Pater.«
Ich gab mir alle Mühe, ihr nicht nachzublicken, als sie davonjoggte, wirklich, und ich schwöre, ihr nur eine Sekunde nachgesehen zu haben, eine ewig lange Sekunde, die genügte, das Schimmern von Schweiß und Sonnenmilch auf den gebräunten Schultern zu registrieren und die lockenden Bewegungen ihres Hinterns.
Zweifellos brauchte ich eine kalte Dusche.
4
Eine halbe Stunde später trug ich wieder meine Uniform: eine schwarze Stoffhose, einen Armani-Gürtel (vormals von einem der Businessbrüder getragen) und ein schwarzes Hemd mit bis zu den Ellbogen aufgekrempelten Ärmeln. Und mein Kollar trug ich natürlich auch. Der Heilige Augustinus blickte ernst in mein Büro hinein und gemahnte mich, dass ich gekommen war, Poppy zu helfen, und nicht, um mich in Tagträumen von Sport-BHs und Laufshorts zu ergehen. Und helfen wollte ich ihr. Unwillkürlich dachte ich an ihr Wimmern im Beichtstuhl, und mir wurde beklommen.
Ich würde ihr helfen – auch wenn es mich umbrachte.
Poppy kam eine Minute zu früh, und ihr lässiges, aber bestimmtes Eintreten verriet, dass sie Pünktlichkeit gewohnt war, Behagen daraus zog und nie würde verstehen können, warum andere säumig waren. Mich dagegen hatten drei Jahre, in denen der Wecker um sieben klingelte, noch immer nicht in einen Morgenmenschen verwandelt, und oft begann die Messe erst um zehn nach acht statt zur vollen Stunde.
»Hi«, sagte sie, während ich ihr bedeutete, sich zu setzen. Ich hatte beschlossen, die Polsterstühle in der Ecke zu nehmen, denn ich hasste es, wie ein Schuldirektor über den Schreibtisch hinweg mit Besuchern zu reden. Und Poppy wollte ich ja trösten und notfalls berühren können und ihr eine persönlichere Kirchenerfahrung als im antiquierten Beichtstuhl ermöglichen.
Sie sank auf ihre elegante, anmutige Art auf den Stuhl, die ebenso faszinierend war … als beobachtete man eine Balletttänzerin beim Schnüren ihrer Schuhe oder eine Geisha beim Tee-Einschenken. Wieder hatte sie den erregenden Lippenstift aufgelegt, knallrot, dazu trug sie taillenhohe Shorts und eine im Nacken gebundene Bluse, die eher für einen Segelausflug am Samstag geeignet schien als für ein Treffen in meinem schäbigen Büro. Doch ihr Haar war noch nass, und ihre Wangen waren vom Joggen leicht gerötet, und ich empfand einen gewissen Besitzerstolz darüber, diese sonst wie aus dem Ei gepellte Frau etwas derangiert zu erleben. Doch das war ein schlechter Impuls, den ich sofort unterdrückte.
»Danke, dass Sie sich mit mir treffen«, begann sie, überschlug die Beine und stellte die Handtasche ab. Vielmehr handelte es sich um eine schlanke Laptop-Tasche voll bunter Schnellhefter. »Ich habe lange überlegt, ob ich etwas wie das hier wählen soll, aber ich war nie religiös, und etwas in mir widersetzt sich weiter der Vorstellung …«
»Verstehen Sie unser Gespräch bitte nicht als religiös«, riet ich ihr. »Ich bin nicht hier, um Sie zum Katholizismus zu bekehren. Warum reden wir nicht einfach miteinander? Vielleicht gibt es hier Aktivitäten oder Gruppen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.«
»Und wenn nicht? Schicken Sie mich dann zu den Methodisten?«
»Aber nein«, erwiderte ich mit gespieltem Ernst. »Immer erst zu den Protestanten.«
Das trug mir ein weiteres Lächeln ein.
»Wie sind Sie eigentlich in Kansas City gelandet?«
Sie zögerte. »Das ist eine lange Geschichte.«
Ich lehnte mich im Stuhl zurück und machte es mir sichtlich bequem. »Ich habe Zeit.«
»Es ist langweilig«, warnte sie mich.