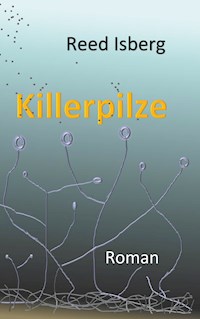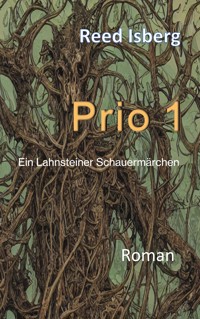
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In Lahnstein ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen. Wer sich infiziert, wird in kürzester Zeit zur hölzernen Mumie. Die Erreger sind Prionen, winzig klein, nicht einmal Mikroorganismen, bloße Eiweißmoleküle, die schon einmal Krankheiten wie BSE ausgelöst haben. Jetzt sind sie zurück. Wie werden die Lahnsteiner reagieren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner Heimatstadt Lahnstein
Inhaltsverzeichnis
Tag 1, Montag, 3. Oktober 2022
1 Das Bäumchen am Martinsschloss
2 Feuer am Ehrenmal
3 Pinte
4 Kampf um die Wenzelkapelle
Tag 2, Dienstag, 4. Oktober 2022
1 Herbstschnitt
2 Oktobergewitter
3 One step beyond
4 Gimpels Erben
Tag 3, Mittwoch, 5. Oktober 2022
1 Notruf Sebastianusstraße
2 Station to station
3 Wie der kleine Bengt einen Igel fand
4 Needful Things
5 Aschenbächer-Institut
6 Last orders
Tag 4, Donnerstag, 6. Oktober 2022
1 Ende einer Dienstreise
2 Klingel und die Gimpels
3 Das Leben des Bodo Schwellenbach
4 Thomas und Mathilde
5 Charly und Julia
Tag 5, Freitag, 7. Oktober 2022
1 Obduktion auf dem Dienstweg
2 DaBa und das RKI
3 Charlys Unterauftrag
4 Die Holzkatze an der Wenzelkapelle
Tag 6, Samstag, 8. Oktober 2022
1 Unlucky Lucky
2 Dinge, die man nicht braucht
3 Stimmung in der Pinte
Tag 7, Sonntag, 9. Oktober 2022
1 Böses Erwachen
2 Bandprobe am Sonntagnachmittag
3 Charlys Diagnose
4 Sonntagsspaziergang am Rhein
5 Was Bilder erzählen
Tag 8, Montag, 10. Oktober 2022
1 Gesundheitskommunikation
2 Behördengänge
3 Der Zeuge Wenders
4 Eva und die Polizei
5 Zeugenbefragung
Tag 9, Dienstag, 11. Oktober 2022
1 Schlag auf Schlag
2 Bodos vorletzter Weg
3 Quarantäne, oder was?
4 Alltagszweierlei
5 Bandsalat
Tag 10, Mittwoch, 12. Oktober 2022
1 Zeitungsmeldung
2 Krisensitzung
3 Kühlcontainer und mobiles Labor
4 Die Prionen-Theorie – ein wissenschaftlicher Disput über die Produktion von Holz
Tag 11, Donnerstag, 13. Oktober 2022
1 Zeitungsmeldung
2 Zur Bestattung freigegeben
3 Leichenschmaus
4 Prio 1
5 Prion Nr. 1
6 Die Biowaffe
Tag 12, Freitag, 14. Oktober 2022
1 Zeitungsmeldung
2 Angepackt
3 Ordnungsbehördliche Empfehlung
4 Zurück nach Berlin
5 Gewissensbisse
6 Alles über Isabelle Folkert
7 Krisenstab
Tag 13, Samstag, 15. Oktober 2022
1 Zeitungsbeilage
2 Freiwillig angewiesene Isolierung
3 Videokonferenz
4 Koko knipst
5 Der verschwundene Holzmensch am Rhein
6 Wenn es Nacht wird in der Stadt
Tag 14, Sonntag, 16. Oktober 2022
1 Geistersonntag
2 Krisenstab mit Frühstück
3 Partielle Erfolgserlebnisse
Tag 15, Montag, 17. Oktober 2022
1 Keine Zeitungsmeldung
2 In the year 2525
3 Krisenstab gefrühstückt
4 Einschleichender Alltag
Tag 16, Dienstag, 18. Oktober 2022
1 Zeitungsmeldung
2 Abschied
3 It’s all over now
4 Das Bäumchen auf dem Johannis-Friedhof
Epilog
Tag 1, Montag, 3. Oktober 2022
1 Das Bäumchen am Martinsschloss
Es war ein ungewöhnlich warmer Abend für Anfang Oktober. Seit Mitte September hatte es nicht mehr geregnet, der heiße, viel zu trockene Sommer war unmittelbar in einen goldenen Herbst übergegangen. In dem kleinen ummauerten Park der Martinsburg, die in Oberlahnstein gern Martinsschloss genannt oder als rheinländischer Kompromiss mit Schloss Martinsburg bezeichnet wurde und direkt am Rhein lag, zeigten die Blumenbeete noch erstaunliche Farbenpracht, während die Laubbäume, die im Sommer angenehmen Schatten spendeten, sich bereits stark lichteten. Die Sonne war untergegangen, die Dämmerung brach allmählich von der Lahnsteiner Höhe herein, während sich das Schloss Stolzenfels auf der anderen Rheinseite noch hell von den dunklen Hängen abhob.
Julia war vorausgelaufen, hatte sich auf ihre Liebesbank gesetzt, wartete auf ihren Romeo, der ihr nachtrottete wie ein Hündchen. Romeo hieß Matteo. Die beiden kannten sich seit Julias Abiball Ende Juni, bei dem Matteo seinen jüngeren Bruder Kai begleitet und ordentlich zum Alkoholkonsum animiert hatte. Während der gesamten Schulzeit hatte Kai keine Anstalten gemacht, mit Julia zu flirten. Bei der Abschlussfeier war er dagegen völlig aufgedreht, wollte dauernd mit ihr tanzen und hatte ein paarmal unbeholfen versucht, ihr einen Kuss aufs Ohr zu drücken. Schließlich wurde es Julia zuviel und sie setzte ihren wankenden Mitschüler zu seinem Bruder an den Tisch, den seine Eltern soeben verlassen hatten. Der Abend endete ausgesprochen nett, die letzte Stunde verging in angeregter Unterhaltung an diesem Tisch, wo Julia und Matteo redeten und Kai schlief.
Die Liebesbank hatte Julia so getauft, weil Matteo ihr dort den ersten Kuss gegeben hatte. Ihren ersten richtigen Kuss im Leben. Matteos erster richtiger Kuss war viel früher gewesen. Er war ihm mehr oder weniger aufgezwungen worden. Julia war anders, sie bedeutete ihm etwas. Er fand in ihr mehr als in den beiden Freundinnen, die er vor ihr hatte. Schon die ersten Wochen fand er einfach romantischer als er es bisher kannte. Julia war …
»Setz Dich zu mir«, sagte Julia mit ihrer Eiswaffel in der Hand. Sie klatschte mit der flachen Hand auf die Bank, wie man einem lieben Hündchen seinen Platz anweist. Matteo setzte sich neben sie und legte einen Arm um sie.
»Wie hast Du so schnell Dein Eis aufgegessen?« Julia sah ihn ungläubig an. Eine Windbö wehte Matteo eine Haarsträhne seiner dunkelblonden Mähne in den Mund, er pustete sie weg.
»Mit dem Mund«, antwortete er.
Julia plapperte weiter: »Man muss es genießen. Es könnte das letzte sein für dieses Jahr. Das Eiscafé macht bald Winterpause.«
Das Herbstlaub raschelte im Kirschbaum bei der Bank. Die untergegangene Sonne tauchte den dunstigen Abendhimmel in ein dunkles Orange, das sich noch dunkler auf den kleinen Park herabsenkte. Ein warmer Wind wehte von Süden durch das Rheintal. Es raschelte hinter der Bank. Julia drehte sich um.
»Das Bäumchen ist neu gepflanzt, das war letzte Woche nicht da«, sagte sie.
Matteo warf einen kurzen Blick über die Schulter. In der zunehmenden Dämmerung sah er einen schlanken, keine zwei Meter hohen blattlosen Strauch unweit der Bank. Die Eiswaffel zerbröselte. Julia steckte den Rest in den Mund und genoss das letzte Stückchen. Matteo wedelte Krümel von ihrer Jeans.
»Ist das der Wind?«, fragte er und blickte erneut hinter sich.
Julia sah in die gleiche Richtung. Die Waffel knirschte in ihrem Mund. »Ich kaue gerade.«
Wieder raschelte es hinter der Bank. Matteo stand auf und spähte auf das dunkle Geäst ohne Blätter. »Das ist kein Baum«, sagte er und ging zwei Schritte auf das Gebilde zu. »Sieht komisch aus. Hörst Du?«
Julia blieb sitzen. »Was denn?«
»Da röchelt was.«
Julia lauschte, hörte Amseln, ferne Verkehrsgeräusche und ein Schiff, dessen Tuckern die Geräuschkulisse überlagerte.
»Bestimmt ein Igel«, sagte sie ohne hinzusehen. »Sucht sein Winterquartier.«
»Hast Du nichts gehört?«
»Es wird dunkel, lass uns was trinken gehen«, sagte Julia, stand auf und blickte in Richtung des Bäumchens.
»Lass dem Igelchen seine Ruhe«.
Matteo warf noch einen Blick auf das dürre Bäumchen, das neben dem großen Kirschbaum fast schon im Dunkeln stand, schüttelte den Kopf, nahm Julias Hand und sagte: »Gehen wir.«
In diesem Moment winselte das Bäumchen wie ein malträtierter Hund, zuckte zweimal so heftig, dass am Boden braune Blätter aufwirbelten. Dann tat sich nichts mehr. Kein Geräusch, keine Bewegung. Matteo und Julia sahen sich an. Es war still im Park. Blätter raschelten im warmen Wind, das Tuckern des Schiffes hatte sich entfernt, die Amseln schwiegen. Ein lauschiger Abend, gemacht für frisch verliebte Julias und Matteos und sonst keinen. Außer ihnen beiden war keine Menschenseele hier. Die Liebesbank stand jetzt allein, das Liebespaar stand allein im Park. Und doch, etwas war noch hier, wenige Schritte von ihnen entfernt. Matteo ließ Julias Hand los, sie hielt ihn mit der anderen an seiner Jacke fest, er riss sich los und trat näher an das Ding heran. Vom dunkelgrauen Boden hob sich das Gebilde mittlerweile nur noch undeutlich ab. Das Schloss war jetzt beleuchtet, umso dunkler wirkte der Rasen. Julia war ihm nicht gefolgt. Von der Bank her rief sie. »Ich höre nichts mehr. Jetzt komm, den Weg sehe ich auch nicht mehr richtig.«
Tatsächlich war es jetzt fast vollkommen dunkel. Matteo ging ganz nah an das Bäumchen heran, spannte den Mittelfinger der rechten Hand in den Daumen und ließ ihn auf Bauchhöhe gegen den dunklen, erstaunlich dicken Stamm schnippen. Als hätte er damit einen schwach gefüllten Luftballon getroffen, knickte etwas ein mit einem Geräusch, das ebenso ein Stöhnen wie austretende Luft hätte sein können. Matteo wich erschrocken zurück und ging rückwärts in Richtung Bank, wo er Julia vermutete.
»Hast Du das jetzt wenigstens gehört?«, fragte er.
»Hast Du Dir weh getan?«, fragte sie zurück.
»Nein, ich habe nur dagegen geschnippt. Hast Du echt nichts gehört?«
»Du hast pscht gesagt.«
»Das war ich nicht.«
Er wischte den Mittelfinger an der Hose ab und machte ein Handyfoto mit Blitzlicht. In diesem Moment erkannte er die Form des Bäumchens deutlicher. Während Julia näher hinzutrat, beleuchtete er das Gewächs mit der Handy-Taschenlampe. Genauer betrachtet hatte das Bäumchen zwei Stämme, eher sogar vier, von denen jeweils zwei näher zusammen standen als die beiden anderen. Am Grund waren die Stämmchen so deutlich verbreitert, dass sie wie Füße wirkten, die sich etwas schräg aneinander vorbei gegenüberstanden. Julias Augen wanderten von unten nach oben, von den Holzfüßen entlang der zwei bis vier Holzbeine über eine oder zwei leicht verdickte Holzhüften, entlang einem unscharf längs gespaltenen Holzrumpf bis zum Kopf, dem einen Kopf, der sich auf Höhe von Matteos Kopf rundlich abzeichnete. Es fehlten nicht nur Blätter, es fehlten auch Äste, wenn man von den armähnlichen Gebilden absah, von denen zwei unterhalb des Kopfes entsprangen und bis zur Gabelung der Stämmchen herunterreichten, während zwei andere sich um den Holzrumpf herumschlangen.
»Ein Liebespaar«, grunzte Matteo. »Eng umschlungen.«
Mit diesen dahingeworfenen Worten machte er das Licht aus.
Aber Julia war es plötzlich ungemütlich im Dunkeln und sie drängte: »Ich will weg hier. Komm schon, da geht es raus.« Sie liefen plötzlich gleichzeitig los. Atemlos erreichten sie die offen stehende schwarze Gitterpforte, liefen an der Schlossmauer entlang, durch den Bahntunnel in die Stadt, ohne ein weiteres Wort zu verlieren.
2 Feuer am Ehrenmal
Zur gleichen Zeit brannte es in Lahnstein. Die Flammen stiegen gerade in der Phase höher, als auch Schloss Stolzenfels endlich in die Schwärze der anbrechenden Nacht eintauchte. Höher noch als die Flammen stiegen orange-glühende Funken zu den Sternen auf, um sich erst über dem 20 Meter hohen Eisenkreuz dem Nachthimmel zu ergeben. Auf den sieben gusseisernen Tafeln flackerten verschwommen die Namen von 194 gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs. Am Ehrenmal auf dem Martinsberg, auf halber Höhe schräg über dem Schützenplatz, hatte sich eine Clique junger Leute zur Spätsommerparty verabredet. Soweit es ging, waren die drei ehemaligen Klassenkameraden den Weg zum Ehrenmal über den Rheinhöhenweg und das kurze Stück Alter Bergweg mit Bernds Ford Transit gefahren. Kurz vor dem hohen Mauerwerk aus Bruchsteinen war die Fahrt zu Ende gewesen, der steile Weg mit den zwischengezogenen Stufen bis zum Platz musste zu Fuß genommen werden. Da war es noch halbwegs hell gewesen. Wenigstens hatte Klocki seinen kleinen Bollerwagen in Bernds Auto deponiert, mit dem er jetzt die Holzscheite zum Ziel transportieren durfte, nachdem alle drei gemeinsam den kleinen Wagen aus dem großen Wagen gehievt hatten. Während Klocki den kleinen Wagen zog, teilten sich Bernd und Lucky den Schwenkgrill, das Dreibein und zwei Liter-Flaschen Grillanzünder. Schließlich hatte Klocki die Idee gehabt und das Holz auch alleine gesammelt. Zudem beschwerte sich der Kumpel nicht, auch nicht, als die beiden Leichtbeladenen demonstrativ pfeifend die Steinstufe passierten, an der sich Klocki mit der Handkarre abmühte und gleichzeitig am Rücken kratzte. Nicht nur sein Rücken war lädiert, beim Holzsammeln hatten ihm die Dornen Striemen an den Armen verpasst und am Zaun hatte er sich das Hosenbein aufgerissen. Oben auf dem Platz hatte sich einiges verändert. Robiniensträucher hatten sich ausgebreitet, zum Teil hüfthoch bis mannshoch, stellenweise aber spärlich genug wachsend, dass Bernd und Lucky sie einfach auf etwa drei mal drei Metern niedergetrampelt hatten, noch ehe Klocki angekommen war. Verkohlte Holzreste zeugten davon, dass andere schon vor ihnen hier gegrillt hatten, mochte es auch eine Weile her sein. Heute sollten sie den Platz für sich haben.
Klocki hatte sich nicht nur um das Holz, sondern auch um das Feuer gekümmert und dicke Holzscheite nachgelegt, die er am Abend zuvor aus einem der Schrebergärten am Rheinufer gesammelt hatte, während Bernd in seinem Transporter gemütlich Schmiere gesessen hatte. Es war eine Schnapsidee gewesen, gestern um diese Zeit noch Holz zu suchen. Der tapfere Klocki kannte eine Stelle, wo Holz lag, aber als er sie im Dunkeln mit einer Taschenlampe suchte, hatte er einen anderen Weg genommen, sich durch Brennnesseln und Dornen schlagen und über einen Drahtzaun klettern müssen. Unten am Rhein konnte Bernd nicht anfahren, deshalb waren sie von der Wenzelkapelle her gekommen. Neben der schemenhaft erkennbaren Hütte hatte Klocki die herumliegenden Holzscheite kurz angeleuchtet und wahllos gegriffen. Nachdem er den Weg kannte, lief er noch ein paarmal hin und her bis zum Zaun, warf Holzscheite auf die andere Seite, kletterte zuletzt mühsam darüber zurück und lief von da aus hin und her mit dem Holz, bis der Bollerwagen voll war. Trotz der Sommerdürre waren die lieblos gehackten Holzscheite nicht so trocken, wie gedacht, weil sie nicht im Trockenen gestapelt waren, sondern am Boden verteilt gelegen hatten. Klocki hatte sie brav aufgesammelt und in seinen mit Plastikfolie ausgelegten Bollerwagen in Bernds mit Plastikfolie ausgelegtes Auto gelegt, so dass das Dienstfahrzeug sauber blieb. Spedition Bolz – Transport und Logistik stand in blaugelber Schrift auf dem Transit, den Bernd Bolz liebevoll pflegte und peinlich sauber hielt.
»Es sollte auch eine Nummer kleiner gehen«, kommentierte Bernd das unerwartete Spektakel der Flammen, nachdem Klocki die bemoosten Holzscheite zuletzt mit einem Liter Grillanzünder nachdrücklich ihrer Bestimmung zugeführt hatte. Allmählich trieb die Hitze das Wasser aus den Scheiten, sodass zunächst der Qualm, dann endlich auch der Funkenflug nachließen.
»Entwarnung, Bernd. Bleib cool. Jedenfalls höre ich noch keine Sirenen.« Klocki zündete sich eine Zigarette an und starrte gedankenverloren ins Feuer. »Was wohl passiert, wenn ich mein Feuerzeug ins Feuer werfe?«
»Mach doch mal.«
Klocki schaute in die züngelnden Flammen, machte einen spitzen Mund und fällte eine Entscheidung. »Nö.«
Nur noch eine Handvoll Holzstücke lagen neben der Feuerstelle. Bernds Blick fiel auf eines, das die Form eines Schuhs hatte. »Brandmeister, was genau verbrennst Du hier? Ist das Holz oder Deine Fußbekleidung?« Er zeigte darauf.
Klocki hob das Stück Holz auf und betrachtete es kurz im Schein des Feuers. »Das hier? Gute Frage. Ein Holzschuh vielleicht? So als Kompromiss. Habe ich beim Sammeln gar nicht so gesehen.«
Bernd machte ein Foto mit seinem Handy. »Für meine Sammlung«, sagte er.
Klocki warf das Holz ins Feuer und wischte sich die Hand an der Hose ab, während Lucky sich plärrend und urinierend am Kreuz zu schaffen gemacht hatte. Lucky Lukas Winterscheid schüttelte ab, verbeugte sich vor dem eisernen Kreuz wie zur Entschuldigung und wankte zum Lagerfeuer zurück. »Wo ist meine Flasche?«
»Da liegt sie doch, Lucky Luke.«
Klocki wies auf eine umgefallene Flasche neben der Feuerstelle, kratzte sich mit der rechten Hand an der linken und dann am Hinterkopf. Dann wurde er still.
Zwei gackernde Mädchen kamen mit Taschen zu Fuß heran.
»Da hast Du’s, da sind sie«, trötete Lucky ihnen entgegen. »Habt ihr den Wodka dabei?«
Es dauerte noch einige Meter, bis die beiden etwas außer Atem am Feuer ankamen.
Bernd versuchte eine freundlichere Begrüßung: »Aha, die Schroers-Zwillinge. Habt Ihr uns endlich gefunden?«
»Ihr wart nicht schwer zu finden, das Feuer sieht man schon vom Schützenplatz«, antwortete Pia. »Wieso war ich hier noch nie?«
»Weil Du zu jung bist«, erklärte Bernd, während er den Schwenkgrill über der Feuerstelle aufbaute.
»Bin ich das?«
»Für die Kriegsgefallenen da drüben seid Ihr zu jung und für das Martinsfeuer auch.«
»Martinsfeuer«, sagte Pia und vergaß die zum Fragezeichen ansteigende Stimmlage.
»Der Pia«, hub Klocki an und wurde sofort von Bernd korrigiert: »Die Pia.«
»Du weißt doch gar nicht, was ich sagen will. Der Pia ist nicht bewusst, welch heiliger Ort das hier ist.«
Pia und Caroline hörten nicht wirklich zu, die Zwillinge waren mit dem Ausbreiten von Decken, Würstchen und Pappgeschirr beschäftigt.
Lucky nahm den Faden auf: »Hier war früher jedes Jahr Feuer, hier wurde das Martinsfeuer abgebrannt, der Merdeskuppe.«
»Zu Deiner Zeit«, kommentierte Bernd. »Muss lange her sein.«
»Zur Väterzeit. Zuhause haben wir Bilder davon. Schwarzweiß im Dunkeln. Man sieht nur Pechfackeln brennen.«
Einen Moment dachte Lucky nach, dann setzte er hinzu: »Und nach dem Merdeskuppe gab es Dibbedotz.« Den Rest sang er: »Dotz, Dotz, Dilljedotz, heut Abend gibt et Dibbedotz.«
»Heute Abend gibt es Bratwurst«, warf Pia dazwischen. »Acht Stück, für jeden zwei.«
Einen kurzen Moment war es still, nur das brennende Holz knackte. Dann setzte sich Bernd neben seine Freundin Pia und sagte: »Eine kleine Nachfrage: Müssten das nicht zehn sein?«
»Mein Schwesterherz ist Vegetarierin. Die hat für sich einen großen Becher Waldorf Salat mit Ananas und Mandarinen mitgebracht.« Sie grinste zu Caroline hinüber, die sich auf der ausgebreiteten Decke im Schneidersitz Wodka in einen Plastikbecher füllte.
»Genau«, sagte Caroline. »Waldorf Salat mit Ananas und Mandarinen und Wodka. Noch jemand?«
»Immer her damit«, keckerte Lucky. »War ein schwerer Tag. Gib dem Klocki auch einen Schluck, der hat am meisten geschafft.« Mit einem Seitenblick auf Klocki fügte er hinzu: »Der ist ganz still geworden.«
Klocki saß mit angewinkelten Beinen auf dem staubigen Boden und rieb sich die Arme.
»Dein Gesicht ist ganz rot«, sagte Bernd zu Klocki.
Klocki wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht. Ihm war tatsächlich heiß und kalt.
»Ich glaube, ich habe Fieber«, sagte er.
Pia sah ihn im flackernden Schein des niederbrennenden Feuers an und war sich nicht sicher, ob sein roter Kopf von innen oder von außen beleuchtet war. »Du warst zu dicht am Feuert«, sagte sie und reichte ihm wortlos eine Papierserviette.
»Danke«, röchelte Klocki leise.
»Armer Klocki, bist Du krank, dass Du nicht mehr hüpfen kannst?«
»Hör auf, Lucky«, raunte Pia. »Dem geht es echt nicht gut.«
Klocki stand auf, schüttelte sich kurz und fragte: »Wieviel sind acht durch drei?«
»Lass mich raten«, antwortete Pia. »Dir ist nicht nach Bratwurst.«
»Nee, ich gehe heim und lege mich ins Bett.«
Heribert Klocki Klingel hob seine Jacke vom Boden auf, griff nach der Lenkachse seines Bollerwagens und zog ohne Abschiedsworte mit seiner Karre davon. Es war ihm nur nach Schlafen zumute, nach nichts anderem. Es war wohl wieder seine depressive Phase, die er seit Jahren immer wieder hatte, plötzlich aus dem Nichts kommend, mitten in fröhlicher Runde, oder auch dann, wenn er ganz alleine war in seiner Zweizimmerwohnung in der Rödergasse, die er sich leisten musste, nachdem er sich mit seinen Eltern in Nastätten zerstritten hatte, weil er seine Lehre geschmissen hatte, weil er nichts zu Ende gebracht hatte, weil er seinen Alten einmal im Suff verkloppt hatte, weil er von der Hand in den Mund lebte, weil er in jeder Hinsicht divers war und überhaupt. Sich selbst überlassen, wie immer, trottete er seiner Matratze entgegen, für die er kein Bettgestell hatte.
Am Ehrenmal legte Lucky die letzten Holzscheite in die Glut.
3 Pinte
In der »Pinte« saßen gute alte Bekannte an einem der fünf kleinen Vierertische, während die üblichen Stammgäste an der langen Theke standen. Dafür war die Kneipe eigentlich auch gedacht. Die Speisekarte war winzig.
Kalte Speisen:Käseschnittchen mit saurer Gurke 4,50 € Schinkenschnittchen mit saurer Gurke 4,50 € Eisbein in Aspik mit Brot 5,50 €
Warme Speisen:Gulaschsuppe mit Brot 4,50 € 1 Paar Siedewürstchen mit Pommes Frites* 4,80 €
* wenn die Fritteuse funktioniert, sonst mit Brot.
Bei seltenen unregelmäßigen Gelegenheiten (offenbar dann, wenn es irgendwo ein günstiges Angebot gab) wurde auch eine kleine Platte Hausmacher Leber- und Blutwurst und Schwartenmagen mit Brot und einem Petersilie gereicht.
Julia Degenhard und Matteo Hofschmidt hatten alles andere als Hunger. Vielmehr hatten sie Wissensdurst, ob jemand das Bäumchen im Schlosspark gesehen hatte. Michaela kam Julia entgegen und ihr gerade recht.
»Hallo Julia, wir sitzen da drüben. Habt Ihr es eilig?«
Julia war noch außer Atem.
»Das glaubst Du nicht«, hechelte sie. »Ich brauche erstmal ein Glas Wasser.«
Matteo hörte es und ging gleich zur Theke, um ein großes Bier und ein Wasser ohne Kohlensäure zu bestellen. Soweit traute er seinen Ohren wieder. Die Mädchen setzten sich zu Charly an den Tisch. Karl-Luis Welter, der dritte im Bunde mit frischem Abitur, saß braungebrannt vor einem ganz leeren und einem fast leeren großen Bierglas, grinste zur Begrüßung und summte einen Sommerhit, dessen Name Julia nicht einfiel, während sein rechter Zeigefinger mit dem benachbarten Mittelfinger um das leere Glas herum spazierte. Das Glas fiel um, aber nicht vom Tisch.
»Schlechtes Bier«, ließ er sich undeutlich vernehmen. »Zappa verkauft schlechtes Bier. Ich will ein Weizen.«
Michaela verdrehte die Augen. »Charly ist besoffen. Er lallt mich schon seit einer Stunde mit seinem tollen Urlaub voll. Und jetzt nennt er den Mann hinterm Tresen nicht mehr Zapfhahn, sondern nur noch Zappa. Noch ein Bier und er nennt ihn Zap.«
Julia war nicht uninteressiert. Der tolle Charly mit der Tolle hatte ihn neulich jemand genannt. Dabei war es keine Schmalztolle, wie in den 50er Jahren, sondern nur eine blonde Strähne, die er von links oben über die Stirn wachsen ließ und abwechselnd aus dem Gesicht wischte oder pustete. Charly war der ziemlich Klassenbeste gewesen und auch nicht der unangenehmste Zeitgenosse, wenn er nüchtern war. Oft genug war er nicht nüchtern, dann wurde er irgendetwas zwischen schwer führbar und unerträglich, oder halb und halb, so wie jetzt, dann war er noch überwiegend unterhaltsam.
»Schön braun bist Du ja«, sagte sie in Charlys Richtung.
Wie auswendig gelernt schoss es aus Charlys Mund: »Interrail Global-Pass, 22 Tage, 518 Euro. Koblenz-Athen-Patras-Brindisi-Voghera-Genua-Marseille-Nizza-Barcelona-Gerona- Lollioret-Paris-Brssl.” Spätestens zwischen Lollioret und Brssl wurde sein Zustand erkennbar.
Matteo kam mit einem großen Bier ohne Schaum und dem Wasser ohne Kohlensäure, stellte das Wasserglas vor Julia ab und setzte sich.
»Hast Du schon erzählt?«, wandte er sich an seine Freundin.
»Äh, nein, Charly hat von seinem Trip erzählt.«
Matteo sah Charly irritiert an, der inzwischen den Kopf zwischen die Arme gestemmt hatte und stumpf dreinblickte, trank einen großen Schluck Bier, kratzte sich am Finger, dann am Kopf und rülpste.
»Das Bier ist abgestanden«, sagte er.
»Schlechtes Bier.« Charly war wieder hellwach. »Sag ich doch. Zappa verkauft schlechtes Bier. Ich will Weizen.«
»Lass mal probieren.« Michaela nahm einen Schluck aus Matteos Bierglas, verzog den Mund nach unten, stellte das Glas ab, schob es mit dem Handrücken weg wie einen Eimer Abwasser, der nicht auf den Tisch gehörte, und schüttelte sich theatralisch. »Bäh, Bier!«
»Ich sag’s Zapfhahn und hole Weizen.« Matteo stand wieder auf.
»Mir auch Weizen«, rief ihm Charly nach. »Und Frieder auch Weizen.«
»Jetzt geht das wieder los.« Michaela verdrehte erneut die Augen.
»Wer ist Frieder?«, wollte Julia wissen.
»Sag’s ihr, Charly.«
»Na, der Frieder. Frieder Ocken. Hab ich auf der Loreley kennengelernt. RockFels Festival. Ganzes Wochenende gecampt. Mit dem Frieder und seiner Truppe. Is selber ’n Rockmusiker, der Ocken.«
»Der heißt echt Frieder Ocken? Wie Friede Rocken?«
»Er heißt Friedhelm...«
»Und wie kommst Du jetzt auf den?«
»Der trinkt auch Weizen. Massenhaft. Fassweise Fassweizen. Kam ich grad drauf.«
An der Theke wurde es laut. Matteo stritt mit Tommy Werhahn, dem Wirt, genannt Zapfhahn, über die Qualität seiner Ware.
»Zapfhahn, Du musst die Leitungen spülen«, rief ein Unterstützer.
»Endlich sagt’s einer«, kommentierte ein anderer.
»Pissbrühe«, fasste ein Dritter zusammen.
Der vierte Thekengast ließ sich nicht lumpen und steuerte seinen Vers bei: »Zappas Bier, unerreicht – sechs gesoffen, acht geseicht.«
Gelächter zog wie ein Dunstschwaden hinter Matteo her, der mit zwei Flaschen Weizenbier und zwei unpassenden schlecht gespülten Cola-Gläsern zurückkehrte.
»So viel zum Reinheitsgebot«, lästerte er. »Hast Du es jetzt erzählt?«, wandte er sich wieder an seine Freundin.
»Charly hat von Frieder erzählt.«
»Immer erzählt der was, wenn ich weg bin. Wer ist Frieder?«
Michaela intervenierte, sie war neugierig geworden: »Also, was wollt Ihr denn loswerden. Ihr wart ja ganz aus der Puste.«
»Wir waren im Park beim Martinsschloss«, übernahm Julia den Bericht. »Eben erst, es war schon fast dunkel…«.
»Da hat Euch ein Flitzer belästigt«, kicherte Charly dazwischen und pustete seine Strähne aus dem Gesicht. »Kenne ich. Der ist ein Chinese.«
»Schlaf jetzt, Charly«, tadelte Michaela.
Julia war aus dem Konzept gekommen: »Sag Du doch, Matteo. Du warst näher dran.«
Matteo wollte es kurz machen, er war noch unsicher, was Trug und Wahrheit sein mochte.
»Seht es Euch selbst an. Hier ist ein Handyfoto.«
Julia kommentierte. »Zuerst dachten wir, da wäre ein Bäumchen ohne Blätter, dann hat es ein Geräusch gemacht, erst wie ein Röcheln, dann wie ein Winseln…«
»Dann habe ich es angeschnippt«, übernahm Matteo das Wort, »und da ging irgendwie Luft raus, vorher hatte es noch gezuckt, oder war es andersherum?«
»Das sieht aus wie zwei Menschen«, brachte es Michaela auf den Punkt.
»Was heißt, Du hast es angeschnippt?«, fragte Charly.
»Na so.« Matteo machte die Bewegung mit Daumen und Mittelfinger. Er schnippte, rieb den Finger an der Jeans, als wollte er ihn sauber machen, entschied sich dann dafür, sich die Nase zu putzen.
»Es war ziemlich unheimlich«, flocht Julia ein.
»Und da habt Ihr es mit der Angst bekommen«, folgerte Michaela.
Charly hatte sein Weizenbier schon komplett ausgetrunken und rülpste eindrucksvoll. »Hätte ich auch«, rülpste er, wobei das Hätte noch zum Rülpser gehörte. »Und nachdem ihm die Luft ausging, ließ das Monster von Lahnstein ein röchelndes Winseln ertönen, bis das Schloss erzitterte und die Menschen im Park in Panik flüchteten.«
Matteo haute mit der Faust auf den Tisch, dass das umgefallene Glas nun doch herunterrollte und auf dem Boden zersplitterte. Von der Theke gab es Beifall und von Zappa böse Worte.
»Hör zu, Charly«, funkelte Julia ihn jetzt böse an. »Wenn Du Dich lustig machen willst, bitte, dann geh doch hin. Jetzt gleich. Das Ding ist bestimmt nicht weggelaufen und es wird Dir genauso Angst machen, wenn es Dich im Dunkeln anstöhnt, dann werden wir sehen, was…«.
»Schon gut«, gab Charly hinzu, »mache ich Morgen. Ich hab‘ Angst vor Flitzern im Dunkeln.«
Matteo war sauer. Erst schmeckte das Bier nicht, dann die Diskussion an der Theke, jetzt wollte dieser Penner am Tisch ihn auch noch verhohnepiepeln. Er stand auf und giftete Charly an: »Ich kriege noch vier Euro zehn von Dir für das Weizenbier.«
Charly nestelte sein Portemonnaie hervor, winkte mit einer Kreditkarte und sagte leicht undeutlich »Acht Euro zwanzig. Frieder auch Weizen.«
Mit einem gezischten »Vergiss es« stand Matteo auf, ging zur Tür, drehte sich kurz zu Julia um und murmelte: »Ich ruf Dich an.« Es klang ebenfalls wie gezischt. Matteo verschwand mit einer wegwerfenden Handbewegung, noch ehe Julia etwas sagen konnte. Sie blieb wortlos sitzen, auch dann noch, als Michaela fragte, ob sie sie nach Hause bringen sollte, was Julia mit einer winkenden Handbewegung ablehnte.
Michaela tätschelte Charlys Hand. »Komm, Charly Braun, dann bringe ich halt Dich nach Hause.«
Charly machte eine unkoordinierte Handbewegung.
4 Kampf um die Wenzelkapelle
Im Sommer war Familie Wenders von der Karthause in ihr neues Domizil im Rheinquartier gezogen, was Moritz zwei Wochen lang so irritiert hatte, dass er sich weigerte, das seltsam riechende Haus zu verlassen, obwohl es schwer auszuhalten war. Katja Wenders hatte versucht, ihm den kahlen Garten schmackhaft zu machen, indem sie vor der Haustür einen Futternapf platzierte. Moritz fand die Dosenmaus langweilig, aber von irgendetwas musste er schließlich leben. Lustlos fraß der Kater das tote Fleisch, das dem von der Karthause in Geruch und Geschmack einigermaßen ähnlich, aber doch nicht dasselbe war, weil die Malerfarben hier alles durchdrangen und verfälschten. Er war es gewohnt, sein Fressen selbst zu fangen, zumindest als Nachspeise. Es war langweilig, wenn man nicht mit Mäusen spielen konnte. Mäuse waren wohl das Letzte, was man in dieser neuen, klinisch reinen Gegend finden konnte. So hatte er sich schließlich ein Herz gefasst und war auf Erkundungstour gegangen. Kater müssen wissen, was in ihrem Revier vorgeht und wann welche Rivalen mit welcher Katze rummachen und auch, wo es die besten Mäuse und Vögel gab. Nach einer Woche Freigang hatte er sein neues Revier an der Wenzelkapelle gefunden, einer kleinen Insel der Glückseligkeit in der betonierten und asphaltierten Landschaft, ein paar Quadratmeter, liebevoll umpflanzt und mit Schlupflöchern für Nagetiere, die in ihrer kleinen Welt keine Veränderungen wahrnahmen, höchstens für einen kurzen Augenblick, wenn jemand aus der Verwandtschaft verschwunden war. Das war nun häufiger der Fall, denn Moritz pflegte sein neues Revier, wie Hansjörg Wenders seinen häuslichen Garten. Der ließ seine Pflanzen sich auch nicht sinnlos vermehren. Ungefähr so wenig, wie Moritz sich vermehren konnte. Seit er als junger Kater einmal nicht aufgepasst und viel zu lange geschlafen hatte, war er eines Körperteils entledigt, das zu dieser Vermehrung einen Beitrag hätte leisten können.
Wo Mäuse sind, da sind auch Katzen. Deshalb wunderte es Moritz keineswegs, dass er in seinem kleinen Paradies an der Wenzelkapelle auf Konkurrenz traf. Genauer gesagt, auf eine Konkurrentin, die ihm zwar schöne Augen machte, gleichwohl als Spielverderber eingestuft werden musste. Schön war sie auch nicht. Er hätte sie einfach ignorieren können, wenn sie nicht im logischen Gefolge einen vaterlandslosen Gesellen herbeigelockt hätte, der seinerseits mit Katz und Maus spielen wollte. Das ging nicht an. Tagelang hatte Moritz den jungen, offenbar unerfahrenen Streuner angefaucht und mit Scheinangriffen verschreckt, zuletzt sogar zwei Tage und zwei Nächte Wache an der Kapelle gehalten, und siehe da: Der Streuner kam nicht mehr. Und die Konkurrentin auch nicht. Die Mäuse dankten es ihnen und konnten sich fortan ganz auf Moritz konzentrieren.
In dieser Oktobernacht änderte sich für Moritz alles. Er hatte seinen Rundgang beendet. Die Wenzelkapelle war gesichert. Der Vollmond beleuchtete seinen Heimweg. Ein letztes Mal drehte er sich um, blinzelte seinem Dom zu, wünschte den übrig gebliebenen Nagetieren eine fruchtbare Nacht, kratzte sich mit der Hinterpfote am Hinterkopf und gedachte, sich zur häuslichen Ruhe zu begeben. Da stand er. Neben der Kapelle. Grau, grimmig, gemein, groß. Den kannte er nicht. Der wollte nichts Gutes. Moritz‘ Katzenhirn verarbeitete den Anblick im Bruchteil einer Sekunde. Genau dieses Bruchteils einer Sekunde hätte es bedurft, den Heimweg zu beschleunigen. Doch es war zu spät. Gerade noch hatte der Unbekannte sein Rückenfell und den Schwanz gesträubt, einen Buckel gemacht, Moritz starr taxiert, ein sicheres Zeichen für einen Draufgänger, da war er auch schon im Ansturm. Jetzt gab es kein zurück. So unerfahren war Moritz nun auch wieder nicht. Dem ersten Prankenhieb konnte er ausweichen, der zweite traf ihn am Hinterlauf. Hat ja gar nicht weh getan. Blitzschnell drehte sich Moritz und versetzte dem noch bremsenden Fremden seinerseits zwei Ohrfeigen, die saßen. Einen kurzen Moment lang fauchten beide aus Leibeskräften, dann setzten sie gleichzeitig zum Sprung an, verkrallten sich zu einem Fellknäuel, zuckten mit Vorder- und Hinterläufen gegeneinander, Blut spritze, Moritz war es egal, aus wem, er war in Kampflaune, haute wild drauflos, wich aus, drehte sich um sich selbst, setzte nach und nach und nach zeigte der Feind Anzeichen von Ermüdung und Fluchtgedanken. Er hinkte, ging rückwärts im Kreuzgang in Richtung Kapelle zurück, schien tatsächlich zu Kreuze zu kriechen, noch leise fauchend mit weit aufgerissenen Augen. Moritz spannte seinen ganzen Körper, scharrte sich mit den Hinterpfoten in Startposition und setzte zum finalen Sprung an. Doch er sprang nicht. Auf einen toten Feind springt man nicht. Oder stellte der sich bloß tot? So hart hatte er ihn doch auch wieder nicht getroffen. Er hatte noch nie einen Gegner getötet. Das macht ein Kater nicht. Er hatte nur sein Revier verteidigt, mehr nicht. Die paar Tatzenhiebe. Was machte der denn da? Der groß-grimmig-gemeine Graue wurde noch grauer, legte den geschundenen Kopf auf die Vorderpfoten, schloss die Augen; ungrimmig, ungemein, klein wirkte er. Moritz schlich vorsichtig heran und inspizierte das Tier, gleichzeitig bereit zu Angriff, Abwehr und Flucht. War es eine Finte? Nein, der war tot. Tot war der. Der Körper lag flach, der Kopf auf den Vorderpfoten, die Hinterpfoten seitlich gestreckt, ohne Atmungsbewegung vor ihm. Er hatte ihn erlegt, getötet. Jetzt sah Moritz die ausgefallenen Fellbüschel, jetzt sah er die braunen Flecken auf der graubraunen rissigen Haut, den schleimigen Brei aus Maul und Nase triefend. Der Typ war krank. Der war schon vor dem Kampf halb tot. Respekt dafür. Für Moritz blieb hier nichts mehr zu tun; er leckte seine Wunden und humpelte nach Hause.
Tag 2, Dienstag, 4. Oktober 2022
1 Herbstschnitt
Dunst waberte über den Rhein an diesem frühen Oktobermorgen. Die beiden Männer des städtischen Baubetriebshof stellten den MB Sprinter auf dem kleinen Parkplatz an der Schlossstraße ab. Als hätte er in diesem Sommer nicht genug geschwitzt, setzte Bodo die Wasserflasche an die Lippen, noch ehe die Arbeit begonnen hatte. Richtig schwül war es schon wieder. Zur Unterhaltung der kommunalen Grünflachen pfiff er eine nur ihm bekannte Melodie, unterbrach sich kurz, um Valentin, dem jüngsten Bauhofmitarbeiter, seine Anweisung mit einem Fingerzeig zu geben: »Da die Ecke. Die Blätter und Zweige müssen auf den Wagen. Nimm die Schubkarre mit.«
Valentin bugsierte die Schubkarre von der Ladefläche und machte sich auf den Weg zu der Ecke, von der er also Blätter und Zweige zum Wagen bringen sollte. Er begann, mit einer Mistgabel die obere Schicht abzutragen und stocherte in dem darunterliegenden Kompost herum. Auch er spürte die drückende Luft‚ was ihm aber nicht so zu schaffen machte, wie dem dicken Bodo. Auch er versuchte, ein Lied anzustimmen, dessen Text er vergessen hatte. Unterwegs mit seinem Arbeitsgerät erfand er selbst einen Text dazu: »Wann wird’s mal endlich wieder Winter«, sang er vor sich und dem Abfallhaufen.
Bodo wollte sich um die Pflanzen an der Freitreppe des Martinsschlosses kümmern. Mit Spaten und Gartenschere watschelte er den Pfad entlang, vorbei an der ersten Bank, vorbei an der zweiten Bank, an dem kahlen Bäumchen ein paar Meter daneben; er stoppte und stutzte.
»Was ist das denn?«, sagte er zu sich selbst, rief dann zu Valentin hinüber: »Valentin, komm mal her. Bring die Schubkarre mit und einen Spaten und den Rechen.«
Valentin holte Rechen und Spaten vom Wagen, legte das Werkzeug in die Schubkarre und kam dann in langsamem Laufschritt.
»Guck Dir das mal an.« Bodo zeigte auf das Gebilde, berührte einen der armähnlichen Äste und zog daran. Der Ast ließ sich leicht abheben, brach ab und zerfiel in mehrere Teile. »Sieht aus wie ein junger Baum. Wie kommt der dahin?«
»Sieht aus wie zwei Menschen«, meinte Valentin.
»So ein Mist gehört hier nicht hin.« Mit diesen Worten stach er kurzerhand mit dem Spaten in das Machwerk und schimpfte: »Ganz morsch, das Holz. Wirf es einfach auf den Wagen zu dem anderen Müll.«
Valentin begann, die Teile mit Handschuhen in die Schubkarre zu legen, während Bodo sich dem gepflegten Pflanzenschnitt widmete. Mehrmals wunderte sich Valentin über die Beschaffenheit und die Form der zerschlagenen Trümmer. Hatte er eben noch etwas Trockenes aufgehoben, das ihn an eine Hand erinnerte, so war es jetzt ein Teil, das sich weicher anfühlte und in der Mitte wie ein Kniegelenk aussah. Bröselte ein handtellergroßes Stück zwischen seinen Handschuhen auseinander, so war das rundliche Teil stabil. Als er es hin und her drehte, fühlte er sich regelrecht angeblickt von zwei Augenhöhlen, in denen es glibberte. Vorne, wo ein Mund gewesen sein könnte, fielen braunweiße Kügelchen heraus. Nicht Kügelchen. Eckige Dinger. Das konnte nicht sein. Das waren, das waren…
»Zähne, Bodo«, schrie er aus Leibeskräften. »Da sind Zähne drin. Das is’n fauler Hund.«
Bodo stand mit der Gartenschere an der Treppe und wischte sich mit einem Papiertaschentuch Schweiß von der Stirn. »So ein Scheißtag«, knurrte er. Er sah von der Freitreppe aus, dass Valentin sich von dem Astwerk entfernt hatte und sich gebückt an der Bank festhielt, eine Hand ohne Handschuh am Mund. Bodo setzte sich stampfend in Bewegung und hatte nach den dreißig Metern schon keinen Atem mehr. Valentin übergab sich neben der Bank und zeigte würgend auf den Trümmerhaufen. Sagen konnte er nichts. Bodo Schwellenbach war ein erfahrener Pflanzenkenner. Kein Baum ohne Namen, zum Teil sogar botanische Namen, keine Blume im Park war ihm unbekannt, kein Unkraut fremd. Mit Holzfiguren kannte er sich weniger aus. Was er sah, nachdem Valentin nur noch einmal leise »Zähne« geschluchzt hatte, war ihm sehr neu: Zähne in Holz.
»Mach Frühstückspause, Junge«, sagte er zu Valentin. »Ich erledige das.«
Wortlos ging Valentin zum Wagen, während Bodo sich an dem unliebsamen Objekt zu schaffen machte. Ein frischer Wind zog auf und vertrieb allmählich den Dunst. Trotz der durchscheinenden Sonne kündigte sich das angekündigte Gewitter an. Bodo wollte das Werk, das er zu erledigen hatte, bald hinter sich bringen. Mit einigem Ekel durch den Gedanken, dass er einen seltsamen Kadaver zu beseitigen hatte, packte er die verbliebenen Teile in die Schubkarre, klaubte sorgsam letzte Krümel zusammen und fegte zuletzt mit einem Rechen die letzten kleineren Reste umher, bis die Fläche einigermaßen gereinigt und ordentlich aussah. Bodo wischte seine klebrigen Finger an der grünen Latzhose ab, während in der Ferne Donner rollte. Die Schubkarre mit Holz, Spaten, Rechen und Schere schob er zum Wagen, hob sie auf die Laderampe und ließ sie lustlos umfallen, wie sie wollte. Des Gärtners Arbeit war getan. Bodo fuhr zurück zum Baubetriebshof. Über dem Rhenser Königsstuhl gab es Wetterleuchten.
2 Oktobergewitter
Die Wettermeldungen hatten es angekündigt. Schon am Vormittag hatte es begonnen zu stürmen und schauerartig zu regnen. Am frühen Nachmittag war endlich ein heftiges Gewitter durchgezogen, dessen Ausläufer sich in kurzen Schauern und einer deutlichen Abkühlung fortsetzten. Es war noch nicht beendet.
Karl-Luis hatte lange geschlafen und den restlichen Tag bis jetzt mit seinem neuen Projekt verbracht. Einem jener Projekte, mit denen er sich in der Firma seines Vaters eine gute Stange Geld verdiente. Welter & Partners. Karl-Luis war einer der Letzteren, sein Vater Heinrich Carl Welter war IT-Experte, und zwar ein echter Crack. Schon dessen Vater, Karl-Luis Großvater, war Mathematik-Professor in Frankfurt gewesen und als solcher ebenfalls ein Crack. Opa hatte seinen Sohn sehr planvoll und gezielt Heinrich Carl getauft in der Annahme, der kleine Genius würde einmal in die Fußstapfen des großen Genius treten und neben einem Doktor- und einem Professorentitel auch mindestens einen Dr. h.c. verliehen bekommen, was so viel bedeutet wie honoris causa oder Ehrendoktorwürde für besondere Verdienste. Nach Opas Plan würde sein Sohn Heinrich Carl, wenn er fertig ausgebildet sein würde, den vollständigen Namen Prof. Dr. Dr. h.c. H. C. Welter tragen. Für Heinrich Carl allerdings bedeutete so viel Ehre nicht so viel. Ihm genügte als vollständiger Name Welter & Partners und seine Freunde nannten ihn Heinz. Opa wälzte sich vermutlich im Grab angesichts der ungeplanten Entwicklung, die sein Sohn nach abgebrochenem Mathematik-Studium in einem Zickzack-Kurs unterschiedlichster beruflicher Tätigkeiten durchlaufen hatte, bis hin zu einem eigenen kleinen Imperium, das ihm weitaus mehr Geld einbrachte, als der geniale Opa es mit seinem Professorengehalt je gesehen hatte. Heinrich Carl war letztlich genialer als sein Vater und in der Tradition der Familie Welter wurde der Sohn Karl-Luis ebenfalls als genialer Hoffnungsträger herangezogen. Offenbar durchlief die Familie eine Evolution der besonderen Art: Mit dem akademischen Downgrade ging ein Einkommens-Upgrade einher. Nun hatte Karl-Luis sein Abitur und betrachtete seine akademische Laufbahn damit als beendet. Zumindest wollte er den Prüfungsstress noch eine Weile abbauen und die Zeit mit Reisen und seiner Band Die potenziellen Mutmaßer genießen. Solange er bei seinen Eltern wohnte, hatte er freie Kost und Logis, die Alten waren vorerst zufrieden, dass ihr Junge noch bei ihnen blieb, zumindest bis er entsprechend der Planung von Vater Heinrich Carl (in diesem Punkt sah sich Papa als Respektsperson und verbat sich angelegentlich, Heinz genannt zu werden) im Sommersemester ein Informatik-Studium in Frankfurt beginnen würde. Karl-Luis hatte versprochen, sich bis zum Januar um einen Masterstudienplatz zu bewerben, der erst im April beginnen würde. Um die familiäre Evolutionstheorie zu bestätigen, müsste er dann lediglich früher abbrechen, als es sein Vater damals geschafft hatte, also nach dem Erstsemester.
Heinz Welters Firma war eine gut strukturierte, florierende IT- und Webagentur mit vielen Netzwerk-Partnern. Einer davon war also Karl-Luis. Alle nannten ihn Charly. Mit acht Jahren hatte Charly autodidaktisch gelernt, Gitarre zu spielen, nachdem ihm seine Eltern zu Weihnachten unverlangt eine Wandergitarre in die Hand gedrückt hatten. Im übernächsten Jahr bekam er seinen ersten Computer zum Geburtstag. Neben den Schulpflichten, die ihm langweilig einfach erschienen, lernte er Schritt für Schritt HTML5, CSS3 und JavaScript. Schnell hatte er auch Programmierkenntnisse in Python entwickelt, womit er bereits nach wenigen Tagen Galgenmännchen und einen Lotto-Simulator entwickelt hatte. Anfang des Jahres hatte Charly versucht, über seinen VPN-Server in das Datensystem seiner Schule einzudringen, ohne besonderes Ziel, nur aus Neugier. Allerdings hatte er sich kurz vor seinem Hackerangriff vom Marion-Dönhoff-Gymnasiums-Server ertappt gefühlt und schnell seine Spuren verwischt, so gut es ging.
Welter & Partners saß in Gestalt von Heinz Welter ohne Partners in seinem häuslichen Arbeitszimmer.
»Kann ich bitte mal Dein Auto haben, liebster Herr Vater?«, fragte Charly.
»Hat der Herr Sohn seine Füße unter meinem Tisch stehen gelassen?«
»Wenn ich sie brauche, finde ich sie schon, werter Erzeuger.«
»Du könntest Dir durchaus ein eigenes Auto leisten bei Deinem Einkommen.«
»Nicht, wenn ich studiere. Du kannst Deins doch von der Steuer absetzen.«
»Das heißt nicht, dass es nichts kostet. Du weißt, wo der Schlüssel hängt.«
»Gibt’s was zu essen?«
»Ich hatte Essen auf Rädern, Deine Mutter ist ja in ihrem Laden.«
Charly hasste den Fußmarsch vom Rheinhöhenweg über den Alten Bergweg und Im Rosenberg hinunter in die Stadt, vor allem den Rückweg, den er als Schuljunge tausend Mal gegangen war. Seit letztem Jahr hatte er einen Führerschein und Papa hatte ihm vertrauensvoll seinen Tesla S überlassen, wenn er nicht selbst damit unterwegs war und Charly nur unterwürfig genug danach gefragt hatte. Fahren konnte er schon so gut wie Papa Heinz und dem Auto hatte er weder Kratzer noch Beule zugefügt. Charly fuhr zum Martinsschloss. Er wollte das Monster von Lahnstein sehen, vor dem Matteo und Julia geflohen waren. Auf dem Parkplatz neben dem Schloss hielt er an, kicherte leise in sich hinein und fluchte in dem Moment, als er beim Aussteigen in eine schlammige Pfütze trat. So konnte er den gepflegten väterlichen Wagen nicht wieder besteigen. Charly wischte sich die Schuhe so gut es ging am gepflegten Rasen im Schlosspark sauber, obgleich ihm klar war, dass er beim Einsteigen wieder in der Schlammpfütze stehen musste. Da er nun schon mal hier war, überflog er das kleine Areal ohne eine Idee, wo und wonach genau er nach Monstern zu suchen hätte. Matteo hatte nicht genau beschrieben, wo er seinen schrecklichen Fund gemacht hatte. Wieder grinste Charly vor sich hin. Ein röchelndes, winselndes, zuckendes, blattloses Bäumchen. Mehr hatte er sich nicht gemerkt. Das müsste aber zu finden sein. Systematisch wie beim Programmieren schritt er den Park ab, vom Gittertor aus nach links, an der Mauer entlang und in zwei Meter Abstand wieder zurück in Richtung Rhein. Auf der Freitreppe setzte er sich kurz auf die feucht-dampfenden Stufen. Wo war das Bäumchen? Hier half kein logisches Denken. So wichtig war die Sache auch wieder nicht.
Bevor er wieder in den Wagen stieg, überlegte Charly, wo er in der Stadt etwas essen könnte. Vielleicht ist die Pfütze nachher ausgetrocknet, kicherte er sich selbst ins Ohr. Er nahm den Weg zu Fuß, durch die Rheinanlage, die Brunnenstraße hoch, dann am Alten Rathaus links in die Hochstraße, schaute zurück zur »Pinte«, die geschlossen war und ging weiter, bis er vor Mutters Laden stand. Es war eine kleine Boutique, eine jener Boutiquen, wie sie woanders gern von gelangweilten gut situierten Frauen eröffnet und bald darauf wieder geschlossen wurden. So dachte Charly hin und wieder, hätte aber nie gewagt, es laut auszusprechen. Nicht zuletzt deshalb, weil Judith Welter keine gelangweilte gut situierte Frau war. Immerhin hatte sie sowohl eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau als auch ein Betriebswirtschaftsstudium erfolgreich abgeschlossen. Bloß war der kleine Karl-Luis dazwischengekommen, bevor ihre Karriere richtig starten konnte. Vermutlich war es auch wieder eins von Papas Spekulationsobjekten. Mama betrachtete es als ihr Projekt und wollte offenbar etwas beweisen. Sie nannte ihr Geschäft Welter Fashion Partners, obwohl sie bei diesem Geschäft gar keine Partners hatte. Es war Charlies Idee gewesen. Judith fand sie gut, weil es nach einer größeren Modehaus-Kette klang. Vorsichtshalber wurde das Experiment vor einem Jahr ohne große Leuchtreklame gestartet und so klebte die Schrift noch immer in bunten Lettern aus Klebeband oben am Schaufenster. Rechts und links sah es trostloser aus. Mit Papierbahnen zugeklebte Schaufenster zeugten von fehlgeschlagenen Experimenten, die wenig aufmunternd wirkten. Mutter zog daraus den Schluss, dass die Kundschaft wie in einem Trichter umso eher in den verbliebenen Geschäftsraum dazwischen strömen mussten. Judith Welter hatte diesen Geschäftsraum seit vielen Jahren für sehr verschiedene Geschäftsideen genutzt. Von den drei Häusern, die sie in die Ehe eingebracht hatte, waren zwei für Wohnzwecke vermietet, eines in der Burgstraße für Geschäftszwecke. Nur diesen einen Raum im Parterre in der Hochstraße mit abgetrenntem Büro nach hinten und einer kleinen Toilette samt Abstellkammer mochte sie nicht hergeben. Als gute und begeisterte Hobbynäherin hatte sie gleichzeitig selbstgenähte Blusen und Jacken neben Modeschmuck als Kommissionsware feilgeboten, zeitweise in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre, als das Internet noch nicht so sehr verbreitet war, sogar eBay-Geschäfte für Kunden abgewickelt. Da war Charly noch gar nicht geboren. Seine Eltern schienen mit ihrem Ideenreichtum zu wetteifern. Hier hatte Charly schon seine eigenen Laptops und Computer verkauft, die er fast jährlich erneuerte. Beim Betreten stellte er fest, dass der Trichter funktionierte, eine Kundin mit Kleinkind war im Gespräch mit der Geschäftsführerin, eine weitere wühlte in einem Wühltisch. Die kannte Charly gut. Es war Julia Degenhard.