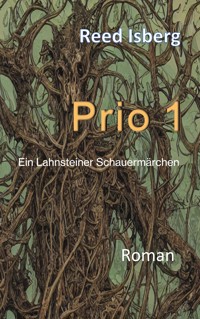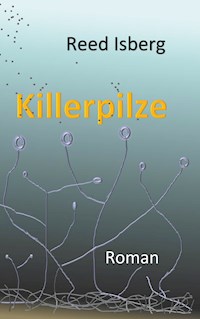
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Harmlose Pilze, die zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden, mutieren plötzlich zu Menschenfressern. Wissenschaftler in verschiedenen Ländern sind auf der Suche nach den Ursachen. Auch Matthias und Souriana sehen sich veranlasst, den geheimnisvollen Zusammenhängen nachzugehen. Sie finden ein Grab und erleben die gewaltigen Dimensionen eines tödlichen Pilzes. Aber dieser ist nicht die einzige Bedrohung. Was hat sich vor und im syrischen Bürgerkrieg abgespielt? Was hat das alles mit mykolabs in Seattle zu tun? Die Vergangenheit holt nicht nur die beiden ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hennef/Bonn, 14. bis 17. Januar 2018
Longyearbyen, Spitzbergen, 2015, September
Aleppo, Syrien, 2012
Bonn/Hennef, 2018, 18. bis 21. Januar
Bonn/Hennef/Siegburg, 2018, 22. bis 24. Januar
Aleppo, Syrien, 2012
Bonn/Hennef, 2018, 24. bis 25. Januar
Longyearbyen, Spitzbergen, 25. bis 26. Januar 2018
Bonn, 2018, 25. bis 27. Januar
Aleppo, Syrien, 2017, Juni
London, 2017, November
Bonn, 2018, 27. Januar
Seattle, USA, 2018, 27. bis 29. Januar
London, 2018, 29. Januar
Hennef, 2018, 29. Januar
Bonn, 2018, 29. bis 30. Januar
Seattle, 2018, 30. Januar
London, 2018, 1. Februar
Hennef, 2018, 1. Februar
Bonn, 2018, 1. Februar
Bonn, 2018, 2. Februar
Bonn, 2018, 3. Februar
Hennef/Bonn, 2018, 3. -4. Februar
1. Hennef/Bonn, 14. bis 17. Januar 2018
Hennef, Wiesengut, Sonntagnachmittag
Das hat aber lange gedauert.« »Ich werde auch nicht jünger.« »Wo ist der Hund?« »Weiß nicht. Im Gebüsch. Figo!« »Es wird dunkel.«
Während Charlotte begann, über die Miktionsprobleme ihres Mannes nachzudenken, lief Heiner wieder zurück ins Gebüsch. Gerade Rentner und schon wird er alt, dachte sie. Der Winternebel wurde dichter und ein feuchter Wind wehte über die blanken Felder des Versuchsbetriebs für organischen Landbau. Womöglich würde es gleich regnen und noch eher dunkel werden als ohnehin um diese Jahreszeit. Aber bis Weingartsgasse mussten sie nur über die Fußgängerbrücke und dann waren sie fast zuhause.
»Da bist Du ja. Was macht ihr denn?«
»Hab‘ in irgendwas reingetreten. Lass uns gehen.«
»Und was hat Figo im Maul?«
»Pfui, Figo! Aus! Gib schon her. Nee, ich pack das nicht an. Pfui! So ist brav.«
»Was hat er?«
»Irgendeinen Klumpen. Grasbüschel oder so. Komm jetzt«.
Die Fußgängerbrücke war glitschig. Ein Mann mit Trenchcoat kam ihnen entgegen und grüßte mit einem Tippen an seinen Hut. Am Ende der Brücke hörten sie ihn in der Dämmerung rutschen und leise fluchen.
Bonn-Poppelsdorf, Montagvormittag
Der Regen hatte die ganze Nacht angedauert und trüber konnte der Tag nicht beginnen. Es war kälter geworden und im Katzenburgweg lag eine feine Schicht von Graupel. Errol zog seinen Kragen hoch, obwohl er kurz vor der Eingangstür war. Fast immer war er der erste von den Doktoranden im Institut für Organischen Landbau, weil er ganz in der Nähe wohnte. Drinnen war es schon im Foyer kuschelig warm und er zog die nasse Jacke auf dem Weg zum Labor aus. Während er sich an der Kaffeemaschine zu schaffen machte, hörte er Mia kommen. Sicher war es Mia, denn sie war regelmäßig die zweite. Die Kaffeemaschine begann zu tropfen und Mias Schirm auch.
»Morgen Errol, wohin damit?«
»Hi! Leg ihn doch einfach ins Waschbecken.«
»Bin fast ausgerutscht vor der Tür. Ich mache gleich mal den Autoklaven an, dann wird es hier richtig gemütlich beim Würmer zählen.«
»Deine Bodenproben hast Du wohl nicht in den Kühlschrank gestellt?«
»Die sind noch frisch von gestern und waren kalt genug, oder meinst Du nicht?«
»Ist es hier kalt oder draußen? Na, ich sage nix dem Boss«.
Prof. Bernhard Ross, geschäftsführender Direktor des IOL, betrat in diesem Moment das Labor, schob seinen Unterkiefer vor und die Augenbrauen zusammen: »Was sagt man mir nix?« Schon fiel sein geschulter Blick auf Mias Plastiktüte, die von innen angelaufen war: »Warst Du heute schon im Feld? Oder von wann sind die Proben? Willst Du damit den Versuch mit Harolds Pilzen machen?« Mia antwortete nicht gleich, sondern starrte wie eine Verliebte auf ihre Tüte. »Ist doch noch alles drin…«. »Vergiss es, wirf sie weg!«, schnaubte Ross. »Da ist jetzt etwas Anderes drin als Du denkst. Eine Bodenprobe, die warm und feucht aufbewahrt wird, ist in wenigen Stunden ein völlig anderes Biotop. Leg Dich mal die ganze Nacht in die warme Badewanne. Ändert sich da nichts?«
»Es wird noch dasselbe drin sein…«.
»Gut, schlechtes Beispiel. Aber zumindest schrumpelt Deine Haut und etwas ändert sich an Dir. Das muss ich doch nicht als Vorlesung ausführen. Du bist Doktorandin im zweiten Jahr und willst Forscherin sein, oder? Und wir arbeiten mit exakten Wissenschaften, das hier ist nicht exakt, der Boden ist verdorben. Gibt es jetzt Kaffee?«
»Schon fertig, Bernd,« meldete sich Errol und nahm zwei Tassen aus dem Schrank. Sofort heiterte sich Bernds Miene auf und er vergaß seinen Vortrag auf dem Weg in sein Büro.
Mia trottete in den Keller. Kühl und feucht war er, wie er sein sollte. Besser hätte ich die Proben gestern Abend hier abgestellt, dachte sie. Der sterile Kühlschrank war wie immer übergequollen mit Petrischalen. Und der unsterile war kaputt; als ob Ross das nicht wüsste. Er hätte schon längst einen neuen beschaffen sollen, aber über Geld darf man hier nicht reden. Das hat die Uni oder nicht. Also eher nicht. So macht man exakte Wissenschaft. Gut, die Bodenproben hatte sie schon letzten Freitag genommen, aber irgendetwas ließ sich damit wohl noch machen. Die Fadenwürmer konnten nicht raus und würden wohl auch nicht so schnell vergammeln. Für die war es ihre kleine Welt.
Mia beschriftete ein erstes Klebeetikett mit PL-18-01-15-1 und trug es in eine Liste ein. Dann bereitete sie neun Versuchsschalen vor, indem sie eigens angefertigte flache gerahmte Siebe in Plastikuntersetzern platzierte und mit Zellstofftüchern belegte. Die kleinen Fadenwürmer, die man Nematoden nannte, würden später nach unten in die Schale wandern, wenn sie mit Wasser gefüllt war. Das war der erste Schritt. Mia öffnete die erste Tüte und zerbröselte die Bodenprobe über einer Schüssel.
Errol trat von hinten heran in dem Moment, als Mia die Erde gleichmäßig auf die Schalen verteilte. Er schlang seinen linken Arm um ihren Bauch und streichelte mit dem rechten Zeigefinger ihren Kehlkopf.
»Errol,« stöhnte Mia genervt, »nicht jetzt und nicht hier«.
Errol ließ sich nicht beirren und sein Finger wanderte langsam abwärts in Mias flauschigen Pulli. »Wo und wann denn sonst?« hauchte er in ihr Ohr. »Schmeiß doch endlich Saskia raus und wir können uns Tag und Nacht allein haben.«
»Saskia ist meine beste Freundin,« stieß Mia patzig hervor. »Und jetzt muss ich mir die Hände waschen.«
»Ok,« raunte Errol, »Ross, the Boss wartet sowieso auf mich, um das Manuskript durchzugehen. Meinst Du wirklich, Deine Infektionsmethode funktioniert?«.
»Das genau will ich herausfinden,« antwortete Mia mit einem Augenrollen.
Und während Errol sich pfeifend entfernte, dachte sie die Methode noch einmal durch. Sie würde die Pilze, die Bernhard Ross aus London erhalten hatte, einmal in getrocknetem Zustand und einmal mit Wasser auf die Bodenproben geben. Dann sollten die Pilze die Nematoden befallen und abtöten. Das erste Problem würde sein, die winzigen Nematoden zu bestimmen und ob sie Pflanzenschädlinge waren oder nicht. Pflanzenschädlinge haben einen Mundstachel zum Saugen. Soweit konnte sie sich auf die wesentlichen Wurmarten konzentrieren. Beim Bestimmen der Arten würde ihr Matthias Hellborn vom Nachbarinstitut helfen. Das hatte er versprochen. Das zweite Problem könnte entstehen, wenn Nematoden so schnell starben, dass sie nicht mehr aus dem Boden nach unten wandern konnten. Auf den Versuch kam es eben an. Es wäre zu schön, wenn man auch irgendwie in den Boden sehen könnte, in jenes unbekannte Stück Erde, in dem so viele Geheimnisse liegen wie im Weltall und in der Tiefsee, sinnierte die junge Forscherin.
Mia schüttete die vorportionierten trockenen Pilzsporen auf drei Schalen und arbeitete sie mit bloßen Händen behutsam in die Versuchserde ein. Auf drei andere Schalen schüttete sie gleichmäßig die vorbereiteten Suspensionen mit Pilzsporen. Drei Schalen ließ sie unbehandelt ohne Pilze; das sollten ihre Kontrollschalen sein. Guter Boden, böser Boden, dachte sie mit einem Finger in der Nase. Die simpelste Versuchsanordnung sollte für den Anfang genügen. Echte Versuchsreihen würde sie natürlich mit viel mehr Schalen aufsetzen. Die Pilze waren eine ganz besondere Spezies. Paecilomyces lilacinus kommt zwar überall im Boden vor und ernährt sich allgemein von organischem Material wie abgestorbenen Pflanzenresten. Manche solcher Bodenpilze können aber auch Nematoden befallen. Die Pilzsporen von Paecilomyces wirken praktisch als biologisches Bekämpfungsmittel gezielt gegen Nematoden, die an Kulturpflanzen heftige Schäden anrichten können. Also schützt der Pilz die Pflanzen, indem er die Fadenwürmer angreift, bevor sie die Wurzeln befallen können. Die Landwirte können höhere Erträge erzielen und alle sind glücklich. Seit 2017 war sogar schon ein zugelassenes Pilzprodukt auf dem Markt. Mias Idee war nicht neu, aber billiger: Sie wollte die Paecilomyces-Kultur aus London im natürlichen Boden anreichern, damit die Bauern sie nicht immer neu kaufen mussten. In jedem Boden herrschen heftige Kämpfe. Der eine ist des anderen Feind. Als sie aus ihren Überlegungen erwachte, blutete die Nase auch schon wieder auf der rechten Seite, wo sie erst gestern eine Entzündung hatte. Mia griff nach dem groben Zellstoff und wischte sich ebenso grob die Finger und die Nase ab, bevor sie einen Pfropfen Zellstoff in das Nasenloch steckte und dann die Versuchsschalen weiter beschriftete.
Bonn-Poppelsdorf, Montagmittag
In der Mensa gab es wieder einmal Krautwickel, die in solcher oder ähnlicher Form hier irgendwo in der Nähe haufenweise zu wachsen schienen. Bei Poppelsdorf-Leaks führte die Meinung in der Rangliste, dass der Weißkohl von den abgeernteten Versuchsfeldern der landwirtschaftlichen Fakultät stammte.
»Christina, hierher!«, rief Errol die Technische Assistentin herbei, die mit Saskia, ihres Zeichens ebenfalls TA, hinzuschlenderte. Zu viert hatten sie endlich einen freien Tisch für sich allein ergattert und genossen die köstlich zubereiteten Speisen mit ironischen Grimassen.
»Sieht aus wie der grünbraune Klumpen, den ich aus der Bodenprobe gefischt habe,« meinte Mia.
»Vielleicht ist er es«, kicherte Saskia, und dann kicherten alle.
Errol betrachtete Mias Finger, an denen sie dauernd rieb und die allesamt rot aussahen. »Juckt es Dich in den Fingern?« fragte er mit einem süffisanten Blick über die Gabel.
»Ja, hat vorhin angefangen. Da sind so kleine Pusteln drauf. Vielleicht bin ich gegen etwas allergisch geworden.«
»Warst Du schon beim Arzt?«, fragte Christina mit einem Gesicht, das zum Pseudogenuss der Mahlzeit einen zusätzlichen Anflug von Entsetzen ausdrückte.
»Mache ich morgen früh«, antwortete Mia, »gleich morgen früh«, und schob ihr Tablett weg.
Hennef, Montagvormittag
Figo war in der Nacht gestorben. Er lag vor seinem Körbchen, als hätte er es nicht mehr geschafft, hinein zu klettern. Charlotte Wehner fand ihn gegen acht Uhr als flaches Bündel in der Diele. Als hätte ihn jemand in graue Watte gepackt und innerlich entleert. Aus dem Maul floss eine gräuliche Substanz oder vielmehr schien sie aus ihm herauszuwachsen und sich im Umfeld des Tieres zu verteilen. Christina schrie nicht, sie begriff nicht. Sie sog den grausigen Anblick in sich auf, als wollte sie dieses letzte Andenken genießen. Irgendwie war sie fasziniert und schockiert zugleich, wie sich der kleine Figo, der gestern noch munter herumhüpfte jetzt in so elendem Zustand präsentierte. Nach einem offenbar kurzen, aber tragischen Siechtum. Dieses Bild würde sie immer in Erinnerung behalten. Charlotte wollte und konnte ihn nicht berühren. Sie begann ohne Bewegung nach der Ursache zu forschen und überlegte, ob sie ihm verdorbenes Futter gegeben hatte. Das wäre vielleicht vorne oder hinten herausgekommen, aber was sie sah, war etwas Anderes. Rückwärts ging sie zur Küchentür, um Heiner zu wecken.
Hennef, Wiesengut, Montag spätnachmittags
Heiner beschloss, vor der Chorprobe noch einmal zu der Stelle zu gehen, wo Figo im Gebüsch war. Irgendetwas hatte der Hund dort gefunden. Irgendeinen Klumpen oder Grasbüschel oder so, erinnerte sich Heiner. Er überquerte die Brücke über die plätschernde Sieg. Die Brücke war noch rutschiger war als am Vortag. Die Temperatur war tagsüber weiter gesunken und es hatte begonnen, in dünnen Flocken zu schneien. Der Boden war angefroren und Heiner hielt sich am Geländer fest. Eine undeutliche Fußspur ließ darauf schließen, dass zuvor eine Person den gleichen Weg genommen hatte. Jetzt dämmerte es bereits und er beleuchtete kurz die Spur mit seiner Taschenlampe, bevor er weiterrutschte. Etwa 100 Meter rechts von der Brücke, wo die kleine Baumgruppe stand, musste die Stelle gewesen sein, wo er Figo mit dem Klumpen erwischt hatte. Oder was auch immer es gewesen sein mag, Heiner war ja auch anderweitig beschäftigt gewesen und hatte nur zwei Hände und Augen für die eine Sache. Figo hatte noch ein Teil im Maul mitgeschleppt, aber es hatte keine Form und Heiner wollte auch gar nicht wissen, was es war. Jetzt, nachdem Figo so schnell und so unerklärlich verendet war, wollte er es wissen.
Im Schein der Taschenlampe war alles grau. Nur hier und da sah man etwas Braun von vermodernden Zweigen oder Laub. Alles schien unberührt. Keine Spuren waren zu sehen. Das Grau vermischte sich am Boden mit einem noch gräulicheren Schimmer, dessen Form unklar erkennbar war. Diffuses Licht, diffuse Strukturen. Der Schein fiel auf eine kleine Wölbung am Boden, die ein wenig zu leuchten schien. Oder war es die Struktur selbst, die im Licht Schatten warf und ein Leuchten andeutete? An mehreren Stellen der Wölbung erhob sich die Struktur zu einer Art Stiel. Heiner leuchtete daran entlang nach oben. Das Ding war erstaunlich lang und dünn, es war groß, mannshoch. Und am oberen Ende befand sich ein wenige Zentimeter großer dünner Ring. Ein richtig runder Ring aus einer leicht schimmernden Substanz. Die ganze Struktur roch nach nichts, war offenbar zart und fast durchsichtig. Und obenauf saß dieser anmutige Ring, der zum Anprobieren geradezu einlud. Misstrauisch betrachtete Heiner ihn von der Seite, an der er sich abflachte. Keine Bewegung war zu erkennen. Er stand still in der Luft und Heiner leuchtete noch einmal herunter zum Boden. Von dort zogen zarte Stränge zu einem nahegelegenen Baum, wuchsen offenbar an dessen Stamm hoch und bildeten dort ähnliche Ringe in weiten Verzweigungen und Verbindungen, waagerecht und senkrecht, kreuz und quer, sich gegenseitig stützend und… Ein Geräusch in der Ferne ließ ihn in seiner Faszination aufschrecken. Er sollte Fotos machen, musste aber zugleich die Taschenlampe halten. Er sollte etwas von dem Zauber sammeln. Oder zuerst etwas pflücken, aber wohin damit? Vorsichtig näherte er die linke Hand einem der fingerdicken Ringe, um ihn anzuprobieren. Er könnte tatsächlich passen. Da war wieder das ferne Geräusch, diesmal näher. Schnapp. Was war das jetzt? Der Ring hatte sich im Bruchteil einer Sekunde zusammengezogen, als er seinen Zeigefinger hineingesteckt hatte, und drückte hart zu. Hastig zog Heiner die Hand zurück, um den Ring abzuschütteln, aber er saß fest am zweiten Fingerglied und je mehr er schüttelte, desto mehr Fäden sammelte er in der Luft und auch am Boden tat sich etwas. Er hing mit dem rechten Fuß in einer spinnwebartigen Masse, die aus der Wölbung im Boden wuchs. Er fluchte leise und strampelte, aber immer mehr Fäden wickelten sich wie zarte Stricke um seine Arme und Beine – und der Finger steckte so fest im Ring, dass es schmerzte. Er wollte schreien, aber die Stimme versagte ihm, vor Schreck, oder vor Kälte, oder vom Kratzen im Hals. Dieses Kratzen hatte er vorher nicht bemerkt. Es fühlte sich an als hätte er einen Wattebausch im Mund, der ihn am Schreien hinderte. Er hing in Spinnweben gefangen. Sie krabbelten ins Hosenbein, als er stürzte. Sie wickelten ihn ein. Sie drangen in Mund und Nase und Ohren. Überall hatten sich Ringe gebildet, die ihn zu fressen drohten, so bewegten sie sich bedrohlich auf ihn zu. Auf die Augen, die bereits zuschwollen. Es ging so schnell. Er sah nichts mehr. In seinen Ohren rauschte es. Die Nase war zu. Er musste husten und keuchen. Was? Was hatte er so schnell alles aufgesammelt? Was … hatte sich … hier … so plötzlich … zugezogen? … Zugezogen. … Zugez…. Der Ring.
Hennef, Wiesengut, Montag spätnachmittags
Thomas Brunell hatte etwas gehört. Dort drüben im Gebüsch raschelte es. Vielleicht hatte er sich geirrt und ein Tier war aus diesem Strauchwerk gekommen. Er zog seinen alten braunen Trenchcoat zusammen und benutzte seinen Hut als Schallreflektor. Langsam schwenkte er seine Taschenlampe in Richtung des Raschelns. Zwischen zwei Büschen waren Dornen niedergetreten. Davor lag etwas Unförmiges im Schnee. Ein Husten und Ächzen und Rascheln war direkt hinter dem Gestrüpp zu hören und es klang, als hätte jemand gerade eine verpatzte Erhängung hinter sich. Thomas sah die Szene wie im Traum. Eine Taschenlampe lag am Boden und illuminierte das phantastische Szenario bläulich schimmernder Fäden, die vom Boden zu einem Baum und wieder zurück wehten wie Spinnweben. Der Schein seiner eigenen Taschenlampe fiel auf den aufgewühlten Boden, das faule braune Laub, auf eine kleine graubedeckte Wölbung im Boden und schließlich auf eine große Wölbung in einem Spinnennetz aus Fäden und kleinen ringartigen Strukturen. Die Wölbung ächzte und bewegte sich ein wenig. Das war kein totes Tier.
»Hallo,« rief Thomas, »können Sie mich hören?« Der Wind wehte einen Strang der Fäden auf ihn zu und er wich instinktiv zurück. Fast schien es, als bewegten sich die Fäden mit den Ringen gezielt auf ihn zu. Hier würde er nichts anfassen. Die Wölbung bewegte sich wieder und er hörte einen undeutlichen, aber menschlichen Laut, der entfernt als »Ja« gedeutet werden konnte. Nichts anfassen. Thomas kramte sein Handy aus der Manteltasche und überlegte, wie er das Bild beleuchten könnte. Sofort wechselte er sein Ansinnen und wählte die 112. Er nannte seinen Namen und versuchte umständlich zu beschreiben, was er sah, als man ihn schlicht fragte, wo er sich gerade aufhält. Auch das war umständlich zu beschreiben, aber offenbar hatte man ihn besser verstanden als er sich ausdrückte. »Wir schicken einen Rettungswagen raus. Bleiben Sie bitte, wo Sie sind. Und versuchen Sie, erste Hilfe zu leisten.«
»Hallo,« rief Thomas noch einmal ins Dickicht, »was ist passiert?«. Keine Antwort, nur ein paar Zuckungen, vielleicht von einem Bein. Einen Kopf konnte er in dem Gespinst nicht ausmachen, vielleicht einen Arm. Wie sollte er Hilfe leisten? Sollte er seinen Mantel ausbreiten? Nichts anfassen. Die Fäden wehten weiter vor ihm herum. War er selbst hier in Gefahr? Er trat weitere zwei Schritte zurück auf den Weg und leuchtete mit der Lampe zurück ins Gebüsch. Von hier aus machte er nun doch ein paar Handy-Fotos mit Blitzlicht, bewegte sich zögernd und zoomend wieder näher, um sich rasch wieder zurückzuziehen. Offenbar war er länger damit beschäftigt als er gemerkt hatte, denn schon kam beim Hofgebäude da hinten ein blauer Schein in sein Gesichtsfeld, gefolgt von einer Sirene. Ein Fahrzeug kam rasch näher. Zwei Fahrzeuge. Erst jetzt spürte Thomas, wie er fror und zitterte.
Bonn, Dienstagmorgen
Mia wartete weiter; ihre Hände hatte sie in Handschuhe verpackt. Schon um zehn vor acht war sie beim Hautarzt angekommen und stand als letzte in einer Schlange kurz hinter der Haustür, die bis zur ersten Etage geduldig wartete. Mia zählte ungefähr 20 bis 22 Personen, wobei sie nicht wusste, ob einige zusammengehörten, wie die Frau mit dem quengeligen Kind, oder als Platzhalter für ihre Großmutter da standen, wie der hübsche junge Mann, dem offensichtlich nichts fehlte. Punkt halb neun öffnete sich die Praxistür und die Schlange verschob sich um sechs Stufen, bevor sie wieder anhielt. Hinter Mia standen die Neuankömmling jetzt bis auf die Straße.
Um viertel vor zwölf war sie entlassen mit der Diagnose allergisches Handekzem. Ob sie die Haare gefärbt habe, welche Medikamente sie nehme, vor allem Antibiotika, und welche Salben und Cremes, ob sie Kontakt mit Unkrautvernichtungsmitteln, Nickel, Konservierungsmitteln oder Farben und Lacken hatte, und mehr hatte sie sich nicht merken können. Doch: Kunststoffe oder Desinfektionsmittel. Sicher war sie auch nicht. Nein, die Haare hatte sie nicht gefärbt, die Cremes waren aus dem Supermarkt, wo ist Nickel drin? Was hatte sie alles angefasst?
Ihre Hände waren zuletzt nicht nur gerötet und geschwollen; sie juckten; die Haut nässte und brannte und es bildeten sich Blasen. Auf den Fingern hatten sich bereits Schuppen und Krusten gebildet, die sich verdunkelten und leicht einrissen. Was um Himmels Willen sollte sie berührt haben?
Am Ende der ewigen Warterei hatte der Arzt ihr eine Spritze in die Hand gesetzt und ein Stückchen Haut als Probe abgeschabt. Sobald die Spritze wirkte, hatte er mit einem Skalpell noch ein kleines Stück herausgeschnitten. Die Probe kam in ein Röhrchen, das später ins Labor geschickt werden sollte. Die Stelle nähte er zum Schluss mit mehreren Stichen zu und verschrieb ihr Kortison als Salbe. Am Empfang sollte sie einen Termin vereinbaren und am Donnerstag wiederkommen. Sie kam nicht wieder.
Siegburg, Dienstagmorgen
»Guten Morgen. Hier ist das Klinikum Siegburg, Innere Medizin, spreche ich mit Charlotte Wehner?«
Das Gespräch war kurz. Sie sollte schnell ins Krankenhaus kommen. Heiner? Der schläft doch in seinem Zimmer. Charlotte stellte das Telefon in die Ladestation und lief in Heiners Schlafzimmer. Er war nicht im Bett. Sein Schlafanzug lag unbenutzt darauf. Er war gar nicht da. Sie war gestern wie immer vor ihm ins Bett gegangen und hatte auch nicht mehr Gute Nacht gesagt.
Jetzt ließ Charlotte ihren Tränen freien Lauf. Erst der Hund und einen Tag später der Mann. Was sollte das heißen: Möglicherweise verseucht? Wieso im Krankenhaus, was für eine Infektion? Charlotte suchte nach ihrer Handtasche und überlegte gleichzeitig, was sie mitnehmen sollte und wie es zu diesem Ereignis gekommen war. Heiner hatte Figo nicht angerührt. Er war eher ungerührt und sachlich und schnell bei der Hand, einen Müllsack aufzutreiben. Mit der Mistgabel hatte er den toten Schatz vorsichtig in seine letzte Heimstatt bugsiert und die Tüte, die nicht viel zu wiegen schien, vorsichtig in den Garten getragen. Später hatte er im Garten ein Loch gegraben, es grob zugeschüttet und Gabel und Schaufel im Fischteich gewaschen. Die Gummistiefel wusch er mit der Gießkanne ab und die Handschuhe warf er in die Mülltonne. Ganz sauber, ganz emotionslos, ganz Heiner.
Die Straßen waren noch nicht wirklich gut befahrbar, aber der Volvo sprang an und ließ sich aus der Ausfahrt und die enge Straße hinab bewegen. Trotzdem brauchte sie über eine Stunde bis zum Krankenhaus, zog ein Parkticket, vergaß den Wagen abzuschließen und eilte über den gestreuten Pfad zum Eingang. Dort erfuhr sie, dass es unvorhergesehene Komplikationen gegeben hat und sie möge sich doch bitte dort drüben setzen, es werde sie gleich jemand abholen.
Heiner.
Es dauerte nicht lange und eine Krankenschwester begrüßte sie mit ausdrucksarmem Gesicht. Sie möge bitte mitkommen. Charlotte folgte ihr in den Aufzug zum 2. Obergeschoss. Das Schild dort trug die Aufschrift Station 2C und irgendetwas medizinisches. Charlotte war egal, wie die Station hieß, sie wollte ihren Mann sehen. Er lag in einem Isolierzimmer. Während sie einen grünen Kittel, eine Haube, Einmalhandschuhe und einen Mundschutz anziehen musste, trat ein Mann in weißem Kittel hinzu, gefolgt von einem weiteren Mann mit einem Trenchcoat auf dem Arm und Hut in der Hand.
»Frau Wehner?«, fragte der Mann im Kittel, und als sie nur fragend nickte, fuhr er fort: »Mein Name ist Dr. Durgao. Ich muss Ihnen die traurige Nachricht überbringen, dass wir jetzt in dieses Zimmer eintreten können; Sie werden Ihren Mann aber nicht mehr so sehen, wie Sie ihn kannten.«
»Heiner?«
»Er ist vor einer Stunde plötzlich und friedlich eingeschlafen. Ich werde Ihnen kurz das wenige erklären, was wir bisher wissen.«
Heiner.
»Bitte warten Sie draußen«, sagte er zu dem anderen Mann, der sich verbeugte und den Gang hinunterschlenderte. Heiner lag auf dem Bett, als hätte er sich nur kurz hingelegt. Die Hände auf der Bettdecke, Schläuche umherbaumelnd, die offenbar erst kürzlich entfernt wurden, nachdem man ihn aufgegeben hatte. Die Hände waren alt geworden. Das waren nicht seine Hände, nur sein Ring schien echt. Sein Ehering. Der war allerdings nicht das einzige, was ihr an seinen Fingern auffiel. Die Finger waren geradezu auf die Knochen reduziert, die Haut schien pergamentartig und porös.
»Was...?« Sie wusste nicht, was sie fragen sollte.
»Der Herr, der draußen wartet,« begann Dr. Durgao leise, »hat ihren Mann gefunden. Wenn sie möchten, kann er Ihnen selbst erzählen, was er uns erzählt hat. Aber bitte setzen Sie sich doch.« Er wies auf einen Stuhl, der nahe am Bett stand und machte eine Pause, bis sich Charlotte, ohne den Blick von den Händen ihres Mannes abzuwenden, schweigend platziert hatte.
»Als ihr Mann hier eingeliefert wurde, hatte er am ganzen Körper gezittert, vielleicht von der Kälte. Er war nicht bei Bewusstsein und bekam zuerst eine Infusion. Meine Kollegen von der Notaufnahme waren mit aufs Zimmer gekommen, kurz danach wurde ich hinzugerufen. Nach ersten Untersuchungen hatte Ihr Mann möglicherweise einen Kampf gehabt, wir fanden Kratzspuren im Gesicht und an den Händen. Wenn es kein Kampf war, hatte er sich vielleicht in der Dunkelheit in Gestrüpp und Dornen verfangen und losgerissen - oder es versucht. Was aber am auffälligsten war, es ist jetzt nicht mehr so gut zu erkennen, ist eine filigrane Masse, die etwa wie graue Watte aussieht. Aber nur ein Film und ein paar Strähnen von etwas, was ich zunächst als eitrig gedeutet hatte. Wir vermuteten eine Infektion. Noch während wir ihn weiter ausgekleidet hatten, hat sein Atem ausgesetzt.«
Charlotte liefen Tränen entlang der Nase und tropften auf ihr Taschentuch, das sie aus der Tasche gekramt hatte. Die Arme waren ihr zu schwer, um die Augen zu trocknen.
»Wir haben ihn wiederbelebt, und er war noch einmal zurückgekehrt. Aber wirklich wach wurde er nicht mehr. Vielmehr kann ich im Moment nicht sagen. Wir waren nicht schnell genug. Sie sollten jetzt zuerst einmal Frieden finden, bevor wir uns weiter unterhalten. Es tut mir leid.«
Charlotte Wehner wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Körperlich fehlte ihr nichts als der Körper ihres Mannes. Also wurde sie entlassen. Sicherheitshalber hatte Dr. Durgao ihre Lunge abgehört, sie nach Beschwerden und dem letzten Essen ihres Mannes gefragt. Aber sie schien körperlich gesund und da für Seelsorge keine Zeit war, wurde sie kurzerhand hinaus in den Flur begleitet. Da stand sie einen Moment geistesabwesend, öffnete ihre Handtasche und schloss sie wieder, öffnete sie wieder, kramte ein Taschentuch heraus und schloss sie wieder. Mit dem Tuch wusste sie dann nichts anzufangen.
Der Mann mit dem Trenchcoat auf dem Arm, den sie vorhin flüchtig wahrgenommen hatte, war langsam auf sie zugekommen, von vorn und sich leicht räuspernd, um sich vorsichtig bemerkbar zu machen. Doch Charlotte war plötzlich heftig erschrocken, als sie den Fremden mit ihren wässrigen Augen wahrnahm.
»Frau Wehner?«, hatte er leise gefragt und auf ihr kaum erkennbares verstörtes Nicken hin hatte er weitergesprochen: »Entschuldigen Sie, wenn ich Sie anspreche. Mein Name ist Thomas Brunell. Ich habe Ihren Mann gefunden.«
»Warum?«, fragte Charlotte, knapp an ihm vorbeischauend.
Falsche Frage, dachte Thomas Brunell verständnisvoll und schlug darauf hin vor, sie ins Café im Erdgeschoss einzuladen.
Dort saßen sie nun und nachdem Charlotte endlich ihre Tasche hinreichend geöffnet und geschlossen, sie schließlich an der Stuhllehne platziert und eine einigermaßen gefasste Sitzhaltung eingenommen hatte, begann er seine Geschichte.
»Da wir uns nicht kennen, sollte ich mich vielleicht zunächst vorstellen.« Er suchte nach weiteren Worten. »Ich war früher Verwalter des Wiesenguts und wohne in Stoßdorf, ganz nahe dabei. Seit dreißig Jahren gehe ich da über die Felder und kenne jeden Grashalm mit Namen. Die Siegaue ist mein Paradies. Sie war es bis letzte Nacht.«
Charlotte hörte ihm aufmerksam zu, während sie auf ihre Kaffeetasse starrte und sich inzwischen auch des Zweckes ihres Taschentuchs bewusstgeworden war. Als sie merkte, dass Brunell nicht weitersprach, sah sie ihm mit einer ungestellten Frage in die Augen. Brunell spürte, dass er weitersprechen sollte.
»Also…«, fuhr er fort. »Wo soll ich anfangen?«, sprach er mehr zu sich selbst.
»Mein Mann?« wisperte Charlotte und da hatte er den Faden wieder.
»Ja, natürlich. Ihr Mann. Ich war am Sonntagabend auf den Feldern spazieren und ich glaube, wir sind uns auf der Brücke begegnet. So genau kann ich das nicht sagen. Und am Montagabend bin ich ebenfalls herumgestreift. Ich gehe jeden Nachmittag oder abends durch meine Felder, ich habe ja Zeit dafür und muss mich auch bewegen. Es ist erstaunlich, dass die Natur nie gleich ist. Kein Tag ist wie der andere, und ich erlebe nach all den Jahren auf dem Wiesengut immer neue Dinge - oder Gedanken.« Er stockte. Ich schweife ab, dachte er sich selbst ermahnend.
Fast zeitgleich griffen Charlotte und Thomas in der entstandenen Pause zu ihren Tassen.
»Ich höre Ihnen gern zu«, sagte Charlotte, diesmal etwas entspannter und ziemlich deutlich.
»Gerne«, erwiderte Thomas, »dann komme ich auf das Wesentliche. Also am Montag, es wurde schon dunkel, bin ich wieder meine Wege gegangen. Ich hatte schon eine Taschenlampe eingesteckt, ich weiß ja nie, wie lange ich Lust habe, herumzulaufen. Und die habe ich auch gebraucht. Da ist so ein winziges Wäldchen, sie kennen es vielleicht. Dort habe ich Rascheln gehört und bin stehen geblieben. Manchmal sind dort Kaninchen. Aber das war kein Kaninchen. Es lag etwas Größeres im Gebüsch und stöhnte wie ein Mensch. Und überall Spinnennetze oder etwas Anderes. Das war gruselig. Sowas habe ich noch nie gesehen.« Thomas stockte wieder und suchte nach angenehmen Worten für das Unangenehme. »Und darin lag ihr Mann. Er lebte. Dann habe ich den Notarzt gerufen.«
Sekunden vergingen bis Charlotte auf die Idee kam, schweigend den Rest ihres Kaffees zu schlürfen. Die Tränen waren versiegt. Offenbar versuchte sie zu verdauen, was sie gehört hatte, fand aber keine passende Frage, obwohl alles in ihr danach drängte, mehr zu erfahren.
»Mehr habe ich nicht zu erzählen«, unterbrach Thomas Brunell ihre Gedanken. »Nur dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich bin dann heute Morgen hierhergekommen, aber man hat mich nicht durchgelassen und nichts gesagt, außer, dass gleich Frau Wehner kommen würde. Da habe ich auf Sie gewartet.«
»Was war das im Gebüsch? Spinnen?«, wollte Charlotte wissen.
»Ich habe keine Spinnen gesehen, nur Fäden.« Thomas verstummte nachdenklich.
»Erst Figo – jetzt Heiner«, hörte er Charlotte sagen und das änderte seinen Gedankengang.
»Figo?«
»Unser Hund. Er sah schrecklich aus. Ist Sonntagnacht elend gestorben.« Da kamen sie wieder, die Kullertränen.
»Interessant«, sinnierte Thomas. »Hund und Herrchen in vierundzwanzig Stunden.«
»Ja, wie Sie das sagen. Schon seltsam.«
Charlotte fiel ein, dass sie ihre Tochter in Seattle noch nicht informiert hatte, und wollte langsam auch nach Hause. Sie machte Anstalten, ihre Tasche zu suchen und sich zu erheben, als Thomas seinen Kaffee austrank.
»Kommen Sie zurecht?« fragte er höflich.
»Ja, ich fahre erst einmal nach Hause und versuche, das alles zu verarbeiten. Vielleicht könnten wir unser Gespräch später einmal fortsetzen? Wir stehen im Telefonbuch. Ich – stehe im Telefonbuch: Wehner, Charlotte – und Heiner. Ich weiß jetzt nicht wann, aber ich habe tatsächlich ein komisches Gefühl bei den ganzen Dingen. Muss mich mal sortieren. Jedenfalls danke ich Ihnen für das Gespräch. Und für Ihre Hilfe.«
Nach der förmlichen Verabschiedung blieb Thomas noch sitzen und ging seinen Gedanken nach. Welch eine Abwechslung in seinem Frührentnerleben. Aus dem Arzt würde er als Fremder wohl nichts herausbekommen. Aber nun hatte er eine Aufgabe. Er musste einen Todesfall aufklären. Oder zwei. Spinnen…
Bonn, Nacht zum Mittwoch
Saskia wachte auf und blinzelte. Der Wecker stand auf kurz vor halb drei. War da ein Geräusch? Ein Keuchen kam aus Mias Zimmer. Saskia wischte sich die Augen und versuchte genauer hinzuhören. Da war nichts. Sie ging in die gemeinsame Küche, um ein Glas Wasser zu holen. Mia schnarchte leise. Hatte ihre Mitbewohnerin wieder Bier getrunken? Das Licht in der Küche brannte. Eine rötlich-graue Schleimspur ging vom Spülbecken zum Schrank und wieder zurück. Saskia traute ihren Augen nicht. Sie folgte einem dünnen Film, der zu Mias Zimmer führte, knipste das Licht in der Diele an, öffnete die Zimmertür, drückte auch dort den Lichtschalter und sah fassungslos auf das Schauspiel, das sich auf dem Bett ereignete. Mia schnarchte nicht, sie röchelte und zitterte. Die Bettdecke war weggestrampelt und der Anblick ihrer Freundin versetzte Saskia in einen grausigen Schrecken. Sie machte zwei Schritte zum Bett, blieb dann aber wie angewurzelt stehen. Vor dem grauen Schleim, vor den roten Tropfen auf der Bettdecke, an Mias Bein und auf dem kleinen Teppich. Schleim drang aus Mias Nase. Ein Taschentuch! Das Betttuch. Irgendetwas zum Abwischen. Mia keuchte und atmete schwer. Saskia lief in ihr Zimmer zurück und suchte nach ihrem Handy. Als sie es endlich fand, drückte sie 112 und lief zu Mias Zimmer zurück. Für die Stimme am Telefon hatte sie kaum Worte, nur die Adresse. Und bitte schnell.
Bonn-Poppelsdorf, Mittwochmorgen
Im IOL war die Hölle los. Errol war gegen zehn Uhr kreidebleich aus dem Keller gekommen und packte Christina am Arm. »Komm mal mit runter,« rief er, »das musst Du Dir ansehen.«
»Ich kann gerade…«.
»Komm mit, schrie Errol unerwartet laut, »lass alles liegen!«
Christina stellte den Messbecher ab und trottete widerwillig hinterher. Es roch muffiger, je tiefer sie die Stufen hinabstieg. Im Kellerlabor beleuchtete die traurige Lampe eine Reihe von Schalen, die offenbar von Mia für ihre Testreihe benutzt wurden.
»Da,« sagte Errol mit dem Finger auf die Ablage zeigend. Mehr brachte er nicht heraus. Christina starrte ungläubig auf die Schalen, in denen keine Erde zu sehen war, aus denen stattdessen weißgraue Wattebäusche gut zwanzig Zentimeter hoch und über die Schalenränder hinaus wucherten.
»Was ist das?« fragte Christina. »Etwa Pilzmyzel?«
»Ich weiß es nicht,« schnaubte Errol verständnislos. Was sollte es sonst sein?«
»Was hat sie hier gemacht?«
»Ich weiß es nicht genau. Ist Bernd schon da?«
Christina nickte. »Ich hole ihn, das muss er sich ansehen.
Der Professor telefonierte wieder einmal. Offenbar war das seine Lieblingsbeschäftigung, während der er ständig mit einem Bleistift auf ein Blatt tackerte und Punkte hinterließ. Manchmal konnte man am Ende des Gespräches ein gewisses Muster erkennen. Meistens jedoch war es eher unstrukturiert, wie seine Gedanken möglicherweise auch. Nein, dachte Christina, der denkt sogar besonders strukturiert. Nur, was es damit auf sich hatte, wusste sie nicht. Sie räusperte sich im Rücken des Professors, um sich bemerkbar zu machen. Ross legte den Bleistift ab, drehte sich um und winkte auf und ab, als ob er andeuten wollte, dass er gleich fertig sei. Christina nahm ihm den Bleistift aus der Hand und schrieb in großen Buchstaben auf das Blatt »KELLER! SCHNELL!«
Bernhard Ross überholte sie auf dem Flur und fragte im Vorbeieilen. »Was gibt es denn zu feiern?«
»Sehen Sie selbst, Errol ist im Kellerlabor,« gab Christina von sich und zeigte mit dem Finger den Weg, den doch keiner so oft gegangen war wie der Boss selbst. Der war schon an der Kellerlabortür und blieb abrupt stehen.
»Sind das Mias Proben?« fragte er und ging ein paar Schritte in den Raum. Von Errol kam ein ‚Mmh‘ mit geschlossenem Mund.
»Wo ist sie denn?« Er wartete auf Antwort, erfuhr aber nur zwei Schulterzucken. »Nichts anfassen! Christina, hol mir Handschuhe, eine Pinzette und ein Reagenzglas. Ich muss das genauer ansehen.«
An der Wand hing ein Mundschutz, den er sich überzog und nuschelte: »Errol, zieh auch einen an.« Errol sah sich um, fand aber nichts dergleichen. »Oder geh raus und mach die Tür zu.«
Die Tür ging zu und wieder auf, als Christina mit den Utensilien hereinkam. Ross zog sofort die Einmalhandschuhe an, die ihm eine Nummer zu klein waren, bewaffnete sich mit der Pinzette und schickte die Assistentin vor die Tür. Viertel nach zehn. Der Wissenschaftler war erwacht.
Während Errol und Christina schweigend die Treppe hochstiegen, lief Saskia im Foyer an ihnen vorbei auf dem Weg ins Labor. Sie blickte nur kurz zurück und ihre verweinten Augen ruhten für einen winzigen Moment auf den bleichgesichtigen Kollegen. Dann brach sie in lautes Weinen aus und stürmte weiter, warf ihre Jacke über einen Stuhl und erstarrte plötzlich. Errol und Christina wollten eigentlich vom Kellerphänomen berichten, aber Saskia schrie sofort los. »Was habt Ihr hier veranstaltet? Mia ist im Krankenhaus. Sie haben sie mitten in der Nacht eingeliefert. Ihr ging es schrecklich übel. Heute Morgen war ich gleich im Petrus-Krankenhaus. Sie liegt auf der Intensivstation, im Isolationszimmer. Ich durfte nicht zu ihr. Ich sagte, ich bin ihre Mitbewohnerin und beste Freundin. Dann hat mir eine Schwester irgendetwas von gefährlichen Keimen und Infektion erzählt. Mehr wusste die nicht. Ich sollte aber später noch einmal wiederkommen. Sie wird erst untersucht. Was ist da los? Was ist mit ihr?«
Errol kam mit zwei Tassen Kaffee. »Setz dich erstmal. Bernd ist dabei, im Keller etwas zu untersuchen«, sagte er mit beruhigender Stimme und stellte eine Tasse vor Saskia auf den Tisch. »Er hat uns rausgeschickt…«.
In diesem Moment stürmte Ross mit wehendem Kittel und ein Reagenzglas wie eine Monstranz hochhaltend vorbei und nuschelte etwas, das man durch den Mundschutz nicht verstehen konnte. Er verschwand im Mikroskopierraum und schloss die Tür hinter sich. Sechs Augen starrten auf die Tür und drei Münder schwiegen.
2. Longyearbyen, Spitzbergen, 2015, September
Donnerstagabend
Jan Kristian Eide hatte Husten. Nicht dass Jan Raucher war, sein Arzt hatte ihn schon vor ein paar Jahren auf Bronchitis untersucht, aber Jan war gesund. Nur nicht so gesund, dass er sich im Moment gesund fühlte. Er wusste, dass er Fieber hatte und ihm war klar, dass er in diesem Sommer seit Tagen mehr hustete als sonst im Winter. Er spuckte ins Waschbecken und putzte sich die Zähne. Ein wenig Zahnfleischbluten beunruhigte ihn nicht und Jan spülte den Mund aus, wusch sich mit der Hand ein paar mal durch das Gesicht und trocknete sich ab. Es war spät genug und er war müde vom vielen Kehren.
Camilla saß auf dem Sofa, hatte die Beine hochgelegt und blickte abwechselnd auf die Werbung im Fernseher und die Programmzeitschrift. Als sie Jan kommen hörte, stöhnte sie. Nein sie stöhnte nicht, sie seufzte. Jan hatte es genau so interpretiert, als er das schöne Bild sah. Camilla war nur halb umgezogen. Unter dem dünnen rosa gestreiften Nachthemd sah Jan noch einen schwarzen BH. Und die langen schlanken Beine sahen in ihren Nylonstrümpfen ebenfalls nicht nach Schlafmodus aus.
»Kommst Du mit ins Bett?« fragte Jan.
»Nein«, hauchte Camilla.
»Schaust Du noch etwas?«
»Nein«, seufzte Camilla.
»Ach, da kommen Nachrichten«, bemerkte Jan und ließ sich mit einem Seufzer auf dem Sofa nieder. Seine Hand legte sich auf Camillas bestrumpftes Knie.
»…Nachspiel im Streit um die Landung tschetschenischer Spezialkräfte auf dem Flughafen von Longyearbyen«.
Jan hörte gespannt zu. Immer noch der alte Kram. Das führt doch zu nichts. Die linke Hand war indessen höher gewandert.
»… aus dem Ausland«, hörte man die Nachrichtensprecherin.
»…näherkommen«, hörte Jan seine Frau seufzen.
Nein, sie seufzte nicht. Sie stöhnte. Sie legte ihre Hand auf Jans Brust und streichelte sie.
»Mach doch aus«, stöhnte Camilla weiter und drehte mit den Fingern die Brustlöckchen unter Jans T-Shirt.
»Moment noch«, keuchte Jan, der sowieso nicht mehr zuhörte, während er mit einer Hand längst den bekannten BH-Verschluss geöffnet hatte.
Er suchte die Fernbedienung, fand sie nicht.
»O…kay«, drang es aus ihm und er beugte sich zu Camilla herunter, um in sie einzudringen.
»Das Wetter.«
Donnerstagnacht
Jan Kristian Eide träumte wirr. Er befand sich in einer dunklen feuchten Höhle und hörte das ferne Geräusch einzelner Tropfen, die auf Wasser fallen. Ein Rascheln war ganz in der Nähe. Es hörte sich so nah an, als käme es aus ihm heraus. In der Dunkelheit waren keine Umrisse zu sehen. Nur ein ganz schwacher bläulicher Schimmer war erkennbar. Wie in einer blauen Grotte stakte er einen Nachen durch einen kühlen See, der keine Grenzen hatte. Er sah ringsum nichts. Das wohlige Gefühl von Geborgenheit wurde nur durch das Rascheln gestört. Das Rascheln wurde lauter. Ein Schnarchen, das von innen kam. Kann man sich selbst schnarchen hören? Urplötzlich explodierte etwas in seinem Inneren, nein, es kam von außen, er war gegen eine Felswand gestoßen und fiel ins Wasser. Das Wasser war hart. Hart wie das Holz des Nachens. Er schluckte Wasser und musste husten. Wo kann ich mich festhalten? Er prustete, aber seine Lungen waren schon vollgesogen. Er musste einen Halt finden. Er fand einen Halt. Das Boot, das Holz. Plötzlich fand er sich bäuchlings darauf liegend und hustete sich das Wasser aus dem Leib.
Da erschien ihm das Licht. Jan wachte langsam und benebelt auf. Eine Stimme sprach zu ihm, zunächst verträumt und dann laut und deutlich: »ma…Du da? …wehe tan?«. Er kannte die Stimme, es war Camillas Stimme. Camilla, seine Frau, die ihm wieder einmal das Leben gerettet hatte, indem sie den Wodka versteckte. Die ihn jetzt allerdings sehr verschreckte. Denn sie rief ihn, sie rief laut. Sie schrie, wie er sie noch nie schreien gehört hatte. Immer noch benebelt fand er sich auf allen Vieren, berappelte sich kurz und musste wieder husten. Er hustete bis er würgte und spuckte, bekam keine Luft mehr, zuviel Wasser in der Lunge, würde kollabieren, blieb aber auf allen Vieren und blickte mit wässrigen Augen auf…, ja, auf was? Auf das Nass. Er war tatsächlich ins Wasser gefallen, aber neben das Bett. Das war doch sein Bett und hinter ihm schrie und trippelte Camilla mit einem Tuch, das sie ihm vor den Mund schob.
»Was soll ich mit…?« keuchte Jan und bekam einen neuen Hustenanfall mit einem Schwall Wasser, der die schmierige Lache vergrößerte, in der seine Hände steckten.
»Du ust Blut…«. Der Satzfetzen erschreckte ihn noch mehr und zog ihm die Brust zusammen, schnürte seinen Hals ab. Nass vom Wasser oder vom Schweiß konnte er sich nicht mehr auf die Arme stützen. Nur ein ängstliches klagendes Röcheln brachte er noch heraus, das nach ‚Mama‘ klang. Dann verlor er das Bewusstsein.
Camilla kniete neben ihm auf dem Boden, rüttelte ihn mit beiden Händen und schrie ihn an. Als sie merkte, dass sie nichts damit bewirkte, suchte sie ihr Handy auf dem Nachttisch und fand es. Sie lief erneut um das Bett herum und sah nach dem unbeweglich am Boden liegenden Jan, während sie die 113 wählte. Sie fasste sich kurz, man hatte sie sofort verstanden. Sie musste sich um ihren Geliebten kümmern.
»Jan! Jan, wach auf!« schrie sie ihn erneut an und schüttelte ihn weiter, drehte ihn auf den Rücken, weg von der roten Pfütze. Jan atmete flach. Oder gar nicht? Wie geht Wiederbelebung? Schütteln. Nein, Herzmassage? Ja, auf den Brustkorb drücken und in den Mund atmen. Camilla musste sich überwinden, ihren Mund auf den eklig verschmierten Mund ihres Mannes zu setzen, um in ihn hinein zu pusten. Sie stellte sich grotesk ungeschickt an und schämte sich vor sich selbst. Das Bild blieb das gleiche. Sie kniete völlig verwirrt neben ihm und neben der schmierigen Lache, wischte sich mit dem Tuch über den Mund, dann über Jans Mund und dann über die Lache. Angewidert von der rotschleimigen Masse, ließ sie das Tuch sinken und starrte schicksalsergeben vor sich hin, legte dann ihren Kopf auf Jans Brust und horchte nach Atmungszeichen. Ja, es rasselte etwas in ihm, in gewisser Weise hörte es sich wie Atmen an. Und das Herz klopfte? Oder war es ihr Herz, das sie spürte bis in die Ohren. Sie beschloss, dass Jan lebte und richtete sich zitternd auf, als sie das Läuten an der Haustür vernahm. Im Bad tropfte der Wasserhahn.
Freitagmorgen
Camilla Inger Eide hatte Husten. Nicht dass Camilla Raucherin war, ihr Arzt hatte sie erst im Mai für gesund erklärt. Nur nicht so gesund, dass sie sich im Moment gesund fühlte. Sie wusste, dass sie Fieber hatte. Sie putzte sich die Zähne. Ein wenig Zahnfleischbluten beunruhigte sie nicht und Camilla spülte den Mund aus, wusch sich das Gesicht und trocknete sich ab. Es war spät genug und sie wollte früh im Krankenhaus sein, um nach Jan zu sehen. Der Weg war nicht weit in der kleinen Hauptstadt. Ob um acht Uhr wohl schon Besuchszeit war? Ob sie ihn retten konnten? Hatte sie ihn gerettet? Hatte sein Atem ausgesetzt oder nicht? Sein Herz geklopft? Wie lange konnte ein Mensch wiederbelebt werden? Bleiben Schäden zurück? War Jan tot? Es drängte sie aus dem Haus und nach Antworten. Hustend schloss sie die Haustür hinter sich ab, steckte einen Kaugummi in den Mund und wählte im Gehen Sarahs Nummer. Da sie sich nicht meldete, rief sie gleich im Universitätszentrum an und meldete Jan krank.
Beim Anstieg zum Longyearbyen Sykehus hatte Camilla mehrere Hustenanfälle und musste immer wieder stehen bleiben. Verunsichert blickte sie zu den hohen Bergspitzen hinter dem Krankenhaus und war froh, nicht dort hinauf zu müssen. Sie zog ein Taschentuch aus der Umhängetasche, putzte sich die Nase, spuckte den Kaugummi und einen kleinen Klumpen Hustenschleim hinein und sah einen kleinen Blutfleck im Tuch, das sie kurzerhand in den kleinen Mülleimer vor dem kleinen Krankenhaus warf. Rund ein Dutzend Leute arbeiteten hier, aber hinter der Eingangstür war keiner von ihnen zu sehen. Da sie nicht unbefugt herumlaufen wollte, setzte sich Camilla auf einen Stuhl und hustete. Offenbar hatte sie damit jemanden geweckt, denn sie hörte leise Schritte sich nähern. Es war eine rotblonde Schwester, die Camilla nicht kannte, die offenbar aber sie kannte. Ihre ersten Worte waren: »Guten Morgen. Sind sie Frau Eide?«
Was dann kam, beunruhigte Camilla fürchterlich und machte sie zugleich wütend. Sie sollte bitte warten bis Dr. Solberg kommt. Was mit ihrem Mann sei, fragte Camilla. Dr. Solberg würde es ihr erklären. Ob es ihm gut ginge. Sie solle bitte noch etwas warten. Wann Dr. Solberg komme. Normalerweise jeden Moment, aber nach dieser Nacht vielleicht etwas später. Camilla schluchzte, wollte aber nicht weinen. Es hatte keinen Zweck, sie musste warten bis dieser Doktor kam. Die Schwester hatte sich auch schon umgedreht und ging um die Ecke. Da saß Camilla nun auf dem unbequemen Stuhl und wartete und schluchzte leise vor sich hin. Und hustete.
Nach einer Viertelstunde ging endlich die Tür auf und eine Frau kam herein. Vielleicht war es Frau Dr. Solberg? Die Frau grüßte höflich und bog um die gleiche Ecke, hinter der die Schwester verschwunden war. Keiner kam mehr herein oder heraus. Camilla saß allein und hustete Blut. Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, bis ein Mann mit Bart und schwarzgerandeter Brille die Tür aufriss, dass Camilla aus ihrer Lethargie hochschreckte. Er grüßte und ging sofort um die Ecke.
Kurz darauf kam er allerdings im weißen Kittel zurück und sprach Camilla an.
»Frau Eide?« fragte er?
»Ja, das bin ich.«
»Gut, dass Sie da sind. Mein Name ist Haug Solberg. Frau Eide, ich will nicht lange drumherum reden. Bitte kommen Sie doch mal mit. Wir gehen zu ihrem Mann.«
Camilla erhob sich hustend.
»Haben Sie Grippe?« fragte Dr. Solberg, als sie um die ominöse Ecke gebogen waren.
»Ich weiß es nicht, Husten wohl, ja.«
Der Arzt ging nicht weiter darauf ein, bog um die nächste Ecke und erklärte ihr unterwegs, dass es gut gewesen sei, dass ihr Mann so schnell eingeliefert wurde. Allerdings stünde man vor einem Rätsel, was genau mit ihm los ist. Einiges deute auf eine Infektion hin, anderes auf eine Vergiftung und er spucke etwas aus, das noch untersucht werden müsse. Ja, er sei am Leben.
Camilla atmete tief ein und zugleich auf. Dabei musste sie so sehr Husten, dass ihr ein Kloß in den Mund kam, den sie ins Taschentuch spuckte. Dr. Solberg hielt kurz vor einer Tür und sah Camilla zweideutig an. Dann öffnete er die Tür mit den Worten: »Noch einmal: Er lebt.«
In diesem Augenblick erschrak Camilla und hustete erneut in ihr Taschentuch, als wolle sie es als Mundschutz benutzen. Im gleichen Moment sah sie Jan auf dem Bett. Sie sah nur seinen Kopf und die Hände auf der Bettdecke. Ringsum standen Ständer mit Schläuchen und Geräte, die blinkten und leise piepten. Camilla riss die Augen auf und konnte nichts sagen. Sie brauchte es auch nicht, denn in diesem Moment, in dem auch die rotblonde Schwester leise eintrat, lüftete der Arzt sein Geheimnis. »Er ist ins Koma gefallen.« Schweigen.
Camilla wurde angeboten, sich auf den einzigen vorhandenen Stuhl zu setzen, aber sie war angewurzelt. Selbst ihr Husten war weg. Sie sah nur ungläubig den graugesichtigen Mann auf dem Bett an, der ihr Jan sein sollte. Zweifellos war er es, nur um Jahre gealtert.
»Wir haben hier keine geeigneten Geräte und Untersuchungsmethoden. Deshalb wird Ihr Mann so schnell wie möglich nach Tromsø überführt. Das wird nicht mehr lange dauern.«
Camilla hustete wieder.
Erst jetzt sah der Arzt genauer hin und sprach sie auf ihr blutiges Taschentuch an.
»Wie lange spucken Sie schon Blut?«, wollte er wissen.
»Ich habe es erst heute Morgen gemerkt«, antwortete Camilla zögernd und mit verstörtem Blick.
»Darf ich Sie bitten, das Taschentuch uns zu überlassen? Ich würde es gern untersuchen.«
Ein Fragezeichen erschien über Camillas Kopf.
»Ihr Mann hat aus Mund und Nase geblutet und viel Schleim abgesondert«, fügte der Arzt erklärend hinzu.
Wortlos überreichte Camilla das Taschentuch der Schwester, die bereits Einmalhandschuhe angezogen hatte und das Tuch in einen Klarsichtbeutel verstaute.
Dr. Solberg entschuldigte sich damit, dass er eine kleine Runde machen müsse. Er wollte auch noch in sein Büro und ins Labor. Sie könne gerne warten. Camilla wartete auf dem harten Stuhl beim Eingang. Und nahm sich mit dem nächsten Hustenanfall ein neues Taschentuch. Sie zückte ihr Handy und versuchte es erneut bei Sarah. Diesmal ging sie dran und fragte müde, was denn so früh los sei. Camilla konnte nicht sortieren, was jetzt das Wichtigste war und röchelte nur: »Kannst Du bitte ins Krankenhaus kommen? Es ist wegen Papa«. Zu weiteren Erklärungen war sie nicht fähig. Ein Wagen mit der Aufschrift Sysselmannen fuhr vor.
Die Rotblonde kam mit einem Pappbecher Kaffee, gerade als Sarah zur Tür herein hechelte. Offenbar war sie gelaufen.