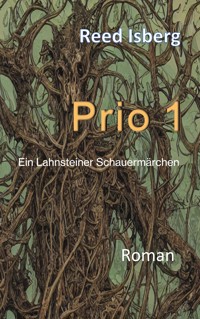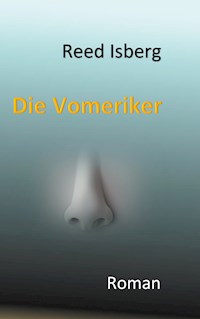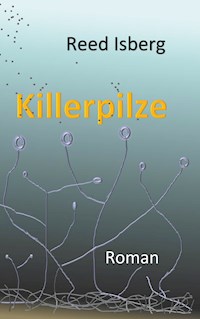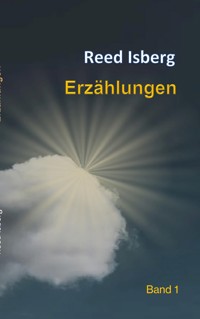
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach seinen Romanen »Killerpilze«, »Die Vomeriker« und »Prio 1« startet Reed Isberg eine Reihe von Kurzgeschichten. Darin verwendet er ungewöhnliche Motive und stattet sie mit fantasievollen Entwicklungen aus. Vor geschichtlichen, wissenschaftlichen oder kontemplativen Hintergründen entwickelt Isberg seine Märchen und Utopien mit überraschenden Geschehnissen, zum Grübeln, zum Mitdenken, zum Schmunzeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die Rückkehr der Glocke
Ein fallender Regentropfen
Als die Tage heller wurden
Wie dem Max und anderen der Kunststoff abhandenkam
Die Bienenkönigin
Der verlorene Geburtstag
Der siebte #Dämon
NYSE Deals – Die Seelenhändler
Der kleine Zirkus
Ameisenbericht
Karlheinz und ich
Das Zeitlos oder ›Wie ich einmal eine Wurst gegessen habe und was danach geschah‹
Der Blaualgenmann
Das Loch im Eichenwald
Das Ende der Welt
Warten auf Hänsel
Die Rückkehr der Glocke
Die Redewendung ›Die Glocken fliegen nach Rom‹ ist rein metaphorisch und hat keine wörtliche Bedeutung. Abseits christlicher Osterfeierlichkeiten wird sie gelegentlich verwendet, um auf eine unerwartete Wendung, eine große Überraschung oder eine ungewöhnliche Veränderung in einer Situation hinzuweisen. Es sei vorab ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Glocken nicht fliegen können.
Im masurischen Nikolaiken war das ein wenig anders. Die Glocke der Pfarrkirche Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz flog, genau wie es Pfarrer Joseph Schnack den Kinderchen im Kommunionsunterricht erläutert hatte, während der Abendmahlmesse am Gründonnerstag nach Rom, um den Segen des Papstes für das Osterfest zu holen. Das ganze Jahr über hatte der Pfarrer keine Verwendung für den Papst, aber für diese Geschichte musste der fromme Mann im fernen Rom herhalten, damit sie glaubwürdig erschien. Joseph Schnack zelebrierte auch keinen anderen Gottesdienst und insbesondere die liturgische Weihe von Brot und Wein durch Verwandlung in Leib und Blut Christi mit solcher Inbrunst und Überzeugungskraft, wie in dieser Abendmahlmesse – und, ja gut, dann auch noch in der Osternachtsfeier, denn Ave Maria, wie das Glöcklein da oben genannt wurde, war ihm ein besonderes Anliegen in der Weltordnung, um die es seiner Meinung nach schlimm bestellt war. Bei umfangreicheren Gottesdiensten pflegte Schnack seine Predigten zeitlich so zu bemessen, dass er zur Wandlung exakt nach einer Stunde kam. Er nutzte dazu seine Armbanduhr in der Weise, dass er den Wortgottesdienst so erweiterte oder verkürzte, jedenfalls so zeitgerecht abschloss, wie es die weitere Liturgie erforderte. Zunächst also wurde das Hanc igitur durch ein Glockenzeichen angekündigt. Manche der älteren Teilnehmer waren zu ihren Kinderzeiten überzeugt gewesen, dass es reicht, bei diesem Zeichen in der Kirche zu sein, und das erste Läuten wäre so etwas wie das Klingeln in der Schule: Jetzt aber rein! Die Kinderchen heute wussten es besser und vernahmen andächtig, wie sich der Priester über das Brot beugte und die Worte sprach: »Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.« Danach hielt er recht glaubhaft nicht mehr Brot in den Händen, sondern den geopferten Leib Jesu. Oben schlug Ave Maria zum zweiten Mal. Sodann beugte sich Pfarrer Schnack über den echten Kelch und sprach die Worte: »Hic est enim calix sanguinis mei novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum.« Ave Maria schlug zum dritten Mal und alle Kinderchen konnten sehen, wie der Priester jetzt richtigen Wein trank. Sie glaubten es gar von ihrer Bank aus ungeprüft, denn Bobbele, der Messdiener, hatte ihnen vor geraumer Zeit gesteckt, dass der Pfarrer schon mehrere Flaschen Wein hinten in der Sakristei abgefüllt hatte, die er auf diese Weise hergestellt hatte. Wie dem auch sei, nachdem der Pfarrer alles Nötige verwandelt hatte, war von Ave Maria nichts weiter zu vernehmen. Das fiel aber erst auf, nachdem der Gottesdienst beendet war, denn weder hatte Kanton Ungefug zum Abschluss seine Orgelkünste präsentiert noch begleitete Glockengeläut die Gläubigen beim Verlassen des Gotteshauses. Mit einem letzten Blick auf den Kirchturm vergewisserten sich die Kinderchen, dass die Glocke nun auf ihrem segenholenden Weg nach Rom war, wenngleich das Geläut hinter den schräg stehenden Brettern noch von keinem ihrer Augen je gesehen worden war.
Ave Maria kehrte zur Osternachtsfeier zurück, als der Gottesdienst wie jedes Jahr am Ostersamstag um 22 Uhr begonnen hatte. Pfarrer Joseph Schnack brachte es alljährlich trotz seines fortgeschrittenen Alters fertig, die Feierlichkeiten auf gut eineinhalb Stunden auszudehnen, weshalb von vornherein auf die Mitnahme von Kinderchen verzichtet worden war, auch wenn sie noch so drängten und quengelten, weil sie sehen wollten, wie Ave Maria von Süden her einflog und in ihr Nest zurückkehrte wie ein Zugvögelchen. Aber es war ja dunkel in der Osternacht. Sie würden Ave Maria schon noch zu hören bekommen. Ave Maria kehrte allerdings zur Osternachtsfeier nicht so pünktlich zurück, als dass sie gegen 23 Uhr ihre drei Glockenschläge zur Wandlung hätte abliefern können. Vielleicht hatte sie sich unterwegs verflogen oder sich in ihrem Nest zuerst einrichten und herausputzen wollen, jedenfalls trat sie ihren Dienst nicht wie vorgesehen an, was nicht nur Joseph Schnack bei der Konsekration von Brot und Wein zur Anhebung seiner Augenbrauen brachte, sondern auch unter den Mitgliedern der feiernden Kirchengemeinde Irritationen dergestalt hervorrief, dass einige Köpfe sich drehten, andere sich nach oben richteten, wo auch unter normalen Umständen keine Glocke zu erblicken gewesen wäre. Der Priester brachte sein frommes Werk tapfer zu Ende und beim Hinaustreten in die kühle Nachtluft vernahmen die Schäfchen immerhin die feierlich-getragenen Klänge von Kanton Ungefugs Orgelpfeifen, sodass nicht zuletzt auch aufgrund fortgeschrittener Müdigkeit kein weiterer Anlass zum Grübeln über die leichte Abwandlung der Liturgie bestand. In dem kleinen Städtchen waren die Wege kurz genug, dass ein jeder um Mitternacht zu Hause, wenn nicht schon eingeschlafen war. Um Punkt 24 Uhr schlug Ave Maria einmal und danach in bestimmtem Abstand noch zweimal ihren Klöppel gegen ihre bronzene Seite zum Zeichen der Wandlung.
Tag 1 nach Rückkehr (Ostersonntag)
Um Punkt ein Uhr schlug Ave Maria genau 24 Mal ihren Klöppel gegen ihre bronzene Seite und damit begann die eingangs erwähnte ungewöhnliche Veränderung in Nikolaiken, die allerdings, da alle Einwohner schliefen, zunächst weder Aufmerksamkeit erfuhr noch Auswirkungen zeitigte. Der erste, der eine Veränderung verspürte, war der Bäcker Szymon Kowalczyk. Eigentlich fiel sie ihm gar nicht auf, sondern er trottete zunächst seinem Tagesablauf wie gewohnt entgegen. Selbstverständlich musste er seinen Wecker im Dunkeln nicht lange betrachten, um zu wissen, dass es zwei Uhr war, denn er hatte das Instrument vor vielen Jahren auf zwei Uhr eingestellt und stand seither jeden Morgen um zwei Uhr auf, wenn und weil es klingelte und zuweilen auch ohne dieses Geräusch abzuwarten, weil es eben Gewohnheit war. Heute ließ er es länger klingeln und wäre gern noch liegen geblieben. Ave Maria tickte derweil anders, sie hatte nur einmal geschlagen, als es zwei Uhr war, was für den Bäcker Kowalczyk natürlich nicht zu vernehmen war, denn sein Wecker auf dem Nachttisch war viel näher und lauter als das Glöcklein im fernen Turm. So kam es, dass Szymon Kowalczyk heute schon kurz nach ein Uhr sein Handwerk begann und sich erst wunderte, als die fertigen Roggenmischbrote bereits den Ofen verließen, während es draußen noch stockdunkel war. Gestern war es am Ende der Backzeit gegen sieben Uhr draußen allmählich hell geworden und der Brötchenjunge zum Dienst erschienen. Heute aber erschien weder der Gehilfe noch irgendein früher Stammkunde. Endlich nahm Kowalczyk einigermaßen erstaunt wahr, dass im Hof der Hahn krähte, was dieser recht zuverlässig immer um sechs Uhr tat, jedenfalls um diese Stunde herum, gleichgültig ob die Sonne schon aufgegangen war oder nicht. Still beschloss der Bäckermeister, seinen irrtümlich frühzeitigen Arbeitsbeginn für sich zu behalten und sein Weckinstrument später höchstselbst einer peinlichen Untersuchung zuzuführen. Hernach klärte ihn allerdings sein Frauchen, Zuzanna Kowalczyk, darüber auf, dass es Ostersonntag war, womit man wohl trefflich erklären könnte, dass weder Brötchenjunge noch Kunden heute seine frischen Waren erwarteten. Somit war für den Bäcker Kowalczyk die Untersuchung seines Weckers einstweilen obsolet geworden.
Für heute ließen sich leichthin dutzende ähnlicher Fälle von Verwunderung beschreiben, die zu nichts weiter führen würden, als dass folgendes feststand: Seit der Rückkehr der Ave Maria aus Rom war in Nikolaiken die Zeit verstellt. Was immer Ave Maria anschlug, es war die Stunde, nach der sich alle Uhren in dem Städtchen richteten. Da die zurückgekehrte Glocke also den Takt setzte, war es in ganz Nikolaiken fortan zu jeder Zeit eine Stunde früher als gestern. Am Tag des Osterfestes machte sich nur Pfarrer Joseph Schnack Gedanken darüber, ob die Kirchenglocke in Rom gewesen war, um sich den Segen des Papstes für das Osterfest zu holen, oder ob sie vielleicht unterwegs von einer anderen höheren Macht angefallen war, durch die sie in die Lage versetzt wurde, Eingriff in den örtlichen Alltag zu nehmen. Die übrigen Nikolaiker registrierten wohl eine Zeitverschiebung, fanden sich jedoch damit ab, dass am Ostersonntag die reguläre Darmperistaltik ebenso früher einsetzte wie die körperlichen Bedürfnisse nach Speis und Trank. Am Feiertag war die Uhrzeit nicht so wichtig und ein jeder beging den dienst- und schulfreien Tag in Ruhe und Gelassenheit, allenfalls in einer kurzen Überlegung dahingehend mit der Zeit beschäftigt, ob es wohl ein Schaltjahr und wie herum nun zu rechnen sei, in der Feiertagslaune dabei außer Acht lassend, dass es einerseits beim Schaltjahr um einen ganzen Tag ging und andererseits die Umstellung auf die Sommerzeit eine ganz andere Sache war. Ave Maria schlug 8 und 12 und 20 Uhr und in Nikolaiken standen alle Uhren auf 8 und 12 und 20 Uhr.
Tag 2 nach Rückkehr (Ostermontag)
Auf die österliche Zeitverschiebung hätten sich die Nikolaiker wohl ebenso einstellen können, wie auf die regelmäßige Umstellung von Winter- auf Sommerzeit. Die einzige Besonderheit bestand darin, dass die Uhren nicht umgestellt werden mussten, sondern von sich aus die Stunde anzeigten, die Ave Maria ihnen vorgab. Einige politisch engagierte Stadtbewohner hielten es auch nicht für ausgeschlossen, dass die Regierung per Dekret eine neue Zeitrechnung eingeführt und umgesetzt habe, ohne die Bevölkerung über ihre Entscheidung zu unterrichten. Indessen ging auch der Ostermontag vorbei, ohne die allgemeine und die öffentliche Ordnung ernsthaft zu stören.
Das aber änderte sich in der Nacht zum Ostermontag. Vom schlafenden Volk in Nikolaiken unbemerkt, schlug Ave Maria nicht nur erst um 1 Uhr genau 24 Mal, sondern hinzukommend um 2 Uhr gar 25 Mal, was – wie man sich leicht vorstellen kann – für jede Uhr eine beachtliche Herausforderung darstellte. Die Nikolaiker Uhren behalfen sich bei diesem Umstand damit, für eine Stunde auf 24 zu verharren, denn eine 25. Stunde war bei keiner von ihnen vorgesehen. Folgerichtig sprangen sie um 3 Uhr, als Ave Maria endlich eins schlug, von 24 auf 1. Ein solcher doppelter Umstand in der Zeit musste nun tatsächlich für größere Verwirrung sorgen als die bloße Zeitverschiebung um ein Stündchen. Es war aber zunächst nur ein Mensch in Nikolaiken wirklich skeptisch geworden, was die Stunde geschlagen hatte, nämlich Pfarrer Joseph Schnack. Gegen Sonnenuntergang hatte er angefangen, die Glockenschläge zu zählen und zur vollen, noch einigermaßen hellen Stunde 19 Schläge gezählt, wohingegen doch die Sonne vor etwa einer Woche ziemlich genau um 20 Uhr und in den letzten Tagen zunehmend noch etwas später untergegangen war. Hatte sich das Himmelsgestirn verschoben? War die Erde verdreht? Hatte er sich verhört oder falsch gezählt? Pfarrer Schnack ermittelte und notierte die nachfolgenden Glockenschläge; immer war es ihm einer zu wenig. Als es nach seiner anfänglichen Zeitrechnung Mitternacht sein sollte, stand er mit einer Lampe vor der Pfarrkirche Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz, beobachtete scharf die Kirchturmuhr und lauschte angestrengt der Ave Maria. Tatsächlich hörte er 23 Schläge und sah sowohl die Kirchenuhr als auch seine Taschenuhr auf 23 stehen. Eine Stunde später stand der Pastor wieder vor der Kirche, hörte 24 Schläge und sah beide Uhren auf 24 stehen. Da nun alles sich so bestätigte, wie er es schon kannte, wandte er sich ab, um sein Nachtlager aufzusuchen, blieb nach der Abendtoilette doch kopfschüttelnd vor seinem Wecker stehen, der nach wie vor auf 24 stand, genau wie auch die Zeiger seiner Taschenuhr sich nicht weiter bewegt hatten, seit Schnack seinen Beobachtungsposten verlassen hatte. ›Jesusmaria‹, dachte der fromme Mann, ›da muss aber doch etwas repariert werden‹, wobei er in diesem Moment noch in erster Linie seine persönlichen Uhren meinte. Bloß weil mit diesem Gedanken und dem Zählen von Stündchen statt Schäfchen schwerlich einzuschlafen war, kam er in die Lage, die Glockenschläge zur nächsten vollen Stunde zu hören. Der müde Pfarrer hätte jetzt einen einzigen verspäteten Glockenschlag erwartet, denn auch wenn Ave Maria verspätet schlug, kam immerhin nach der Stunde 24 die Stunde 1 des neuen Tages. Aber was? Der Gedanke an zwei Uhr normaler Zeit war gar nicht zu Ende zu führen im anhaltenden Glockengeläut, welches Schnack nun vernehmen musste. Das war weiß Gott mehr als ein Glockenschlag, es waren derer noch einmal 24 dazu. Hatte er richtig mitgezählt? Hatte Ave Maria 25 Mal geschlagen oder mehr oder weniger? Der Wecker jedenfalls stand nun endlich auf 1, wo er leidlich hingehörte und Joseph Schnack war nicht länger in der Lage, sich wach zu halten. Mochte der Uhrmacher aus Lötzen Morgen nach dem Uhrwerk sehen.
Tag 3 nach Rückkehr (Dienstag)
Dieser Tag war anders als der Vortag, noch anderser als der Vorvortag und am andersten als alle Tage davor. Unwillkürlich wie eine Naturgewalt, deren sich die Menschen nicht entziehen können, sagen wir ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch, was zugegebenermaßen in Nikolaiken nicht oft der Fall war, so unwillkürlich jedenfalls erfuhr das kleine masurische Städtchen eine Anwandlung von Anarchie, bloß weil die Glöcklein und die Ührchen neuerdings anders tickten. Ein jeder begann, nach seiner Art zu leben, gewissermaßen nach seiner eigenen Uhr zu laufen. Manche hielten sich genau an die neue Uhrzeit, weil eben ihr eigenes wie jedes andere ersichtliche Zeitmessgerät diese nun einmal anzeigte und sie also gehorsamst zu befolgen war. Zum Beispiel Bürgermeister Zielinski, der wie stets in allen Amtsjahren zuvor pünktlich um 8 Uhr alter Zeitrechnung im Amt erschien, heute also schon um 5 Uhr neuer Zeit. Kacper Zielinski war klar, dass ein langer Tag vor ihm lag, denn er hatte die feste die Absicht, wie stets bis 18 Uhr amtlicher Zeit im Amt zu bleiben, auch wenn die Sonne ihm einen Streich zu spielen schien und er kurzzeitig irritiert am frühen noch dunklen Morgen seine Amtsstube be- und seinen Amtsdienst antrat. Ob er in diesem Amt bleiben würde, war indessen nicht so klar, denn schon um 7 und noch mehr um 8 Uhr neuer Zeit versammelte sich eine zunehmende Menge von Personen vor dem Rathaus mit Plakaten wie ›Keine Diktat-Uhr in Nikolaiken‹ und Rufen wie ›Nieder mit der Amtsuhr‹. Kacper Zielinski kannte die immergleichen Protestler, die gegen alles und für nichts waren, weshalb er keinen Pfifferling auf das Gebrüll gab, sich lieber der Herausforderung widmete, wie eine ordentliche Amtsführung quasi zeitlos zu bewerkstelligen sei. Als erste Amtshandlung an diesem Morgen erfand der Bürgermeister die masurische Heimarbeit, und zwar nicht nur für Amtsbedienstete (in Nikolaiken waren nahezu alle Dienste amtlich), sondern auch für freie Bauern, Geschäftsleute, Wirte und ähnliche Zünfte, die gemeinhin ohnedies ihre Arbeit in ihrem Heim oder nicht weit davon verrichteten. Die entsprechende Anordnung sollte später, wenn sich der Pulk verflüchtigt hatte, draußen am Amtsbrett angeschlagen werden.
Inzwischen ereignete sich folgendes: Jakub Zattopek, der werktäglich den Frühbus nach Lötzen pünktlich um 8 Uhr startete, obwohl er keine Uhr besaß, und dabei die Post mitnahm, erschien wie immer nach Gefühl und beendeter Nachtruhe einigermaßen pünktlich im Amt und wies den Bürgermeister auf den Umstand hin, dass es auf dessen großer Amtsuhr hinter dem großen Amtstisch kurz nach 5 und im Übrigen die Poststation unbesetzt sei – was er denn tun solle. Kacper Zielinski gebot gleichermaßen als Mann des Volkes, des Staates und der Tat, einen pünktliche Start und so fuhr der gehorsame Zattopek seinen komplett leeren Autobus ohne Post und ohne Fahrgäste die anderthalb Stunden nach Lötzen und kehrte ebenso gehorsam wieder zurück, ohne mit seiner Fahrt irgendeinen Zweck erfüllt zu haben.
Was es dem Pfarrer Joseph Schnack sehr erschwerte, den Uhrmacher Jakub Woyzeck aus Lötzen brieflich um baldestmögliche Reparatur des Kirchenuhrwerks Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz zu ersuchen. War von Jakub Woyzeck schon in normalen Zeiten ein Notdienst allenfalls nach Tagen zu erwarten, so war unter den gegebenen Umständen absehbar, dass Ave Maria noch eine ganze Weile ihren verdrehten Spuk weiterbetreiben würde.
Um ungefähr 8 Uhr gewohnter, also eher gefühlter Uhrzeit erschien auch der Lehrer Bartosz Bobbel zum Dienst im Schulhaus, heute also schon um ungefähr 5 Uhr. Bartosz Bobbel hatte sich überhaupt nicht um eine Uhrzeit geschert, für ihn waren, genau wie für Jakub Zattopek und viele andere Nikolaiker, die Sonne und der eigene Leib die Maßstäbe für den Tagesrhythmus. Am Gründonnerstag war es hell gewesen um sieben, am Pult hatte er um acht gestanden. So auch heute, allerdings mutterseelenallein im künstlich erleuchteten Schulraum. Bartosz Bobbel nutzte die Zeit, um alle fehlenden Schüler ins Klassenbuch einzutragen. Er ging so weit, die von ihren Eltern entsprechend der ihnen angezeigten Uhrzeit geschickten Zöglinge um elf Uhr noch einmal sämtlich ins Klassenbuch einzutragen, diesmal als erheblich verspätet. Nichtsdestotrotz wurden die verwunderten Schüler bereits nach zwei Unterrichtsstunden wieder glücklich entlassen, denn für Lehrer Bobbel war die Schule wie jeden Tag um 13 Uhr beendet und die nahe Kirchenglocke hatte soeben 13 mal geschlagen. Auch ein Lehrer lernt täglich dazu.
Tag 4 nach Rückkehr (Mittwoch)
Unscharf war es um den Fall des alten Schmieds Krzysztof Schmiedcz bestellt, dessen letztes Stündlein in der Nacht auf Mittwoch schlug, just in dem Moment, wo er sich seiner Miktionsfähigkeit noch einmal dringlich zu vergewissern suchte. Er scheiterte, es kam nichts, und nachdem sein Frauchen Edwiga Schmiedcz ob des Poltergeräuschs aufgewacht war und ihn am stillen Ort still verstorben vorfand, war es dem nächtlich herbeigerufenen Medikus Dr. Schwanka schwer möglich, eine genaue Todesstunde zu bestimmen, denn bevor er das Haus des Schmieds betreten hatte, waren 24 Glockenschläge zu vernehmen, als er das Haus wieder verließ, noch einmal in etwa so viele. Genau hatte er nicht mitgezählt, aber wenn es zweimal Mitternacht geschlagen hatte, wäre er keine Minute im Haus gewesen und hätte in Nullkommanichts eine Leichenschau durchgeführt, was ihm nicht nur rekordverdächtig, sondern auch unbotmäßig erschien. Er einigte sich hilfsweise auf Mitternacht als Todeszeitpunkt, was seine Taschenuhr auch hergab. Allein, nachdem er zuhause wieder in sein Bett gekrochen war, kam er schlecht in den Schlaf und stand nach zwei Stunden gerädert wieder auf, weil es draußen hell wurde.
Etwa zur Zeit des Erwachens des Dr. Schwanka erwachte auch Posthauptwart Michal Krol um 6 Uhr der Neuzeit durch seinen Wecker, den er gestern dummerweise nicht angeschaltet hatte, was ihm einen peinlichen Ruf bei Jakub Zattopek eingebracht hatte, welcher ohne Post pünktlich nach Lötzen gefahren war. Heute also zeigte sein Wecker 6 und rappelte auch ordentlich für 6. Posthauptwart Michal Krol zog sich an, frühstückte und war heute schon um 7 statt 8 Uhr in seinem Postamt, um die Frühpost für Lötzen herzurichten und die Post von gestern dazu, die noch im Nikolaiker Postamt verblieben war. Doch, was soll man dazu sagen: Jakub Zattopek, der werktäglich den Frühbus nach Lötzen pünktlich um 8 Uhr seiner natürlichen Zeit startete, war auch heute schon ohne Post abgefahren und das, wie Posthauptwart Krol von Bürgermeister Kacper Zielinski mit tadelndem Unterton erfahren musste, bereits vor drei Stunden.
»Potzblitz«, entfuhr es dem Posthauptwart, »wann muss man denn hier die Post fertig haben, damit der werte Herr Zattopek sie endlich auch einmal mitnimmt?«
»Um 8 Uhr wie immer«, war die lapidare Antwort, mit der Bürgermeister Zielinski den Postbediensteten ratlos stehen ließ.
Wie manche andere Kurzgeschichte ließe sich auch diese zu einem längeren Roman ausdehnen, doch steht es einer Kurzgeschichte nicht an, jeden einzelnen Fall, und sei er noch so erwähnenswert, aufzuzählen, der in solch denkwürdiger Situation zu schildern möglich wäre. Kommen wir also zu einem Ende. Es wäre nämlich auch verwunderlich gewesen, wenn nicht dem einen oder anderen halbwegs gebildeten Nikolaiker aufgefallen wäre, was hier zeitlich seit der Osternacht vorging, nämlich, dass Ave Maria täglich um eine weitere Stunde nachging und obendrein noch eine 25. Stunde erfunden hatte, während der die Zeiger ruhten. Und alle Uhren der Stadt folgten ihr in diesem ungehörigen Treiben.
Es war für Pfarrer Joseph Schnack klar, dass nur der Uhrmacher Jakub Woyzeck aus Lötzen die Ave Maria zur Räson bringen könnte und dieser kam endlich am Mittwoch gegen 8 Uhr mit dem Frühbus, den Jakub Zattopek gehorsam durch die Dunkelheit nach Lötzen und mit Sonnenaufgang wieder zurück nach Nikolaiken gelenkt hatte. Der Uhrmacher Woyzeck stieg unausgeschlafen hinauf in den Glockenturm, fand im Räderwerk nichts ungewöhnliches und kletterte nach dem achten Glockenschlag gehörig betäubt hinaus zur Turmuhr Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz, wo er sich unversehens mit dem Hosenbund hinten am großen Minutenzeiger verfing dergestalt, dass sich das vergoldete Kupferblech in der Mitte zu biegen begann, sodass der Zeiger bis zu seiner Mitte auf 12 Uhr und mit seinem spitzen Ende auf 3 Uhr zeigte, während sich der kleine Stundenzeiger zu bewegen begann, bis er auf 12 zum Stehen kam. Hätte der geknickte Zeiger sich auch nur wenige Minuten weiterbewegt, wäre der tapfere Mann unweigerlich davon abgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Durch Gottes, Ave Marias und Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz Gnaden blieb ihm dieses Schicksal erspart, der Zeiger blieb im rechten Winkel. Für den Moment war keine Bewegung mehr festzustellen noch ein Glockenschlag zu vernehmen, als ob sich Ave Maria innerlich sammelte, um eine neue Zeitrechnung auszuhecken. Wir zuvor hatten sich in diesem Moment alle Uhren Nikolaikens wieder auf die Kirchglocke eingestellt wie moderne Funkuhren auf den Zeitzeichensender, will sagen, dass ihre Minutenzeiger mittendurch abknickten und einen rechten Winkel bildeten, mit dem nichts rechtes anzufangen war. Es dauerte eine knappe Stunde, bis die Feuerwehr den armen Woyzeck aus seiner misslichen Lage befreit hatte. Als ob es einer irdischen Gewalt unbedingt bedurft hätte, hatte der gebeutelte Jakub Woyzeck immerhin seinem Handwerk alle Ehre gemacht. Denn nun geschah das wirkliche Wunder von Nikolaiken vor den Augen und Ohren der Umstehenden. Ave Maria schlug genau 13 Mal, die Turmuhr zeigte mit dem Stundenzeiger auf 13, mit der inneren Hälfte des Minutenzeigers auf 12 und mit der äußeren Hälfte auf 3. Im Weiteren stellte sich heraus, dass fortan alle Uhren in Nikolaiken wieder die korrekte Uhrzeit angaben, wenn auch mit genicktem Minutenzeiger. Aber das war den Nikolaikern allemal lieber, als in eine zunehmende Zeitkatastrophe zu geraten.
Die Sache mit dem geknickten Zeiger regulierte sich nach einem Jahr übrigens von selbst, denn Pfarrer Schnack ließ die Ave Maria vor der Abendmahlmesse am Gründonnerstag ordentlich mit Stricken befestigen, so dass sie nicht läuten und zugleich auch nicht nach Rom fliegen konnte. Ave Maria schien darüber nicht amüsiert, denn sie warf zum Hanc igitur den geknickten Minutenzeiger vollends ab und alle Ührchen der Stadt taten es ihr gleich. Der Vorfall wurde als masurische Solidarität regelrecht gefeiert und niemand in Nikolaiken störte sich an den Ein-Zeiger-Uhren, wie sie auch heute noch existieren als entschleunigende Armbanduhren, als Tisch- und Taschenuhren oder als Turmuhren, wie zum Beispiel am Rathaus in Lenzen, am Turm der Stadtkirche St. Michael in Jena oder der Kirche St. Martin in Baar oder der St.Jacobi-Kirche in Wiegersdorf, am Obertorturm in Aarau oder am Berntor in Murten oder bei der Monduhr am Turm der Liebfrauenkirche in Bielefeld und an vielen Kirchen in aller Welt. Und an der St. Jakobikirche in Lübeck, wo am 19. Februar 2019 – genau wie damals in Nikolaiken – der Uhrzeiger auf den Kirchvorplatz gestürzt ist.
Ein fallender Regentropfen
Hallo, mein Name ist Tom. Meine Freunde nennen mich »Major Tom«, nicht nur wegen ›Tom‹, auch wegen ›völlig losgelöst von der Erde‹. Dabei sind sie genauso losgelöst. Wir sind alle so. Normalerweise spreche ich wässrisch, aber wenn Sie lieber Deutsch lesen, kann ich auch das.
Hier oben war ich noch nie. Genau hier über Hamburg: Breitengrad 53.550341, Längengrad 10.000654, Höhe 232 Meter. Ich kann hier noch nie gewesen sein, keiner von uns kann das, jedenfalls ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn wir einmal in der Troposphäre sind, bewegen wir uns in einer Höhe von bis zu 17 Kilometern über der Erde. Und das im Raum über die ganze Erde verteilt, also über 510 Millionen Quadratkilometer mal 17 Kilometer hoch, sagen wir grob gerechnet: In einem Raum von 8,7 Milliarden Kubikkilometern. Jetzt bin ich aber nicht einen Kubikkilometer groß, sondern nur 1 Kubikmillimeter, in einen Kubikkilometer passe ich 10×1017 Mal hinein. Mit meiner Größe könnte ich Knirps nach meiner schnellen Kopfrechnung demnach an 8,7×1027 verschiedenen Punkten in der Luft sein. Das kann nachrechnen, wer will, mir ist das egal, ich kann es sowieso nicht ändern, wo ich gerade bin und schwupp, während ich hier so philosophiere, bin ich schon einige Meter weiter. Das GPS zeigt schon wieder neue Daten. Dabei ist dieser Stratus noch eine langsame Wolke, fast wie Hochnebel kleben wir hier über der Stadt. Wir müssen uns ein bisschen unterhaken, wenn wir nicht runter-tropfen wollen. Ich würde gern noch ein wenig weiter fliegen und sehen, was da hinten auf dem Meer passiert. Es ruckelt schon. Oder ist das der Heini neben mir? Ich nenne ihn Heini, die anderen sagen Heinz zu ihm, aber mir ist der nicht so angenehm, ein Heini halt. Der wird immer dicker, wahrscheinlich hat er irgendwelche Kon-densationskeime aufgenommen oder so, aber dazu später mehr. Eigentlich wollte ich sagen, dass der Heini eben noch meine Größe hatte, also ungefähr 1 bis 2 Millimeter. Aber jetzt ist er dick und das kam plötzlich oder langsam, das kommt nicht so genau, weil wir mit der Zeit nicht viel am Hut haben. Für Sie ist es vielleicht zwei Minuten her, dass Sie diesen Absatz zu lesen begonnen haben, für mich ist es einerlei, ob Sie für den Absatz eine Woche oder eine Millisekunde brauchen. Wenn Sie fertig sind, sind Sie eben fertig. Und hier beende ich den Absatz.
Zurück zum Stratus: Unsere Wolke ist völlig strukturlos und besteht nur aus uns oder wenn Sie es so gestelzt lesen wollen: ›Aus feinen Wassertröpfchen‹. Außer dem Heini neben mir, der ist kein feines Wassertröpfchen mehr, der ist ein Tropf. Die Kollegen, ach übrigens, wenn wir uns Männernamen geben, denken Sie sich nichts dabei, wir sind einfach divers und müssen nicht gendern und wir pflanzen uns sowieso nicht geschlechtlich fort, wie Sie das vielleicht tun; also meine Kollegen, wie dick die sind, kann ich nur für meine Nachbarn sagen, die anderen sind weiter weg und welche sind dazwischen und davor, so dass ich die nicht sehen kann. Das ist eigentlich ganz aufregend, denn man weiß als einzelner Tropfen im Verband nie, was gleich passiert, weil man es nicht kommen sieht. So wie jetzt. Gerade passiert etwas. Dauernd passiert etwas in unserer Wolke, die man sich nicht vorstellen muss, wie ein gezeichnetes Wattebällchen, unten gerade und oben mit vier oder fünf Hügeln, nein, wie gesagt ist ein Stratus strukturlos, diffus, nicht