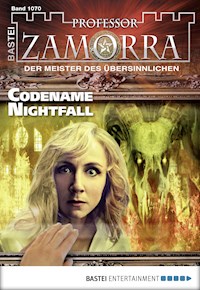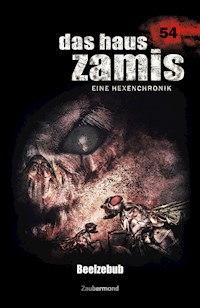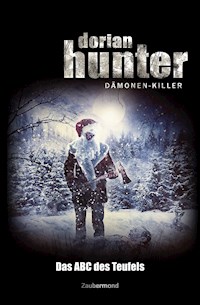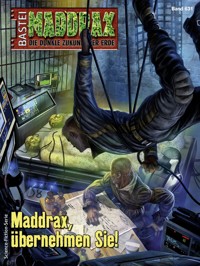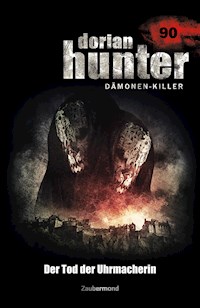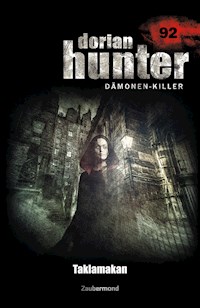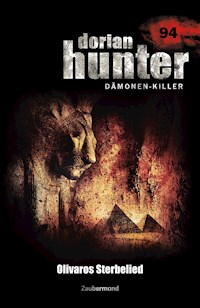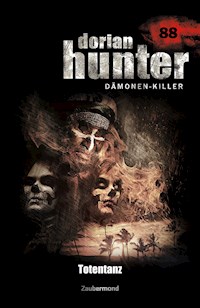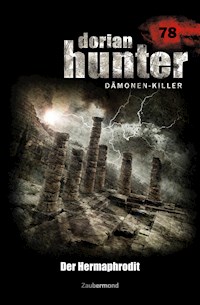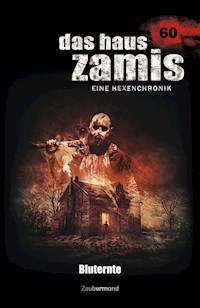1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Die Nacht der Bestie
Der Mann sah aus, als hätte man ihn in einen Häcksler gesteckt. Tiefe Wunden durchzogen seinen Brustkorb. Seine linke Wange war ein einziges Loch. Der Kerl war nackt, wie Gott ihn geschaffen hatte. Und so tot, wie der Teufel es wollte.
"Scheißdreck", fluchte Chefinspektor Pierre Robin leise. "Das hier war kein normaler Täter, so viel steht fest."
"Das hier", bestätigte die mysteriöse Dubois, "ist alles andere als normal."
Robin fluchte erneut. Dann griff er zum Telefon und rief Professor Zamorra an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Die Nacht der Bestie
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Protasov AN/shutterstock
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8714-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Die Nacht der Bestie
von Simon Borner
Der Mann sah aus, als hätte man ihn in einen Häcksler gesteckt. Tiefe Wunden durchzogen seinen Brustkorb. Seine linke Wange war ein einziges Loch. Der Kerl war nackt, wie Gott ihn geschaffen hatte. Und so tot, wie der Teufel es wollte.
»Scheißdreck«, fluchte Chefinspektor Pierre Robin leise. »Das hier war kein normaler Täter, so viel steht fest.«
»Das hier«, bestätigte die mysteriöse Dubois, »ist alles andere als normal.«
Robin fluchte erneut. Dann griff er zum Telefon und rief Professor Zamorra an.
»Die Welt strotzt nur so vor ungesehenen Farben, und sie summt in nie gehörten Frequenzen. Von niemandem bemerkt, von vielen vergessen. Nur die Weisen wussten stets, dass diese Sphären – Dimensionen, die unsere ach so plumpen Sinne nicht wahrnehmen können – den Schlüssel zu unserer Existenz enthalten: das unsichtbare, elektromagnetische Fundament, auf dem unsere grässliche Wirklichkeit schwankend fußt.«
Russell Brand
Kapitel 1
Auf Leben und Tod … und mehr!
Jane Cooper rannte. Hart schlugen die Sohlen ihrer dünnen Sandalen auf das regenfeuchte Kopfsteinpflaster der Gassen, laut rasselte der Atem in ihrer Lunge. Blut rauschte in ihren Ohren, und das Herz schlug ihr bis zum Hals.
Sie musste weg hier, verdammt! Weg, bevor es zu spät war!
Wieder drehte sie sich um. Wo war die unheimliche Gestalt? Verfolgte sie sie immer noch? Und vor allem: Wo war Steve?
Tränen stiegen Jane in die Augen, als sie an ihren Freund dachte. An das viele Blut und sein entsetztes Gesicht, kurz bevor er zu Boden gegangen war. An seine letzten Worte an sie: »Lauf! Bitte, Jane – lauf um dein Leben!«
Ein leises Schluchzen drang aus ihrer Kehle, als die Erinnerung kam. Jane erschrak! Sie durfte keine Geräusche machen. Nicht hier in den Schatten. Nicht hier, wo der Unheimliche jederzeit wieder zuschlagen konnte.
Schnell lief sie weiter, vorbei an Hausfassaden, hinter deren Fenstern sich nichts und niemand mehr rührte. Um Straßenecken, die so verlassen wirkten, als wäre die gesamte Stadt entvölkert worden. Verflucht, wo waren die anderen Menschen? Wo waren die Cops – oder wie auch immer man sie in diesem Land nannte? Irgendwo musste es doch noch Menschen geben!
Ich brauche Hilfe, dachte sie, ein flehendes Wimmern auf den zitternden Lippen. Steve braucht Hilfe! Dringend!
Wieder eine Straßenecke. Jane hatte längst alle Orientierung verloren. Sie war fremd in Paris, und seit die waghalsige Flucht begonnen hatte, schien sich die Stadt an der Seine zum reinsten Irrgarten verwandelt zu haben. Fast schien ihr, als wolle Paris nicht, dass sie entkam. Als wäre die Stadt selbst mit dem Monstrum im Bunde, das an den Fersen der jungen Touristin klebte wie ein finsterer Schatten.
Janes Seite schmerzte. Ihr Atem ging immer schwerer. Sie brauchte eine Pause. Keuchend verkroch sie sich in einem Hauseingang. Ihr ängstlicher Blick glitt über die schmale, von mehrgeschossigen dunklen Wohnhäusern gesäumte Gasse. Nichts rührte sich da draußen. Nicht einmal eine streunende Katze bewegte sich über das feuchte Pflaster, auf dem sich das gelbliche Licht einiger trüber Laternen spiegelte. Kein einziges Geräusch drang an ihre Ohren.
Trotzdem wusste sie es.
Er war da. Ganz in ihrer Nähe.
Sie spürte es so sicher wie ihre Panik, so sicher wie die Gefahr.
»Was willst du von uns, du Arschloch?«, flüsterte sie, trotzig und mutig und ängstlich und verzweifelt. Wieder schossen ihr Tränen in die Augen, und als ihre Knie nachgaben, sank sie weinend an der verschlossenen Haustür zu Boden. »Warum lässt du uns nicht in Ruhe? Bitte!«
Einen halben Herzschlag später ging die Tür in ihrem Rücken auf. Und zwei Hände, hart und unerbittlich wie die Pranken des leibhaftigen Satans, packten nach der jungen Frau!
☆
Fünfzehn Minuten zuvor
Die Pariser Nacht war atemberaubend – und das auf mehrere Arten zugleich. Jane keuchte, als Steve Kendall sich von ihr löste. Das Gefühl seines Kusses haftete an ihren Lippen, als wollte es nie mehr fort.
»Na?« Er grinste und strich ihr über das schulterlange braune Haar. »Hab ich zu viel versprochen?«
Eher zu wenig, dachte sie, und eine wohlige Wärme breitete sich in ihr aus. Doch das konnte sie nicht zugeben. Wenigstens jetzt noch nicht. Männer musste man zappeln lassen.
»Ich weiß nicht«, tat sie daher unbeeindruckt, während ihr Blick über die von Laternen und Leuchtstrahlern erhellte Szenerie am Ufer der Seine glitt – über all die Brücken, Kirchen, Bistros und Passanten. Was für ein Panorama! »Ich hatte sie mir irgendwie größer vorgestellt.«
»Größer?« Steve lachte. Kühler Abendwind spielte mit seinen blonden Locken. »Das ist Paris, Baby. Die Metropole des europäischen Kontinents. Stadt der Liebe, Stadt der Künste … Und dir ist sie zu klein? Ausgerechnet dir Landei aus Kentucky?«
»Hey, hey, hey, Mister.« Tadelnd hob sie den Zeigefinger. »Nichts gegen Kentucky, ja?«
Dann prustete sie los, und er nahm sie erneut in den Arm. »Du listiges Biest, du«, raunte er ihr zu, warmer Atem an ihrem Ohr. »Pass bloß auf.«
Sie kannten einander noch nicht lange. Jane war erst seit wenigen Monaten an seinem College, und Steve stand schon kurz vor dem Abschluss. Doch sie hatten schnell aneinander Gefallen gefunden – schnell und intensiv! Sie war eine unerfahrene Farmerstochter aus dem Mittleren Westen, er ein Städter mit eigener Wohnung außerhalb des Campus. Grundgütiger, er sang sogar in einer Band! Seine lockere Art, sein stoppeliger Dreitagebart und diese tiefblauen Augen hatten sie im Nu erobert. Und tief in seinem Inneren war Steve genauso romantisch wie sie! Der Kurztrip nach Paris – eine Stadt, die er liebte und von früheren Besuchen kannte, in der sie aber noch nie gewesen war – war seine Idee gewesen.
Seit Stunden schlenderten sie, die verbrauchten Flugtickets der Billig-Airline noch in den Hosentaschen, nun schon durch die Innenstadt der alten Metropole. Sie hatten auf den Stufen von Montmartre gesessen, waren um den Eiffelturm scharwenzelt, auf den sich Jane wegen ihrer Höhenangst nicht traute. Auf dem Dach des berühmten Kaufhauses Samaritaine, von wo aus man einen tollen Ausblick hatte, waren sie sogar einem Straßenmusiker begegnet. Den Text seiner Gitarrenlieder hatte Jane zwar nicht verstanden, doch die gefühlvolle Musik hatte sie ebenso verzaubert wie der gesamte Rest der Pariser Atmosphäre. Steve hatte vollkommen recht mit seinen Worten: Mehr als Paris ging nicht.
Sie zogen weiter. Vom Ufer der Seine aus gingen sie Arm in Arm einfach drauflos, vorbei an Brasserien und kleinen Bars. Jane mochte die schmalen Straßen, die kaum breit genug für einen PKW waren, ebenso sehr wie die verwinkelten alten Bauten und die hohen Fassaden. Alles wirkte so märchenhaft, so durch und durch irreal.
»Als wäre man im schönsten Traum der Welt«, sagte sie.
Steve lachte wieder. »Das finde ich auch. Und … Hey, was wird das denn?«
Sein veränderter Tonfall ließ sie aufhorchen. Sie sah in die Richtung, in die auch Steve plötzlich mit halb fragender, halb erstaunter Miene blickte.
Eine Gestalt trat gerade aus den Schatten einer schmalen Seitengasse. Sie schien aus purer Schwärze zu bestehen. Jane sah keinerlei Details an ihr – kein Gesicht, keine Kleidung. Nur diesen großen, breitschultrigen Umriss aus Finsternis, der aus dem Nichts zu kommen schien und langsam näher kam.
Ein Umhang, dachte der rationale Teil ihres Studentinnenverstands. Der Typ trägt ein Cape mit Kapuze. Eine Kutte oder so.
»Hast du ein Problem, oder was?«, fuhr Steve die Gestalt an. »Hey, ich rede mit dir! Was willst du? Verpiss dich gefälligst, und lass uns in Ruhe.«
Die Gestalt ging unbeirrt weiter. Schritt für Schritt kam sie den beiden jungen Amerikanern entgegen. Das Licht der Straßenlaternen schien von seiner finsteren Form verschluckt zu werden wie von einem schwarzen Loch.
Jane warf einen schnellen Blick zur Seite. Die Straße war menschenleer. Sie waren allein hier. »Steve, ich hab Angst. Lass uns einfach zurückgehen.«
Er brummte unwillig. Er ließ sich nicht gern blöd anmachen, das wusste sie.
»Was bist du für’n Freak, hm?«, spie er dem Dunklen entgegen. »Hältst du das für witzig? Touristen erschrecken?«
Doch er machte einen Schritt rückwärts, dann noch einen und einen dritten. Und er zog Jane mit sich.
Dann geschah es. Der dunkle Umriss regte sich, und bevor Jane richtig begriff, was geschah, sah sie die Waffe in den Händen des Fremden aufblitzen.
»Steve!«, schrie sie entsetzt.
Einen Augenblick später fiel der erste Schuss.
☆
»Haaaaccchhhh …« Steve Kendall presste die Hand an die Wunde in seinem Bauch und schleppte sich weiter. »Scheiße, tut das weh! Scheiße, Mann, Scheiße!«
Blut quoll zwischen seinen Fingern hervor. Die menschenleere Straße verschwamm und drehte sich vor seinen Augen.
Jane! Wo war Jane! Er hatte ihr gesagt, sie solle fliehen. Genau das hatte sie getan. Doch anstatt sich um ihn zu kümmern und zu beenden, was er begonnen hatte, war der Freak in der dunklen Kapuzenkutte ihr nachgelaufen – geradewegs ins Gewirr der nachtleeren Gassen und Straßen von Paris. Steve wusste nicht, was aus ihnen geworden war.
Doch er spürte, was aus ihm wurde.
Wenn ich nicht bald die Hauptstraße finde, bin ich erledigt, dachte er und kämpfte verbissen gegen die nahende Ohnmacht an. Jeder Zentimeter, den er sich ächzend und blutend über das kalte Pflaster schleppte, war ein immenser Kraftakt. Verflucht, wie weit war es denn bis zur Promenade? Jane und er waren doch nur ein paar Blocks weit stadteinwärts geschlendert, bloß um ein paar Hausecken. Und auf einmal war dieser Freak da gewesen – und sonst niemand mehr.
»Scheiße!«, sagte Steve wieder, doch die Silben waren kaum noch mehr als ein wimmerndes Flüstern. Erneut schleppte er sich ein Stück weiter, zitternder Leib auf feuchtem Boden. Er hustete, musste würgen. Kalter Schweiß stand auf seiner Stirn. Das Atmen fiel ihm schwer.
Dann sah er sie: Das war die Ecke. Gleich da vorn begann die Uferpromenade. Dort würde es Menschen geben. Hilfe. Rettung.
Noch zehn, zwölf Meter trennten ihn von der heller erleuchteten Promenade. Würde er es schaffen?
Ich muss, dachte er und biss die Zähne zusammen. Für Jane.
Wenn er erst Hilfe gefunden hatte, würde die Polizei kommen. Die gendarmerie. Und sie würden den Freak finden, bevor er Jane erwischte.
»Jane ist schnell«, wisperte er, und ein fast schon hysterisches Lachen drang aus seinem Hals, bei dem er vor Schmerz zusammenzuckte. »Die kriegst du nicht.«
Er schleppte sich weiter. Und eine dunkle Gestalt trat ihm in den Weg – so selbstverständlich, als hätte sie nur auf ihn gewartet!
Es war der Freak. Steve erkannte ihn sofort: die breiten Schultern, der klobige Umriss aus total anmutender Schwärze, die alles andere verschluckte.
»Nein!«, keuchte der Amerikaner. Er wollte sich aufrichten, sich umdrehen, wegrennen. Nichts davon gelang ihm. Stattdessen stieg Übelkeit in ihm auf, wie er sie nie zuvor empfunden hatte. »Nicht! Bitte!«
Die Gestalt kam näher, schnell wie der Wind und absolut gnadenlos. Die Waffe blitzte abermals im Licht der Laternen.
Steve drehte den Kopf zur Seite. Er wusste, was kommen würde, und er wollte nicht dabei zusehen. Stattdessen sah er nach rechts, zu den schlafenden dunklen Häusern.
Er schrie, als er Jane dort liegen sah! Wehrlos und bewusstlos in einem Hauseingang, abgelegt wie ein Paket. Wartend. Auf das sichere Ende.
☆
Der Keller war kalt und nahezu stockfinster. Jane wusste kaum, wie ihr geschah, als sie – zum wievielten Mal eigentlich? – die Augen öffnete und sich in ihm wiederfand. Kaum kam die Orientierung zurück, dicht gefolgt von den grausamen Erinnerungen, folgten auch die Tränen wieder. Sie waren alles, was ihr noch blieb.
Jane war nackt, genau wie die anderen hier unten. Genau wie Steve. Sie alle hingen auf schräg stehenden Pritschen, gefesselt an Hand- und Fußgelenken. Elektroden und Klammern hingen an ihren Leibern, am Brustkorb ebenso wie an Schläfen und Stirn. Dicke Ballknebel prangten in ihren Mündern. Niemand wehrte sich mehr. Es gab keine Gegenwehr hier unten in der Hölle von Paris. Denn es gab auch keine Hoffnung für jene, die der Finstere hergeschafft hatte. Wozu dann noch kämpfen?
Ich will einfach, dass es vorbei ist, dachte Jane. Sie sah zu Steve, der ohnmächtig in seinen Fesseln hing. Die letzte »Behandlung« hatte ihm gewaltig zugesetzt. Elektrizität war aus den Kabeln und Leitungen geströmt, die an ihm klebten wie gierige Blutegel, und hatte den jungen Mann aus Amerika zu einem bibbernden, sabbernden Haufen Elend verkommen lassen. Auch für ihn wäre der Tod die einzige noch realistische Erlösung, das wusste Jane. Der Gedanke tröstete und entsetzte sie gleichermaßen. Lass es endlich vorbei sein.
In dem Moment erklang eine Stimme in der Stille des Kellers. Jane hatte sie nie zuvor gehört und bezweifelte, dass sie zu dem Finsteren mit der Waffe gehörte. Dafür klang sie irgendwie zu … gebildet?
»So«, sagte der fremde Mann. Es klang nicht unfreundlich. Eher sachlich und nüchtern. »Guten Abend. Sind Sie jetzt so weit? Können wir endlich anfangen?«
Anfangen? Jane spürte, wie neue Panik in ihr aufstieg. Was in aller Welt wollte der Typ?
Keinen Atemzug später hörte sie, wie die Maschinen ein weiteres Mal hochfuhren. Elektrisches Summen erfüllte die kalte Kellerluft, und irgendwo stampfte und klopfte der Rhythmus einer unsichtbaren Apparatur.
Dann kam der Schmerz zurück. Denn in der Hölle gab es keine Gnade.
☆
Château Montagne
Der Mond schien auf die Felder und Wiesen an den Hängen der Loire. Das kleine Dorf lag friedlich in seinem Tal, und der stolze Fluss plätscherte vorbei wie schon seit Jahrtausenden. Kaum ein Licht brannte noch da, wo die Menschen lebten. Nur im Château außerhalb des Ortes waren die Fenster hell erleuchtet.
Professor Zamorra liebte diese Stunden, wenn der Tag vorbei und die Nacht in voller Blüte war. Viel zu selten erlebte der Dämonenjäger sie hier, zu Hause in dem alten und geheimnisvollen Stammsitz seiner Vorfahren.
Es war allerhöchste Zeit für eine Verschnaufpause, dachte er.
Schweigend und ein wenig glücklich sah er hinaus auf die mondbeschienene Landschaft. Auf die Idylle, in der er nun schon seit vielen Jahren leben durfte und in die er immer wieder dankend zurückkehrte. Um Kraftbatterien aufzuladen und – wenigstens für kurze Augenblicke – dem trügerischen Gefühl erliegen zu dürfen, er könne nach wie vor ein ganz normales Leben führen. Fernab von den Mächten der Finsternis und den Machenschaften der Hölle.
Die Ereignisse der vergangenen Wochen saßen ihm in den Knochen. Er spürte sie bei jedem Atemzug. Mehr als einmal hatten sie ihn und seine Partnerin Nicole Duval über die Grenzen ihrer Belastbarkeit gezwungen. Doch jedes Mal hatten am Ende sie triumphiert: das Licht und das Gute.
Noch gab es sie. Und noch gab es Hoffnung.
»Ein Anruf für dich, chéri«, sagte Nicole. Sie stand in der offenen Tür des Schlafzimmers, ein Traum in schwarzer Seide, nach dem er sich noch immer mit Haut und Haar verzehrte.
»Um diese Zeit?« Zamorra seufzte und trat vom Fenster weg. »Das war’s wohl mit der Ruhepause, hm?«
Aber Nicole schüttelte den Kopf. »Keine Sorge, es ist nur Giacomo.«
Montsignore Giacomo Parisi. Zamorra kannte den alten Italiener schon seit einigen Jahren. Er lebte in Rom, wo er ein von der deBlaussec-Stiftung unterstütztes Internat leitete. Die Schule am Rande der Ewigen Stadt nahm nur Kinder auf, die auf die ein oder andere Art Opfer paranormaler Zwischenfälle geworden waren1). Parisi und seine wenigen, sorgsam ausgewählten und geschulten Mitstreiter versuchten, ihnen eine Rückkehr in einen normalen Alltag zu ermöglichen. Oder ihnen wenigstens beizubringen, wie für sie ein normaler Alltag aussehen konnte.
Zamorra griff dankend nach dem Hörer, den Nicole ihm hinhielt. »Giacomo«, grüßte er den Weggefährten. »Wie geht es Ihnen? Was macht das collegio?«
Es seufzte am anderen Ende der Verbindung. »Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen, Zamorra«, sagte der ehemalige Prediger und ehemalige Dämonenbekämpfer. »Aber das sind zwei Fragen, die ich nicht mit ein und derselben Antwort beantworten kann. Auch deswegen rufe ich an.«
Der Meister des Übersinnlichen hob eine Braue. »Oh?«, fragte er verwundert.