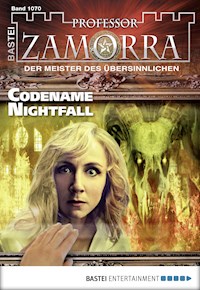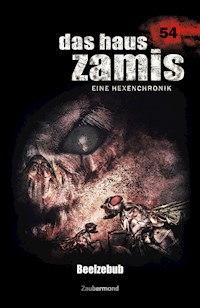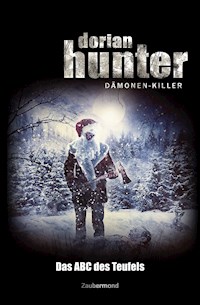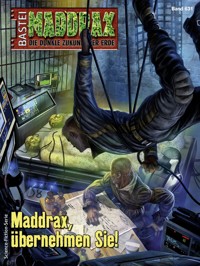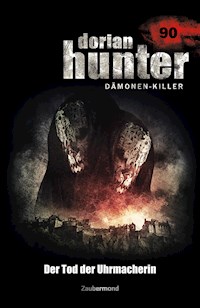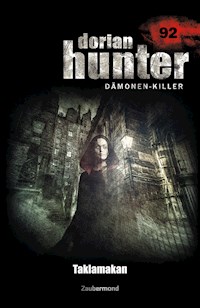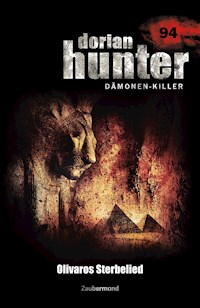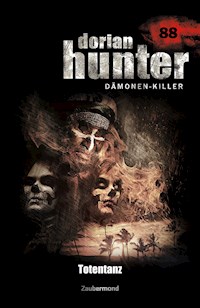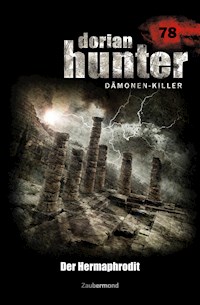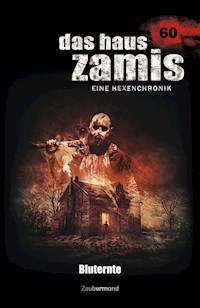1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Welt der Schatten
Sie waren überall! Kaum hatte der erste Zombie den offenen Hausflur verlassen, strömten die Untoten aus allen möglichen Verstecken - so zielsicher, als hätten sie nur auf ihr Stichwort gewartet.
Zamorra sah sie hinter parkenden Autos hervorkommen, aus den Büschen des kleinen Parks ...
Ein weiteres halbes Dutzend bog in die Gasse ein. Seite an Seite wie eine Wand aus Monstern, die jede Flucht unmöglich machte.
Nicht ihr Verstand trieb sie an, sondern reiner, purer Raubtierinstinkt.
Reine Gier!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Welt der Schatten
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: leolintang/shutterstock
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8869-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Welt der Schatten
von Simon Borner
Sie waren überall! Kaum hatte der erste Zombie den offenen Hausflur verlassen, strömten die Untoten aus allen möglichen Verstecken – so zielsicher, als hätten sie nur auf ihr Stichwort gewartet.
Zamorra sah sie hinter parkenden Autos hervorkommen, aus den Büschen des kleinen Parks …
Ein weiteres halbes Dutzend bog in die Gasse ein. Seite an Seite wie eine Wand aus Monstern, die jede Flucht unmöglich machte.
Nicht ihr Verstand trieb sie an, sondern reiner, purer Raubtierinstinkt.
Reine Gier!
»Landet eine Münze mit der Kopfseite nach oben, ist die Chance für ihre Zahlseite vertan. Bis zu diesem Augenblick waren beide Seiten aber gleich wahrscheinlich. In einer anderen Welt mag die Zahlseite zuoberst gelegen haben. An diesem Punkt trennen sich die zwei Welten dann voneinander.«
Philip Pullman
Kapitel 1
Das Ende
Sie fraßen Menschenfleisch!
Fassungslos lugte Jackson Miller aus seinem Versteck. Die Monster waren noch immer da – und sie labten sich am Körper des so grausam getöteten Wachmanns.
Was passiert hier, keuchte Miller innerlich. Unendliche Kälte breitete sich in seinem Inneren aus. Er musste sich die Faust auf die Lippen pressen, um nicht aus Angst zu schreien. Was ist das?
Er wusste es nicht. Nur eines war ihm in diesem grauenvollen Moment klar: Er durfte sich nicht ebenfalls erwischen lassen! Wenn die entsetzlichen Kreaturen ihn bemerkten, war auch sein Schicksal besiegelt.
Ich muss hier raus! Jetzt sofort!
Zitternd sah er sich um. Seit über einer halben Stunde floh er nun schon durch die leer gewordenen Korridore des Louvre – vorbei an Dutzenden von Leichen, an Pfützen aus Blut und an Gedärmen, die noch immer dampften, so frisch waren sie aus ihren Leibern herausgerissen und … und angebissen worden.
Nur den Ausgang hatte er nirgends gefunden.
Das ist Unsinn. Der rationale Teil seines Verstandes setzte wieder ein. Er kämpfte die Angst beiseite, wenigstens für den Moment. Dies ist eines der wichtigsten Museen der Welt. Es muss hier überall Notausgänge geben. Ich bin nur zu hektisch, um sie zu bemerken.
Miller nickte. Ja, genau. So musste es sein. Es gab Ausgänge, er achtete nur nicht auf sie. Wenn er es noch einmal versuchte … Wenn er jetzt aus seiner Deckung kam und direkt losrannte … Wie weit würde er kommen, bevor die Monster ihn einholten? Weit genug bis zum nächsten Notausgang?
Bestimmt. Notausgänge sind für Notfälle da, und das hier ist ein Notfall. Entsprechend erreichbar müssen sie sein. Immer und überall.
Abermals atmete Miller durch. Er spürte sein wild schlagendes Herz, hörte das Schmatzen und Stöhnen der Monster. Und wieder musste er sich zwingen, nicht an Caroline zu denken. Bloß nicht! Wenn er an sie dachte, hatte er schon verloren.
Konzentrier dich darauf, hier rauszukommen, rief er sich zur Ordnung. Ein Ziel nach dem anderen. Du musst den Ausgang finden, bevor sie dich auch erwischen. Alles andere findet sich dann schon.
Ganz genau. So war es und nicht anders. Es gab für alles eine Lösung.
Jackson Miller schluckte trocken, spannte die Muskeln an … und sprang hoch. Im Nu war er aus seinem Versteck, das in der hinteren Ecke eines Ausstellungssaals gelegen hatte. Hart schlugen seine Schuhsolen auf dem blanken Museumsboden auf, und laut hallten seine schnellen Schritte durch die unheimliche Grabesstille, die in den Louvre Einzug gehalten hatte, seit die Schreie verstummt waren und nur noch die Monster regierten.
Miller rannte um sein Leben und drehte sich nicht um. Wo war die nächste Tür, wo der Notausgang? Da! Ein grünes Schild wies ihm den Weg, endlich. Miller folgte dem Pfeil, sprang über zwei am Boden liegende Leichen, sah sogar schon die schwere Tür mit der Aufschrift EXIT vor sich! Noch zwanzig Meter trennten ihn von ihr. Noch fünfzehn. Noch dreizehn.
Ich schaffe es, jubelte er innerlich.
Dann hörte er das Knurren.
Es war nicht nur ein Monster, das ihm schlurfend in den Weg trat. Es waren vier! Sie hatten fahle, ausgemergelte Gesichter und eiternde Wunden am ganzen Leib. Die sehnigen Arme griffen nach ihm, die blutverschmierten Münder öffneten sich weit.
»Nein«, keuchte Miller, als die ersten übermenschlich starken Hände ihn packten. »Nein! Bitte!«
Doch die Bestien kannten keine Gnade.
Sie kannten überhaupt nichts mehr – außer ihren Hunger!
☆
Zwei Stunden zuvor
Die Stadt an der Seine präsentierte sich mit absolutem Mistwetter. Jackson Miller schlug den Jackenkragen hoch und sah sich um. Prasselnder Regen fiel auf den quadratischen Platz vor der Metro-Station Palais Royal / Musée de Louvre, und auf der Rue de Rivoli sorgte jedes vorbeifahrende Auto für wahre Wasserfontänen.
»Du hattest vollkommen recht«, sagte Caroline. »Der Tag ist nicht zu retten. Wir sollten besser etwas unternehmen, wo wir vor dem Regen sicher sind.«
Das Ehepaar aus Kentucky war zum ersten Mal in Paris. Eigentlich wollten sie die wenigen Urlaubstage damit verbringen, an der Seine entlangzuschlendern und auf den Außenterrassen der schmucken Bistros und Brasserien das berühmte savoir vivre der Franzosen zu genießen. Doch bei sintflutartigem Dauerregen ging das schlecht. Also hatte Miller vorgeschlagen, einen Ausflug in den Louvre zu unternehmen. Dort war es bestimmt trocken und warm. Und auch wenn Caroline und er sich für Kunst in etwa genauso sehr interessierten wie ein Waschbär für Kernphysik, war dieser Louvre ja doch weltberühmt. Da schadete es sicher nicht, sagen zu können, man habe ihn besucht. Denn wofür fuhr man schon nach Paris, wenn nicht, um hinterher vor Nachbarn und den Freunden aus dem Schützenverein damit angeben zu können?
Miller deutete auf den Museumseingang. Die gläserne Pyramide und die viergeschossige alte Fassade hinter ihr waren trotz des Mistwetters gut zu erkennen – ein absolutes Postkartenmotiv. »Sollen wir?«
Caroline lächelte unglücklich. »Augen zu und durch.«
Dann liefen sie los, raus aus der Metro-Station und über die Straße. Der Regen war absolut unerbittlich. Er prasselte auf sie ein, als wollte er sie daran hindern, das Museum zu betreten. Und der Weg bis zum Haupteingang – vorbei an einem Einkaufszentrum und dann quer über den Place du Carousel – erwies sich leider als deutlich länger als gedacht. Erst nach über fünf Minuten erreichten sie die steinernen Stufen, die zur breiten Eingangstür führten. Sie waren nass bis auf die Knochen.
»Bäh!«, schimpfte Miller.
Auch Caroline hatte Mühe, ihre Verachtung zu verbergen. »Können die ihre U-Bahn nicht näher an ihr doofes Museum bauen? Echt, diese Froschfresser …«
Daheim in den guten alten USA hätte es das nicht gegeben. Einmal mehr fühlte Miller sich in seiner Überzeugung bestätigt: Der öffentliche Personennahverkehr war kommunistischer Irrsinn. »Mit Parkplätzen direkt vor dem Haus wäre das nicht passiert, so viel steht fest.«
Dann zogen sie los, kauften ihre sündhaft teuren Eintrittskarten und begannen den Rundgang durch das Museum. Der Louvre war so früh am Morgen noch relativ leer. Miller sah einzelne Schulklassen durch die Räume streifen. Erwachsene standen oder saßen vor manchen Gemälden und wirkten, als dachten sie über große Dinge nach. An den Ecken der großen Räume standen Wärter in dunkelblauen Uniformen und taten ihr Bestes, nicht aufzufallen.
»Mein Gott, wie affig«, brummte Miller. »Guck mal. Die halten sich alle für ach so wichtig, nur weil sie hier auf Van Gogh und Da Vinci starren.«
»Ja, genau«, stimmte Caroline ihm bei. »Als wären die Bilder irgendwie bedeutsam oder so. Obwohl: Das mit den Sonnenblumen mochte ich auch. Von wem war das noch gleich? Van Gogh?«
»Dem Aussehen nach war das von Katie Bennett«, erwiderte er spöttisch. Bennett war das fünfjährige Töchterchen ihrer Nachbarn daheim in Kentucky und geistig behindert. »Wenn überhaupt.«
Caroline lachte. Und weiter gingen sie.
Zeit verstrich, gefolgt von noch mehr Zeit. Miller langweilte sich zwischen all den Kunstwerken, die aus nächster Nähe betrachtet sogar noch enttäuschender wirkten als ohnehin. Die ach so berühmte Mona Lisa war ja sogar winzig! So viel Theater wegen eines läppischen Bildes, das kaum größer schien als eine Ansichtskarte? Lachhaft!
Dass etwas nicht stimmte, merkte er erst im zweiten Stock.
»Sag mal«, murmelte er und sah sich fragend um. »Spinn ich, oder ist hier oben niemand?«
Auch Caroline stutzte. »Stimmt. Jetzt fällt es mir auch auf. Seit der Treppe haben wir niemanden mehr gesehen.«
Dann hörten sie das Stöhnen. Es drang direkt aus dem Nebenraum, kehlig und viehisch. Miller runzelte die Stirn. »Na, da ist jedenfalls jemand. Oder soll das auch Kunst sein?«
Caroline lachte erneut und ging zum offenen Durchgang, der die zwei Bereiche der Ausstellung miteinander verband. »Falls ja, ist es bestimmt schon wieder Quatsch und …«
Plötzlich verstummte sie und riss die Augen auf. Ihre Wangen wurden kreidebleich, und der Schrei, der als Nächstes aus ihrer Kehle drang, war schrill und panisch.
»Was in aller Welt …?« Im Nu war Miller bei seiner Frau. »Was hast du denn? Was …«
Dann sah auch er es! Keine fünf Meter vor ihm lag ein Museumswärter am Boden. Er zuckte spastisch. Der Blick ging ins Leere. Der Mann hatte zwei klaffende Wunden – eine in der Bauchhöhle, eine am Hals –, aus denen heraus das Blut nur so pulsierte. Vor den Wunden knieten zwei abscheuliche Kreaturen und labten sich an seinem Lebenssaft und seinem Fleisch. Sie trugen ganz normale Kleidung, sahen ansonsten aber aus wie lebende Leichen. Die Wangen waren eingefallen, die Augen trüb. Die Glieder wirkten schmal und sehnig, gleichzeitig aber unfassbar stark. Und sie knurrten!
Miller wollte Caroline packen und losrennen, doch die Monster waren schneller. Bevor er richtig begriff, was geschah, war das vordere Ungetüm schon bei seiner Frau!
Caroline schrie, als der Untote nach ihr griff. Panisch schlug sie nach der bizarren Kreatur, doch das Wesen mit dem blutverschmierten Maul war stärker. Es packte Caroline am Blusenkragen, schob mit der anderen Hand ihren Kopf zur Seite …
Und dann biss es zu!
☆
Er schaffte es! Jackson Miller wusste nicht, wie es ihm gelungen war, aber er hatte die vier Kreaturen tatsächlich abgeschüttelt. Keuchend und aus mehreren kleinen Wunden blutend, stieß er die Tür des Notausgangs endlich auf und rannte weiter – hinaus ins Freie. Raus, wo Hilfe wartete – ganz bestimmt.
Der Regen hatte aufgehört. Erste Sonnenstrahlen brachen durch die Wolkendecke. Miller rannte über den Vorplatz des Louvres. Wo war diese gendarmerie, wenn man sie mal brauchte?
»Hilfe!«, brüllte der Amerikaner. »Hilfe, wir brauchen Hil…«
Dann stutzte er. Denn alle Menschen auf dem Platz hatten sich gleichzeitig zu ihm umgedreht. Mehr noch: Sie alle hatten gleichzeitig zu knurren begonnen!
Es waren vielleicht zwei Dutzend. Und nun kamen sie auf ihn zu, aus allen Richtungen.
Miller blieb entsetzt stehen. Die eisige Kälte stieg erneut in ihm auf. Sein Verstand mochte sich weigern, das Geschehen zu begreifen, aber sein Instinkt wusste längst, was Sache war.
Untote! Diese Leute waren allesamt Untote. Es gab die Monster nicht nur im Inneren des Louvre, sondern …
»Sondern in ganz Paris«, begriff der Tourist aus Kentucky.
Dann begann er zu schreien.
Er schrie noch, als die ersten Zombies ihn erreicht hatten. Und er schrie, bis ihre gierigen, gnadenlosen Bisse und Prankenhiebe auch ihm endgültig das Leben raubten.
☆
Château Montagne
Abendrot lag über dem Tal der Loire. Erster Nebel stieg aus den vielen Feldern und Wiesen auf, und die nahen Wälder warfen die letzten Schatten des vergehenden Tages. Insekten sirrten in der für die Tages- und Spätherbstzeit noch erstaunlich warmen Luft.
Professor Zamorra stand auf der Terrasse seines altehrwürdigen Anwesens und sah sich um. Die friedliche Atmosphäre der so ausgesprochen ländlichen Umgebung war Balsam für seine Nerven. Die vergangenen Wochen hatten ihm alles abverlangt, was er geben konnte, und die Erschöpfung steckte ihm noch immer in den Knochen. Genau wie es die vielen bislang unbeantworteten Fragen taten.
Diese seltsame Geschichte an Halloween. Davor die Sache mit den Regenbogenblumen, mit Carrie Bird und Dylan McMour, die so plötzlich wieder verschwunden waren, als hätten sie sich in Luft aufgelöst… Zamorra schauderte ein wenig bei der Erinnerung daran. Er wusste noch immer nicht genau, was er von den Folgen dieser Ereignisse halten sollte. Waren die Regenbogenblumen für immer verloren? Sie wuchsen schon länger im Keller des Châteaus, als er benennen konnte. Sollte all das für immer vorbei sein, einfach so?
Die Weichen der Zeit stehen auf Veränderung, dachte er einmal mehr. Und er fragte sich, ob das etwas Gutes war. Oder ein weiteres Problem auf der langen Liste seiner Sorgen.
Umso dankbarer war er für Momente wie diesen, wo er – und sei es auch nur ganz kurz – einfach auf der Terrasse seiner Heimat stehen durfte und den Anbruch des frühen Abends genoss. Die Ruhe, die dann über das Land fiel, und den Frieden, den sie verströmte. Es gab diese Augenblicke. Das durfte er nie vergessen. Es gab sie … und sie erleben zu dürfen, war jeden Kampf und jede Anstrengung wert.
Am liebsten würde ich mit Nicole losziehen, dachte er. Einfach einen kleinen Spaziergang machen. Ohne Plan, ohne Sinn.
Sie konnten runter in das kleine Dorf gehen, das am Fuße des Schlosses lag. Dorthin, wo Madame Claire bereits ihr ganzes Leben lang wohnte. Sie konnten Mostache und dem Teufel einen Besuch abstatten. Der Name des Wirtshauses mochte unangenehme Erinnerungen wecken, aber der Rotwein, den man dort ausschenkte, war ausgesprochen köstlich – genau wie die vielen Gerichte auf der kleinen und durch und durch ländlichen Speisekarte.
Ein Abend im Zum Teufel, einfach so. Der Gedanke gefiel Zamorra sehr. So leben, wie es normale Leute taten. Menschen, die sich nicht tagtäglich mit den Machenschaften der Finsternis befassten. Menschen, die nicht einmal wussten, dass die Finsternis existierte.
Doch er wusste es. Mehr noch: Er, Nicole und ihre vielen Mitstreiter in aller Welt waren oft die einzige Rettung. Deswegen durften sie nie nachlassen und nie lange durchatmen. Denn das Böse schlief nicht. Auch dann nicht, wenn alles danach aussah.
Vor allem dann nicht!
Seufzend drehte sich Zamorra um und ging zurück ins Haus.
Auf der Schwelle zum Wohnzimmer kam ihm Nicole Duval entgegen. Seine langjährige Partnerin trug eine modische Bluse und eine eng anliegende Jeans. Ihr Haar fiel ihr locker auf die Schultern. Nicole war nicht weniger erschöpft als er, doch in ihrem Blick lag ein ebenso tadelndes wie schelmisches Funkeln. »Wo willst du denn hin?«, fragte sie ihn. »Ich dachte, wir genießen den lauen Herbstabend auf der Terrasse. Jedenfalls sahst du da draußen ziemlich genießerisch aus, weswegen ich zu dir wollte.«
Er lächelte schwach. »Die Idee gefällt mir, aber ich fürchte, die Pflicht ruft. Ich muss jetzt hoch ins Computerzimmer und meine Recherchen fortsetzen.«
»Recherchen?« Sie runzelte abfällig die Stirn. »Chéri, du spinnst doch. Zum ersten Mal seit Wochen steht mal wieder niemand vor uns und schreit akut nach Hilfe. Zum ersten Mal brennt nirgendwo ein Krisenherd, und meines Wissens ist auch nirgends ein neues Problem aufgeploppt, das unmittelbar nach unserer Aufmerksamkeit verlangt. Wir haben einen Moment lang Ruhe! Wann war das zuletzt der Fall, hm? Und ausgerechnet diesen Moment willst du jetzt auch mit Arbeit füllen?«
»Wann, wenn nicht jetzt?«, erwiderte er seufzend. »Pausen muss man nutzen – für Dinge, für die sonst keine Zeit bleibt. Mich würde beispielsweise brennend interessieren, was mit den Regenbogenblumen wird. Wohin sind Carrie und Dylan verschwunden? Oder erinnerst du dich an diese mysteriöse Kommissarin Dubois aus Paris? Noch so ein offenes Ende, das mir immer wieder im Kopf rumspukt.«
»Pausen muss man nutzen, das stimmt«, sagte Nicole. »Aber zum Durchatmen, nicht zur Vorbereitung. Chéri, auf das, was wir machen, kann man sich kaum vorbereiten. Man kann sich nur bereithalten – und eben ausspannen, wann immer man die Gelegenheit bekommt. Um Energie zu tanken. Um Wunden zu lecken.« Sie lächelte. »Und überhaupt: Hattest du nicht selbst gesagt, Dubois sei ein Rätsel, das vielleicht niemals gelöst werden könne?«
Er nickte. Irgend so etwas hatte er vermutlich tatsächlich von sich gegeben. Im Eifer der Erschöpfung. Aber trotzdem ließ das üble Gefühl, das ihr gemeinsames Abenteuer in ihm geweckt hatte, nicht nach – bis heute nicht.
Dubois – ihren Vornamen hatte Zamorra nie erfahren – war ranghohe Kommissarin in Paris gewesen1). Ihre Abteilung hatte zum Hauptquartier der städtischen gendarmerie