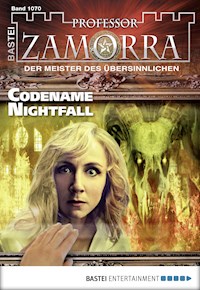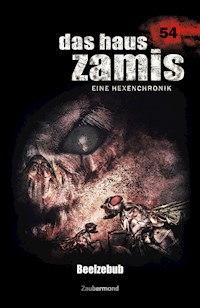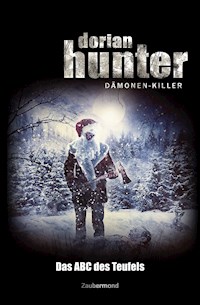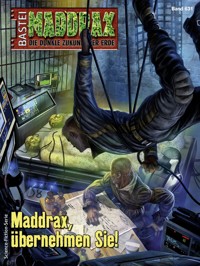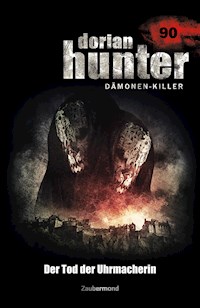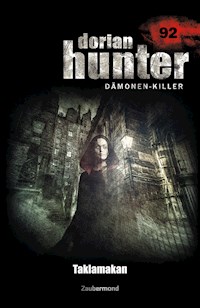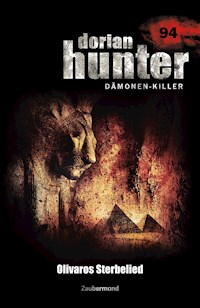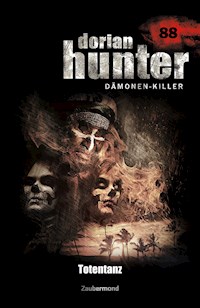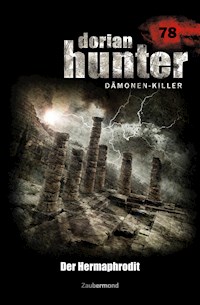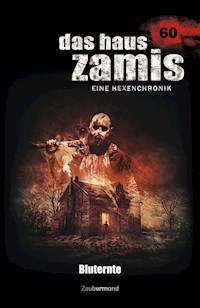1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
London, 1926
Die Bühne brannte lichterloh. Doch die Zombies ließen sich nicht beirren. Ihr gieriges Knurren übertönte den Lärm der fliehenden Zuschauer.
Zamorra wusste: Er durfte jetzt nicht aufgeben!
"He da!", hörte er plötzlich eine Frauenstimme.
Er runzelte die schweißfeuchte Stirn.
Die Frau stand am Bühnenrand!
"Vertrauen Sie mir!", rief sie ihm zu. "Sie werden sich nicht erinnern, aber wir sind einander schon begegnet, Sir. Unter ganz ähnlichen Umständen! Mein Name ist Agatha Halliday ... und dieses Mal werde ich Ihnen helfen!"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Das Grauen von Sunningdale
Prolog Modus operandi
Kapitel 1 Schatten der Vergangenheit
Kapitel 2 Kreaturen der Nacht
Kapitel 3 Der rätselhafte Montgomery
Kapitel 4 Keine Leiche zum Dessert
Kapitel 5 Für immer verloren?
Kapitel 6 Die Macht der Vril-ya
Kapitel 7 Boten der Zukunft
Leserseite
Vorschau
Impressum
Das Grauen von Sunningdale
von Simon Borner
London, 1926
Die Bühne brannte lichterloh. Doch die Zombies ließen sich nicht beirren. Ihr gieriges Knurren übertönte den Lärm der fliehenden Zuschauer.
Zamorra wusste: Er durfte jetzt nicht aufgeben. Die Menschen hatten keine Chance ohne ihn!
»He da!«, hörte er plötzlich eine Frauenstimme.
Er runzelte die schweißfeuchte Stirn.
»Vertrauen Sie mir!«, rief sie ihm zu. »Sie werden sich nicht erinnern, aber wir sind einander schon begegnet, Sir. Unter ganz ähnlichen Umständen! Mein Name ist Agatha Halliday ... und dieses Mal werde ich Ihnen helfen!«
PrologModus operandi
Jenseits der Schatten
Zamorra stöhnte vor Schmerz. Schweiß lief ihm in die schreckensweit aufgerissenen Augen, und jede Faser seines geschundenen Körpers schien in Flammen zu stehen.
Trotzdem stand er wieder auf.
»Ist das alles, was du kannst?«, fragte er knurrend,
Der Dämon war riesig. Der gewaltige Leib füllte beinahe den gesamten höhlenartigen Raum aus. Die Kreatur hatte drachenähnliche Schuppen am gesamten Körper. Ein langgezogenes Maul enthielt gleich mehrere rasiermesserscharfe Zahnreihen. Die sehnigen Tentakel endeten in mächtigen Krallen, und die dunklen lidlosen Augen, deren hasserfüllter Blick auf dem Meister des Übersinnlichen ruhte, erinnerten an die eines Urzeitgiganten aus den Tiefen der Ozeane. Außerdem glühte er in einem blauen Licht, das krank machte, wenn man es zu lange anschaute. Sein gesamter unheiliger Körper war von dem Licht umgeben.
Und das Licht verteidigte ihn! Abermals schoss ein Strahl purer dunkler Energie aus der Corona des Dämons heraus. Der unstet umherzuckende Strahl schlug gegen die Wände und die Decke des unterirdischen Gewölbes. Fels bröckelte, und ein dünner Regen aus Steinbröckchen und Staub ging zu Boden.
Dann traf der Strahl sein Ziel!
Merlins Stern hatte schon vor mehreren Minuten – die sich wie Ewigkeiten anfühlten – seine schützende Schicht um Zamorra erzeugt. Die grün schimmernde Blase bestand aus magischer Energie, die das mächtige Amulett aus Sternentiefen bezog. Der große Magier Merlin persönlich hatte es vor langer Zeit handgefertigt, und es hatte Zamorra schon vielfach das Leben gerettet. Auch in dieser bizarren Nacht der Schrecken war es wieder unverzichtbar.
Zamorra stöhnte erneut. Die Blase fing den Angriff auf, so gut sie nur konnte, und schützte den Amulettträger. Doch der Dämon war stark! Und die Blase wurde mit jedem Treffer schwächer.
Ich halte das nicht mehr lange durch, wusste Zamorra.
Schon jetzt drehte sich alles vor seinen Augen. Sein Atem ging stoßweise, und seine Eingeweide fühlten sich an, als hätte ein böser Riese sie ordentlich durchgeknetet. Das Amulett war ein Segen, aber es nahm sich auch Energie von seinem Träger. Und je länger der ungleiche Kampf andauerte, desto weniger Energie war übrig.
Ich muss es beenden, dachte er. Jetzt und hier. Andernfalls gewinnt das Monstrum. Es hat die Zeit auf seiner Seite.
Zamorra war erneut in die Knie gegangen. Doch er richtete sich abermals auf und stellte sich dem Ungeheuer entgegen.
»Es reicht jetzt«, sagte er mit fester Stimme.
Trotz der magischen Blase, die ihn einhüllte, konnte er die Stimme des Dämons in seinen Gedanken hören. Es war, als würde sie ihn bis in die Tiefen seiner unsterblichen Seele hinein beschmutzen.
Das kannst du haben, erwiderte das Ungeheuer lauernd.
Und griff erneut an.
Zamorra warf sich zur Seite, als die ersten Strahlen kamen. Die blaue Energie verfehlte ihn nur knapp. Nutzlos schlug sie gegen die Wand, riss mächtige Lücken in den alten Fels. Ein sehniger Tentakelarm zuckte dicht an Zamorras Kopf vorbei, und als das Monstrum hasserfüllt zischte, war dem Dämonenjäger, als spüre er den heißen, schweflig stinkenden Atem der Kreatur auf der Haut.
Dann wirbelte er herum. Und setzte alles auf eine Karte.
Zamorra wusste genau, was er zu tun hatte. Wenn es ihm gelang, den Dämon in die Ecke zu locken, konnte er ihn vielleicht für einen kurzen Augenblick ...
Er kam nicht dazu, den Gedanken zu beenden. Eine Bewegung, die er im Augenwinkel wahrnahm, ließ es nicht zu. Denn dort in den Schatten am anderen Ende der Höhle ... stand plötzlich ein Kind!
Es war vielleicht neun oder zehn Jahre alt. Ein Mädchen in altmodisch anmutenden Kleidern und mit dunklem Haar. Die Kleine blinzelte orientierungslos. Dann fiel ihr Blick auf den Dämon – und sie schrie!
Die unheilige Kreatur zögerte keine Sekunde. Sofort zuckten die Tentakel in Richtung des Kindes. Gierig streckten sie sich nach ihm aus.
Zamorra rannte los und betete, dass er noch rechtzeitig kam.
Kapitel 1Schatten der Vergangenheit
England, 1900
So musste sich die Ewigkeit anfühlen.
Agatha Miller sah aus dem Fenster der Kutsche und auf die schneebedeckte Landschaft und kam sich vor, als hätte sie die Zivilisation ein für alle Mal hinter sich gelassen. Überall fand sie nur dickes Weiß und klirrende Kälte. Selbst die Bäume versanken hier draußen im Schnee, und ihre kargen Stämme ragten aus dem unberührten Weiß wie die leblosen Finger eines schon vor Tagen Erfrorenen. Nichts schien hier mehr zu leben. Im Gegenteil: Das weite Land vor ihrem Fenster wirkte, als würde das Leben nie wieder zu ihm zurückkehren. Als wäre der Frühling pure Fiktion.
Agatha wickelte sich noch ein wenig enger in die Decke, die auf ihren Schultern lag. Ihre Füße, die in zwei schmucken Halbschuhen steckten, baumelten lustlos in der Luft über dem Kutschenboden. Ihr war kalt.
»Keine Sorge«, sagte Mathilda.
Agatha sah auf. Die stämmige Gouvernante saß auf der gegenüberliegenden Bank im Inneren der Kutsche, wo sie friedlich vor sich hin strickte. Mathilda trug ein dunkles Kostüm mit hohem Kragen, dazu einen ausladend hässlichen Hut und hohe Lederstiefel. Hässlich war auch ihr strenges Gesicht und das Haar, das sie an diesem Tag – wie an allen anderen – zu einem strengen Dutt gebunden hatte.
»Wie bitte, Miss Mathilda?«, fragte Agatha. Die Gouvernante bestand auf dieser Anrede, und das Mädchen hatte gelernt, sich zu fügen. Wenn auch nur in dem einen Detail. »Was meinten Sie?«
Mathilda legte das Strickzeug zur Seite und faltete die Hände im Schoß. »Dass du dir keine Sorgen machen musst, Kleines«, sagte sie. »Ich sehe dir doch an, wie es um dich steht. Immer wieder wandert dein Blick hinaus in die Kälte. Fast so, als würdest du damit rechnen, dass wir in ihr verloren gehen oder dass uns ein Eisbär attackiert. Das allerdings wird nicht passieren. Unsere Kutsche ist gut unterwegs. Und Eisbären leben hoch im Norden, nicht hier im Herzen des Empires. Warte nur ab, Kleines: Noch vor Anbruch der Nacht haben wir London erreicht. Trotz des Wetters.«
Kleines. Wie sehr sie das Wort hasste!
Agatha war fast zehn und nicht klein. Und überhaupt: In »Kleines« steckte mehr Ablehnung und Bevormundung, als sie ertragen konnte. Wann immer sie jemand so nannte, zog sich ihr Innerstes zusammen. Agatha musste sich dann stets gehörig am Riemen reißen, um nicht – wie ihre Mutter es nannte – »wieder einen deiner unerträglichen Zwergenaufstand-Tobsuchtsanfälle« zu haben.
Den hätte Miss Mathilda nämlich noch weniger geduldet als alles andere.
»Sind Sie sicher?«, fragte das Mädchen stattdessen. »Sehen Sie nur zu den Wolken, Miss. Das schneit bestimmt gleich schon wieder. Wie lange schaffen die Pferde die Strecke denn unter den Umständen? Und bleiben unsere Räder nicht einfach irgendwann stecken, bei all dem Schnee?«
Mathilda lachte. Es klang arrogant. »Du und deine Phantasie, Kleines. Steckenbleiben, ts ts. Wie kommst du nur immer auf solch grässliche Einfälle, hm? Das wird selbstverständlich nie und nimmer geschehen. Unser Kutscher hat alles unter Kontrolle und weiß sehr genau, was er tut. Andernfalls ...«
Sie kam nicht dazu, den Satz zu beenden. Denn die Kutsche kippte ein Stück zur Seite – und blieb dann ruckartig stehen.
»So eine Scheiße!«, rief eine raue Männerstimme.
Agatha, die nicht an Kraftausdrücke gewohnt war, riss die Augen auf.
»Elendes Kackwetter!«, rief die Stimme weiter. »Wie soll man denn da durchkommen? Soll ich fliegen, oder was ist los? Eine Kutsche mit Flügeln bauen?«
Mathilda öffnete die Tür der Kutsche und steckte den Kopf ins Freie. »Ist alles in Ordnung, Geoffrey?«
»Nichts ist in Ordnung«, kam die Antwort des übel gelaunten Kutschers. »So ein elender Kackdreck!«
Agatha musste sich ein Schmunzeln verkneifen. Sie kannte Geoffrey als schmallippigen und schmalsilbigen Handlanger, dessen faltigen Züge und schütteres Haar perfekt zu seiner grobschlächtigen Natur passten. Er trug meist schwarz – schwarze Hose, schwarzes Hemd, schwarzer Mantel. Und seine Wortwahl an diesem Nachmittag entsprach ganz und gar nicht dem, was Miss Mathilda für schicklich hielt.
»Ich bitte Sie, lieber Geoffrey!«, tadelte die Gouvernante ihn auch prompt. »Mäßigen Sie Ihren Ton, seien Sie so gut. Sie sind hier immerhin in der Gegenwart zweier Damen aus gutem Hause. Und dann schauen Sie, dass Sie die Kutsche wieder flottbekommen, damit wir ...«
»Flott?«
Der Kutscher lachte humorlos. Dann kam er zur Tür gestapft. Sein dunkler Hut saß schief auf dem Kopf, und die großen Hände steckten in nicht minder schwarzen Fäustlingen.
»Sie machen Witze, Mathilda«, fuhr er fort – und spuckte in hohem Bogen in den Schnee, in dem er stand. »Richtig?«
Die Gouvernante stutzte. »I... Inwiefern?«
»Die wird nicht mehr flott«, sagte Geoffrey. Danach zog er die Nase hoch. »Schauen Sie selbst, wie tief das verfluchte Ding im Matsch steckt. Da bräuchte es schon fünf Pferde, um es wieder rauszuziehen – und drei Tage Tauwetter!«
»Aber ...« Mathilda schien allmählich den Ernst der Lage zu begreifen. »Aber wir können ja auch nicht einfach hier sitzen bleiben, Geoffrey. Irgendetwas müssen wir doch tun.«
Der Kutscher nahm den Hut ab und rieb sich über die Halbglatze. Dabei sah er in die Ferne und kniff die Lider enger zusammen.
»Sunningdale«, sagte er knapp.
»B... Bitte?«
»Sunningdale«, wiederholte er. »Kleiner Ort, nur ein paar Meilen entfernt. Bis dahin sollten wir's vor Einbruch der Nacht schaffen.«
Mathilda hob entsetzt die Brauen. »Etwa zu Fuß?«
Der Kutscher schenkte ihr ein Lächeln, das selbst Agatha ausgesprochen gehässig fand. »Was denn sonst? Glauben Sie, der Kutsche wachsen noch Flügel, oder wie?«
Sie gingen zu Fuß.
Wobei: Gehen war schon zu viel gesagt. Geoffrey ging – schnurstracks voraus und ohne sich umzudrehen. Mathilda und Agatha kämpften vielmehr um jeden neuen Schritt. Seit sie die Kutsche am Wegesrand zurückgelassen hatten, hatte Mathilda kaum mehr ein Wort verloren. Sie verzog das Gesicht, als betrachte sie die Situation als persönliche Beleidigung und den Winter als einen Zustand, der einer britischen Dame nicht würdig war. Ihre Stiefel versanken im Schnee, wann immer sie sie voreinander setzte.
Agatha kam ebenfalls nicht leicht voran, hatte im Gegensatz zu Mathilda aber Spaß dabei. Gut, es war eisig kalt. Der Wind hatte zugenommen, ebenso der fallende Schnee, und ohne den vorausstapfenden Geoffrey hätte auch sie sich nie und nimmer orientieren können. Aber insgeheim bereitete ihr der unerwartete Ausflug auch Freude – vor allem, weil er der dauerstrengen Mathilda gegen den Strich ging.
Miss Mathilda war noch nicht lange im Dienste von Agathas Eltern. Frederick und Clarissa Miller waren das, was man in gewissen Kreisen wohlhabend nannte – nicht reich, aber beileibe nicht arm. Sie lebten in einer Villa auf dem Land, genauer gesagt in Torquay. Agatha war nicht dort, weil sie in London eine Tante besuchen sollte, die sie kaum kannte. Ihr Vater Frederick war der Ansicht, das von der eigenen Mutter unterrichtete Kind solle mehr von der Welt sehen und erleben. Der Aufenthalt in London, wo seine Schwester lebte, war daher seine Idee gewesen. Agatha wäre liebend gern daheim in der Villa geblieben.
Das hat er jetzt davon, dachte sie und sprang über eine weitere Schneeverwehung. Seine Kutsche steckt im Matsch fest, seine Pferde frieren – und seine Tochter schlägt sich alleine durch. Zumindest, bis die Eisbären kommen.
Da war sie wieder, ihre Phantasie. Im Geiste malte sie sich aus, wie plötzlich gewaltige Bären auf der schneebedeckten Einöde näher kamen. In ihrer Vorstellung fraßen sie Mathilda zuerst auf, dann den mürrischen Geoffrey – und erklärten Agatha kurzerhand zu ihrer neuen Königin.
Hatten Bären überhaupt Königinnen? Agatha wusste es nicht genau, bezweifelte es aber. Sie würde es nachschlagen, sobald sie wieder unter Menschen war.
Das konnte allerdings dauern. Noch sah Agatha nirgends ein Haus oder Anzeichen einer Siedlung. Da waren nur das flache Land, der Schnee und die kargen Bäume.
»Sind wir bald da?«, fragte Mathilda gerade.
Abermals schmunzelte Agatha. Denn die Frage kam so passgenau, als hätte sie selbst sie gestellt
Geoffrey schnaubte nur, schlug den Kragen seines schwarzen Mantels höher und ging weiter – durch die eisige Wüste und dem trüben Horizont entgegen.
Etwa zwei Stunden später erreichten sie den Ort.
Sunningdale war kaum der Rede wert. Zumindest nicht in den Augen einer Neunjährigen, die wenig auf schmucke Häuser, breite Veranden und friedliche Ruhe gab. Der durch und durch übersichtliche Ort, den sie pünktlich zum Abendrot erreicht hatten, beherbergte kaum mehr als ein paar Dutzend Menschen. Er verfügte allerdings über einen Stall und sogar über eine kleine Pension, in der eine resolute Witwe namens Ethel Cleaver das Regiment führte. Den Stall hatte Geoffrey beauftragt, nach der zurückgelassenen Kutsche und den Pferden seines Herrn zu sehen, und in Witwe Cleavers winziger Pension saßen Agatha und die schlecht gelaunte Mathilda nun am wärmenden Feuer.
Ehrlich gesagt, saßen sie dort sogar schon eine ganze Weile. Mathilda sah trotzdem noch immer so aus, als stünde sie hüfthoch im Schnee und wäre nur Sekunden von einem erbärmlichen Erfrierungstod entfernt.
»Nein, also wirklich«, schimpfte die Gouvernante leise. Die Strapazen des zurückliegenden Nachmittags hatten sie vergessen lassen, dass sie sich normalerweise nicht vor Agatha beklagte. »Erst fährt er uns in den Schnee, und jetzt sitzen wir hier in diesem besseren Kuhkaff fest – noch dazu bis auf Weiteres. Das ist doch keine Art! Ich fürchte, Mr Miller wird den armen Geoffrey gehen lassen müssen.«
Ihr Ton machte klar, dass sie das ganz und gar nicht fürchtete, sondern vielmehr erwartete. Und Geoffreys abgetrennten Kopf noch dazu. Auf einem Silbertablett. Mit Schleifchen drum.
»Och«, sagte Agatha. »Ich fand's lustig. Wie ein richtiges Abenteuer. Und für den vielen Schnee kann Geoffrey ja nichts.«
»Pah.« Mathilda winkte ab. Sie hatte zu stricken versucht, konnte sich aber merklich nicht konzentrieren. Auch das verhagelte ihr wohl die ohnehin schlechte Laune. »Das verstehst du nicht, Kleines. Das bespreche ich dann schon mit deinem Vater, wenn wir wieder zu Hause in der Villa sind.«
Die Villa ist nicht dein Zuhause, dachte Agatha grimmig. Du hast da nichts zu verlangen und auch nicht von »wir« zu reden. Du schon gar nicht.
Sie liebte das Haus im Grünen sehr. Fast so sehr, wie sie »Miss Mathilda« nicht leiden konnte.
»Meinen Sie, den Pferden geht es gut?«, wechselte sie schnell das Thema.
Die Gouvernante hob eine Braue. »Was? Welchen Pferden denn?«
»Na, unseren«, sagte Agatha. »Den beiden von der Kutsche.«
»Selbstverständlich, Kind«, gab die Dame achtlos zurück. »Die Angestellten aus dem lächerlichen Dorfstall werden sich schon um sie kümmern. Keine Sorge. Frag dich lieber, wie es uns beiden geht. Nein, wirklich: Eine Nacht im schmalen Bett einer Pension? Das wird meinem Rücken ganz und gar nicht gefallen. Ach, ach, ach.«
Agatha war der Aufenthalt in der Pension egal. Nein, korrigierte sie sich prompt. Nicht egal. Sie bevorzugte ihn sogar. Alles war besser – und fraglos auch spannender – als der Besuch bei der seltsamen Tante.
Das Abenteuer geht weiter, dachte sie zufrieden.
Wie wenig es doch manchmal brauchte, um aus dem gewohnten Trott zu kommen. Eine festgefahrene Kutsche genügte, und schon waren sämtliche Pläne im Grunde Schnee von gestern. Und an ihre Stelle trat ...
Das Unerwartete.
Das Potenzial für Überraschungen.
Agatha liebte dieses Gefühl. Nicht zu wissen, was als Nächstes passieren würde, war ein Segen. Es war das perfekte Mittel gegen Langeweile, und wenn die Neunjährige eines hasste, dann Langeweile.
Und Vorhersehbarkeit.
Und Miss Mathilda.
Und Rosenkohl