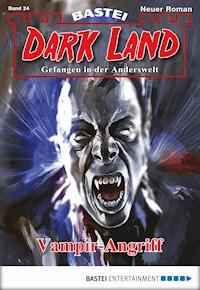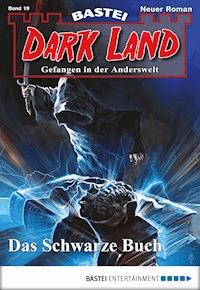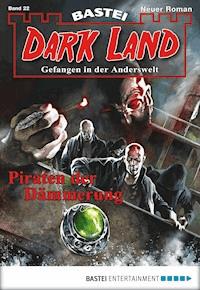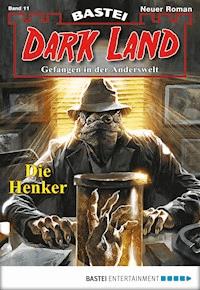1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Als die Millionärin Isabella Janvier auf der Ile de Sainte Marie, einer kleinen, zuvor von ihr gekauften Insel vor der Küste von Martinique, eine Villa bauen lassen will, stößt die von ihr beauftragte Firma auf die Grundmauern eines anderen, möglicherweise schon vor Jahrhunderten aufgegebenen Gebäudes. Auch ein Friedhof mit über zwanzig Gräbern kommt bei den Ausgrabungen zum Vorschein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Dhyarra-Friedhof
Leserseite
Vorschau
Impressum
Der Dhyarra-Friedhof
von Rafael Marques
Der dumpfe Klang unzähliger Trommeln erfüllte die Luft, als der Mann die steinerne Kapelle verließ. Fackeln erleuchteten die bewaldete Umgebung des alten Gotteshauses, das sich auf einem einsamen Hügel weit abseits des nächsten Ortes erhob. Dutzende Männer hatten sich an diesem heiligen Ort versammelt, um den Worten des Dunkelhäutigen zu lauschen, der – eingehüllt in den Talar eines Priesters – vor die Warteten trat und ein seltsames Artefakt in die Höhe hielt, das er in den letzten Stunden mit eigenen Händen geschaffen hatte. Ein Amulett, in dem sich die Magie ihrer aller Heimat mit jener dieser heiligen Stätte vereinigte ...
Küste von Martinique
19. Juli 1852
Entschlossen hob der Mann in dem Priestergewand das kreisrunde Objekt an, in dessen Mitte zwei grüne Edelsteine wie die Augen einer mächtigen Gottheit funkelten. »Unsere Ahnen haben mir die Kraft gegeben, es zu erschaffen«, verkündete er und erntete dadurch aufgeregtes Gemurmel.
Die wartende Menge war nervös, aufgescheucht von den bösen Geschichten, die man sich von einer Insel wenige Kilometer vor der Küste Martinique erzählte. Ein Fremder sollte dort leben, ein Weißer, der von den Béké – den Nachkommen der Sklavenhändler und noch immer die heimlichen Herrscher von Martinique – dort geduldet wurde, dem man jedoch Kontakt zum Teufel, Menschenopfer und magische Experimente nachsagte. Manche schoben die Missernten der vergangenen Jahre auf seine Taten, andere vermuteten dahinter das Werk seiner Frau, die das Zweite Gesicht besitzen und in Wahrheit eine Hexe sein sollte. Ihre dämonische Brut sollte die Insel bevölkern und von dort aus Unheil über ganz Martinique verbreiten.
Die Trommeln erstarben, und auch die in bunte Gewänder gehüllten Tänzer verharrten auf der Stelle. Seit dem Ende der Sklavenzeit lebten die alten Rituale der nun freien Bevölkerung wieder auf, die sie über die Jahrhunderte seit der Verschleppung aus Afrika im Geheimen bewahrt hatten. Wie an diesem Ort vermischten sie sich mit jenen des Christentums, dem jeder der Männer angehörte.
Warum keine Frauen unter ihnen waren, lag auf der Hand: Jeder der Anwesenden wusste, dass er sich in höchste Gefahr begab, wenn er sich gegen das Böse, genauer gesagt den Teufel auflehnte. Wenigstens die Frauen und Kinder sollten vor dessen Zorn geschützt sein, sollte es ihnen nicht gelingen, ihre Mission zu erfüllen. Nun warteten sie allein auf das Zeichen jenes Mannes, der das Amulett wie ein Zeichen der alten Götter in die Höhe reckte und die Gesichter seiner Getreuen musterte.
»Es ist wahr, die Geister der Ahnen sind mir erschienen und haben meine Hände geleitet, als ich dieses Amulett erschuf«, fuhr er mit energischer Stimme fort. »Sie gaben mir die Kraft, eine Waffe gegen das Böse zu erschaffen, das mit seinen Totenkrallen nach unserer Insel greift. Die Béké haben nicht den Mut, sich gegen die Teufelsdiener aufzulehnen, wir dagegen schon. Macht die Boote bereit, wir greifen noch in dieser Nacht an!«
Der Priester lächelte zufrieden, als die Männer ihre Fackeln, Messer und Gewehre in die Höhe reckten und ihm zujubelten. Er hoffte nur, dass ihr Enthusiasmus auch dann noch anhielt, wenn sie im Angesicht des Bösen kämpfen mussten.
Îlet Marie, vor der Küste Martiniques
Gegenwart
»Danke, Nadia«, sagte Isabella Janvier beiläufig, als sie den Cocktail entgegennahm.
Natürlich erschien es selbst ihr ein wenig dekadent, auf ihrer in einer Bucht dieser malerischen Insel ankernden Yacht eine Bloody Mary zu schlürfen, während ein Dutzend Bauarbeiter dabei waren, in mühevoller Kleinarbeit Baumaterial von ihrem Kutter an Land zu verfrachten. Noch dazu, da sie eine Bergère mit gelber Schleife trug, die so gar nicht zu ihrer dünnen, dunkelblauen Bluse und der hautengen, schwarzen Leggings passen wollte. Schon seit frühester Jugend hatte man ihr einen eklatanten Mangel an Modegeschmack nachgesagt. Andererseits war sie reich genug, um sich über die Gedanken anderer Leute keinen Kopf zu machen.
Es war ein herrlicher Tag, den man als Frau wie sie einfach nur genießen konnte. Möwen zogen krächzend ihre Kreise über den blauen Himmel, die Sonne ließ ihren warmen Schein über das Meer streichen, das bis zum Horizont glitzerte wie eine kristallene Wüste. Dieser Ort war ein Paradies auf Erden, wie Isabella fand.
Das leise Klatschen nackter Füße näherte sich ihr von der linken Seite. Es war Nadia Delacourte, ihre Assistentin, Anwältin, Cocktailmixerin und Freundin. Da sie ihr Jura-Studium mit einem Job in einer elitären Pariser Bar finanziert hatte, verfügte sie nicht nur über einige extravagante Talente, sondern auch über exzellente Kontakte in die französische High Society. So verdankte Isabella es überhaupt erst ihrer Freundschaft zu einem martiniquanischen Landbesitzer, dass sie ihre fixe Idee, eine Insel in der Karibik zu kaufen, in die Tat umsetzen konnte.
Nadia trug ein Hauch von Nichts, ein ausgefranstes, weißes Shirt, das ihren Bauch freiließ, sowie azurblaue Hotpants. Dass die Arbeiter ihr angesichts ihrer stark figurbetonten Kleidung immer wieder verstohlene Blicke zuwarfen, quittierte sie meist mit einem verschmitzten Lächeln. Sie war Mitte zwanzig und damit fünfzehn Jahre jünger als Isabella, die die Schönheit ihrer Assistentin nutzte, um selbst nicht so sehr im Fokus der Außenwelt zu stehen.
»Wie lange wirst du es hier draußen wohl aushalten?«, fragte die Anwältin und nippte an der Flasche Bier, die sie locker in der linken Hand hielt. »So weit weg von den pulsierenden Städten, den Cocktail-Partys und opulenten Bällen. Du bist nicht für die Einsamkeit gemacht, sonst würde dein Sommersitz in Montbrison nicht langsam vor die Hunde gehen.«
Isabella zuckte mit den Schultern und rückte ihren Hut zurecht. »Ich bin eben vielschichtig«, erklärte sie äußerlich ungerührt.
»Oder du möchtest dich vor Ruben verstecken. Als ob dir das irgendwo gelingen würde.«
»Nadia ...«, zischte Isabella und rieb drohend Daumen und Zeigefinger der linken Hand aneinander. Nicht dass sie wirklich daran dachte, ihre Assistentin zu feuern, doch bei einer derart fürstlichen Entlohnung duldete sie keine frechen Kommentare. Selbst wenn sie ziemlich genau der Wahrheit entsprachen.
Ruben und sie waren seit ziemlich genau zwei Jahren geschieden, was ihn nicht davon abhielt, ihr immer wieder hinterherzuspionieren oder ihr an den unmöglichsten Orten aufzulauern. Für ihn mochte das nur ein Spiel sein, so wie ihre gesamte Ehe, sie dagegen hatte ihn wirklich geliebt, und trotz des schmerzlichen, aber überfälligen Schnittes in ihrem Leben empfand sie immer noch einiges für ihn. Ein Umstand, den er nur zu gerne ausnutzte, um sie ein ums andere Mal zu verführen wie ein Schulmädchen. Auf eine einsame Insel würde er sie dagegen wohl kaum verfolgen können.
Ihre Erinnerungen an vergangene, glücklichere Jahre wurden jäh unterbrochen, als sich das Bordtelefon meldete. »Ich gehe schon«, verkündete Nadia überflüssigerweise, lief zum Steuer und nahm das Gespräch an. »Was?«, lautete ihr entgeisterter Ausruf, woraufhin Isabella in die Höhe fuhr.
Fragend starrte sie ihre Assistentin an, die mit versteinerter Miene den Telefonhörer sinken ließ. »Was hat dieser komische Priester noch mal über die Insel gesagt? Dass der Teufel hier haust?«, fragte sie.
Isabella nickte zögerlich.
Ihre Assistentin wandte ihren Blick in Richtung Insel. »Kann sein, dass er recht hatte«, flüsterte sie.
Îlet Marie, vor der Küste Martiniques
19. Juli 1852
Mit dem Priester an der Spitze des vordersten Bootes ruderten die mutigen Männer Richtung Osten. Die Insel, auf der der Teufel hausen sollte, lag nur wenige Kilometer von der Küste entfernt. Schiffe verkehrten täglich in dieser Region, allerdings war es den Händlern und Fischern per Dekret der Inselregierung untersagt, sich der Îlet Marie zu nähern. Offiziell hieß es, der neue Besitzer wünsche es nicht, dass an seiner Küste gefischt werde, in Wahrheit erzählte man sich dagegen die wildesten Geschichten – von arglosen Menschen, die der Insel zu nahe kamen und nie wieder zurückkehrten, von seltsamen Fackelzügen an den Stränden und Gesängen, bei denen um die Gunst des Teufels gebuhlt wurde.
Was davon wirklich stimmte und was der übersteigerten Fantasie der Landbevölkerung entsprungen war, wusste auch der Priester nicht. Er war jedoch fest davon überzeugt, dass das Eiland zu einem Hort des Bösen geworden war, den es auszumerzen galt. Immerhin hatten sich ihm die Ahnen offenbart, um das Amulett zu fertigen und zu segnen, das er mit beiden Händen eisern umschlossen hielt. Seine Kräfte sollten hoffentlich genügen, um den Dienern des Teufels Einhalt zu gebieten.
Lediglich das fahle Mondlicht riss die Insel schemenhaft aus der Finsternis. In dieser Nacht zeigte sich kein Feuerschein, und auch auf den Booten brannte keine Fackel mehr. Niemand wollte, dass ihr Angriff zu früh bemerkt wurde.
Wieder und wieder klatschten die Ruder in die ungewöhnlich aufgewühlte See. Weit am Horizont kündigte sich ein herannahendes Gewitter an, wobei grelle Blitze durch die dunkle Wolkenfront huschten. Es war fraglich, ob es ihnen gelingen würde, nach der Vernichtung der Teufelsdiener wieder rechtzeitig ans Festland zurückzukehren, dennoch verschwendete niemand einen Gedanken daran, jetzt noch einen Rückzieher zu machen. Sie folgten ihrem geistigen Anführer blind, der einerseits diesen Umstand genoss, andererseits aber auch wusste, dass es möglicherweise für keinen von ihnen eine Rückkehr geben würde.
»Weiter nach rechts«, wies er seine Begleiter an, die nun die einzige sichere Bucht der ansonsten von steilen Felshängen geprägten Insel ansteuerten. Er hoffte, dass man sie dort nicht bereits erwartete. Im Mondlicht waren jedenfalls keine menschlichen Silhouetten im Sand zu erkennen.
Immer näher rückte der Strand, und mit jedem Meter steigerte sich die innere Anspannung des Priesters. Nur der Gedanke an seine Ahnen und die Macht des Amuletts ließen ihn noch aufrecht stehen. Niemals durfte er Schwäche zeigen, nicht gerade jetzt, im Angesicht des Bösen.
Als der Bootsrumpf in den sandigen Untergrund stieß, wäre der Priester beinahe von Bord geschleudert worden. Nur mit Mühe gelang es ihm, sich an der Reling festzuhalten. Doch auch so war er gezwungen, gemeinsam mit seinen Begleitern in das nicht ganz hüfthohe, sternenklare Wasser zu springen, um die letzten Meter bis zum Ufer zu überwinden.
Auch jetzt zeigte sich niemand, der sie mit Waffengewalt in Empfang nahm. Allein die ungewöhnliche Stille ließ ihn erahnen, dass auf der Insel etwas ganz und gar nicht mit rechten Dingen zuging. Normalerweise hätte ihnen längst der Gesang der Grillen oder anderer Insekten an die Ohren dringen müssen. Stattdessen vernahm er lediglich das sanfte Rauschen der Brandung, die Atemgeräusche seiner Kameraden sowie den eigenen Herzschlag.
»Weiter!«, feuerte er die mutigen Männer an, die es dennoch nicht wagten, an ihm vorbeizutreten. Er führte die Waffe der Ahnen in der Hand, und er sollte als Erster dem Bösen entgegentreten. Das war der Preis des Mutes, der ihn überhaupt erst zu diesem gefährlichen Unterfangen getrieben hatte.
Im Mondlicht entdeckte der Priester einen Trampelpfad, der durch das dschungelartige Gelände tiefer ins Innere der Insel führte. Fast hätte er mit abgeschlagenen Köpfen, Skeletten mit Teufelshörnern oder aufgespießten Herzen gerechnet, doch nichts dergleichen begegnete ihnen auf dem Weg zwischen den Büschen, die bald in düstere Baumriesen übergingen. Immerhin wiesen die kleinen Fußspuren darauf hin, dass der Pfad tatsächlich von Menschen benutzt wurde. Zumeist von Kindern, wie es schien, was das Bild nicht weniger unheimlich machte.
Bald schon verschwanden die Spuren in den Schatten der Bäume, die kaum eine Orientierung in dem Dickicht zuließen. Wieder ließ sich der Priester von dem Amulett und der Kraft der Ahnen leiten, wobei er sich endgültig der Präsenz einer fremden, dunklen Kraft bewusst wurde. Etwas lauerte auf der verfluchten Insel, und mochten manche der Geschichten auch den Ängsten der Menschen entsprungen sein, sie trugen alle einen wahren Kern in sich.
Der Priester war so in Gedanken versunken, dass er überrascht auf der Stelle verharrte, als er die weite Lichtung erreichte. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, denn im Mondlicht zeichneten sich mehrere sich bewegende Silhouetten ab, die allesamt ein unheilvolles blaues Licht mit sich trugen.
Auch seine Begleiter hatten die geisterhaften Geschöpfe entdeckt. Sein zögerliches Verhalten hielt sie nun nicht mehr zurück. Aufgehetzt von seiner Rede und verängstigt durch die Geschichten von Teufelsanbetung und Menschenopfer kannten sie nur noch ein Ziel: das Böse zu vernichten.
Schreiend verließen sie ihre Deckung und stürmten auf die düsteren Gestalten zu. Und so nahm das Unheil seinen Lauf ...
Îlet Marie, vor der Küste von Martinique
Gegenwart
»Ahmed!«, brüllte Karim Bouchard aus voller Kehle. »Ahmed, wo steckst du, verflucht?«
Der Vermessungstechniker antwortete nicht, als hätte sich unter ihm die Erde aufgetan und ihn mit Haut und Haar verschlungen. Es sah dem jungen, algerisch-stämmigen Franzosen überhaupt nicht ähnlich, seinen Arbeitsplatz zu verlassen und einfach abzutauchen, zumal das auf einer derart kleinen Insel auch kaum möglich war. Der lichte Wald bot so gut wie keine Deckung, und dass er sich die Kleider vom Leib gerissen hatte, um durch das azurblaue Wasser zur Yacht seiner attraktiven Auftraggeberinnen zu schwimmen, glaubte Karim auch nicht.
An Isabella Janvier und ihre stets leichtbekleidete Anwältin verschwendete er nicht allzu viele Gedanken. Reiche, dem Festland überdrüssig gewordene Franzosen gab es auf Martinique wie Sand am Meer. Mit ihnen zu arbeiten, war ein einträgliches Geschäft, da sie gerne mehr zahlten als nötig, um ihre pompösen Bauvorhaben möglichst schnell in die Tat umzusetzen. Als Nachfahre arabischer Arbeiter, die nach dem Ende der Sklaverei nach Martinique geholt worden waren, besaß er genügend Verbindungen, um zu verhindern, dass die Behörden ihr Veto gegen derartige Projekte einlegten.
Ahmed arbeitete erst zum dritten Mal für ihn, dennoch verließ er sich bereits blind auf den Techniker, der neben ihm das einzige Mitglied des zwölfköpfigen Bautrupps war, der die Îlet Marie schon einmal betreten hatte. Damals hatte er die ersten Vermessungen für die eigentliche Villa vorgenommen, nun sollte noch ein zweites Haus gebaut werden. Das Baumaterial für beide Gebäude wurde gerade von seinen Helfern auf die Insel geschafft, um die sicher irgendwann auftauchenden Umweltschützer vor vollendete Tatsachen zu stellen. Karim kannte das Spielchen zur Genüge.
Auf der Suche nach Ahmed passierte der stämmige Mann einige Tachymeter und andere Messgeräte, nur den Techniker selbst fand er nicht. »Ahmed, verflucht, melde dich endlich!«, brüllte Karim, wieder ohne eine Antwort zu erhalten.
Schließlich dachte er an die zweite Aufgabe, die er seinem jungen Kollegen zugeteilt hatte. In dem lichten Wald, der vor allem aus Mahagoni- und Johannesbrotbäumen bestand, sollte er mit einem Detektor den Boden absuchen. Immer wieder fanden sich auf derart einsamen Inseln verborgene Schätze, deshalb hatte er persönlich mit den Besitzern auch einen Vertrag abgeschlossen, der besagte, dass sie die Gebäude so schnell wie möglich errichteten, dabei aber im Boden vergrabene Fundstücke behalten durften. Auf die Art waren ihm schon einige Artefakte bis hin zu Goldmünzen in die Hände gefallen.
Ob Ahmed auf einen Schatz gestoßen war und sich damit abgesetzt hatte? Ausschließen wollte er es nicht, allerdings war der Junge ihm nie besonders gerissen vorgekommen. Eher wie ein hochintelligenter Träumer, der sich mit seinem Beruf als Vermessungstechniker unterfordert sah.
Gerade als Karim erneut den Namen seines Angestellten rufen wollte, fiel ihm ein länglicher Gegenstand auf, der unweit eines besonders großen Courbaril – wie jene Bäume in der Landessprache genannt wurden, deren Früchte als Johannisbrot bekannt waren – lag. Erst als er näher herantrat, wurde ihm bewusst, dass es sich um einen menschlichen Körper handelte. Es war Ahmed, der dort mit starrem Blick und aschfahler Haut lag.
»Verdammt!«, stieß Karim hervor und rannte auf den leblosen Techniker zu. Schnell sah er, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam, und als er nach seinem Puls tastete, stellte er fest, dass die Haut bereits erkaltet war. Seine Leiche umgab zudem ein seltsamer Brandgeruch, für den es keine natürliche Quelle zu geben schien.
Instinktiv griff sich der Bauleiter an die Hüfte, wo ein Messer in einer Lederscheide steckte. Ein Relikt seiner Zeit in der französischen Armee, das er bis zum heutigen Tage stets mit sich führte, da er sich von damals eine gewisse Paranoia behalten hatte. Allein, ein Gegner war weit und breit nicht zu entdecken.
»Was ist nur mit dir passiert?«, murmelte Karim, während er dem Vermessungstechniker die Augen schloss. Auch die Lider waren eiskalt und ließen ihn innerlich frösteln.
Neben der Leiche lagen der Metalldetektor und eine Schaufel. Offenbar hatte Ahmed ein Loch gegraben, das inzwischen wieder teilweise in sich zusammengestürzt war. Eigentlich lag es auf der Hand, dass es irgendwie mit seinem Tod in Verbindung stehen musste, nur wie sollte das möglich sein.