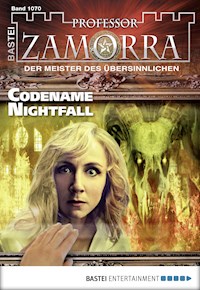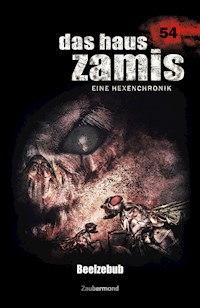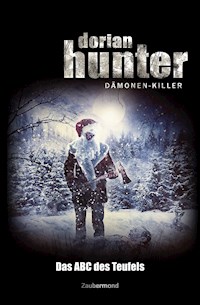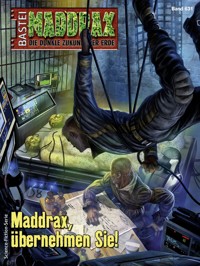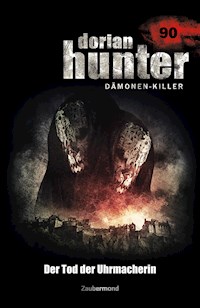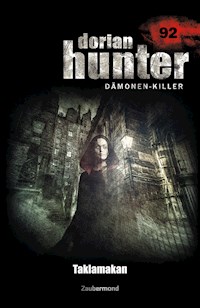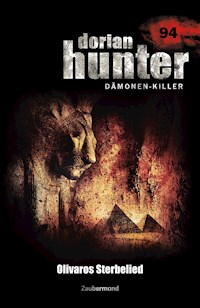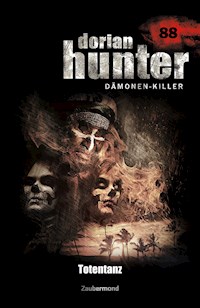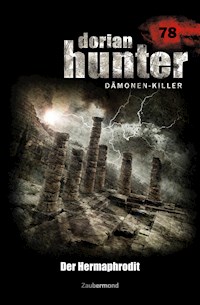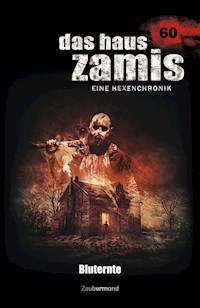1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Jenny Moffat rannte um ihr Leben und blindlings ins Dunkel. Tiefer und immer tiefer trieb die Panik sie in den stillgelegten U-Bahn-Tunnel unterhalb von Manhattan. Laut - oh, so entsetzlich laut - klapperten ihre Sohlen auf den hölzernen Bahnschwellen. Röchelnd ging ihr Atem. Wenn sie schluckte, schluckte sie Blut. Kaum ein Knochen in ihrem geschundenen Leib, der nicht schmerzte. Kaum ein Muskel, der nicht längst protestierte. Doch sie durfte nicht anhalten. Wenn sie anhielt, starb sie - so einfach war das. Erschreckend einfach. Denn sie war nicht allein hier unten in der Finsternis. Und was ihr auf den Fersen war, kannte keine Gnade ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Der Schatten der Welt
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Michael Lingg
Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-8387-4962-4
www.bastei-entertainment.de
Der Schatten der Welt
von Simon Borner
Jenny Moffat rannte um ihr Leben und blindlings ins Dunkel. Tiefer und immer tiefer trieb die Panik sie in den stillgelegten U-Bahn-Tunnel unterhalb von Manhattan. Laut – oh, so entsetzlich laut – klapperten ihre Sohlen auf den hölzernen Bahnschwellen. Röchelnd ging ihr Atem. Wenn sie schluckte, schluckte sie Blut. Kaum ein Knochen in ihrem geschundenen Leib, der nicht schmerzte. Kaum ein Muskel, der nicht längst protestierte.
Doch sie durfte nicht anhalten. Wenn sie anhielt, starb sie – so einfach war das.Erschreckendeinfach.
Denn sie war nicht allein hier unten in der Finsternis.
Und was ihr auf den Fersen war, kannte keine Gnade …
»Pah! Ich kenne dich, Zeit; magst du auch gottgleich und Furcht einflößend wirken. Was bist du, wenn nicht ein Phantom, ein Traum wie wir alle hier? Weniger noch, denn du wirst verstreichen und vergehen. Fürchtet sie nicht, unsterbliche Menschen. Die Zeit ist nur der Schatten der Welt auf dem Hintergrund der Ewigkeit!«
Jerome K. Jerome, Clocks
Kapitel 1 Hallo Alltag
Das Blut schmeckte salzig. Die Lippe war aufgeplatzt und sandte pochende Schmerzschübe aus. Amy Williams, weiblicher Officer des New York Police Department, sah den Mann, der sie geschlagen hatte, grimmig an.
»Hab ich mich jetzt klar genug ausgedrückt?«, knurrte er. Die pechschwarze Skimaske dämpfte seine Stimme kaum.
»Glasklar«, sagte Amy leise. Obwohl die Wut in ihr loderte wie ein Waldbrand nach tagelanger Dürre, setzte sie sich wieder auf den Marmorfußboden. Zu den anderen Geiseln.
Skimaske drehte den Kopf, richtete sich wieder an die ganze Gruppe. »Noch mal, damit sich diese Missverständnisse nicht wiederholen: Wer den Helden spielen möchte, stirbt. Wer eine Flucht versucht, stirbt. Wer nicht tut, was wir verlangen, stirbt. Das sind die Regeln, und sie sind vollkommen einfach. Beachten Sie sie, und wir stehen das hier gemeinsam und ohne Schaden durch. Wir sind nicht an Ihnen interessiert.«
»S-sondern?«, stammelte Jennings, der Filialleiter, vorsichtig. Er war eine Maus von einem Mann: schlaksig, unauffällig und schwach. Halbglatze, goldene John-Lennon-Brille, Windsorknoten. Sein Gesicht war kreidebleich, seine Stirn schweißnass.
Skimaske richtete den Lauf seines handlichen Maschinengewehrs auf ihn. Die Waffe war schwarz und glänzte im Licht der wenigen Deckenlampen, die noch nicht zerschossen waren. »Sondern«, sagte er – mehr nicht.
Erneut ärgerte sich Amy, dass sie ihnen die Handys abgenommen hatten. Was nützte ein Officer ohne Verstärkung? Wusste Police Plaza One, das Hauptquartier der Manhattaner Polizei, überhaupt schon von diesem Überfall?
Die fünf in Schwarz gekleideten Maskierten waren vor zwanzig Minuten in die edel eingerichtete Federal Bank of New York City eingedrungen. Ihre Bewegungen, die knappen, auf das Nötigste reduzierten Äußerungen und ihre schockierend effiziente Methodik machten deutlich, wie gut sie sich auf diese Art von »Arbeit« verstanden. Binnen Sekunden hatten sie die Überwachungskameras zerschossen, die Telefonleitungen gekappt und die zufällig Anwesenden – Bankangestellten wie Bankkunden – in der Mitte des Schalterraumes zusammengetrieben wie Vieh. Dort saß Amy nun, Blut im Gesicht und Wut im Bauch, umgeben von neunzehn leise schluchzenden und zutiefst verängstigten Personen nahezu aller Altersklassen.
Sie hatte versucht, mit den Tätern zu verhandeln. Als Repräsentantin des NYPD war das gewissermaßen ihre Pflicht. Deeskalation und Kooperation, so hießen die magischen Worte in Situationen wie dieser. Amy stammte zwar von City Island – quasi aus der New Yorker Provinz, wo man sich eher um Fahrraddiebe und Falschparker als um Geiselnehmer kümmern musste –, aber auch sie hatte natürlich eine klassische Polizeiausbildung durchlaufen und die »Grundlagen bei Geiselnahmen« nie vergessen.
Doch anstatt eines Gesprächs hatte sie sich einen Schlag mit dem Gewehrlauf eingehandelt. Sie würde eine ganze Weile warten müssen, bis sie es erneut versuchen durfte.
Und sie würde einen Plan B finden. Einen, an dessen Ende ein Kontakt zur Außenwelt stand, verdammt!
Die fünf Unbekannten hatten die zweiflügelige Tür der Bank von innen verschlossen. Der alte Wärter – seinem blutverschmierten Uniformaufdruck nach zu urteilen, hatte er Carl geheißen – lag tot auf dem Marmor, reglose Insel im Meer seines eigenen Blutes. Niemand kam mehr ins Gebäude, niemand aus ihm hinaus. Nicht gegen den Willen der Maskierten.
»Wohin führt der Lift da hinten?«, raunte Amy dem zittrigen Jennings zu. Prompt kassierte sie entsetzte Blicke derjenigen, die um sie herum saßen. Amy verstand die Angst der Menschen, hielt sie aber für falsch. Wer Angst hatte, hatte bereits verloren. Wer Angst hatte, kämpfte nicht. »Jennings«, zischte sie ungeduldig, als der Mäuserich nicht antwortete. »Der Lift.«
Drei der fünf Unbekannten machten sich gerade an dem Ding zu schaffen. Ein schwarzer Kasten aus Edelholz, mannshoch und einer europäischen Telefonzelle nicht ganz unähnlich. Er befand sich an der Rückwand des Schalterraumes, mehrere Meter hinter den Schaltern. Seine Frontseite war offen und führte in eine mit sanftem, gelblichem Licht erhellte Fahrstuhlkabine.
Jennings’ Mundwinkel zuckten. Rote Flecken erschienen auf seinen Wangen. Amy rechnete schon fast damit, dass er sich übergab, einnässte oder beides, da hauchte der Filialleiter ihr endlich eine Antwort entgegen. »K-keller. Einziger Zugang z-zum Tresorraum.«
Also doch. Ein Kapitalverbrechen. Noch dazu eines der dreistesten Sorte! Die FBNY war die renommierteste Bank der Stadt und arbeitete sehr eng mit Washington und der Wall Street zusammen. Sie war das El Dorado für Bankräuber und diese Filiale unweit von der berühmten Fifth Avenue ihr größter, wichtigster Standort.
Vermutlich lagerte nirgends in New York City mehr Geld. Nicht einmal in Donald Trumps geheimen Geldspeichern.
»Sie da!«, rief einer der Maskierten am Lift plötzlich. »Jennings. Kommen Sie her.«
Der Mäuserich zuckte zusammen – und hörte gar nicht mehr damit auf. Fast schon spastisch.
Vermutlich ist der Lift nur mit Code oder Schlüssel benutzbar, ahnte Amy. Sie brauchen Jennings, um ihn zu bedienen. Sie streckte die Hand aus und berührte Jennings sanft am Arm. »Ganz ruhig«, raunte sie ihm zu. »Ich begleite Sie, okay? Das kriegen wir schon hin.«
Vorsichtig erhob sie sich, den Filialleiter mit beiden Händen stützend. Die Umsitzenden schrien auf, als der Mann, der Amy geschlagen hatte, wutentbrannt auf beide zulief. »Mein Kollege hat ihn gerufen«, zischte der Maskierte und packte Amy grob am Kinn. »Nicht dich, Bulle!«
Hinter seiner Taucherbrille mit den getönten Gläsern, mit der er den Zeugen seine Augenfarbe verheimlichte, glaubte Amy kurz, etwas aufflackern zu sehen. Aber das musste Einbildung sein.
»Na gut«, sagte sie. »Ganz wie ihr wollt.« Dann ließ sie Jennings los und hob artig die Hände.
Wie erwartet, brach der Mäuserich sofort zusammen. Seine Knie gaben nach, und er fiel hin wie ein nasser Sack.
»Er kommt bestimmt gleich«, ätzte Amy. Sie wollte den Geiselnehmer nicht unnötig reizen, aber sie wusste, dass die Lage noch schlimmer werden würde, wenn sie sich nicht einmischte.
Skimaske hielt sie noch einen Moment schweigend in seinem Griff, dann ließ er nickend von ihr ab. »In Ordnung. Du stützt ihn.«
Na also. Amy bückte sich nach Jennings und half ihm wieder auf die Beine. Schweigend bahnten sie sich einen Weg durch die anderen Geiseln, die sie, so erweckte es auf Amy zumindest den Anschein, nur zu gern passieren ließen. Für sie waren Amy und der Mäuserich instabile Faktoren, Risiken. Sie waren froh, sie los zu sein.
Die zwei Bewacher – der Schlägertyp und sein Kompagnon – blieben bei den Geiseln zurück. Stattdessen kam einer der drei vom Lift auf Amy und Jennings zu und eskortierte sie mit vorgehaltener Maschinenpistole zum Fahrstuhl. »Rein da«, schnauzte er sie an, kaum dass sie die Kabine erreichten.
Amy stutzte. Hätte er nicht viel eher nach dem Schlüssel oder Sicherheitscode fragen müssen? Mit einem unguten Gefühl im Magen, befolgte sie die Anweisung und hievte den leise wimmernden Jennings in die Kabine.
»Du auch«, forderte der Maskierte dann.
Amy sah ihn an. Ihr Überlebenswille kämpfte mit ihrer Angst und ihrer Neugierde. »Weshalb?«
Der Mann schubste sie, sodass sie rückwärts in den Fahrstuhl stolperte. »Weil ich es sage.«
Im Inneren der Kabine war es eng. Zu eng für drei Personen, doch der Maskierte trat trotzdem ein. Jennings lehnte an der Seitenwand, den Blick seiner glasigen Augen ins Leere gerichtet. Sein rechtes Augenlid zuckte unkontrolliert.
Der Maskierte deutete auf die Handschellen an Amys Uniformgürtel. »Um ihn mache ich mir keine Sorgen«, sagte er. »Aber um dich. Also: Benimmst du dich freiwillig, oder muss ich dich zwingen?«
Du zwingst mich doch ohnehin schon, dachte sie. Doch sie rang sich ein falsches Lächeln ab und hob abwehrend die Hände. »Sie sind der Boss, Boss.«
Der Maskierte grunzte. »Verdammt richtig.« Dann ergriff er Jennings’ Handgelenk und presste die Rechte des Mäuserichs gegen ein Scan-Feld, das in der Kabinenwand eingelassen war. Der Computer bestätigte die Identität des Filialleiters, und der Fahrstuhl begann seine Reise in die Tiefe.
Als die Kabine gänzlich abgetaucht und aus dem Sichtfeld der im Schalterraum Versammelten verschwunden war, hob der Maskierte die Hand und zog sich mit einem erleichterten Seufzen die getönte Taucherbrille vom Kopf.
Das ist nicht gut, dachte Amy erschrocken.
Wie ungut es aber wirklich war, begriff sie erst, als sie die Augen ihres Entführers sah. Seine pechschwarzen Augäpfel, in deren Zentrum Höllenfeuer zu irrlichtern schienen.
Das ist gar kein normales Verbrechen, sondern ein paranormales!, durchfuhr es Amy. Sie seufzte leise.
Hallo Alltag.
***
»Erinnert sich noch jemand daran«, keuchte Police Lieutenant Steven Zandt und ging vor der heranwalzenden Feuersbrunst in Deckung, »dass wir mal ganz normale Fälle gelöst haben? Alltägliches Zeugs wie Morde, Überfälle und Diebstähle? Ich hab das doch nicht geträumt, oder? Das war doch früher wirklich so!«
Diane Millerton, irisch- und auch sonst sehr stämmige Gerichtsmedizinerin, presste sich enger an das Dach des umgestürzten U-Bahn-Waggons. Ihr rotes Haar schien vor dem Hintergrund des gewaltigen Feuers nahezu zu strahlen. »War es«, erwiderte sie und wischte sich mit dem Ärmel ihres dunklen Kostüms den Schweiß von der Stirn. »Ist aber lange her.«
»Zu lange, wenn Sie mich fragen.« Kaum war die Feuerwalze vorbei, stand Zandt wieder auf, die Waffe in den Händen, und feuerte über den Waggon hinweg in den Tunnel. Er hörte erst auf, als das Magazin leer war. »Und wer ist schuld daran?«
Sergeant Andy Sipowicz, der neben Diane Schutz suchend auf dem verlassenen und zum Schauplatz eines unfassbaren Krieges gewordenen Bahnsteig kauerte, hob den Kopf. »Sir, wenn Sie jetzt meinen Namen nennen«, sagte er zu seinem ehemaligen Vorgesetzten, »schieße ich Ihnen ins Bein.« Dann zögerte er kurz und fügte ein leises »Bei allem Respekt« an. Nur zur Sicherheit.
Zandt grunzte nur ungehalten. Was – bedachte man, dass er Andy für die Bemerkung auch den Kopf vom Hals hätte reißen können – wohl das Beste war.
Andy war zufällig in Police Plaza One gewesen, als der Notruf eintraf, und weil es ein besonders bizarrer war, hatte Zandt darauf bestanden, dass er sie zum Tatort begleitete. Dabei hatte Andy doch nur auf seine Freundin Amy warten wollen. Ihretwegen war er an diesem Tag überhaupt nach Manhattan gekommen. Amy, die schon seit Tagen seltsam wirkte, hatte zur Bank gewollt – persönlich, nicht online, wie sonst. Da daheim auf City Island derzeit alles ruhig war, hatte Andy sie begleitet. Nicht zuletzt, um herauszufinden, was in letzter Zeit mit ihr los war.
Doch statt Antworten hatte er weitere Fragen gefunden. Zum Beispiel die, die Lieutenant van Zandt jetzt stellte: »Was zum Teufel macht ein Feuer speiender Dinosaurier in meiner U-Bahn?«
»Das ist kein Dinosaurier, Sir«, sagte Diane und wagte einen weiteren vorsichtigen Blick aus ihrer Deckung.
»Und es ist auch nicht Ihre U-Bahn«, ergänzte Andy ein wenig trotzig.
Zandt warf ihm einen warnenden Blick zu. »Es ist meine Stadt, oder? Also ist es auch meine Bahn.«
Andy wusste nicht, wie lange der Lieutenant schon in Manhattan für Recht und Ordnung sorgte. Er wusste nur, dass er es vor der »Ära Sipowicz«, wie Zandt sie inzwischen nannte, nie mit paranormalen Dingen zu tun gehabt hatte. Die waren erst mit Andy – und einem gewissen Dämonenjäger aus Frankreich – in sein Berufsleben getreten. Sehr zu Zandts Missfallen. Anfangs hatte sich der stiernackige Lieutenant derlei Dingen noch mit kindischer Sturheit verweigert und schlichtweg ignoriert, was nicht in sein rationales Weltbild passte. Inzwischen, und insbesondere seit New York City von einem waschechten Vampir beherrscht wurde, ergab sich Zandt aber der Realität.
Was allerdings nicht bedeutete, dass sie ihm gefiel.
»Und was soll das sonst sein«, fragte Zandt gerade schnippisch, »wenn nicht ein Dinosaurier? Es ist riesig und hat schuppige Haut.«
»Ein Drache«, antwortete Diane. »Glauben Sie mir, Sir. Ich bin Irin. Wir kennen die Viecher.«
Zandt und Andy sahen sie ungläubig an.
»Nicht aus eigener Erfahrung«, wiegelte die Medizinerin ab, den Anflug eines »Typisch Männer«-Lächelns auf den Lippen. »Aus unserer Sagenwelt. Von Drachen, Kobolden und Co. hören wir schon im Kindergarten.«
»Na, herzlichen Glückwunsch, Doc«, brummte Zandt. »Sieht aus, als würde heute Ihr Kindheitstraum wahr.«
Sparky – wie Andy das Untier dort im Tunnel getauft hatte – nutzte diesen Moment, erneut sein dämonisches Gebrüll hören zu lassen. Laut und herrisch hallte es von den Wänden wider. Mauerreste rieselten von der Decke, als wollten sie die Flucht ergreifen, solange sie es noch konnten. Die Neonröhren schwankten in ihren von der Bahnsteigdecke hängenden Halterungen. Es war ein großes Glück – und ein nicht minder großes Wunder –, dass alle Passanten die Station rasch und unbeschadet verlassen hatten und auch niemand beim Entgleisen der U-Bahn wirklich schlimm verletzt worden war. Um all die Knochenbrüche und Blessuren kümmerten sich oben auf der Straße sicher längst die Rettungsdienste. Und hoffentlich erzählten sie den Passanten und der Presse auch, was das NYPD ihnen zu sagen aufgetragen hatte: dass es sich bei dem Vorfall um eine Gasexplosion handelte.
Gasexplosion. Welch ein Euphemismus. Dabei war das gar nicht mal so falsch, denn was da so flammend aus Sparkys Maul strömte, war ganz gewiss eine Art Gas. Nur eben eine brennende Art.
Das Monster war einfach so aufgetaucht, zumindest nach Andys bisherigem Wissensstand. Augenzeugen hatten von seltsamen Lichtern im Tunnel berichtet. Und dann, als der Zug der Linie A gerade in den Bahnhof einfuhr, war die erste Feuerwand aus dem Dunkel geschossen gekommen. Ab da hatte Chaos regiert. Keine drei Sekunden später war der erste Notruf eingegangen, fünf Minuten später der Bahnhof evakuiert gewesen. Und Andy und Co. waren unterwegs.
Wir sind die Ghostbusters, dachte der junge Sergeant nun und lachte ebenso leise wie humorlos. Wir widmen uns den Fällen, die niemand sonst übernehmen kann.
Trotzdem dürfte die Verstärkung jetzt echt langsam mal auftauchen, fand er. Insbesondere die Mädels und Jungs vom Fire Department. Schließlich stand der halbe Bahnhof in Flammen. New Yorks Reaktionsschnelle im Krisenfall war auch schon mal besser gewesen. Überhaupt: Dies war kein Fall fürs NYPD, sondern für die Nationalgarde. Zu dritt gegen einen ausgewachsenen Drachen? Das war selbst für Andy ein Novum.
Kein Wunder, dass Zandt schäumte.
»Die Drachen, die ich kenne, sind deutlich niedlicher«, sagte Diane. Andy stimmte ihr zu. Mit den Illustrationen aus den Märchenbüchern seiner Kindheit hatte dieser Godzilla-Verschnitt, den er nur schemenhaft in der rauchverhangenen Finsternis ausmachte, nicht viel gemeinsam.
»Okay«, sagte Andy. »Die Nachhut lässt auf sich warten, aber dieses Vieh wütet fröhlich weiter vor sich hin. Also müssen wir ran, es zu stoppen und davon abzuhalten, sich noch mehr Haltestellen vorzunehmen. Wir brauchen einen neuen Plan.«
»Wir brauchen ein größeres Boot«, erwiderte Zandt und warf frustriert den Dienstrevolver von sich. Offensichtlich war seine Munition endgültig aufgebraucht.
Andy verstand das Filmzitat – aus Der weiße Hai – und nickte. »So kann man es auch sagen.«
»Weiß Ihre irische Kinderstube zufällig, wie man die Dinger platt macht?«, wandte sich der Lieutenant an Diane.
»Wir könnten ihm eine Jungfrau zum Fraß vorwerfen«, antwortete diese scherzend. »Vielleicht hilft’s.«
»Ich nominiere Sipowicz«, brummte Zandt.
Andy hob beleidigt die Brauen. »Hey!«
»Keine Widerrede, Sergeant«, sagte der Lieutenant. Die Achselbeugen und der Rücken seines wie immer weißen, wie immer zerknitterten Hemdes waren schweißnass. »Sonst lassen wir Sie auch noch ein weißes Kleidchen anziehen, verstanden? Und jetzt gehen Sie gefälligst da raus und machen Sparky schöne Augen.« Dann begannen er und Diane zeitgleich zu prusten. Die ständigen Konfrontationen mit dem Übernatürlichen schienen sie abgehärtet zu haben. Was sie früher noch erstaunt hätte, war heute schon fast so etwas wie Alltag für sie.
»Ja, ja«, maulte Andy. »Hauptsache, ihr habt Spaß.«
Plötzlich und ohne Vorwarnung fiel gleißendes Licht aus dem Tunnel auf die drei Menschen und ihre behelfsmäßige Deckung. Es war, als hätte jemand die Tore zu einer kalten Sonne geöffnet – und nach einem Augenblick verging es wieder.
»Was zum Teufel …«, murmelte Zandt.
Diane stutzte. »Hören Sie das?«, fragte sie und hob die Hand.