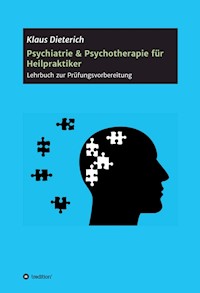
9,99 €
Mehr erfahren.
In diesem praxisnahen Lehrbuch ist das komplette Wissen der Psychiatrie und Psychotherapie prägnant und kompakt dargestellt. Das Buch richtet sich sowohl an angehende Heilpraktiker als auch an Pflegepersonal in der Ausbildung. Als umfassendes Nachschlagewerk mit detaillierten Diagnosekriterien der ICD-10 ist es auch für approbierte Psychotherapeuten geeignet. Eine zusammenfassende Darstellung der speziellen Psychopathologie mit Übersichtstabellen über die einzelnen psychiatrischen Störungsbilder steht dem Leser in Form von Lerntabellen im letzten Kapitel zur Verfügung. Somit ist das Lehrbuch hervorragend zur Prüfungsvorbereitung geeignet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Klaus Dieterich
Psychiatrie & Psychotherapie für Heilpraktiker
Lehrbuch zur Prüfungsvorbereitung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Umschlagfoto: Pixabay
© 2019 Dr.rer.nat. Klaus Dieterich
ISBN Paperback: 978-3-7482-5562-8
ISBN Hardcover: 978-3-7482-5563-5
ISBN e-Book: 978-3-7482-5564-2
Inhalt
Vorwort
1 Grundlagen
1.1 Definitionen
1.2 Das psychotherapeutische Erstgespräch
1.2.1 Anamnese
1.2.2 Psychopathologischer Befund
1.2.3 Diagnose
1.3 Diagnosesysteme - psychiatrische Systematik
1.3.1 Triadisches System
1.3.2 Moderne Klassifikationssysteme
2 Allgemeine Psychopathologie
2.1 Elementarfunktionen der Psyche
2.2 Störungen der Elementarfunktionen
2.2.1 Bewusstseinsstörungen
2.2.1.1 Quantitative Bewusstseinstörungen
2.2.1.2 Qualitative Bewusstseinstörungen
2.2.1.3 Syndrome mit quantitativen bzw. qualitativen Bewusstseinsstörungen
2.2.2 Orientierungsstörungen
2.2.3 Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Auffassungsstörungen
2.2.4 Gedächtnisstörungen
2.2.5 Denkstörungen
2.2.5.1 Formale Denkstörungen
2.2.5.2 Inhaltliche Denkstörungen
2.2.6 Wahrnehmungsstörungen
2.2.7 Ich-Störungen
2.2.8 Affektstörungen
2.2.9 Störungen des Antriebs und der Psychomotorik
2.2.10 Kontaktstörungen
2.2.11 Störungen der Intelligenz
3 Psychiatrische Krankheitsbilder
3.1 Organisch bedingte psychische Störungen
3.2 Organisch bedingte psychische Störungen im Detail
3.2.1 Dementielle Syndrome
3.2.2 Organisches amnestisches Syndrom
3.2.3 Delir und verwandte Störungen
3.2.4 Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit
3.2.5 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns
3.3 Suchterkrankungen und Substanzmissbrauch
3.3.1 Definitionen
3.3.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
3.3.3 Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen
3.4 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen
3.4.1 Schizophrenie
3.4.2 Der Schizophrenie verwandte Störungen
3.5 Affektive Störungen
3.5.1 Manie
3.5.2 Depression
3.5.3 Bipolare Störung
3.6 Neurotische- Belastungs und somatoforme Störungen
3.6.1 Angststörungen
3.6.2 Zwangsstörungen
3.6.3 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen
3.6.4 Dissoziative Störungen (Konversionsstörungen)
3.6.5 Psychosomatik
3.6.5.1 Somatoforme Störungen
3.6.5.2 Psychosomatosen
3.6.6 Andere neurotische Störungen
3.7 Essstörungen
3.7.1 Anorexia nervosa
3.7.2 Bulimie
3.7.3 Binge-Eating-Störung
3.8 Schlafstörungen
3.8.1 Nichtorganische Schlafstörungen
3.9 Sexuelle Störungen
3.9.1 Sexuelle Funktionsstörungen
3.9.2 Störungen der Geschlechtsidentität
3.9.3 Störungen der Sexualpräferenz
3.9.4 Psychische & Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung
3.10 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
3.10.1 Die Persönlichkeitsstörungen im Detail
3.10.2 Andauernde Persönlichkeitsänderungen
3.10.3 Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
3.10.4 Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle
3.11 Psychiatrische Störungen im Kindes – und Jugendalter
3.11.1 Intelligenzminderung
3.11.2 Entwicklungsstörungen
3.11.3 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen
3.11.4 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
4 Psychiatrische Notfälle
4.1 Suizidalität
4.2 Angst – und Panikzustände
4.3 Erregungszustände
4.4 Katatone Störungen und Stupor
4.5 Wahn und Sinnestäuschungen
4.6 Verwirrtheitszustände
4.7 Delirante Zustände
4.8 Intoxikationen
5 Psychopharmakologie
5.1 Definitionen
5.2 Wirkungsmechanismen von Psychopharmaka
5.3 Psychopharmakotherapie
6 Psychotherapeutische Verfahren
6.1 Psychodynamische (tiefenpsychologische) Therapieverfahren
6.1.1 Psychoanalyse
6.1.2 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
6.2 Verhaltenstherapie
6.3 Humanistische Verfahren
6.3.1 Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie
6.3.2 Gestalttherapie
6.3.3 Logotherapie
6.4 Systemische und interpersonelle Psychotherapieverfahren
6.4.1 Systemische Therapie
6.4.2 Interpersonelle Psychotherapie
6.5 Ergänzende Therapieverfahren
6.5.1 Hypnosetherapie
6.5.2 Autogenes Training
6.5.3 Progressive Muskelrelaxation
6.5.4 Kreative Psychotherapieverfahren
6.5.5 Körperorientierte Psychotherapieverfahren
6.5.6 EMDR
7 Psychotherapeutische Heilberufe
7.1 Akademische psychotherapeutische Heilberufe
7.2 Der Heilpraktiker
7.2.1 Berufsbezeichnung und rechtlicher Rahmen
7.2.2 Die Heilpraktikerprüfung
8 Forensische Psychiatrie und Gesetzeskunde
8.1 Schweigepflicht
8.2 Geschäftsfähigkeit
8.3 Nichtigkeit der Willenserklärung und Testierunfähigkeit
8.4 Schuldunfähigkeit
8.5 Jugendrecht
8.6 Unterbringung
8.7 Betreuung
8.8 Heilpraktikergesetz
8.9 Durchführungsverordnung zum Heilpraktikergesetz
9 Psychiatrische Lerntabellen zur Prüfungsvorbereitung
9.1. Lerntabellen der Psychopathologie
9.2. Lerntabellen zu den organischen Störungen
9.3. Lerntabelle der Suchterkrankungen
9.4. Lerntabellen zur Schizophrenie und anderen psychotischen Störungen
9.5. Lerntabellen zu den affektiven Störungen
9.6. Lerntabellen zu den neurotischen Störungen
9.7. Lerntabellen zu den somatoformen Störungen
9.8. Lerntabellen zu den Belastungsstörungen
9.9. Lerntabellen zu den Essstörungen
9.10. Lerntabelle der Schlafstörungen
9.11. Lerntabellen zu den Sexualstörungen
9.12. Lerntabellen zu den Persönlichkeitsstörungen
9.13. Lerntabellen zu den Impulskontrollstörungen
9.14. Lerntabellen zu den Störungen in Kindheit und Jugend
Glossar zur Diagnostik & Psychopharmakologie
Quellenangaben
Vorwort
Das hier vorliegende Lehrbuch soll in erster Linie der Prüfungsvorbereitung dienen und den Lernenden befähigen, die Prüfung zu bestehen. Das Buch richtet sich sowohl an angehende Heilpraktiker als auch an Pflegepersonal in der Ausbildung. Als Nachschlagewerk mit den detaillierten Diagnosekriterien der ICD-10 ist es auch für alle psychologischen Psychotherapeuten und Ärzte geeignet.
Die Inhalte sind prägnant und kompakt dargestellt. Eine zusammenfassende Darstellung der speziellen Psychopathologie mit Übersichtstabellen über die einzelnen psychiatrischen Störungsbilder steht dem Lernenden in Form von Lerntabellen am Ende des Buches zur Verfügung.
Dr. Klaus Dieterich
1. Grundlagen
1.1 Definitionen
In diesem Lehrbuch werden Sie mit einigen Begriffen konfrontiert, welche hier im Vorfeld erläutert werden sollen.
In der speziellen Psychopathologie (Krankheitslehre) werden die einzelnen psychiatrischen Erkrankungen dargestellt und erläutert. Dazu werden verschiedene Teilbereiche herangezogen, um die Krankheit zu beschreiben.
Die Definition erläutert zur wesentlichen Erfassung des Krankheitsbildes kurz die Erkrankung.
Die Epidemiologie macht statistische Aussagen über die Häufigkeit, Geschlechts- und Altersverteilung der Erkrankung in der Bevölkerung. Zur Epidemiologie gehören die Begriffe Morbidität und Mortalität. Unter Morbidität versteht man die Krankheitshäufigkeit bezogen auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Zur Morbidität zählen die Prävalenz und die Inzidenz. Hingegen bedeutet Mortalität die Sterblichkeitsrate einer bestimmten Erkrankung und gibt die Anzahl der Todesfälle im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in einem bestimmten Zeitraum (in der Regel 1 Jahr) wieder. Die Prävalenz ist ein Maß für die Häufigkeit einer Krankheit in der Bevölkerung und wird in der Regel in Prozent angegeben. Die Prävalenz ergibt sich, wenn man die Anzahl der Erkrankten durch die Anzahl der untersuchten Individuen zum Untersuchungszeitraum teilt. Die Prävalenz wird oft als Punktprävalenz wiedergegeben, das ist die Prävalenz zu einem bestimmten Zeitpunkt (an einem bestimmten Stichtag). Weiterhin gibt es die sogenannte Lebenszeitprävalenz, auch als Lebenszeitrisiko (life-time-risk) bezeichnet. Die Lebenszeitprävalenz bezeichnet die Prävalenz auf die gesamte Lebenszeit bezogen und ist somit ein Maß für die Wahrscheinlichkeit einmal im Leben an einer bestimmten Krankheit zu erkranken. Ein anderes Maß für die Krankheitshäufigkeit ist die sogenannte Inzidenz. Diese gibt die Zahl der Neuerkrankungen in einem bestimmten Zeitraum in der Bevölkerung an. Die Inzidenz ergibt sich, wenn man die Anzahl der neu Erkrankten durch die Anzahl der untersuchten Individuen in der betrachteten Zeitspanne dividiert. Die Inzidenz wird entweder in Prozent oder als Anzahl der Neuerkrankungen pro Jahr pro 100.000 Einwohner angegeben.
Die Ätiologie beschäftigt sich mit den Krankheitsursachen. Diese sind meist multifaktoriell bedingt, also von mehreren Faktoren abhängig.
Der Krankheitsverlauf beschreibt den Verlauf von Beginn bis Ende einer Krankheit bzw. bei chronischen Erkrankungen den zeitlichen Verlauf mit allen Schwankungen über die Lebensspanne betrachtet.
Die Prognose gibt Aufschluss über die Gesundungswahrscheinlichkeit und die Heilungschancen einer Krankheit.
Die Symptomatik beschreibt die zu der Erkrankung gehörigen Krankheitszeichen, den Symptomen, welche in der Diagnostik durch technische Hilfsmittel oder Verfahren (bildgebende Verfahren, Blutbild etc.) oder psychometrisch (durch psychologische Testverfahren) anhand von diagnostischen Richtlinien überprüft und bewertet werden. Als Syndrom bezeichnet man einen Komplex aus mehreren verschiedenen Symptomen, die für eine bestimmte Erkrankung charakteristisch sind.
Die Differentialdiagnostik beschreibt Erkrankungen mit ähnlicher bzw. identischer Symptomatik, welche beim Stellen der Diagnose ebenfalls als mögliche Ursache in Betracht gezogen werden müssen.
Komorbiditäten sind Erkrankungen, die zusätzlich zu einer definierten Grunderkrankung auftreten können. So ist die Grunderkrankung einer „Zwangsstörung“ häufig assoziiert mit einer Angststörung als Begleiterkrankung. Zur Komorbidität einer Zwangsstörung gehören somit Angststörungen.
Die Therapie gibt die Heilbehandlungsmöglichkeiten an. In der Psychiatrie gehören dazu die Psychotherapie und die Psychopharmakotherapie oder kurz Pharmakotherapie (medikamentöse Behandlung).
1.2. Das psychotherapeutische Erstgespräch
Im psychotherapeutischen Erstgespräch, dem ersten Patientenkontakt des Therapeuten, sind neben dem Aufbau einer tragfähigen Beziehung vor allem drei Dinge wichtig:
• die Anamnese
• der psychische Befund
• die Diagnose
Das sind die Grundbausteine jeder psychiatrischen bzw. psychotherapeutischen Untersuchung, welche exploriert werden müssen.
1.2.1. Die Anamnese
Die Anamnese beschreibt die Krankengeschichte des Patienten und sollte folgende Informationen umfassen:
• Biografische Anamnese (Lebensgeschichte des Klienten)
• Familienanamnese (Familiensituation)
• Sozialanamnese (Freunde, Kontakte, Beziehungen)
• Somatische Anamnese (Krankengeschichte bzgl. körperlicher Erkrankungen, körperlicher Befund)
• Psychiatrische / psychotherapeutische Anamnese (frühere psychische Erkrankungen, auch anderer Familienangehöriger, sowie frühere Therapieversuche)
Eine eindeutige Diagnose kann nur im Kontext einer ausführlichen Anamnese gestellt werden.
1.2.2. Psychischer oder psychopathologischer Befund
Die Erhebung des psychopathologischen Befundes ist das Kernstück der psychiatrischen Diagnostik. Die Elementarfunktionen der Psyche (siehe Allgemeine Psychopathologie) bilden den Kern des psychopathologischen Befundes.
Beispiel eines psychopathologischen Befundes
Außeres Erscheinungsbild:
gepflegtes Äußeres, sportlich-leger gekleidet
Sprechverhalten u. Sprache:
ruhiger Sprechfluss mit leichtem Akzent
Kontaktverhalten:
freundlich und offen mit regelhafter Kontaktaufnahme
Bewusstseinslage/Vigilanz:
wirkt klar. Vigilanz ist quantitativ und qualitativ erhalten
Orientierung:
vollständig orientiert
Aufmerksamkeit und Gedächtnis:
regelhaft
Denkstörungen:
ohne formale oder inhaltliche Störungen
Wahrnehmungsstörungen:
Wahrnehmung quantitativ und qualitativ unbeeinträchtigt
Ich-Störungen:
keine, klares Ich-Erleben
Stimmungslage (Affektivität):
stimmungsgedrückte Affektanteile wahrnehmbar
Antrieb und Psychomotorik:
regelhaft
Krankheitseinsicht:
vorhanden
Therapiemotivation:
vorhanden
Selbst- oder Fremdaggression:
keine
Suizidalität:
glaubhaft verneint
Prämorbide Persönlichkeit (Selbsteinschätzung):
lebensfrohe Persönlichkeit
1.2.3. Diagnose
Die Diagnose wird aufgrund der Informationen der Anamnese und der des psychischen Befundes erstellt und ist zunächst nur als eine vorläufige Diagnose zu betrachten. Man spricht daher auch von Arbeits- oder Verdachtsdiagnose. Denn im weiteren Behandlungsverlauf können neue Details zum Vorschein kommen, wodurch es notwendig werden kann, die vorläufige Diagnose zu revidieren.
1.3. Diagnosesysteme - psychiatrische Systematik
1.3.1. Triadisches System
Das triadische System basierte auf der ätiologischen Klassifikation psychischer Erkrankungen, wie es früher Verwendung fand und seit Einführung der neuen Klassifikationssysteme (siehe unten) nicht mehr in Gebrauch ist. Dabei wurden die psychischen Störungen in drei Kategorien eingeteilt, die sogenannte pathogenetische Trias:
• Exogene (organische) StörungenDen exogenen Störungen liegen organische Ursachen zugrunde, eine Erkrankung des Gehirns oder andere körperliche Erkrankungen. Zugehörige Erkrankungen sind beispielsweise:
• Demenz
• Delir
• Endogene StörungenBei den endogenen Störungen sind neben psychosozialen Faktoren primär biologische Anlagefaktoren an der Entstehung beteiligt. Zugehörige Erkrankungen:
• Schizophrenie und wahnhafte Störungen
• Affektive Störungen
• Psychogene StörungenBei der Pathogenese der psychogenen Störungen spielen vorwiegend psychodynamische bzw. erlebnisreaktive Faktoren eine wichtige Rolle. Zugehörige Erkrankungen sind beispielsweise:
• Belastungsstörungen & Anpassungsstörungen
• Angststörungen
• Zwangsstörungen
• Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
• somatoforme Störungen
• dissoziative Störungen
• Ess-, Schlaf- und sexuelle Störungen
1.3.2. Moderne Klassifikationssysteme
Weltweit existieren heute zwei diagnostische Klassifikationsmodelle für die Klassifizierung psychischer Störungen:
• das europäische Klassifikationssystem ICD-10 (International Classification of diseases in der 10. Überarbeitung, von der WHO herausgegeben)
• das amerikanische Klassifikationssystem DSM-V (diagnostic and statistical manual of mental disorders in der 5. Auflage, von der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft, der APA, herausgegeben)
Bei beiden Systemen werden psychische Störungen nach phänomenologischen Gesichtspunkten (Symptomatik, Schweregrad, Krankheitsdauer und Verlauf) klassifiziert und nicht mehr nach ätiologischen Gesichtspunkten wie im triadischen System.
ICD-10
Die psychischen Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten sind im Kapitel V der ICD-10 beschrieben und tragen den Kennbuchstaben F. Das Kapitel F enthält in 10 Unterkapiteln die10 Hauptgruppen, welche die Gesamtheit der heute bekannten psychischen Störungen umfassen.
Die erste Ziffer gibt das Unterkapitel und die zweite Ziffer eine gezielte Diagnose an. Diese Diagnose wird weiter eingegrenzt durch eine dritte Ziffer. Dazu folgt nach der zweiten Ziffer ein Punkt. Die dritte Ziffer (die erste nach dem Punkt) gibt eine Spezifizierung der Diagnose an. Die vierte Ziffer (die zweite nach dem Punkt) gibt entweder einen zeitlichen Verlauf an oder beschreibt Begleitumstände oder Begleitphänomene.
Die Unterkapitel von Kapitel V der ICD-10:
F0: Organische Störungen, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen F1: Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen F2: Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen F3: Affektive Störungen
F4: Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
F5: Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen oder Faktoren
F6: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
F7: Intelligenzminderung
F8: Entwicklungsstörungen
F9: Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
Beispiel 1:
Das Unterkapitel F2 (Auszug):
Gezielte Diagnose durch die zweite Ziffer:
F20
Schizophrenie
Weitere Spezifizierung der Schizophrenie durch die dritte Ziffer:
F20.0
paranoide Schizophrenie
F20.1
hebephrene Schizophrenie
F20.2
katatone Schizophrenie
Verlaufsformen:
Spezifizierung der Schizophrenie durch Angaben des zeitlichen Verlaufs über die vierte Ziffer:
F20.x0 kontinuierlich
F20.x1 episodisch
F20.x2 episodisch, mit stabilem Residuum
Beispiel2:
Das Unterkapitel F3 (Affektive Störungen, Auszug):
Gezielte Diagnose durch die zweite Ziffer:
F 30
manische Episode
F 31
bipolare affektive Störungen
F 32
depressive Episode
F 33
rezidivierende depressive Störungen
F 34
anhaltende affektive Störungen
F32 depressive Episode
Spezifizierung der depressiven Episode durch Angabe von Schweregraden (dritte Ziffer):
F 32.0 leichte depressive Episode
F 32.1 mittelgradige depressive Episode
F 32.2 schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
F 32.3 schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
Hinweis:
Die in den einzelnen Kapiteln des Buches in Klammern angegebenen Ziffern (F-Code) hinter der Bezeichnung der Störungsbilder entsprechen dem ICD-10-Diagnoseschlüssel.
DSM-V
Das DSM-V ist das psychiatrische Klassifikationssystem in den USA und wird von der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (APA) herausgegeben. Das DSM-V ist ein multiaxiales Klassifikationssystem und in 5 Achsen gegliedert. Die psychiatrischen Störungsbilder sind hierbei in insgesamt 16 Kategorien auf die Achsen I und II verteilt.
Die 5 Achsen des DSM-V:
Achse I: psychopathologische Störungen Achse II: Persönlichkeitsstörungen
Achse III: körperliche Erkrankungen, die für die Störungen der Achse I und II von Bedeutung sind
Achse IV: psychosoziale und umgebungsbedingte Probleme, die psychische Störungen beeinflussen können
Achse V: Beurteilung des allgemeinen Funktionsniveaus des Patienten, wobei die Leistungsfähigkeit in den psychischen, sozialen und beruflichen Funktionen erfasst wird





























