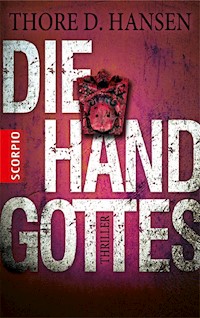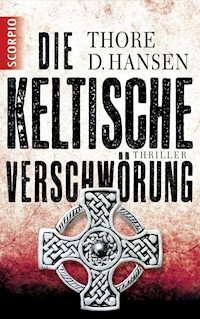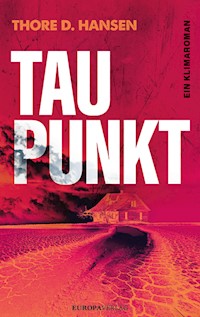Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
EIN THRILLER, DER UNS DEN ATEM NIMMT. DENN ER KANN MORGEN SCHON REALITÄT SEIN. Ein Mord in der Finanzwelt sorgt für Unruhe in den geheimen Zirkeln des Geldsystems. Die Scotland-Yard-Polizistin Rebecca Winter entdeckt, dass ein geheimer Algorithmus die Ursache für eine einsetzende Mordserie ist: Den Börsen, durch ihre technische und globale Vernetzung angreifbar und manipulierbar wie nie zuvor, droht ein gigantischer Crash. Winter stößt auf einen Plan, der die uns bekannte Zivilisation bis ins tiefste Mark treffen wird. Dass die großen Player wie die Deutsche Bank, Goldman Sachs & Co. die von ihnen entfesselten Kräfte der Finanzwelten schon lange nicht mehr kontrollieren können, ist mittlerweile jedem klar. Thore D. Hansens Thriller entwirft ein Schreckensszenario, das von Seite zu Seite beklemmender wird – weil das, was er erzählt, möglicherweise längst Wirklichkeit ist. Der ungeklärte Tod eines Investmentbankers führt die Scotland-Yard-Polizistin Rebecca Winter zu dem BND-Agenten und Kryptologen Erik Feg. Er entschlüsselt einen Code, der die automatischen Handelssysteme an den Börsen weltweit manipulieren könnte. Winter und Feg geraten mitten in den Kampf einer unbekannten Gruppe von Herren, die sich in Brüssel und an den Schaltstellen europäischer Politik eingenistet haben, um einen geheimen Plan umzusetzen. Was zunächst nach kriminellen Machenschaften einiger skrupelloser Banker aussieht, entpuppt sich schnell als Abgrund eines globalen Kampfes um die Vorherrschaft des Geldes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
EUROPAVERLAGBERLIN
Thore D. Hansen
Quantum Dawn
EUROPAVERLAGBERLIN
Dieser Roman ist ein fiktionales Werk, auch wenn er reale Gegebenheiten aufgreift. Die Personen und die Handlung sind frei erfunden, sodass etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig wären. Das gilt auch, wenn die Namen der fiktiven Personen und Institutionen ähnlich sein oder mit diesen übereinstimmen sollten.
1. eBook-Ausgabe
© 2015 Europa Verlag GmbH & Co. KG, Berlin · München · Wien
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Umschlagmotiv: © plainpicture/Millenium
Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
ePub-ISBN 978-3-944305-80-6
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
»Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild sein Prophet.«
Heinrich Heine
»Die wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird ihre Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen, dass das System ihren Interessen feindlich ist.«
Gebrüder Rothschild
»Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat, ihr Armageddon.«
Carl Friedrich von Weizsäcker
EINS
LONDON, 23. OKTOBER
»Das Geld fließt schon bald«, versicherte Jarod Denver seinem Spiegelbild mit einem zuversichtlichen Nicken. Er rückte das Sakko zurecht, legte eine rote Seidenkrawatte mit Schwung um den hochgeklappten Hemdkragen und band sie ohne Hast. Erst gegen Mitternacht wollte er einen Mitarbeiter von Goldman Sachs treffen, der Informationen über ungewöhnliche Transfers der Bank hatte. Das Klopfen an seiner Wohnungstür konnte nur eines bedeuten: Naravan hatte doch wieder etwas vergessen. Warum können manche Leute nirgendwo hingehen, ohne etwas liegen zu lassen? Wie kann einer Programmierer werden, komplexe Algorithmen schreiben, komplizierte Verschlüsselungen entwickeln, wenn er selbst den eigenen Haustürschlüssel nicht unter Kontrolle hat? Selbst wenn er ihm wichtige Dienste geleistet hatte, war es an der Zeit, diesen Freak endlich loszuwerden.
Denver riss die Tür auf. Im nächsten Augenblick wurde er niedergestoßen, die Dielen vibrierten unter der Wucht seines Aufpralls. Zwei maskierte Männer in schwarzer Montur, einer mit schallgedämpfter Pistole im Anschlag, hockten über ihm. Ein Knie presste sich auf seine Brust, Denvers Arme waren fest auf dem Boden fixiert, das Gewicht nahm ihm die Luft. Arme und Beine wurden blitzschnell gefesselt, am rechten Knöchel spürte er kurz einen brennenden Schmerz.
Polizisten waren das nicht. Um Hilfe zu schreien, war gefährlich, denn die Polizei war ihm längst auf den Fersen. Angesichts des Drucks auf seiner Brust hätte er ohnehin nur ein Keuchen hervorgebracht. Einer der Männer packte ihn an den Haaren, zerrte seinen Kopf, bis der Schmerz auf seiner Kopfhaut fast unerträglich wurde. Schließlich zog er Denver ganz hoch, schleifte ihn ins Wohnzimmer und knallte ihn auf den Schreibtischstuhl. Er konnte nur kurz die Augen seines Angreifers erblicken, die, wie seine Stimme, Eiseskälte ausstrahlten. Der andere Mann, etwas kleiner, aber umso stämmiger, brüllte ihn an.
»Sie übergeben uns sofort die Daten!«
Denver brach der Schweiß aus. Diese Scheißsituation hatte er sich selbst zuzuschreiben. Ein Moment der Unaufmerksamkeit. Jede Tarnung, alle Bemühungen des letzten Jahres, nicht gefunden zu werden, zerschlagen, weil er für den Bruchteil einer Sekunde nicht nachgedacht hatte. Als der eine Peiniger endlich von seinem Schädel abließ und zur Seite trat, setzte der andere die Waffe an seine Stirn. Unvermittelt wurde ihm von hinten ein schwarzer Sack über den Kopf gestülpt. Blanke Panik packte ihn.
»Ganz ruhig, und es geschieht Ihnen nichts!«, zischte der Größere und stieß Denvers Kopf nach vorne.
Denver fürchtete, jeden Augenblick ohnmächtig zu werden. Seine durch die ständige Flucht geschundenen Nerven gerieten nun an ihre Grenzen, sein Magen verkrampfte sich, sein rechtes Augenlid begann zu flattern. Die Gedanken rasten. Wie konnte man ihn hier finden? Er hatte nie von seiner Wohnung aus telefoniert, mit seinem Rechner war er kein einziges Mal von hier aus im Netz gewesen, hatte jede digitale Spur vermieden. Seit Wochen hatte er mit den Herren und seinem unberechenbaren Auftraggeber Dan Former nur noch über sichere Verbindungen Kontakt aufgenommen. Wenn überhaupt, konnte nur Former wissen, dass er und Naravan in London waren – irgendwo in London, mehr nicht. Ein Bewegungsmuster ließ sich sicher nicht erkennen, jedenfalls keins, aus dem Former, die Polizei oder sonst wer irgendwelche vernünftigen Rückschlüsse hätten ziehen können. Obwohl er sich stets auf alle erdenklichen Bedrohungen vorbereitet hatte, war Jarod Denver nun völlig hilflos.
Die Männer sprachen kein Wort. Unter seinem Sack lauschte er ihren Bewegungen. Einer schien sich direkt vor ihm am Schreibtisch zu bewegen, der andere verließ das Zimmer. Der Laptop wurde hochgefahren, Schubladen wurden geöffnet, etwas in der Küche fiel zu Boden, Papiergeräusche neben ihm, in der Küche das Klacken von Schranktüren, das Knarzen der Ofenklappe, der Schnappverschluss der Kaffeedose, dann Schritte ins Schlafzimmer. In ihre Gründlichkeit mischte sich Ungeduld.
»Beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit!«
Denver hatte alles gut versteckt. Er konnte nur hoffen, dass es gut gehen würde. Oder sollte er nachgeben und endgültig alles verlieren? Diese Männer wussten ganz genau, was sie wollten.
»Sie werden hier nichts finden!«, sagte er, seine Stimme klang überraschend fest in seinen Ohren.
»Lügen Sie nicht!«
Er wurde vom Stuhl hochgerissen. Der erste Schlag traf ihn in die Nieren, der nächste in den Magen. Sein Körper bäumte sich auf, er japste nach Luft.
»Das können Sie gleich jemandem erklären, der schon ungeduldig darauf wartet, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich würde mir das an Ihrer Stelle gut überlegen«, sagte einer der Männer.
Übelkeit breitete sich in Denvers Magen aus. Was hatte man mit ihm vor, und von wem redeten diese Männer? Für einen Moment war er sich nicht sicher, ob vielleicht Dan Former hinter diesem feigen Anschlag stecken würde. Doch das war nicht sein Stil. Wer zum Teufel waren diese Leute? Der andere Kerl mit der etwas heiseren Stimme machte sich weiter an Denvers Laptop zu schaffen. Das Stromkabel fiel hinunter.
»Da ist nichts drauf!«
Die Tatsache, nichts sehen zu können, ohne Vorbereitung vielleicht nächsten Schlägen ausgesetzt zu sein, war unerträglich. Nur die wahrnehmbaren Geräusche verrieten, dass jemand umherging und schließlich die Tasche in seinem Schlafzimmer mit einem Klicken öffnete. Als er zurückkam, hatte sich seine Stimme aufgehellt.
»Hier. Die Festplatte war in einer Tasche!«
Denver hörte, wie an seinem Rechner getippt wurde. Die Schmerzen von dem Nierenschlag quälten ihn noch immer. Der Sack über seinem Kopf verstärkte das Gefühl, völlig ausgeliefert zu sein. Wie einem räudigen Straßenköter trat ihn einer der Männer erneut in die Nieren.
»Rücken Sie das Passwort raus!«
Denver wusste nicht, was er tun sollte. Schweigen? Um sein Leben reden? Eine Geschichte. Er brauchte eine Geschichte! Doch er hatte keine, nichts, was ihm aus der Situation half. Besser schweigen. Wie lange würden die brauchen, um das Passwort aus ihm herauszuquetschen, zu prügeln, zu …? Das war ihr Terrain, ihr Beruf, nicht seiner, er war Investmentbanker, er konnte sich ihre Methoden dennoch nur zu gut ausmalen. Sein Schlachtfeld waren Kursschwankungen, Information und Desinformation, das Zuschlagen per Tastendruck, er wusste, wie man Anleger und Banken barbierte, aber er hatte keine Ahnung, wie man physische Schmerzen ignorierte.
Doch noch hatten sie die entscheidende Festplatte nicht gefunden. Er musste Zeit gewinnen, kooperieren, nur so hatte er später vielleicht noch eine Verhandlungsbasis.
»Quantumdawnxp2015codeblack.«
Der Mann am Laptop schlug das Passwort förmlich in die Tasten. Sekundenlang war es totenstill.
»Das ist niemals alles! Sie werden uns jetzt zu Ihrem Programmierer führen, ist das klar?!«
Denvers Augenlid begann jetzt so stark zu zucken, dass er es sich am liebsten herausgerissen hätte. Er war völlig ratlos, woher sie wissen konnten, dass Bill Naravan mit ihm zu tun hatte. Vielleicht hatten sie ihn sogar im Treppenhaus gesehen, und er war ihnen entwischt. Bevor er etwas sagen konnte, riss ihm einer der Männer den Sack vom Kopf und streifte ihm ein Klebeband über den Mund. Er konnte ohnehin kaum atmen. Seine Angst steigerte sich ins Unermessliche. Er wurde durch den Flur ins Treppenhaus gezerrt.
Unten angekommen hörte er, wie sich draußen auf der Straße eine Wagentür öffnete. Es folgte ein weiterer Schlag, der all seine Sinne betäubte.
ZWEI
LONDON, SALTWELL STREET, 24. OKTOBER
Rebecca Winter spürte bleierne Müdigkeit, als sie morgens gegen halb sechs in ihrem Ohrensessel erwachte. Wie ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert beherrschte er mit seinem roten Samt, fixiert von Messingnägeln, ihr kleines Wohnzimmer. Er war bequem, aber ihr Schlaf war zu kurz gewesen. Sie hatte bis spät in die Nacht einen Bericht über eine Manipulation im Hochfrequenzhandel studiert, bevor sie mit dem Medicus in den Händen, umhüllt von einer Wolldecke, in ihrem kleinen Apartment in der Saltwell Street, ganz in der Nähe des Londoner Wirtschaftszentrums Canary Wharf, eingenickt war.
Sie schob das Buch von ihrem Schoß neben sich auf den Sessel, streckte sich, gähnte ausgiebig, ging zum Fenster und blickte in den kleinen verwilderten Garten, der zu ihrer Wohnung gehörte. Wieder einmal dachte sie daran, sich mehr um ihn zu kümmern, Gemüse und Kräuter anzupflanzen, doch die Zeit fehlte, wie für vieles in den vergangenen Jahren. Sie zupfte einen Wollfussel von ihrem Jogginganzug und trottete in die Küche. Dort holte sie ein paar Muffins aus dem Schrank, legte sie auf einen Teller, machte sich einen Tee und überlegte, wie sie den Tag mit so wenig Schlaf in den Knochen durchstehen sollte. Vielleicht wäre jetzt der richtige Augenblick, ihr Überstundenkonto etwas abzubauen und später ins Büro zu fahren. Im Kühlschrank war keine Milch. Es war sicher zu früh, ihre Nachbarin zu fragen, obwohl die gern zu ungewöhnlichen Zeiten herumgeisterte. Sie würde den Tee heute mal ohne Milch trinken.
Auf dem Rückweg ins Wohnzimmer vermied sie es, in den Wandspiegel im Flur zu blicken. Sie wusste, wie sie zu so früher Stunde aussah.
Kaum hatte sie sich wieder in ihren Ohrensessel fallen lassen, einen Biss in den Muffin genossen und mit geschlossenen Augen den ersten Schluck Tee geschlürft, klingelte das Telefon. Sie blickte auf ihren Wecker im Bücherregal. Noch nicht mal sechs!
Es war Robert Allington, der Leiter der Abteilung für schwere Wirtschaftsdelikte bei Scotland Yard – ihr Chef. Um diese Uhrzeit! Seit Wochen traktierte er sie, sie solle doch ihren Eifer etwas zurückschrauben und kürzertreten, und nun rief er zur Unzeit an. Vermutlich würde er sich jetzt sogar wundern, dass sie nicht gleich abhob. Sie zögerte, trotzte für einen Moment. Dann siegte ihr Pflichtgefühl.
»Guten Morgen, Rebecca, entschuldige die frühe Störung. Ich habe keine gute Nachricht: Denver hängt im Park!«
»Waas?!« Winters Stimme überschlug sich. »Wo?«
»Mudchute Par …«
Noch bevor Allington zu Ende sprechen konnte, hatte sie aufgelegt. Die Nachricht war ein Schock. Alles hatte sie in den letzten Monaten darangesetzt, den Wertpapierbetrüger Jarod Denver zu fassen. Und nun war er tot! Ihre Müdigkeit war wie weggebeamt. Sie stürzte zum Schrank, um ihre alte Jogginghose gegen eine schwarze weite Stoffhose zu tauschen und zog einen ihrer zahlreichen bunten Pullover über. Rebecca Winter mochte es immer bequem. Sie schnappte sich ihr Handy. Beim Hinausgehen riss sie ihren weiten Wollmantel so energisch vom Haken, dass das Innenfutter riss. »Verdammte Scheiße!« Mit der Wucht ihrer Verärgerung knallte sie die Tür ins Schloss.
Seit drei Jahren arbeitete Winter als Inspector in enger Kooperation mit dem Serious Fraud Office für eine Sonderabteilung von Scotland Yard. Der Ausbruch der Finanzkrise war Jahre her. Einige Banken waren inzwischen zu immensen Strafen verurteilt worden. Aber dass es gelang, einzelne Banker, wie den ehemaligen Goldman-Sachs-Manager Fabrice Tourre, auch »Fabulous Fab« genannt, hinter Gitter zu bringen, war die Ausnahme.
Seine Verurteilung war einer ihrer größten Erfolge. Sie hatte der US-Börsenaufsicht und dem FBI die entscheidenden Hinweise geliefert, um das Verfahren gegen den 34-Jährigen auf den Weg zu bringen. Aber er war nur ein mittelgroßer Fang gewesen, nicht einer der Killerwale, und nun sollte ihr ausgerechnet nur ein toter Fisch ins Netz gehen, der vielleicht einige Wale hätte beißen können?
Während sie in den Manteltaschen nach ihrem Autoschlüssel fingerte, rannte sie zu ihrem Wagen. Ihre Gedanken überschlugen sich. Schon mehrfach hatte sie mitansehen müssen, wie nach monatelangen Recherchen Anwälte den Richtern hieb- und stichfeste Beweise madig redeten. Doch die Fakten rund um diesen Jarod Denver hatte sie äußerst akribisch recherchiert. Der nicht mal 30-jährige Investmentbanker, aufgewachsen in Tottenham, stand im Verdacht, in mehreren Fällen mit Insiderwissen und anderen Tricks gearbeitet zu haben. Ein gerissener Emporkömmlimg, der nach seinem Studium schnell zu den Händlern in Canary Wharf aufschloss. Jetzt hatte sie nur noch den Lohn kassieren, Denver im Verhör mit den Ergebnissen ihrer Ermittlungen so unter Druck setzen wollen, dass er keinen Zweifel daran haben würde, eine Milderung beim Strafmaß zu bekommen, wenn er sofort und umfassend über weitere Verstrickungen an der Londener Börse und seine Hintermänner auspacken würde.
»Acht Monate Arbeit für eine verdammte Leiche. Ich werde irre.« Sie schwang sich in ihren schwarzen Mini, riss das Blaulicht aus der Innenlade, knallte es aufs Dach, wendete vorsichtig und gab dann Vollgas.
Chief Inspector Allington sprach gerade mit den Ermittlern vor Ort, als er Rebecca Winter über das Gras heranhetzen sah. Ein Geist in einem wehenden Mantel, einen Kopf größer als er, was ihn immer wieder irritierte. Die Frau war gerade mal 28 Jahre alt und verfügte mit ihren hohen Wangenknochen und der feinen länglichen Nase in ihrem von dunklen Locken umrahmten Gesicht über ein eigentlich ganz interessantes Aussehen. Sie legte, zumindest im Vergleich zu ihren Kolleginnen, keinen Wert auf modische Kleidung. Und nicht selten wunderte sich Allington über die Art und Weise, wie sie auftrat. Lediglich bei Gerichtsterminen erschien sie, offenbar widerwillig, in einem Kostüm.
Dennoch zog sie den einen oder anderen Blick manch eines männlichen Kollegen auf sich. Dabei verblüffte ihn die kühle Art, wie sie Flirtversuche im Keim erstickte, ohne auch nur den Ansatz einer Gemütsbewegung preiszugeben. Als ob sie auf der zwischenmenschlichen Ebene quasi null wahrnehmen würde. Ganz anders verhielt es sich, wenn es um ihre Fälle ging. War sie gut gelaunt, schienen ihre Augen von innen heraus zu leuchten, doch bei den meisten Gelegenheiten, wie an diesem Morgen, sah Allington sie mit ernster Miene herbeieilen. Selten hatte er jemanden in seiner Abteilung gehabt, der so engagiert war. Bis dato hatte er es jedoch nicht vermocht, tiefere Motive für diesen Einsatz herauszufinden.
»So sehr hättest du dich nicht beeilen müssen, schließlich ist er schon tot. Eine alte Dame hat ihn bei ihrem Morgenspaziergang mit dem Hund gegen fünf Uhr 15 gefunden«, sagte Allington und hustete kräftig in die Hand. Seine Nase war gerötet, die Gesichtshaut blass und die Augen leicht geschwollen.
»Ja klar! Ich hätte also noch in Ruhe frühstücken sollen, so siehst du aus!«, giftete Winter mit einem Blick auf Denver, der noch an einem Ast hing. Mit leerem Magen vor einer Leiche zu stehen, gehörte nicht zu ihrem Alltag und gefiel ihr gar nicht. Auch wenn diese bestens gekleidet war, selbst die rote Seidenkrawatte saß unter dem Strick noch relativ ordentlich.
»Ziehen Sie nicht so ein Gesicht, junge Frau«, mischte sich der Forensiker ein, der Jarod Denvers Leiche seelenruhig inspizierte. »Ist doch die beste Zeit für einen erfrischenden Morgenspaziergang zwischen Herbstlaub und aufgehender Sonne!«
Rebecca blinzelte durch die bunte Baumkrone in den dunklen Himmel. Es war selbst für das gewöhnlich raue Inselklima ungewöhnlich kalt. Auf den erfrischenden Morgenspaziergang hätte sie gut verzichten können. »Wie lange hängt der da?« Winter wandte das Gesicht von dem Toten, als sie sprach.
»Alles in Ordnung, Rebecca?« Allington sah ihr an, wie betroffen sie war. Selbst für ihn waren Leichen in den letzten Jahrzehnten eher die Ausnahme.
Winter war für den Moment nur froh, die Muffins nicht im Magen zu haben, vergrub ihre Hände in den weiten Manteltaschen und blickte auf die vom gestauten Blut blau gefärbten Ohren der Leiche. An Denvers offenem Mund klebte getrockneter, blutversetzter Speichel. So etwas hatte sie als Spezialistin für Wirtschaftsdelikte noch nie gesehen. Sie war überhaupt noch keinem Toten so nahe gekommen. Der Anblick ekelte sie, und rasch wanderte ihr Blick wieder ab zu Allington. »Besser könnte es mir gar nicht gehen. Fehlt nur noch der Picknickkorb.«
»Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit.« Der Forensiker klatschte in die Hände, als wolle er sein Auditorium zur Ordnung rufen. »Der Zustand der Leiche lässt auf zwölf bis maximal 24 Stunden schließen. Zudem ist der Mudchute Park zu dieser Jahreszeit noch recht gut besucht. Also ist es unwahrscheinlich, dass der Mann hier länger als zwölf Stunden hängt.«
Rebecca Winter trat zurück, während zwei Beamte von Scotland Yard Denvers Leiche herabließen und zu Boden legten. »Haben Sie etwas gefunden, einen Abschiedsbrief, irgendwas?«
»Nur eine Geldbörse mit ungewöhnlich viel Bargeld und ein Prepaid-Handy«, berichtete der Forensiker.
Das war zu erwarten, dachte Winter. Die letzten Spuren, die Scotland Yard von Denver hatte ermitteln können, waren seine Kreditkarten, die er nach seiner Flucht vor zehn Monaten nur noch zweimal in Wien und Brüssel benutzt hatte.
»Moment.« Der Rechtsmediziner hatte das rechte Hosenbein hochgezogen und am unteren Fußgelenk eine Schürfwunde entdeckt.
»Was?«
»Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber …« Mit einer Pinzette zupfte er etwas von der Haut und betrachte sie unter einer Lupe. »Schon gut. Ich schicke Ihnen die Ergebnisse am Nachmittag.«
»Okay, geben Sie mir das Handy. Vielleicht finden wir so …«, setzte Winter an.
»Ist gut, Rebecca, wir machen den Rest. Ich weiß, was dir der Fall bedeutet, aber jetzt wartest du bitte erst mal die Auswertung ab«, sagte Allington in einem für ihn ungewöhnlich scharfen Ton, der ihm sofort leidtat, als er seine Mitarbeiterin ansah. »Ist dir eigentlich bewusst, was an diesen Ermittlungen alles dranhängt?«
Winter presste die Lippen zusammen und schlug den Kragen ihres Mantels hoch. Mit einem gequälten Lächeln drehte sie sich um und ging zu ihrem Wagen.
Allington hatte recht. Sie hätte sich die Eile sparen können. Sie war natürlich sofort von Mord ausgegangen. Motive gab es genug. Jarod Denver war einer von der ganz miesen Sorte. Mit einem geschickt ausgearbeiteten Prospekt für die Investition in einige Tausend Hektar rumänischen Wald und Wärmekraftwerke hatte er eine rentable und ethisch korrekte Anlage versprochen. Keine Rede davon, dass die Verhandlungen mit den Rumänen auf sehr wackeligen Beinen standen und bereits Unmengen von Schmiergeldern verschlungen hatten. Er hatte einige grünschnabelige Investmentbanker in seinem Büro versammelt und diese wochenlang vor allem Senioren abtelefonieren lassen. Sie häuften in wenigen Monaten rund 25 Millionen Pfund auf. Als das ganze Gebäude einzustürzen drohte, zockte Denver mit Derivaten und Währungen, vergaloppierte sich, zweigte noch mal ein paar Millionen für sich ab und verschwand schließlich von der Bildfläche.
Wäre es wirklich ein Selbstmord, würde er sich vielleicht in diese unheimliche Serie einreihen, grübelte Winter. Sie nahm ihr Smartphone und öffnete eine Datei. Sie und Allington hatten mehrfach in den letzten Monaten über die Hintergründe dieser Selbsttötungen spekuliert. Ihr Chef hatte es vor Kurzem trotz seiner sonst sehr zurückhaltenden Art auf den Punkt gebracht: Wenn es keine Freitode waren, dann waren sie Aktivitäten einer höchst professionellen Mafia oder sogar die Arbeit von Geheimdiensten, von der sich eine junge Scotland-Yard-Beamtin in ihrem eigenen Interesse besser fernhalten sollte. Geschehen Dinge, die die Staatsräson berühren, gibt es keinen Rechtsstaat mehr, hatte er gepredigt. Diese Haltung hatte Winter schockiert. Aber auf jede Nachfrage, ob Allington denn schon einmal so etwas erlebt habe, war nur ein Kopfschütteln gefolgt.
Hatte er vielleicht recht? Konnte es sein, dass sie angesichts der Masse dieser Fälle gegen Windmühlen kämpfte? An den falschen Stellen recherchierte?
Fast 20 Topleute der Finanzbranche hatten sich im Frühjahr 2014 anscheinend umgebracht oder waren unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen – Denver war vielleicht nur der neuste Fall dieser Serie. Winter blickte auf ihr Handy und sah die Namensliste. Hatte der Investmentbanker mit einem dieser Toten in Kontakt gestanden? Gab es Überschneidungen? Die Serie dieser Todesfälle war wirklich merkwürdig. Der Kommunikationsdirektor der Rückversicherungsgesellschaft Swiss Re, Tim D., starb Mitte Januar 2014 unter nicht geklärten Umständen. Am 26. Januar 2014 wurde der frühere hochrangige Manager der Deutschen Bank William B. im Alter von 58 Jahren in seinem Privathaus im Londoner Ortsteil South Kensington erhängt aufgefunden. Auch Gabriel M., der hochrangige JPMorgan-Mitarbeiter, stürzte sich im Alter von 39 Jahren am 27. Januar 2014 vom Dach der Europa-Zentrale von JPMorgan in London. Kurz darauf wurde Mike D., der Chef-Ökonom einer amerikanischen Investmentbank, im Alter von 50 Jahren tot in der Nähe einer Brücke im Bundesstaat Washington aufgefunden.
Nach einer kurzen Unterbrechung wurde JPMorgan von einem weiteren mysteriösen Todesfall überrascht, als Li J. im Alter von 33 Jahren am 18. Februar 2014 vom Dach der JP-Morgan-Zentrale in Hongkong sprang.
Danach schien für eine Zeit eine gespenstische Ruhe eingekehrt zu sein. Dennoch hatte der Tod von zahlreichen Bankern vielen zu denken gegeben. Dass aber Banken und Finanzinstitute wirklich vor einem so riesigen Abgrund standen, an dem viele Mitarbeiter nur noch den Freitod für sich sahen, hatte weder Rebecca Winter noch anderen in der Abteilung einleuchten wollen. Weitaus plausibler erschienen ihr Spekulationen, dass unter diesen Leuten Wissen kursierte, dessen Brisanz Winter nur erahnen konnte, ohne sich irgendwelchen Verschwörungstheorien hinzugeben. Für Derartiges war sie gänzlich unempfänglich. Man könnte die jüngste Verkettung der Banker-Selbstmorde als einen Zufall abtun – aber was, wenn mehr dahintersteckte? Schließlich hatte der Vizepräsident von JPMorgan, Gabriel M., kurz vor seinem angeblichen Selbstmord seiner Freundin gemailt, er verlasse gerade das Büro und sie würden sich bald sehen.
Die Polizei hatte behauptet, beim Ableben von M. handelte es sich um einen unverdächtigen Todesfall. Was aber, wenn die vielen Todesfälle unter Bankern das Ergebnis einer Säuberungsaktion wäre? Gegen Insider, die zu viel wussten und eine Bedrohung für die allumfassende Agenda der Banken waren? War der Tod Jarod Denvers der Auftakt zu einer weiteren Serie von Freitoden? Und was heißt schon Freitod? Wenn ich jemanden so weit in die Enge treibe, dass er vom Hochhaus springt, ist das noch ein freier Tod?, fragte sich Winter. Aber es gab eben zu wenig Beweise.
Wut kochte in ihr hoch. Sie hatte das Gefühl, dass Allington das Ganze vielleicht nicht leichtnahm, aber doch zu abgeklärt betrachtete.
Kurz vor ihrem Wagen machte sie so entschlossen kehrt, dass sie auf dem feuchten Laub ausrutschte. Sie konnte sich gerade noch abfangen, unterdrückte jede Schreckäußerung, vergewisserte sich, dass niemand ihr Straucheln gesehen hatte, und setzte sich mit dem Schwung der Verärgerung über ihr Missgeschick in Bewegung, um schnurstracks auf Allington zuzusteuern und ihn am Ärmel zu packen.
»Ja, mir ist bewusst, was an diesen Ermittlungen alles dranhängt, Rebecca«, erklärte Allington. »Und Denver war in eine ganz andere Dimension verwickelt. Nämlich Kursmanipulation und Wertpapierbetrug im großen Stil – und vielleicht noch mehr. Und ich habe keine Zeit zu verlieren.« Allington hob beide Hände zu einer beruhigenden Geste. »Mach, was du willst, Rebecca, aber hier kannst du nichts mehr ausrichten.«
Dann drehte er sich zu dem Forensiker um, der gerade dabei war, seine Utensilien einzupacken. Allington wusste selbst, dass Denver einiges auf dem Kerbholz hatte. Er stand unter anderem im Verdacht, dem Investor Dan Former geholfen zu haben, zahlreiche kleine Unternehmen an die Börse zu bringen, um die Aktien im Anschluss weit über Wert an vier Hedgefonds zu verkaufen. Der Wert der Hedgefonds, natürlich auch im Besitz von Former, wurde künstlich um Milliarden gesteigert. Auch dieses Kartenhaus war zusammengefallen und hatte Tausende Anleger um ihr Geld gebracht. Einige Manager des Fonds waren bereits abgetaucht, um, so der Verdacht, über Mittelsmänner an asiatischen Börsen zu wetten, und der SEC, die US-Börsenaufsichtsbehörde, ermittelte zudem wegen der Anwendung illegaler Handelssysteme. Doch Former hatte sich bislang mit Anwälten erfolgreich zur Wehr setzen können, ja, ihm war es sogar gelungen, sich als Opfer zu stilisieren. Denver war der letzte relevante Kronzeuge gewesen. Hatte Former ihn am Ende auf dem Gewissen? Motive hätte er, aber immer noch zu viel Geld, um sich Rachegefühlen hinzugeben. Außerdem müssten sie ihm einen Auftragsmord nachweisen, da solche Männer sich wohl kaum selbst die Hände schmutzig machten. Auf jeden Fall war mit Denvers Tod Rebecca Winters wichtigster Zeuge dahin.
Der Forensiker blickte Winter hinterher, die kopfschüttelnd wieder ihrem Wagen zustrebte. »Wo haben Sie denn den bunten Vogel her?«, warf er Allington zu.
Der Chief Inspector klopfte ihm auf die Schulter. »Sie werden’s kaum glauben, aber der bunte Vogel ist im Moment meine beste Ermittlerin. Sie ist eben nicht bei der Mordkommission, wo man so was hier jeden Tag sieht. Wie war denn Ihre erste Leiche?«
Der Rechtsmediziner versetzte seinem Koffer einen beherzten Tritt, sodass der Verschluss einrastete. »Tja, das war ein zertrümmerter Schädel, Vorschlaghammer, weitere Details erspare ich Ihnen. Ich habe eine Stunde gekotzt. Danach habe ich begonnen, meinen Beruf zu lieben«, sagte er und verabschiedete sich mit einer eleganten Verbeugung.
Rebecca Winter hatte sich in ihren Wagen gesetzt und trommelte wütend mit den Fingern auf dem Lenkrad. Ihrer Ansicht nach verstand Allington einfach nicht, dass sich in den letzten Monaten etwas verändert hatte. Bis vor Kurzem hatten sich die meisten Betrüger im Recht gewähnt. Nur die wenigsten hatten sich eingestanden, dem asozialen Rausch des Zockens verfallen zu sein.
Diese gestörte Selbstwahrnehmung hatte Verhaftungen bis dato leicht gemacht, da die Täter kein Unrechtsempfinden gehabt hatten. Sicher, der Ermittlungsdruck war inzwischen so hoch, dass ihr ein Selbstmord bei Denver für einen kurzen Moment plausibel erschien – wäre da nicht diese dubiose E-Mail an einen Mitarbeiter der Weltbank und den gesuchten Hedgefondsmanager Dan Former, die ihr während der Ermittlung von Unbekannten zugespielt worden war. Neben nebulösen Drohungen gegenüber Former, die nur schwer zu deuten waren, stand in dieser Mail, Denver würde den großen Plan der »White Knights« durchkreuzen, wenn sie ihn fallen ließen. Was für Pläne waren das?
Als weiße Ritter bezeichnete man nicht die unersättlichen Bank- und Industriemanager, wusste Rebecca Winter, sondern Leute wie den amerikanischen Investor George Soros, gegen den inzwischen selbst ermittelt wurde. Auch den bereits verstorbenen James Goldsmith oder die Wirtschaftstycoone Bill Gates und Warren Buffett, die vorgaben, mit einem Teil ihres Vermögens die Welt verbessern zu wollen. Aber der Begriff »White Knights« bezeichnete an den Finanzmärkten auch Großinvestoren oder Unternehmen, die von einem anderen Unternehmen größere Anteile kauften, um es dadurch vor einer feindlichen und ungewollten Übernahme zu schützen.
Winter hatte Denver überall, aber nicht mehr in Europa vermutet. Wie konnte er so dumm sein? Irgendetwas passte hier überhaupt nicht zusammen. Für einen Moment ließ sie ihren Kopf auf das Lenkrad sinken. Bevor das forensische Gutachten am Nachmittag Klarheit bringen würde, hätte es keinen Sinn mehr, mit Allington zu diskutieren. Aber wenn er glaubte, mit Denvers Tod wäre alles erledigt, hatte er sich getäuscht. Die Übelkeit beim Anblick der Leiche und der eingebluteten Ohren war dem Knurren ihres Magens gewichen. Sie startete den Motor und steuerte den nächsten Imbiss an.
DREI
AN EINEM GEHEIMEN ORT IN DER BRETAGNE, 24. OKTOBER
Die üblichen Karossen parkten vor dem massiven Holztor der mittelalterlichen Burg: Bentleys, Daimlers, Rolls-Royces und, die gediegene Harmonie brechend, ein roter Maserati. Die Chauffeure unterhielten sich, lässig an die Wagen gelehnt, oder polierten ihre chromblitzenden Limousinen. Sie wussten, dass es dauern konnte bei den Herren und sie ihre Wartezeit irgendwie totschlagen mussten. Hier draußen gab es außer ihnen nichts und niemand. Der nächste Ort war gefühlte Lichtjahre weit entfernt. Und die massiven Natursteinmauern ließen nichts nach außen dringen. Drinnen allerdings, in einem der riesigen Festsäle, hallte eine knarrende Stimme durch den Raum.
Wäre der Hedgefondsmanager Dan Former ein Mann, der zu etwas mehr Selbstbeobachtung neigen würde – was leider nicht der Fall war –, wäre ihm klar geworden, dass die Herren vor ihm langsam aber sicher die Konzentration verloren. Aber an diesem Tag mussten Entscheidungen getroffen werden, dieses letzte Treffen musste die Herren überzeugen, ihn und Lascaut bedingungslos zu unterstützen. Am Ende dieses Tages würden alle auseinandergehen und sich nie wieder in dieser Runde sehen.
Mit einem erleichterten Blick registrierte sein alter Weggefährte, der Unternehmer und Lobbyist Patrice Lascaut, dass Dan Former schließlich seine Papiere zusammenrollte, die in Mahagoni gefasste Lesebrille abnahm, sich durchs grauweiße Haar strich und wohl langsam zum Ende kommen wollte. Eine Stunde hatte er sich in Rage geredet. Trotz der Länge war sein Auftritt ein fesselnder Drahtseilakt gewesen. Former wirkte professoral und im nächsten Augenblick revolutionär. Er hatte den Anwesenden prophezeit, dass an den internationalen Märkten alles kurz vor einer neuen Eskalation stünde. Mit leuchtenden Augen forderte er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer. Wie blinde Hunde hätten sie in den vergangenen 20 Jahren nicht bemerkt, dass sich längst ganz andere über den großen Fressnapf hergemacht hatten.
Hätte Lascaut nicht die Motive Dan Formers gekannt, wäre er vielleicht von seinem Vortrag ebenso gebannt gewesen wie die übrigen Herren, die seine ultimativen Prophezeiungen mit Spannung und Schrecken zugleich aufnahmen.
Dan Former war der Sprössling einer alten Londoner Bankiersfamilie, ein gewaltiges Bündel von Meinungen und Überzeugungen, von denen er einige lange verschwiegen mit sich trug. Wie Lascaut hatte er über Jahrzehnte als Unternehmer und Investmentbanker ein selbst für heutige Verhältnisse immenses Vermögen anhäufen können. Doch in letzter Zeit machte sich Lascaut Sorgen um seinen Freund. Er strebte plötzlich nach politischem Einfluss. Er postulierte, dass ihn seine Geldmacht und sein Wissen dazu legitimierten und nunmehr sogar verpflichteten. Dass er sich mit diesem Anspruch automatisch in Widersprüche begab, störte ihn nur wenig. Seit einem Jahr zerrten Ermittlungen der amerikanischen Börsenaufsicht SEC gegen seinen Fonds Former Global Investments an seinen Nerven und seinem Image als knallharter, aber sauberer Geschäftsmann. Former witterte Verrat von Konkurrenten. Fonds, die nicht zu sättigen waren und alle Mittel einsetzten, um sich ein noch größeres Portfolio einzuverleiben. Die Verluste der letzten Jahre waren, wie er Lascaut in einer langen Nacht in Monaco anvertraut hatte, wie ein Wendepunkt, der ihn persönlich zutiefst verletzt hatte.
In Wirklichkeit empfand Lascaut seinen alten Weggefährten als ein Puzzle aus Widersprüchen. Ein Nimmersatt, wie es nur große Spieler sein können. Während er sich in der Öffentlichkeit gerne als Mäzen aufspielte, zerschlug er im nächsten Augenblick profitabel ganze Unternehmen. Er lockte Menschen geschickt mit seinem Macherimage an, lullte sie mit Lobesreden ein. Doch brachten sie ihm nicht den gewünschten Erfolg, ließ er sie eiskalt wieder fallen. Lascaut hatte sich im Laufe der Jahre gut darauf eingestellt, ja, er schätzte sogar Formers Kaltschnäuzigkeit, spielte er doch in der gleichen Liga. Gerne erzählte Former Lascaut die Geschichte, wie er bereits als 15-Jähriger mit einem 6000-Pfund-Gewinn auf einer Pferderennbahn seinen Sinn für das Risiko unter Beweis gestellt hatte. In den Casinos von Cannes und Nizza hatte er dann seine Raubtiermentalität verfeinert. Und doch unterschied er sich, wie er immer wieder gerne betonte, von diesen Raufbolden an den elektronischen Börsen, die nur Geld vernichteten und keine Werte mehr schufen.
Obwohl Dan Former es nach seinem unfreiwilligen Rückzug aus seinem Hedgefonds und der Öffentlichkeit vorzog, in luftiger Freizeitkleidung durch den Tag zu gehen, hatte er seinen immer gebräunten, schlanken Körper heute in einen grauen Anzug mit Weste und goldener Seidenkrawatte eingepackt. Als er das Rednerpult aus Eiche, verziert mit einem Messingsextanten, verließ, klackten die beschlagenen Absätze seiner handgefertigten Schuhe von Rudolf Scheer & Söhne laut auf dem Marmorboden, widerhallend von den Wänden des großen Festsaales. Erste Signale der amerikanischen Börsenaufsicht entlasteten ihn. Dennoch vermied er es, bis zu einer endgültigen Entscheidung öffentliche Termine anzunehmen, um erneuten Vernehmungen zu entgehen oder gar einer Verhaftung. Noch waren die Verhandlungen mit der SEC, die Ermittlungen gegen ihn und seinen Hedgefonds einzustellen, nicht abgeschlossen.
Doch der Anlass dieses Treffens in der Bretagne war alles andere als öffentlich. Lascaut hatte Former am Vorabend mittels eines Diplomatenpasses aus seinem Exil in Monaco geholt. Vor ihm saßen die rund 50 Herren, ebenfalls in bester Garderobe, der eine oder andere Zigarre rauchend oder einen Single Malt in der Hand. Nur drei oder vier Anwesende waren unter 60 Jahre alt, ein grauer Kopf reihte sich an den anderen. Es waren Unternehmer, ältere Investmentbanker, ehemalige Bankvorstände, Makler und Politiker, von denen nicht wenige mit besorgten Mienen dreinschauten. Andere hatten es sich in Ledersesseln bequem gemacht und waren den Worten Formers gelassen gefolgt. Sie gehörten zu einem Zirkel, der sich zwar nicht als Opfer der Finanzkrise sah, aber sie wussten, dass in Brüssel, Washington und London Interessengruppen ein Spiel trieben, das die gesamte Weltwirtschaft gefährdete. Ein Spiel, das weitaus dramatischer war als alles, was es zuvor gegeben hatte. Bevor Former das Podium verließ, wandte er sich noch ein letztes Mal direkt an sein Publikum.
»Meine Herren, wir müssen jetzt handeln, sonst sind wir alle bald weg vom Fenster. Die Manager dieser Unternehmen wollen nicht nur an unser Geld. Sie wollen uns entmachten! Sie wollen einen autoritären Kapitalismus und keinen demokratischen.«
Der bald 68-jährige Former fixierte seine Zuhörer mit seinen hellblauen Augen und wartete ab. Mit verschränkten Armen ließ er seinen Blick durch die mittelalterliche Halle wandern. Durch die Fenster unter den Rundbögen drangen ein paar Sonnenstrahlen und tanzten mit den Rauchschwaden. Es begann ein leises Gemurmel.
Einer der Herren stand auf. »Danke für deinen apokalyptischen Vortrag, Dan«, sagte er. Leises Gelächter durchzog den Raum. »Aber was mehr als all die gelieferten Informationen brauchst du noch von uns?«
Former wartete mit seiner Antwort. Er war sich nicht sicher, wie viele der Herren ihm folgen würden. Sicher war hingegen, dass die meisten sich in Schweigen hüllten, auf keinen Fall noch mehr preisgeben wollten, von dem, was sie wussten. Seitdem sich unlängst diverse Freunde und Kollegen umgebracht hatten, waren die Herren gefangen zwischen Aufruhr und Zweifel, und ebensolche Regungen erblickte Former in den Gesichtern vor ihm.
Er wusste, dass es eine unausgesprochene Regel gab: Wer über die internen Vorgänge im Geldsystem zu viel Kenntnis hatte, wer in der Pyramide weiter oben war, wurde von einer unsichtbaren Macht beobachtet. Niemand wusste, was die wahren Motive für die Freitode der Banker waren, und viele befürchteten sogar, dass hier nachgeholfen wurde. Aber von wem? Deswegen musste er den Herren Sicherheit verschaffen, absolute Diskretion liefern, keiner hier wollte zum Club der toten Banker gehören.
»Ich brauche jetzt vor allem Ihr Vertrauen«, sagte Former. »Dass sich die Banken und Händler mit ihren Algorithmen einen nicht zu rechtfertigenden Vorteil verschaffen, ist inakzeptabel, aber es geht ja noch viel weiter. Der gesamte Aktienmarkt, das ganze Geldsystem ist nach Lehman komplett manipuliert worden, alle Regeln werden mittlerweile gebrochen. Mit Ihrem Wissen kommen wir aber weiter«, resümierte er.
Einer der Herren widersprach Former, während das Getuschel aller Anwesenden lauter wurde. Einige stützen ihre Köpfe ab oder machten sich Notizen. Jeder schien die markigen Worte Formers und seine Warnungen anders aufgenommen zu haben.
»Dan! Die SEC hat doch längst Ermittlungen eingeleitet, um diesen Parasiten das Handwerk zu legen. Die NASDAQ steht im Fadenkreuz. Wir müssen uns nur noch etwas gedulden.«
Former baute sich noch einmal auf, schüttelte den Kopf und bedeutete seinem alten Weggefährten, zu übernehmen.
»Patrice, das ist dein Moment«, sagte er überdeutlich.
VIER
LONDON, 24. OKTOBER
Nach dem Schock über Denvers Tod brauchte Rebecca Winter ein paar Stunden zum Durchatmen. Deshalb fuhr sie erst am Nachmittag über die Dacre Street in das alte Monster, wie sie ihre Dienststelle immer nannte. New Scotland Yard liegt unweit der Westminster Abbey, mit Betonschwellen und Eisenbarrieren geschützt. Der riesige Block aus Glas und Stahl war seit 1967 Heimat der berühmten Polizeibehörde.
Im Lift zupfte sie ihr lockiges mittellanges Haar auseinander, ohne einen Blick in den Spiegel zu werfen. Wie jeden Tag herrschte auf ihrer Etage reger Betrieb. Beamte huschten durch die Flure. Manche trugen Papierstapel mit sich, andere tippten im Gehen auf ihren Tablets herum oder erkundigten sich nach neuen Ergebnissen ihrer Recherchen. Heute erschien ihr das übliche Treiben zu hektisch, zu laut. Im Bereitschaftsraum hatten sich einige Kollegen mit Kaffeetassen in der Hand zusammengefunden und beäugten Winter, die grußlos die Tür passierte.
Den Zusammenstoß mit einem Kollegen und dessen Entschuldigung registrierte sie kaum. Viel zu sehr kreisten ihre Gedanken um das anscheinend unvermeidliche Ende ihrer Ermittlungen im Fall Denver.
Robert Allington hatte gerade ein Stück Kuchen in sich hineingestopft, als er Winter an seinem Büro vorbeihuschen sah. Er war verärgert, weil ihm, kaum dass er sein Büro betreten hatte, Rupert Meldon, ein 30-jähriger Ermittler, Waffe, Dienstmarke und seine Kündigung auf den Tisch geknallt hatte und damit eine nur schwer zu füllende Lücke hinterließ.
Nach fünf 18-Stunden-Tagen hatte Meldon am Vortag eine Manipulation im Hochfrequenzhandel nachweisen können, was angesichts der zu prüfenden Menge an Orderaufträgen eine Sensation war. Er hatte Winter die Daten stolz präsentiert, aber vergessen zu ermitteln, wer zu dem Zeitpunkt die Aufsicht im Handelsraum der Londoner Börse gehabt hatte. Anstatt die Leistung Meldons zu würdigen, hatte Winter das respektable Ergebnis vor der versammelten Mannschaft nur mit einem trockenen »Danke« quittiert und ohne ein weiteres Wort den Rest übernommen. Das hatte Allington von einer Kollegin erfahren. Dennoch wollte er die »Nervensäge«, so der durchgehende Ruf Rebecca Winters in der Abteilung, nicht noch mehr unter Druck setzen. Er wusste, dass sie freiwillig bis zu 14 Stunden am Tag arbeitete. Entweder hing sie am Rechner, um Konten und Transfers von Milliarden auf Spuren zu untersuchen, die auf eine Börsenmanipulation schließen ließen, studierte Derivate und andere Produkte, die kaum einer verstand, forschte, wer, wem, was, wohin und unter welcher Prämisse transferierte oder versuchte digitale Spuren zu finden, um den Aufenthaltsort von aktenkundigen Betrügern zu ermitteln.
Und wenn sie nach 21 Uhr nicht mehr im Büro war, trieb sie sich zur Verwunderung Allingtons aus Recherchegründen auch mal in den Edelbars des Bankenviertels herum, um, wie sie beteuerte, rein dienstlich mit Escortgirls zu plaudern. Sie wollte nichts unversucht lassen, um an Informationen zu kommen. Nicht selten waren Investmentbanker oder Bankmanager selbstherrlich genug, bei ihren Freizeitbeschäftigungen mit ihren Erfolgen und ihrem Trickreichtum zu prahlen und dadurch Insiderinformationen auszuplaudern. Rebecca Winter hatte irgendwie einen Draht zu diesen Frauen. Erst vor Kurzem hatte sie erzählt, wie sich einige Ladys über ihre Freier und deren eigenwillige Wünsche bei ihr ausheulten, als wäre sie ihre Therapeutin, und dabei das eine oder andere ausplauderten. Das Vertrauen gewann sie wohl auch durch ihr Auftreten in ihrem asexuellem Outfit aus überweiten Klamotten, einem stets ungeschminkten Gesicht und ihrem Desinteresse an männlichen Avancen. Wie auch immer, dachte er, es zählt, was rauskommt. Selbst ein paar Cocktails bis spät in die Nacht hinderten sie nicht daran, am nächsten Morgen in stoischer Pünktlichkeit im Büro oder an einem Einsatzort zu erscheinen. Sein erster Instinkt, dass es diese Frau weit bringen würde, hatte ihn bis heute nicht getäuscht. So wie sie ihr Studium mit Auszeichnung absolviert hatte, hatte sie ihre Ausbildung bei Scotland Yard genutzt, um rasch auf sich aufmerksam zu machen und sich bei Allington zu bewerben. Doch bei aller Wertschätzung für ihre akribische Arbeit – langsam sollte er sie an die kürzere Leine nehmen, denn das vorläufige Ergebnis des Forensikers bot eine Überraschung, die ihn trotz seines Ärgers in Rebecca Winters Büro trieb.
Winter warf ihre Schlüssel auf den Tisch, ließ sich auf den ledernen Bürostuhl fallen, packte aus einer zusammengerollten Zeitung eine Portion Fish and Chips aus und starrte vor sich hin. Ihr Büro glich dem Lebensbereich eines Messies. Während sich die meisten Kollegen mit digitalen Archiven zufriedengaben, hatte sie an jeder Wand Regale voller wild durcheinandergepackter Papierstapel und verschiedenfarbiger Aktenordner. Auf ihrem Schreibtisch war gerade mal Platz für eine Kaffeetasse. Persönliches – Fehlanzeige. Noch nicht mal eine Zimmerpflanze durfte ein einsames Dasein fristen. Nur auf dem Bildschirm saß ein kleiner Stoffteddy und blinzelte verloren in den Raum.
Allington verzog die Nase, als er sich in die Tür lehnte. »Na, schmeckt’s wieder?«
Sie hielt im Kauen inne. Oh Gott, kann der mich nicht mal fünf Minuten in Ruhe lassen?, dachte sie. Seit Monaten hatte Rebecca Winter das Gefühl, ihr Vorgesetzter verwechselte seinen Job mit dem eines Vaters. Selbst wenn sie die Jüngste in der Abteilung war, gab es dafür keinen ersichtlichen Grund. Im Gegenteil. Sie leistete weitaus mehr als die meisten ihrer Kollegen, die streng nach der Uhr arbeiteten und nicht bereit waren, auch nur eine Stunde länger zu bleiben, wenn es mal eng wurde.
»Ich hasse es, wenn sich jemand seiner Verantwortung einfach durch einen Selbstmord entzieht. Wer weiß, was uns jetzt alles durch die Lappen geht«, machte Winter ihrem Ärger über die Ereignisse des Morgens Luft.
Allington wagte etwas, dass er sonst nie tat. Er schob einen Papierstapel beiseite, setzte sich auf die Tischkante direkt neben Winter und beugte sich zu ihr. Die Ermittlerin rückte mit ihrem Stuhl ein Stück nach hinten.
»Robert, du brauchst ein anderes Aftershave, und weniger ist mehr«, sagte sie. Diese Art von Nähe überschritt eindeutig ihre Grenzen.
»Es war kein Selbstmord. Hier ist der vorläufige Bericht.«
Sie zupfte ihm das Papier aus der Hand, schob ihr Essen beiseite und las die ersten Ergebnisse des Forensikers. Die Erklärung war verblüffend einfach. Denver musste vor seinem Ableben relativ unsanft gefesselt worden sein. An der Schürfwunde am rechten Fußknöchel hatte der Rechtsmediziner Fasern des Stranges gefunden, an dem Denver hing. Um seinen Mund waren zudem Spuren eines Klebebandes, und das Genick war nicht gebrochen, was angesichts der Höhe, aus der sich Denver vom Baum gestürzt haben müsste, unmöglich war. Schließlich hatte der Gerichtsmediziner bei der Leichenschau noch Nierenschwellungen festgestellt.
»Das war eine Hinrichtung«, erklärte Allington. »Wir haben durch Metadaten seines Handys außerdem eine Wohnung entdeckt, die Denver auf einen anderen Namen angemietet hatte. Offensichtlich war er der Meinung, dass wir ein abgeschaltetes Handy nicht orten könnten. Die Kollegen von der Spurensicherung sind schon vor Ort.«
Statt sofort aufzuspringen, wie es ihre Art war, blieb Winter grübelnd sitzen. Hatte man an Denver quasi wie bei einem Mafiamord zur Abschreckung bewusst diese Spuren hinterlassen? Das passte nicht in diese Finanzszene. Wirtschaftsverbrecher von der Couleur Denvers oder Formers kämpften mit Derivaten oder Devisen. Und dass ein paar Rentner, die Denver über den Tisch gezogen hatte, sich zu einer schlagkräftigen Rachevereinigung anstatt einer aussichtslosen Sammelklage versammelt hatten, war auch auszuschließen. Wie sollte sie jetzt weiterkommen? Der einzige Mann, der sie vielleicht noch ans Ziel bringen könnte, wäre der abgetauchte Dan Former, für den Denver gearbeitet hatte. Er hatte Denver vor einem Jahr nach einem Insiderhandel entlassen. Für Winter sah das nach einem Bauernopfer aus. Die bedrohlichen Mails zwischen beiden rückten ihn zwar in den Kreis der Verdächtigen, aber der Schaden war für Former bisher zu gering, und die Ermittlungen der Börsenaufsicht traten ohne einen Kronzeugen wie Jarod Denver auf der Stelle.
»Dann gib mir mal die Adresse dieser Zweitwohnung«, sagte sie zu ihrem Chef, während sie sich erhob und in ihren Mantel schlüpfte.
»Rebecca, das ist jetzt Sache der Mordkommission.«
»Mag sein, aber es ist auch immer noch mein Fall.« Sie bemühte sich, sachlich zu klingen, obwohl sie innerlich schäumte. »Also bitte, die Adresse.«
Widerwillig kritzelte Allington die Anschrift auf einen Zettel. Ohne ein weiteres Wort steckte sie ihn in ihre Manteltasche, nahm die Schlüssel vom Tisch und ging Richtung Tür. Vielleicht richtete sich ihre Wut gegen den Falschen, aber sie fühlte sich nicht verstanden. Als würde sie dafür bestraft werden, dass sie sich so gewissenhaft eingesetzt hatte. Für einen kurzen Moment fürchtete sie, dass Allington mehr über sie in Erfahrung gebracht hatte, dass er sich durch ihr beharrliches Schweigen zu ihrem Privatleben provoziert fühlte und Nachforschungen angestellt hatte. Seit Wochen faselte er immer wieder von seiner Verantwortung als Vorgesetzter, und dass er sich sicher sein müsste, dass sie nicht aus persönlichen Gründen zu große Risiken bei ihren Ermittlungen einginge. Persönliche Gründe – wer konnte die schon beurteilen? Und was glaubte er überhaupt? Dass ihr irgendein Banker eine Kugel durch den Kopf jagen würde? Das Schlimmste, was sie sich vorstellen konnte, war schon eingetreten: Ihr Kronzeuge war tot.
Kurz vor der Tür blieb sie stehen, drehte sich um und sah, dass Allington gerade mühsam einen Hustenanfall unterdrückte. »Fängst du an, mich bewusst auszubremsen? Ich meine, hier zählt für mich jede Minute. Dass es Mord war, verändert alles in diesem Fall, und ich erfahre es vermutlich als Letzte!«
Allington atmete tief durch. Er war langsam an einem Punkt, an dem er nicht mehr wusste, wie er mit Rebecca Winter umgehen sollte. Seit einigen Wochen, nach dem Ausbleiben gewohnter Erfolge, war sie immer rastloser geworden. Das Gutachten war gerade erst vor einer halben Stunde eingetroffen, ohnehin hatte der Forensiker den ersten Bericht ungewöhnlich schnell geliefert. Er erhob sich von der Schreibtischkante und kickte mit dem Fuß ein am Boden liegendes Papierknäuel gegen die Wand.
»Ja, genau, Rebecca. So schnell wie möglich, bloß nicht die Letzte sein!«
Allington sah erstmals so etwas wie Traurigkeit in Winters Gesichtszügen. War das wirklich ihr wunder Punkt? Die Angst, nicht die Erste zu sein? War das ihr einziger Antrieb? Musste sie immer einen Schritt voraus sein? Dass ein Fall, egal wie viel Zeit man darin investiert hatte, von einer Sekunde auf die andere auch mal in sich zusammenfiel, gehörte einfach dazu. Könnte ihr vielleicht eine Lehre sein, dass auch sie einmal an die Grenzen des Machbaren stößt, dachte Allington. So niedergeschlagen wie heute hatte er sie allerdings noch nie erlebt.
»Die Spuren warten«, sagte Allington.
Winter ging zwei Schritte auf ihn zu. »Robert, ich weiß nicht, ob du kapierst, was ich da draußen mache. Da tobt ein Krieg. Jedes Imperium breitet sich durch Krieg aus, auch das unsichtbare des großen Geldes. Es … es ist, als würden rund um den Planeten riesige Waffenmengen in den Depots zusammengezogen werden. Hast du dich eigentlich mal gefragt, was die Superreichen mit diesen Machtmitteln noch vorhaben?« Winter zerrte an ihrem Mantelkragen und trat noch einen Schritt näher.
»Bitte, Rebecca, spar dir das Pathos. Ich weiß, dass dich diese Frage zermürbt, aber du jagst mir die ganze Abteilung in die Luft. Egal, wie gut du bist, du musst runterkommen und lernen, auch auf das Team Rücksicht zu nehmen. Du bist in der letzten Zeit nicht wiederzuerkennen.«
»Mir geht es gut. Aber wenn ich das Gefühl habe, nicht mehr unterstützt zu werden, muss ich in der Tat darüber nachdenken, ob ich hier noch richtig bin. Loyalität braucht zwei Seiten, auch die meines Vorgesetzten.«
»Du weißt ganz genau, dass ich dich mehr unterstütze als jeden anderen hier.«
»Vielleicht solltest du genau das lassen«, sagte Winter und ging zur Tür. Beim Hinausgehen drehte sie sich noch einmal um. »Tut mir leid, ich will dich nicht kränken, aber ich brauche keinen Vaterersatz!«
Allington trat ans Fenster. Er wusste, dass da draußen vieles schieflief. Vielleicht war er nach über 30 Jahren im Beruf und vielen Rückschlägen selbst schon zu zermürbt. Er sah sein Spiegelbild in der Scheibe. Angeschwollene Tränensäcke nach einer schlaflosen Nacht mit leichtem Fieber und Hustenanfällen, tiefe Wangenfalten, gnädig kaschiert von einem Dreitagebart. Er blickte auf das Foto von Warren Buffett, das direkt über Rebecca Winters Schreibtisch hing. Sie hatte es nach einer kurzen Begegnung mit dem Großinvestor nach einem Vortrag an der London School of Economics aufgehängt. Das Zitat in fetten Lettern darunter war wohl ihr Antrieb, spiegelte die ganze Schizophrenie dieses globalen Spieles für sie wider. »Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen.«
Allington erinnerte sich an ihren Bericht von der Begegnung mit Buffett. Sie hatte die Gunst der Stunde genutzt und ihn mit der fehlenden Konsequenz einer solch drastischen Aussage konfrontiert. Warum er selbst weiter bei diesem Klassenkampf mitmache, hatte sie wissen wollen, schließlich zog Buffett aus seiner Erkenntnis, Teil eines Klassenkampfes zu sein, ganz offensichtlich keinerlei Konsequenzen. Im Gegenteil. Er zockte weiter an den Weltbörsen, investierte in fragwürdige Unternehmen, was über das Schicksal von Millionen Menschen entscheiden konnte. Seine Teilhabe an »The Giving Pledge«, dem Club der großen Spender, den Bill Gates ins Leben gerufen hatte, war für Winter daher nur ein Feigenblatt. Wer einer Bank wie Goldman Sachs half, war bei Winter unten durch.
Buffett hatte sie nicht einmal eines Blickes gewürdigt und weiter die Autogrammkarten seiner Fangemeinde unterzeichnet, die sich um den Finanzguru tummelten, als wäre der Dalai Lama im Saal. Diese Begegnung mit dem unnahbaren Großinvestor war anscheinend die Initialzündung für Winter gewesen, die Ursachen dieser »Krankheit«, wie sie die Zockerei nannte, zu bekämpfen. Alle, gegen die Winter ermittelte, schienen von der gleichen Gier befallen zu sein. Und waren sie nicht so erfolgreich wie Buffett, blieb ihnen nur die Trickkiste, mit der sie weltweit unzählige Kleinanleger, Sparer und Arbeiter um ihre Vermögen brachten. Und Winter wollte diese Zocker verstehen. Sie zog sogar psychologische Studien heran, um zu analysieren, was in den Köpfen ihrer Kontrahenten vorging.
Für Allington war die Sache denkbar einfach. Er stufte diese Klientel als relativ berechenbar ein. Die meisten Händler verhielten sich egoistischer und risikobereiter als eine Gruppe von Psychopathen im Knast. Die meisten versuchten gar nicht mehr, einfach Gewinn zu machen. Statt sachlich und nüchtern auf den höchsten Profit hinzuarbeiten, ging es vielmehr darum, mehr zu bekommen als ihre jeweiligen Gegenspieler. Und um diese zu schädigen, gingen sie alle Risiken ein. Allington konnte die Hartnäckigkeit Winters dennoch nicht nachvollziehen, aber er nutzte sie, denn ihre Erfolge waren ein Aushängeschild für die ganze Abteilung, wenn er auch fürchtete, dass sie eines Tages zu weit gehen könnte.
FÜNF
LONDON, 24. OKTOBER
Sturm war aufgezogen. Das Klappern des leicht geöffneten Fensters weckte Bill Naravan in seinem Zimmer im Hotel Sanctuary an der Londoner Tothill Street. Denver hatte ihn hier untergebracht. Die Underground-Station St James’s Park war nur eine Gehminute vom Hotel entfernt, der Buckingham Palace lag quasi um die Ecke. Während er sich leicht fröstelnd noch einmal die Decke über den Kopf ziehen wollte, erblickte der Programmierer die Uhr auf dem Nachttisch.
»Ach, du Scheiße!«
Es war bereits Nachmittag. Bis in die späte Nacht hatte er sich im Bett hin und her gewälzt. Gähnend schlurfte er zum Schreibtisch, rieb sich das blasse Gesicht und öffnete seinen Laptop. Sein Magen knurrte. Erste Hilfe fand er in einem Korb über der Minibar. Schokoriegel und Kekse, genau das Richtige für ihn, wenngleich er alles andere als so aussah, als würde er je Süßigkeiten im Übermaß essen. Seit Jahren kämpfte er mit seinem Untergewicht, verbrannte sich in Nächten vor seinen Rechnern. Während er in den Schokoriegel biss, widmete er sich seinen Mails im Darknet, einem sicheren IRC-Chat.
Etwas stimmte nicht. Denver hatte sich noch nicht gemeldet. So chaotisch er war, bei Verabredungen war er immer zuverlässig. Naravan schob sich den restlichen Schokoriegel in den Mund und durchforstete wie üblich die Nachrichtenportale und wichtigsten Onlineausgaben der Tageszeitungen. An einer Meldung des Daily Telegraph blieb er hängen und erstarrte mit offenem Mund vor dem Bildschirm.
Am Morgen wurde der international gesuchte Wertpapierbetrüger Jarod Denver tot in London aufgefunden. Der ehemalige Mitarbeiter des Hedgefonds »Former Global Investments« wurde unter anderem wegen Insiderhandels und weiterer Machenschaften gesucht, die auch im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den Inhaber des Hedgefonds, Dan Former, stehen …
Neben dem Telegraph brachte nur noch die Financial Times einen Kurzbericht zwischen weitaus dramatischeren News aus der Finanzwirtschaft, ohne auf nähere Hintergründe einzugehen. Und in zwei Internetforen waren kurze Debatten angestoßen worden, die Denvers Tod mit der jüngsten Selbstmordserie unter Bankern in Verbindung brachten und wildeste Verschwörungstheorien aufstellten.
Naravans Hände begannen zu zittern, er sprang auf, hastete im Raum umher, sammelte fahrig seine Socken auf, zog seine Klamotten an und begann, eilig seine Sachen in einen grauen Rucksack zu stopfen.
»Scheiße, scheiße, verdammt!«
Er öffnete eine Seitentasche, zog zwei alte Handys heraus. Aus einer kleinen Plastikhülle fummelte er zwei von etlichen SIM-Karten heraus und bestückte die Handys damit. Er schaute sich ein letztes Mal im Raum um und verließ sein Zimmer. Unbemerkt passierte er die Rezeption und stand auf der Straße. Der Wind blies kräftig. Blätter wirbelten um seine Füße. Für einen Moment blieb er stehen, schaute die Straße hinauf und hinunter und hielt sich an seinem Rucksack fest.
»Scheiße, was mach ich jetzt?«, murmelte er. »Was mach ich jetzt bloß?«
Das alles durfte nicht wahr sein. Was hatte Denver getan? Unzählige Fragen rotierten in Naravans Kopf. In der Meldung stand nur, dass er tot aufgefunden wurde, aber an Selbstmord glaubte er nicht. Dafür war Denver viel zu motiviert gewesen und sicher, noch alles im Griff zu haben. Andererseits hatte es zwischen ihm und Dan Former einen handfesten Streit gegeben. Denver hatte sich über die Hintergründe beharrlich ausgeschwiegen, aber er hatte wochenlang recherchiert, vermutlich, um Former unter Druck setzen zu können. Aber eigentlich hatte Naravan keinen blassen Schimmer, was da wirklich ablief, und es interessierte ihn auch nicht, er wollte nur mit der Programmierung der verschiedenen Algorithmen seinen Schnitt machen. Denver und Former hantierten mit Millionen, um an möglichst viele Geheimnisse gegnerischer Handelssysteme heranzukommen. Warum Former Denver aber plötzlich das Geld für ihre Arbeit nicht mehr überwiesen hatte, war ihm auch nicht klar, doch seit vor ein paar Wochen die letzten Zahlungen von Former ausgeblieben waren, drehte Denver fast täglich durch. Er schüttete massenweise Wein in sich hinein und lamentierte über den Mangel an Respekt, den Former ihm entgegenbrachte. Naravan wusste nur, dass genau der Algorithmus, an dem er zuletzt gearbeitet hatte, der Auslöser für den Streit zwischen beiden war. Langsam wurde ihm klar, dass er wohl zu fahrlässig seine Dienste verkauft hatte.
Er ging ratlos die Straße hinunter und bog ab Richtung St James’s Park. Er war sich nicht sicher, aber möglicherweise hatte Denver sich nicht nur mit Former angelegt. Der Programmierer spürte einen schweren Druck im Magen. Wenn man bei Denver die Daten, Mails und anderen Hinweise gefunden hatte, würde man wohl auch auf ihn kommen, vielleicht entdecken, was er bereit war zu programmieren. Sein Herz raste noch stärker als zuvor. Er griff sich an die Brust, um sich wieder zu beruhigen. Wären seine Eltern nicht vor einem Jahr bei einem Autounfall ums Leben gekommen, hätte er einfach alles stehen und liegen lassen können, wäre zu ihnen geeilt und abgetaucht. Die Tatsache, dass da niemand mehr war, an den er sich im tiefsten Vertrauen wenden konnte, schmerzte, dämpfte seinen Fluchtinstinkt.
Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Ohne zu wissen, wohin mit sich selbst, schlich er sich in eine Nebenstraße des Parks, setzte sich auf eine Bank und starrte auf seine Schuhe.
Du bist ein verdammter Idiot gewesen, Bill Naravan, ein verdammter Narr. Er griff in seine Jackentasche und zog das Handy heraus. Hektisch tippte er die Nummer von Patrice Lascaut ein, dem Mann, der versucht hatte, zwischen Denver und Former zu vermitteln. Seit Former abtauchen musste, war dieser geschniegelte alte Mann sein Ansprechpartner. Einen Moment zögerte er, die letzte Ziffer einzugeben. Wer war wirklich bereit, Denver umzubringen? War er selbst nur noch am Leben, weil er Denver hintergangen und Lascaut seinen Teil des Codes bereitwillig ausgehändigt hatte, um zumindest schon mal eine Anzahlung zu bekommen? War es nicht völlig töricht zu glauben, dass Männer wie Former sich unter Druck setzen ließen? Warum hatte sich Denver mit Former nicht über die Summe einigen können, die der Algorithmus wert war? Er selbst wusste eigentlich gar nicht, wie viel der Code wert war, aber offensichtlich ein Leben. Und seines? Mit zitternden Händen durchwühlte er seine mittellangen Haare. Er stand auf, machte sich schnellen Schrittes auf den Weg nach St Pancras. Vielleicht könnte er mit dem Eurostar die Insel in Richtung Brüssel verlassen?
SECHS
AN EINEM GEHEIMEN ORT IN DER BRETAGNE, 24. OKTOBER
Eine ungeplante Debatte unter den Herren hatte Lascauts Auftritt verzögert. Er rückte seine Krawatte zurecht und richtete sich in dem schweren Ledersessel auf. Das Gemurmel nahm ab. Dann erhob er sich und nahm ein Bündel Unterlagen, das er aus seinem Aktenkoffer geholt hatte. Er machte sich die Mühe, jedem Einzelnen persönlich die Papiere zu geben. Jedem schaute er dabei in die Augen. Lascaut war schon lange Jahre mit Dan Former befreundet, und als er ihn erreichte, klopfte er ihm leicht auf die Schulter.
Former lächelte und beobachtete seinen gealterten Freund. Lascauts Habitus wirkte noch immer wie der eines altgedienten Kämpfers, der alles in seinem Leben erreicht hatte. Nun ging er drahtig und scheinbar gesund um die Tische und verteilte eine Studie, deren Brisanz einigen ziemliche Bauchschmerzen bereiten würde.
Alles, was Former und Lascaut in den letzten Monaten an Insiderwissen zusammengetragen hatten, sollte dem Zweck dienen, die Gruppe weiter einzuschwören, um den Mut aufzubringen, sich unter herben Einschnitten gegen eine Finanzindustrie zur Wehr zu setzen, die selbst diesen hartgesottenen Unternehmern nicht mehr geheuer war.
Lascaut war in Paris der Grandseigneur unter den Geschäftsleuten. Sein ganzes Handeln war von einer unerbittlichen Disziplin geprägt, nichts ließ er andere machen. Er kontrollierte rund 15 Unternehmen in der Stahl- und Autozulieferindustrie, investierte an der Börse ausschließlich in solide Werte und war lange Zeit einer der einflussreichsten Lobbyisten in Brüssel und Paris gewesen. Auch wenn dieser Zugang in den letzten Jahren schwand, hatte das nichts an seinem Auftreten geändert. Dafür war er, wie Former ihm immer wieder vorwarf, viel zu eitel. An Aufhören war nicht zu denken, und seit die Regeln an den Finanzmärkten über Bord geworfen wurden und die Politik von Heuschrecken unterwandert worden war, kümmerten sich Lascaut und Former tagtäglich darum, dass sie nicht vom Spielfeld gekickt wurden.
Former sorgte sich um seinen alten Freund. Der Anschein von guter Gesundheit trog zumindest etwas, auch wenn er seinen Herzinfarkt vor einem Monat relativ gut weggesteckt hatte. Dieser Schlag nagte an ihm. Das war Former nicht entgangen. Er hatte Lascaut vor bald 25 Jahren bei einer Auktion im Pariser Sotheby’s wiedergetroffen, als er nach einem gescheiterten Versuch, einen frühen Rembrandt zu ersteigern, mit rot angelaufenem Gesicht den Saal verließ. Dabei war die erste Begegnung nach dem gemeinsamen Studium an der London School of Economics alles andere als freundschaftlich gewesen. An der Universität waren sie sich weitestgehend aus dem Weg gegangen, zu nassforsch und raubeinig erschien ihm Lascaut seinerzeit. Er trank, war nicht selten in Streitigkeiten mit anderen Studenten verwickelt. Former hatte ihn als einen Mann in Erinnerung, der sich mit allen Mitteln nach oben arbeiten wollte, er schien neben dem Interesse an Geld und einer Karriere als Banker über wenig Kultur und Allgemeinbildung zu verfügen. Sein gesamtes Auftreten ließ kaum auf gemeinsame Interessen schließen. Aber sie hatten beide am Ende den Abschluss mit Auszeichnung in der Tasche und starteten zur gleichen Zeit ins Berufsleben. Jahre später konnte Former die Karriere von Lascaut nicht übersehen, als er in Frankreich zu einem Großunternehmer aufstieg.
Former hatte seinen alten Studienkollegen am Ausgang des Pariser Auktionshauses mit einer eher arroganten Bemerkung angesprochen, ob denn Lascauts Börse zu klein sei, um bei einer solch exklusiven Versteigerung mithalten zu können. Lascaut hatte lauthals vor sich hingeschimpft, dass einer seiner Intimfeinde ihm seit Jahren mit völlig überzogenen Geboten immer wieder Objekte vor der Nase wegschnappte und er nicht gewillt sei, sich von solch einem Irren treiben zu lassen. Und so kamen sie ins Gespräch über Kunst, Geld, Politik und Börsen, entdeckten ungeahnte Gemeinsamkeiten ihrer Karriere, gemeinsame Feinde und ganz anders als in Formers Erinnerung, hatte sich Lascaut zu einem umfassend gebildeten Macher entwickelt und seinen Respekt geerntet. Von diesem Zeitpunkt verband beide eine seelenverwandte Freundschaft und die gleiche Leidenschaft: Beide liebten sie das Spiel und den Reiz des Erfolges, egal ob es um Unternehmen, Aktien, Autorennen oder Golf ging. Nur der Sieg war letztlich befriedigend.
Einige Tage nach ihrer Begegnung in Paris hatte Former ihn in seinem Londoner Büro besucht. Neugierig hatte er verfolgt, wie Lascaut gerade erfuhr, dass ein Freund versuchte, vertrauliche Informationen für eine feindliche Übernahme eines seiner Unternehmen zu nutzen. Lascaut hatte nur kurz die Stirn in Falten gezogen, dann zum Hörer gegriffen und telefoniert, einen großen Rückkauf von Aktien organisiert und das Blatt an nur einem Tag gewendet. Doch als er am selben Nachmittag gegen Former beim Golf verloren hatte, hatte er auf seinen Golftrolley eingedroschen und sich erst Stunden später nach einem Glas Whisky beruhigt. Von da an waren ihre Begegnungen immer wieder von Spiel und gegenseitiger Neugier, aber auch einer subtilen Konkurrenz geprägt.
Die Entwicklung der letzten Jahre nach dem Finanzcrash hatte sie noch mehr zusammengeschweißt. Former war bereit, zu handeln. Und Lascaut, in einem für ihn ungewöhnlichen Pathos zu reden.