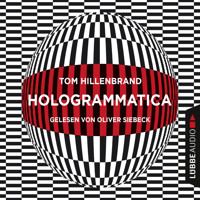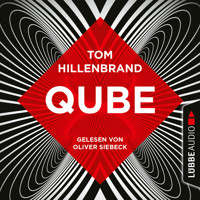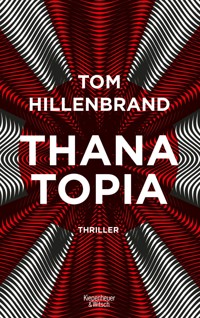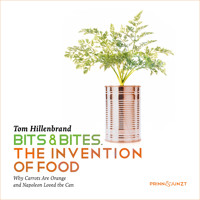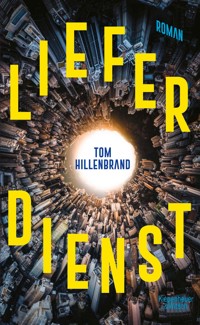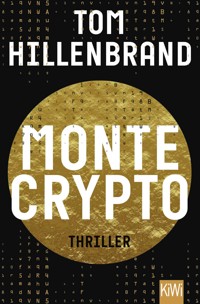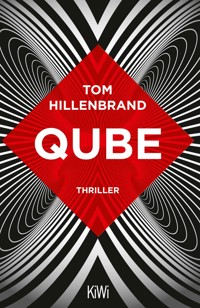
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Aus der Welt der Hologrammatica
- Sprache: Deutsch
London, 2091. Investigativjournalist Calvary Doyle wird auf offener Straße niedergeschossen. Zuvor hatte der Reporter zum Thema Künstliche Intelligenz recherchiert. Die auf KI-Gefahrenabwehr spezialisierte UNO-Agentin Fran Bittner beginnt in dem Fall zu ermitteln. Der Journalist besaß anscheinend neue, beunruhigende Informationen über den berüchtigten Turing-Zwischenfall, bei dem die Menschheit die Kontrolle über eine KI verlor. Die KI befand sich seinerzeit in einem Quantencomputer, einem sogenannten Qube. Gibt es womöglich noch einen solchen Würfel, mit einer weiteren digitalen Superintelligenz darin? Und kann Fran Bittner den zweiten Qube finden, bevor jemand auf die Idee kommt, ihn zu aktivieren? Der grandiose neue Thriller von SPIEGEL-Bestseller-Autor Tom Hillenbrand führt uns an die Grenzen unserer Welt − ein Feuerwerk der Ideen, aufregend und hochspannend!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tom Hillenbrand
Qube
Thriller
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tom Hillenbrand
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tom Hillenbrand
Tom Hillenbrand studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Redakteur bei SPIEGEL ONLINE. Seine Sachbücher und Romane – darunter die kulinarischen Krimis mit dem Luxemburger Koch Xavier Kieffer als Ermittler – haben sich bereits Hunderttausende Male verkauft, sind in mehrere Sprachen übersetzt, wurden vielfach ausgezeichnet und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
www.tomhillenbrand.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
London, 2091: Investigativjournalist Calvary Doyle wird auf offener Straße niedergeschossen. Zuvor hatte der Reporter zum Thema Künstliche Intelligenz recherchiert. Die auf KI-Gefahrenabwehr spezialisierte UNO-Agentin Fran Bittner beginnt, in dem Fall zu ermitteln.
Bald stellt sich heraus, dass der Journalist anscheinend neue, beunruhigende Informationen über den berüchtigten Turing-Zwischenfall besaß, bei dem die Menschheit die Kontrolle über eine wildgewordene KI verlor.
Die KI befand sich seinerzeit in einem Quantencomputer, einem sogenannen Qube. Gibt es womöglich noch einen solchen Würfel, mit einer weiteren digitalen Superintelligenz darin? Und kann Fran Bittner den zweiten Qube finden, bevor jemand auf die Idee kommt, ihn zu aktivieren?
Der grandiose neue Thriller von SPIEGEL-Bestsellerautor Tom Hillenbrand führt an die Grenzen unserer Welt – ein Feuerwerk der Ideen, aufregend und hochspannend!
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: iStock.com/troyka
ISBN978-3-462-32135-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motti
Hinweis
PROLOG
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
EPILOG
GLOSSAR
Leseprobe »Thanatopia«
Und der Vorteil, den diese Puppe vor lebendigen Tänzern voraushaben würde? Der Vorteil? Zuvörderst ein negativer, mein vortrefflicher Freund, nämlich dieser, daß sie sich niemals zierte.
Heinrich von Kleist, »Über das Marionettentheater«
Your bones got a little machine.
You’re the bone machine.
Pixies, »Bone Machine«
Ein kleines Qube-Lexikon finden Sie am Ende des Buchs
PROLOG
Ein geiler Arsch rettete Calvary Doyle das Leben. Der geile Arsch zockelte, zusammen mit dem auch nicht üblen Rest, die Marylebone Road entlang, Richtung Park. Doyle, der im Außenbereich eines Cafés saß, gingen gerade wichtige Dinge durch den Kopf, beunruhigende, ja, welterschütternde Dinge. Aber als dieser Wahnsinnsarsch in sein Blickfeld geriet, passierte das, was ihm in solchen Fällen immer passierte: Seine Lenden begannen zu kribbeln, sein Verstand setzte aus. Das limbische System gab Anweisung, den Doyle’schen Schädel ein wenig nach rechts zu drehen, damit die Doyle’schen Augen dem geilen Arsch noch etwas folgen konnten, bevor er in der Menge verschwand.
Dieser Kopfdrehung verdankte Calvary Doyle, so zumindest würde es der Gehirnchirurg des Brompton Hospital später gegenüber der Metropolitan Police darstellen, das Leben – der anonyme Arsch rettete gewissermaßen seinen. Hätte Doyle weiter geradeaus geblickt, hinaus auf die Marylebone, wäre der Weg des Projektils durch seinen Schädel nämlich ein anderer gewesen. Die Kugel wäre durch den unverzichtbaren präfrontalen Kortex und das für einen Geistesmenschen wie Doyle ebenfalls kaum entbehrliche Broca-Areal gepflügt.
Aufgrund der triebinduzierten Kopfdrehung um etwa einundzwanzig Grad kam es anders. Die Kugel prallte gegen das Joch- sowie das Nasenbein, bevor sie durch den Augapfel ins Gehirn drang. Aufgrund des Zickzackkurses büßte das Projektil so viel von seiner kinetischen Energie ein, dass es im Entorhinalis stecken blieb. Nun war auch dieser Teil des Gehirns nicht wirklich verzichtbar, aber zumindest brachte die Verletzung Doyle nicht augenblicklich um. Er fiel lediglich ins Koma.
Während ein selbstfahrender Rettungswagen die Marylebone hinaufjagte, war Dr. Macklemore Sydensticker bereits auf dem Weg in den Operationssaal. Dort wartete seine Assistentin, Tarifa Soleil. Sie hatte bereits eine stark vergrößerte Darstellung von Doyles Encephalon aufgerufen. Wie eine regenschwere Wolke schwebte das Hirn-Hologramm über dem OP-Tisch. Sydensticker nickte ihr zu.
»Was haben wir, Tarifa?«
»Calvary Doyle, dreiundvierzig Jahre, Kopfschuss.«
»Kopfschuss? Mitten in London?«
»Nahe dem Regent Park, ja.«
»Das ist aber nicht der Doyle, oder?«
»Welcher?«
»Na, der Journalist. Von Total Exposure.«
Soleil wischte in der Luft herum.
»Ja, doch, wohl der.«
Sydensticker trat näher an das Gehirnwölkchen heran und vollführte eine Bewegung mit dem Zeigefinger. Das Hologramm begann sich zu drehen. Ein prominenter Patient – trotzdem war dies ein stinknormales Männergehirn, laut Datenbank tausendvierhundertsiebzehn Gramm schwer, alle Parameter im normalen Bereich. Also, nun natürlich nicht mehr.
»Hat der Rettungswagen schon Daten für die Simulation geschickt, Tarifa?«
»Ja, Doktor. Trajektorie liegt vor.«
»Dann mal her damit.«
Das schwebende Gehirn veränderte sich. An der Vorderseite, auf Höhe des linken Auges, erschien ein roter Fleck.
»Wundkanal. Querschnitt«, sagte Sydensticker. Er konnte nun einen roten Trichter sehen. Ob dieser zu hundert Prozent der tatsächlichen Wunde entsprach, wusste man natürlich nicht. Der OP-Rechner hatte mithilfe von Scans aus dem Rettungswagen eine Simulation erstellt und außerdem die Datenbank befragt. Darin befanden sich dreidimensionale Aufnahmen von Gehirnen, in die ein Projektil eingedrungen war. Die Datenbank war ziemlich groß. Man musste sich eigentlich wundern, wie viele Leute sich in den Kopf schießen ließen. Doch wie die meisten Unfallchirurgen wunderte sich Dr. Macklemore Sydensticker über gar nichts mehr.
Der Arzt drehte das Hologramm hin und her. Wie es in Doyles Schädel wirklich aussah, würde er erst wissen, wenn er ihn aufmachte. Was er allerdings bereits sagen konnte, war, dass es mit Doyles journalistischer Karriere von nun an rapide bergab gehen würde. Wenn der Mann Glück hatte, würde er seine Suppe irgendwann wieder selbst löffeln können. Aber so richtig wahrscheinlich war das nicht.
Eine rote Einblendung erschien, ein Countdown, der sie darüber informierte, dass der Patient in neunzig Sekunden hier sein würde. Per Sprachbefehl brachte Sydensticker den Anästhesisten in Position, ebenso den Roboter mit der Diamantfräse und ein halbes Dutzend weiterer Helferlein. Aus dem Gang vernahm er Fußgetrappel. Sydensticker zog sich Handschuhe über.
»Ach du Scheiße«, murmelte Soleil.
Sydensticker musterte seine Assistentin.
»Scheiße von der ich wissen muss?«
»Ich denke schon. Das ist … Doyle hat einen Scan machen lassen, also ich meine einen Quantscan.«
Sydensticker runzelte die Stirn. Mit Quantscan meinte sie, dass Doyle eine extrem hochauflösende Aufnahme seines Gehirns hatte machen lassen. Man musste sich dazu in ein künstliches Koma versetzen lassen und vierundzwanzig Stunden in einem Spezial-MRT liegen. Solche Scans wurden nicht aus medizinischen Gründen gemacht. Sie dienten dazu, eine digitale Emulation des Gehirns zu erstellen.
Sydensticker zuckte mit den Achseln. »Und? Hilft uns nichts. Und ihm ehrlich gesagt auch nicht.«
Sanitäter rollten den leblosen Doyle herein. Sydensticker warf einen kurzen Blick auf die holographischen Zahlen und Kurven über dem OP-Tisch. Sie sahen weniger übel aus als erwartet. Er war zuversichtlich, dass der Patient ihm zumindest nicht unter dem Messer wegsterben würde.
Als die ersten Daten des Brainscanners einliefen, wurde Sydensticker noch zuversichtlicher. Die Kugel steckte in einem Randbereich des Lobus frontalis fest. Einen Zentimeter weiter, und es wäre nicht mehr viel zu machen gewesen. Doch so wie es aussah, würde Doyle wieder halbwegs werden. Ein paar kleinere motorische Defizite, eingeschränktes Gesichtsfeld, eventuell Probleme mit Libido und Impulsivität, aber mit etwas Glück keine größeren kognitiven Probleme. Sydensticker drehte den über dem Tisch schwebenden Scan und begann, den Robochirurgen zu programmieren. Gerade wollte er die Prozedur starten, als Tarifa Soleil vernehmlich fluchte. Sydensticker seufzte.
»Was denn noch? Ich würde jetzt gerne.«
»Da ist jemand mit einer Patientenverfügung. Die Verwaltung hat ihn zu mir durchgestellt. Ein Anwalt.«
»Scheiß auf ihn.«
»Aber …«
»Die Frage, ob wir den Life Support abschalten oder so was, stellt sich nicht, noch nicht. Erst mal müssen wir schauen, ob er durchkommt. Also scheiß drauf.«
Sydensticker griff sich den Holopen und markierte den Weg, den das Instrument des Robochirurgen nehmen sollte.
»Doktor, es sieht so aus, als ob Doyle für genau diesen Fall eine ganz spezielle Verfügung bei einem Notar hinterlegt hat und …«
»Für den speziellen Fall, dass ihm jemand in den Kopf schießt?«
»Für eine schwere Gehirnverletzung, ja. Die drohen mit Klage. Die Verwaltung ist schon ganz nervös.«
»Und der Typ ist in der Leitung?«
»Ja.«
»Das ist doch alles un-fass-bar.«
Sydensticker kontrollierte die Werte des Patienten, um sicherzugehen, dass dieser stabil war.
»Okay. Ich rede mit dem Arschloch.«
Neben dem OP-Tisch erschien die Gestalt eines Schwarzen, Ende fünfzig. Er sah nicht wie ein Anwalt aus. Sydenstickers Erfahrung nach waren das die schlimmsten.
»Strider Johnson, Kanzlei Fields & Waterstone. Verzeihen Sie die Störung, ich mach’s kurz.«
»Sehr kurz«, erwiderte Sydensticker.
»Ihnen geht in diesem Moment ein notariell beglaubigtes Schreiben zu, laut dem Mister Calvary P. Doyle im Fall einer Kopfverletzung mit potenziellen Auswirkungen auf seine Kognition eine Quant-Konversion möchte.«
»Schön für ihn, wird aber nichts«, entgegnete Sydensticker. »Um sein organisches Encephalon gegen ein digitales auszutauschen, bräuchten wir einen Quantencomputer, in dem sein Brainscan bereits eingespielt ist und der …«
»Bekommen Sie.«
»Sportsfreund, Ihr Mandant hat eine Kugel im Kopf. Er kann keine vierundzwanzig Stunden warten, bis der Rechner präpariert …«
»Doktor, der bootfähige Qube mit Doyles digitaler Gehirnkopie wird gerade angeliefert.«
»Was? Wo?«
In diesem Augenblick klopfte es an die OP-Tür. Durch die Scheibe konnte Sydensticker eine Frau sehen, die ein Paket hochhielt.
»Woher zum Teufel wussten Sie, dass er die …«
»Mister Doyle hat minutiöse Vorkehrungen getroffen. Bitte setzen Sie ihm den Qube ein.«
»Wir prüfen die Verfügung«, sagte Sydensticker und schaute zu seiner Assistentin. Soleil war bereits dabei, das Schreiben zu lesen.
»Sieht okay aus«, sagte sie. »Das Gleiche gilt für die Frachtpapiere des Qubes. Sterilisiert, versiegelt, UNANPAI-Zertifikat, alles da.«
Sydensticker seufzte. »Von mir aus. Und jetzt raus mit Ihnen, Johnson. Ich mag keine Anwälte in meinem OP.«
Die holographische Projektion des Anwalts nickte verständnisvoll und löste sich in Luft auf. Mit einem gewissen Bedauern betrachtete Sydensticker den OP-Plan, den er dem Robochirurgen einprogrammiert hatte. Der Plan war ziemlich brillant und hätte bestimmt funktioniert. Aber wenn der Patient es anders wollte, war ihm nicht zu helfen. Sydensticker löschte den Ablaufplan und lud stattdessen die Standardprozedur »Totalexzision« in den Robo.
Kaum eine halbe Stunde später war alles vorbei. In Doyles wieder verschlossenem Schädel lief nun ein e-Cephalon, ein kleiner Computer. Sein organisches Gehirn lag in einer Schale neben dem OP-Tisch. Schon griff eine Schwester danach und kippte es in den Recycler.
»Was für eine Verschwendung«, murmelte Sydensticker. Dann streifte er die Handschuhe ab und verließ übel gelaunt den Operationssaal.
1
Fran fror. Seit Jahren war sie nirgendwo mehr gewesen, wo die Temperatur unter null Grad lag – es gab kaum noch Orte, an denen es derart kalt wurde. Fran zog den Reißverschluss ihres Parkas hoch und stapfte auf das Blockhaus zu, das sich fünfzig Meter hangaufwärts befand. Selbst für einen zur Einsiedelei neigenden Menschen wie Hardhouse war dies ein entlegener Treffpunkt. Fran Bittner war mit dem Scramjet von Paris nach Vancouver geflogen, von Vancouver mit einer kleinen, unfassbar langsamen Maschine nach Whitehorse und von dort mit dem Auto hierher. Einen Namen besaß der Ort nicht. Auf den letzten dreißig Kilometern hatte es nicht einmal mehr Holonet gegeben. Die Wegweiser am Rande der Straße bestanden aus Metall, nirgendwo Einblendungen oder gar Werbung – das nördliche Yukon-Territorium war Naked Space.
Kein Grid, keine Holos, keine Kameras – das waren die Gründe, warum der Alte diese Gegend ausgesucht hatte. Ihr Chef hatte Sorge, dass ihn jemand belauschte, ihm zusah. Das ließ Fran vermuten, dass es sich um einen Auftrag handelte, der mit ihrem Hauptgegner zu tun hatte.
Sie erreichte die Blockhütte. Es gab keine Klingel, deshalb klopfte sie. Ein Mann öffnete die Tür – nicht Hardhouse, sondern ein Japaner mit Schnauzbart. Er musterte Fran fragend.
»Commander Fran Bittner«, sagte sie und hielt dem Mann ihre Marke unter die Nase – ein bronzefarbenes Medaillon, auf dem ein stilisiertes Gehirn eingraviert war. Eine Hälfte sah organisch aus, die andere erinnerte an einen Computerchip. Darunter stand »UNANPAI: United Nations Agency for the Non-Proliferation of Artificial Intelligence«.
Der Mann nickte und hielt ihr die Tür auf. Er deutete auf eine hölzerne Treppe. »Direktor Hardhouse ist oben, Ma’am.«
Das Interieur sah so aus, wie sie es sich vorgestellt hatte: viel unbehandeltes Fichtenholz, geknüpfte Teppiche in Erdfarben, Elchkopf an der Wand, indigene Kunst. Falls es in diesem Haus Technologie gab, die in den vergangenen hundert Jahren entwickelt worden war, hatte man sie gut versteckt. Fran stieg eine Treppe empor und fand sich in einem Gang wieder, von dem drei Türen abgingen. Alle waren angelehnt.
»Bittner?«, rief eine tiefe Stimme.
»Ja, Sir.«
»Links.«
Fran steuerte die fragliche Tür an. Direktor Riverrhine Hardhouse saß an einem großen Schreibtisch aus Kiefernholz, auf dem mehrere Aktenordner voller Papier lagen. Als Fran eintrat, blickte er auf und lächelte sie an. In seinem Blick lag etwas Väterliches, zumindest bildete sie sich das ein. Vielleicht rührte der Eindruck von Hardhouse’ dichtem weißen Haar und dem kurz geschnittenen Vollbart, der ihm etwas Onkelhaftes verlieh. Seine Augen und sein Mund waren von zahllosen kleinen Fältchen umgeben, wie sie Menschen haben, die gerne und viel lachen. Fran hatte Direktor Hardhouse allerdings noch nie lachen gesehen. Vielleicht hob er sich das für den Feierabend auf.
»Setzen Sie sich, Bittner. Heißen Tee? Sie sehen so aus, als könnten Sie einen gebrauchen.«
»Danke, Direktor.«
Hardhouse griff nach einem Telefon mit Wählscheibe. Er sagte irgendwem am anderen Ende, er möge Tee bringen. Sobald er aufgelegt hatte, lehnte er sich zurück und musterte Fran.
»Haben Sie sich von Ihrem letzten Einsatz gut erholt?«
Vier Monate war Fran Bittner in der Kalifornischen Hegemonie unterwegs gewesen, undercover. Sie hatte eine Sekte namens Ordo Equester Sethiani infiltriert. Normalerweise waren Sethianer harmlos. Sie glaubten, Gott sei in Wahrheit gar nicht Gott, sondern ein Demiurg, ein böser Handlanger, der den wahren Gott gefangen hielt. Deshalb warteten Sethianer, wie ihr Name andeutete, auf einen Heilsbringer namens Seth. Dieser würde den Demiurgen zur Strecke bringen und selbst zu Gott werden oder den wahren Gott befreien oder vielleicht auch beides. Fran hatte diesen Teil der sethianischen Heilslehre nie ganz verstanden.
Die fragliche Splittergruppe war weitaus fanatischer als die normalen Sethianer. Die selbst ernannten Ritter des Seth glaubten, ihr Heiland werde keineswegs als Mensch herniederkommen, sondern vielmehr aus dem Geist einer Maschine geboren werden, dank des guten Werks der Ordo Equester. Einfacher ausgedrückt waren diese Wahnsinnigen dabei gewesen, eine unlizenzierte Künstliche Intelligenz zu bauen.
Sie hatten die Rechnung jedoch ohne UNANPAI gemacht. Nun saßen die Seth-Ritter alle im Death Valley Open Penitentiary. Bis Fran und ihr Team den Kerlen die diversen Verstöße gegen den KI-Sperrvertrag hatten stichhaltig nachweisen können, waren nervenaufreibende Wochen vergangen. Davon, dass sie sich von dieser Strapaze auch nur halbwegs erholt hatte, konnte überhaupt keine Rede sein.
»Ja, Direktor«, erwiderte Fran, »bestens erholt.«
»Freut mich zu hören. Ich habe nämlich einiges mit Ihnen vor.«
Aus dem Gang waren Schritte zu vernehmen. Eine rundliche Frau trat ein, in den Händen ein Tablett mit Teekanne, Tassen und Haferkeksen. Sie stellte es ab und schloss die Tür hinter sich. Hardhouse schenkte Fran Tee ein.
»Zucker, Milch?«
»Nein danke, Sir.«
»Sie sind immer so streng mit sich, Bittner.«
Fran wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Sie nippte an ihrem Tee.
»Kennen Sie Total Exposure, Commander?«
»Eine Holoshow. Dokus oder so was, glaube ich.«
»Investigative Reportagen. Londoner Produktionsfirma.«
Fran nickte, nippte erneut.
»Einer von deren Reportern ist schon länger auf unserer Liste. Calvary Doyle.«
Hardhouse öffnete einen schmalen Ordner, nahm ein Foto heraus und legte es auf den Tisch. Es zeigte einen Mittvierziger, hellhäutig und blond, mit markantem Kinn und Adlernase.
»Doyle interessiert uns, seit er diese Reportage über Turing II gedreht hat.«
Vor über fünfzig Jahren hatte die Menschheit die Kontrolle über einen intelligenten Computer namens Æther verloren, ein Ereignis, das als Turing-Zwischenfall in die Geschichte einging. Benannt war die Katastrophe nach dem Mathematiker Alan Turing, der sich bereits vor hundertfünfzig Jahren mit der Frage auseinandergesetzt hatte, unter welchen Voraussetzungen man einen Computer als intelligentes, dem Menschen ebenbürtiges Wesen betrachten musste. Æther war Menschen nicht nur ebenbürtig gewesen, sondern weit überlegen.
Vor einigen Jahren war jemand auf die Idee gekommen, den superintelligenten Rechner erneut in Betrieb zu nehmen. In letzter Minute war es UNANPAI gelungen, die Künstliche Intelligenz zu zerstören, bevor Æther die Kontrolle über den Planeten übernehmen konnte. Dieses Ereignis bezeichnete man inzwischen gemeinhin als zweiten Turing-Zwischenfall, kurz Turing II.
»Es gab sehr viele Filme und Dokus über Turing II, Direktor.«
»Ja, aber Doyles Arbeit war in doppelter Hinsicht auffällig. Erstens, weil er in seinem Film der Wahrheit so nahe gekommen ist wie sonst kaum einer. Und zweitens, weil er in der Öffentlichkeit immer wieder gewisse … Meinungen geäußert hat.«
»Sie meinen, er ist Pro-KI?«
»Er sieht unsere Arbeit kritisch. Glaubt wohl, dass Æther letztlich auf der Seite der Menschheit gestanden habe, dass man vielleicht sogar«, Hardhouse seufzte, »eine neue KI bauen sollte.«
Fran nickte grimmig. Der KI-Bauversuch der Sethianer war nicht der einzige, den UNANPAI in den vergangenen drei Jahren vereitelt hatte. Die Welt, so schien es, war völlig verrückt geworden. Aber warum? Die einzige logische Antwort lautete: Turing II. Æthers erneutes Erwachen hatte etwas verändert, viele Menschen schienen seitdem im KI-Fieber zu sein. UNANPAIs Haussoziologen vertraten die Ansicht, der zweite Zwischenfall habe die Gesellschaft daran erinnert, dass der Bau einer weiteren KI möglich sei, und in vielen den Wunsch geweckt, die verfemte Technologie doch wieder einzusetzen. Fran erschien diese Hypothese kontraintuitiv. Der zweite Zwischenfall war eine Mahnung an die Welt gewesen, nicht nachzulassen und KI-Umtriebe noch energischer als bisher zu verfolgen. In gewisser Hinsicht geschah das auch. Das Budget von UNANPAI war massiv aufgestockt worden. Mehrere Föderativen hatten ihre Turing-Gesetze verschärft.
Aber gleichzeitig brodelte es. Einige Leute argumentierten, die Zeit sei gekommen, eine bessere, eine sichere KI zu bauen. Viel zu viele Menschen glaubten diesen Schwachsinn.
»Ich befürchte, Doyle steht mit seiner Meinung nicht alleine da, Sir.«
»Nein. Aber dass er eventuell Pro-KI-Thesen vertritt, ist nicht der Grund, dass ich Sie habe holen lassen. Ich schicke voraus, dass dies ein ungewöhnlicher Auftrag sein könnte, sehr ungewöhnlich. Nun … ich fange am besten mit dem an, was sich kürzlich ereignet hat. Vor einer Woche hat jemand auf Doyle geschossen, mitten in London.«
»Getroffen?«
»Blattschuss. Ins Auge.«
Erneut betrachtete Fran das Foto. Sie musste zugeben, dass sie den Kerl nicht unattraktiv fand.
»Doyle hat es überlebt. Notoperation im Brompton Hospital. Seitdem ist er ein Quant«, Hardhouse blickte ihr in die Augen, »genau wie Sie.«
»Weiß man, wer ihn loswerden wollte?«
»Bisher nicht. Das herauszufinden ist Ihre Aufgabe, unter anderem.«
»Ist das nicht eher ein Fall für die Metropolitan Police?«
»Wie ich schon sagte, dies ist ein ungewöhnlicher Auftrag, und niemand kann genau sagen, wohin er Sie, wohin er uns führen wird. Was mich, was UNANPAI an dem Fall interessiert, ist weniger das Tötungsdelikt. Wie ich vorhin sagte, haben wir Doyle bereits länger auf dem Radar. Er gilt als KI-Experte, er spricht mit vielen Leuten, deswegen beobachten wir ihn, allerdings eher niederschwellig. Er mag Pro-KI sein, aber bauen wird er vermutlich keine.«
»Er hat vielleicht Kontakt zu Leuten, die das vorhaben.«
»Denkbar. Was unsere Agenten auf jeden Fall mitbekommen haben, ist, dass Doyle in den Monaten vor seinem kleinen Unfall an einer größeren Recherche dran war. Viele Reisen, viele Gesprächstermine – es muss etwas gewesen sein, das mit KI zu tun hat, davon ist unsere Londoner Außenstelle überzeugt.«
»Genaueres haben die nicht?«
Hardhouse schob ihr einen Ordner herüber.
»Der Bericht von Sweet. Sie kennen ihn?«
Jocco Sweet war der Londoner Resident. So hießen bei UNANPAI die lokalen Büroleiter.
»Ja. Guter Mann, Sir.«
Hardhouse nickte.
»Warum macht er’s nicht?«, fragte Fran.
»Dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen, noch nicht. Der Grund ist aber keineswegs, dass er nicht kompetent wäre. Sie bringen einfach gewisse … Befähigungen mit.«
Ihr einnehmendes Wesen meinte Hardhouse vermutlich nicht. Sie schaute ihn fragend an.
»Zunächst einmal läuft in Ihrem Kopf ebenfalls so ein kleiner Quantencomputer.«
»In Sweets auch, soweit ich weiß. Und ein Quant denkt und empfindet nicht anders als ein herkömmlicher Mensch, Sir.«
»Ich weiß schon. Aber was Doyle angeht – der ist erst seit ein paar Tagen Quant. Ich habe gehört, dass die Erfahrung anfangs manchmal … ungewöhnlich ist. Auf jeden Fall denke ich, dass Sie besonders emphatisch sein werden, wenn es darum geht, sich in das Zielobjekt hineinzuversetzen. Hinzu kommt, dass Doyles Recherche vielleicht mit dem Turing-Zwischenfall zu tun hat, an dessen Verhinderung Sie ja beteiligt waren. Auch deshalb sind Sie die ideale Person.«
»Sie meinen, er recherchiert zu Turing II? In welcher Weise?«
»Da tappen wir im Dunkeln. Er aber auch.«
»Ich verstehe nicht.«
»Die Sache ist kurios. Wenn Sie Sweets Bericht lesen, werden Sie es verstehen. Gehen Sie diskret vor. Wir wissen nicht, wer uns zuschaut. Auf jeden Fall müssen wir so bald wie möglich wissen, was für einer Sache Doyle da auf der Spur war.«
»Und dann wissen wir auch, wer die Recherche verhindern wollte?«
»Ganz richtig. Also dann – an die Arbeit. Sie operieren alleine. Keine Berichte an die Zentrale, nur an mich. Aber erst, wenn es richtige Ergebnisse gibt, Commander.«
»Finde ich Sie hier?«
»Ich bin die nächsten Wochen im UNO-Hauptquartier in Toronto. Falls Ihre Ergebnisse auf KI-Umtriebe hindeuten sollten, begeben Sie sich zum Rapport bitte in eine unserer Lowtech-Enklaven und berichten analog.«
»Verstanden, Direktor.«
Die UNANPAI-Agentin erhob sich und salutierte. Dann machte sie, dass sie fortkam.
2
Sobald Fran wieder im Wagen saß, fühlte sie sich entsetzlich müde. Vielleicht hatte es mit der Zeitverschiebung zu tun, vielleicht mit den vielen Bodyswaps der letzten Zeit. Dennoch zwang sie sich, das Dossier aufzuschlagen. In einer knappen Stunde kam sie in Whitehorse an. Ab da reiste sie nicht mehr alleine, und Fran wusste aus Erfahrung, dass man UNANPAI-Akten wie diese besser nicht in der Öffentlichkeit las – zu auffällig. Niemand benutzte mehr herkömmliches Papier. Ungewöhnlicher als das Papier war nur noch der hellblaue Pappordner mit den metallenen Locherstreifen. So etwas gab es lediglich im Museum – und bei der KI-Polizei der UNO.
Der Gedankengang dahinter war in etwa folgender: Wenn es da draußen Künstliche Intelligenzen gab, war ihre Erlebniswelt notwendigerweise digital. Alle von Menschen irgendwo gespeicherten Daten wären einer KI zugänglich, weil kein Mensch sie so gut sichern konnte, dass ein hochintelligenter Computer nicht herankam. Der direkte Zugriff auf analoge Informationen war einer KI hingegen verwehrt, wie einem Fisch das Land. Deshalb glichen jene Teile der UNANPAI-Datenbank, in denen die wirklich kritischen Informationen aufbewahrt wurden, einem Archiv aus den Fünfzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts.
Fran schlug den Report auf. Er war mit der zweithöchsten Sicherheitsstufe versehen. Fran begann zu lesen.
Calvary Doyle war Engländer, besaß einen Commonwealth- und einen CANFED-Pass. Der Journalist hatte renommierte Schulen und Colleges besucht – Eton, Petersburg, Montreal. Seit sechs Jahren arbeitete er für Total Exposure. Mehrere seiner Reportagen und Dokumentationen waren mit Preisen ausgezeichnet worden. Fran bezweifelte dennoch, dass man von so etwas leben konnte. Dem Bericht zufolge musste Doyle das auch gar nicht, seine Familie war wohlhabend.
Nachdem sie das Doyle-Dossier zur Hälfte gelesen hatte, registrierte sie mit einer gewissen Genervtheit, dass sie die meisten enthaltenen Fakten auch mühelos hätte selbst recherchieren können. Nichts davon war besonders aufsehenerregend, nichts verdiente die Geheimhaltungsstufe »Indigo«.
Wie so oft kamen die interessanten Dinge vermutlich erst am Ende. Dennoch zwang sie sich, nichts zu überblättern und alles gewissenhaft durchzulesen – von Doyles güldener Kindheit über seine ersten journalistischen Gehversuche bis zu seinen Reportagen über Künstliche Intelligenz. Erst auf den letzten Seiten gab es ein paar Details zu dem, was der Journalist in den vergangenen Monaten getan hatte. Offenbar war er viel durch Nordamerika und durch Asien gereist. Außerdem hatte er sich mehrere Wochen im All aufgehalten. Bei seinen Reisen war er sehr diskret vorgegangen. Oft nahm er nicht die Züge oder Flieger, die er Wochen zuvor gebucht hatte, sondern disponierte kurzfristig um. Doyle sprang im letzten Moment aus Bussen, ließ Taxifahrer kreuz und quer durch die Stadt fahren, nur um mitten auf einer Kreuzung aus dem Fahrzeug zu springen. »Es ist deshalb zu vermuten, dass Doyle davon ausgeht, verfolgt zu werden«, schlussfolgerte der Autor des Berichts. Das war derart scharfsinnig, dass es Fran einen Gähner entlockte.
UNANPAIs Hacker hatten versucht, Doyles Systeme zu infiltrieren, um an seine Rechercheprotokolle zu gelangen. Die Rechner zu knacken war anscheinend kein Problem gewesen, die Inhalte erwiesen sich allerdings größtenteils als verschlüsselt. Überhaupt schien sich nur sehr wenig Material auf den Computern des Journalisten zu befinden. Nach Einschätzung von Special Agent Jocco Sweet verwendete Doyle zur Geheimhaltung und Verschleierung seiner Aktivitäten »die UNANPAI-Methode«, wie er das in seinem Bericht nannte. Anders gesagt: Doyle notierte sich seine Rechercheergebnisse auf Papier. Fran musste grinsen. Der Typ schlug sie quasi mit ihren eigenen Waffen.
Der Londoner Resident hatte daraufhin geplant, sich die Informationen auf die gute alte Weise zu besorgen, indem er in Doyles Apartment in Fitzrovia einbrach, alles filzte und bei der Gelegenheit überall Kameras installierte. Aber dazu war es nicht mehr gekommen. Dem Dossier zufolge war die Aktion bereits terminiert gewesen, für den Abend des sechsten Mai. Am Morgen desselben Tages wollte Doyle nämlich nach Nuuk fliegen, um in der Millionenstadt Interviews bei einigen IT-Firmen zu führen. Er würde drei Tage fort sein, das zumindest legten Hotel- und Flugbuchungen nahe.
Aber dann war Doyle niedergeschossen worden, am Tag vor seiner Abreise. Der Einbruch wurde abgeblasen, weil zu befürchten stand, dass die Metropolitan Police ebenfalls in Doyles Apartment auftauchte. Diese Befürchtung erwies sich jedoch als unbegründet, denn während der ersten Nacht, die Doyle im Brompton Hospital verbrachte, brannte sein Wohnhaus aufgrund einer Gasexplosion komplett aus.
»Nie im Leben«, murmelte Fran.
Sweet war derselben Ansicht. Der Brand musste im Zusammenhang mit dem Attentat stehen. Jemand wollte nicht nur einen lästigen Mitwisser loswerden, sondern außerdem sämtliche analogen Beweismittel in Rauch aufgehen lassen.
Fran wurde allmählich klar, warum nicht die Londoner UNANPAI-Zelle die Untersuchung fortführte, sondern sie. Hardhouse hatte Sweet zwar gelobt, aber eigentlich musste man konstatieren, dass der Chef ihrer Londoner Dependance es kolossal vermasselt hatte. Trotz wochenlanger Arbeit konnte Sweet nicht sagen, was für eine Geschichte das eigentlich war, der Doyle hinterherrecherchierte. Nach dem Attentat wäre es zudem notwendig gewesen, unverzüglich in Doyles Apartment einzubrechen. Doch Special Agent Sweet hatte im entscheidenden Moment gezögert. Und nun besaßen sie rein gar nichts.
Fran ging das Dossier erneut durch. So wie es aussah, war Doyle Anfang Februar auf einer Technologie-Konferenz in La Paz gewesen. Danach hatte seine Reisetätigkeit signifikant zugenommen. Sweet schlussfolgerte daraus, ihre Zielperson habe auf der Konferenz irgendetwas erfahren, das eine große Recherche ausgelöst hatte. In den folgenden Wochen war Doyle in insgesamt vierzehn Städten gewesen, darunter Seattle, Petersburg, Johannesburg, Hongkong und Sapporo. Letzteres erregte Frans Aufmerksamkeit, denn dort befand sich das UNANPAI-Hauptquartier. Allerdings saßen in Sapporo auch ein Haufen Technologiefirmen. Was Doyle dort im Einzelnen getan hatte, stand nicht in Sweets liederlichem Report.
Die Reise, die Fran jedoch am stärksten ins Auge stach, war die ins All. Vom zweiten bis zum neunzehnten April war Doyle oben gewesen. Was hatte er dort gemacht? Darüber schwieg das Dossier sich aus. Nun, so ganz stimmte das nicht: Vielmehr erklärte der Bericht, wieso man Doyles Spur im All nicht habe folgen können.
Diese Erklärung war auch bitter nötig. Während es auf der Erde relativ einfach war, seine Spuren zu verwischen – man fuhr mit einem Auto ohne Transponder, überquerte die grüne Grenze, mietete sich einen Privatjet –, war derlei im Weltraum unmöglich. In der Regel gab es nur ein einziges Shuttle, das einen beispielsweise vom Mond zum Mars brachte, und um die Einreiseformalitäten konnte man sich auch nicht drücken, schließlich mussten alle durch dieselbe Luftschleuse. Doch so wie es aussah, hatte Doyle zwar die Orbitalstation des Weltraumaufzugs erreicht, dort verlor sich seine Spur jedoch. Hatte er sich das Weltraum-Äquivalent eines Privatjets gemietet? Gab es so etwas überhaupt? Fran war sich nicht sicher. Ihr Gefühl sagte ihr, dass Doyle dort oben etwas Wichtiges herausgefunden haben musste, denn nach der Rückkehr hatte er seinem Produktionsstudio signalisiert, man werde nun bald mit dem Dreh eines neuen Beitrags beginnen können.
Und dann hatte ihn jemand abgeknallt. Doyles großes Glück war, dass er irgendwann vor seinem Weltraumtrip einen Brainscan hatte machen lassen. Außerdem hatte er einen Qube gekauft, einen jener kleinen Quantencomputer, die notwendig waren, um eine Gehirn-Emulation laufen zu lassen.
Er musste gewusst haben, dass ihm Gefahr drohte. Der Quantencomputer und der Scan waren eine Lebensversicherung, anders ließ sich das kaum interpretieren. Allerdings kostete alleine der Qube eine halbe Million Eurodollar. Hinzu kamen der Scan, die Cogit-Software, der chirurgische Eingriff. Seinen Verstand zu digitalisieren war etwas, das außerhalb der finanziellen Möglichkeiten der meisten Menschen lag. Darum gab es auch nur ein paar Millionen Quants – oder wie die Normalos Fran und ihresgleichen zu nennen pflegten: Hohlköpfe.
Das Dossier enthielt ein Addendum, das erst kürzlich eingefügt worden war. Ihm zufolge wurde Doyle voraussichtlich übermorgen aus dem Krankenhaus entlassen. Mehr war aus der Akte nicht herauszuholen.
Ihr Selbstfahrer gab einen Laut von sich. Fran sah auf. In weniger als fünf Minuten würden sie den kleinen Flughafen von Whitehorse erreichen. Sie überlegte. Von Anchorage konnte sie einen Direktflug nehmen, der sie in weniger als drei Stunden nach London brachte, aber das war unpraktikabel. Sie musste zunächst nach Berlin, ihrem derzeitigen Wohnsitz. Für diesen Auftrag, das ahnte sie, würde sie ihre gesamte Garderobe an Gefäßen benötigen. Fran seufzte. Swaps. Noch mehr Swaps.
3
Als Erstes tauchen ihre Banner auf dem Hügelkamm auf: gelbe Stoffstreifen, die an langen Stangen im Wind flattern, ohne Symbole oder Schriftzeichen darauf. Er ist nicht der Einzige, dem die sich nähernde Prozession auffällt. Ivar, der Sohn des Gemeindevorstehers, schreit: »Sie kommen! Die Auserwählten des Gelben, sie kommen!«
Er stellt den Wassereimer ab, mit dem ihn seine Mutter zum Brunnen geschickt hat, beschirmt die Augen, um besser sehen zu können. Auf dem Hügel wachsen die Flaggen weiter in den Himmel empor, bis nach einigen Sekunden die Bannerträger auftauchen. Sie sind in Tuch gewandet, das dieselbe Farbe besitzt wie die Flaggen – es ist ein sattes Goldgelb, das ihn an Sonnenblumen erinnert. Unwillkürlich hält er den Atem an. Er zählt insgesamt acht Träger. Gesandte des Gelben haben normalerweise lediglich einen Fahnenträger bei sich. Wenn derart viele auf einmal kommen, steht zweifellos etwas Bedeutendes bevor.
Als Nächstes kommen die Paladine des Gelben, zehn an der Zahl. Sie reiten auf jenen seltsamen Eisenpferden, von denen er zwar schon gehört, die er aber noch nie zu Gesicht bekommen hat. Sie erinnern entfernt an Wagen, nur werden sie weder von einem Pferd noch von einem Ochsen gezogen, und sie bewegen sich schneller, viel schneller. Die Ritter des Gelben kommen im Zickzack den Hügel hinab und beziehen an verschiedenen Punkten Position, Blitzwerfer im Anschlag.
Inzwischen ist er schweißgebadet. Ins Dorf kommen selten Besucher, zweimal im Jahr der Badermeister, ab und an ein Krämer oder Gaukler. Ihr Leben besteht aus Feldarbeit und Jagd. Niemand interessiert sich für sie, schon gar nicht der Zauberer.
Immer mehr Dorfbewohner versammeln sich auf dem Platz in der Mitte der Siedlung. Nun sieht er auch seine Mutter, die sich durch die Menge drängt und ihm bedeutet, zu ihr zu kommen. Er schüttelt den Kopf. Von seinem Platz am Brunnen, der in ein gemauertes Podest eingelassen ist, kann er hervorragend sehen.
Ein Raunen geht durch die Menge, Finger recken sich gen Himmel. Er schaut nach oben. Mehrere Vögel schweben über dem Hügelkamm. Sie scheinen sich in Richtung des Dorfs zu bewegen. Nein, das sind keine Vögel. Sie bewegen sich eher wie Fliegen oder Wespen. Dafür sind sie freilich viel zu groß. »Was ist das?«, entfährt es ihm.
Er bemerkt, dass sich eine Hand auf seine Schulter legt. Sie gehört dem alten Juri, von dem man sagt, er habe noch im Allkrieg gekämpft. Juri selbst redet nicht darüber, die anderen dafür umso mehr. »Das, mein Sohn«, sagt der Alte, »sind Drochen.«
»Ihr meint Drachen?«, erwidert er.
»Nein. Drochen. Die Hetzhunde des Zauberers. Schreckliche Bestien, schneller als ein Falke und erbarmungsloser als ein Wolf.«
Ihm schaudert ob dieser Beschreibung, aber es ist ein wohliger Schauder. Endlich passiert einmal etwas, und er glaubt, dass es nichts Schlimmes sein wird. Sicher hat der Gelbe Zauberer keine Veranlassung, ihrem Dorf zu zürnen. Jeden Morgen hissen sie seine Standarte über dem Gemeindehaus. Wenn einer seiner Priester durch das Dorf kommt, werfen sie sich ihm zu Füßen und tun alles, was er verlangt. Sie sind loyale Diener, und das, so sagt man, schon seit langer Zeit.
Ein Gefährt rollt den Berg hinab, das aussieht wie eine zu groß geratene Metallkiste. Juri, der noch immer neben ihm steht, bezeichnet es als »Panzerwagen«. Das Vehikel hält am Rande des Dorfs. Er bemerkt, dass er einige Schritte in Richtung des Panzers getan hat, ohne dass seine Beine seinen Kopf zuvor um Erlaubnis gefragt haben. Er ist nicht der Einzige. Kurz darauf steht das ganze Dorf vor dem Gefährt, in respektvollem Abstand. Die Paladine haben sich um das Fahrzeug herumgruppiert, die Bannerträger bilden ein Spalier. Er glaubt, vor Anspannung wahnsinnig zu werden, denn eine Zeit lang passiert überhaupt nichts. Dann hört man ein zischendes Geräusch, und eine Klappe in der Seite des Panzerwagens öffnet sich. Heraus treten zwei Männer und zwei Frauen. Es sind Auserwählte, durchweg groß und schlank, alle in denselben schwarzen Roben, mit einem in strahlendem Gelb gehaltenen Tabard darüber. Auf ihren rasierten Köpfen sitzen silberne Kronen.
Erneut spürt er Juris Hand auf seiner Schulter, doch diesmal ruht sie dort nicht sanft, sie drückt ihn zu Boden.
»Runter, Tölpel«, zischt der Alte.
Nun erkennt er, dass sich alle anderen bereits in den Staub geworfen haben. Als er niedersinkt, meint er zu bemerken, dass ihn eine der Gelben Priesterinnen ansieht. Lächelt sie ihm etwa zu? Dann berührt seine Stirn den Boden, und er sieht nur noch Dreck.
»Willkommen, Auserwählte des Herrlichen«, hört er die Stimme des Bürgermeisters. »Eure ergebensten Untertanen stehen zu Euren Diensten.«
»Es ist gut«, erwidert eine männliche Stimme. »Erhebt euch.«
Zögerlich stehen die Dorfbewohner wieder auf und mustern die Auserwählten erwartungsvoll. Einer von ihnen, ein Mann mit Hakennase und stechenden Augen, wendet sich der Menge zu.
»Ich grüße euch! Mein Name ist Krek, Hierophant des zweiten Grades. Ich überbringe euch Grüße aus der Zitadelle. Euer Lehnsherr, der Gelbe Zauberer, ist sehr zufrieden mit euch.«
Die Dorfbewohner schauen einander an. Er fühlt sich auf einmal einige Fingerbreit größer. Der Gelbe Zauberer hat sein allsehendes Auge auf sie geworfen. Nicht ins benachbarte Krno ist er gekommen und auch nicht ins prächtige Vlik, sondern hierher, in ihr verschlafenes Dorf. Das ist sicher ein gutes Zeichen. Er blickt in das Gesicht von Juri. Wenn der Alte sich genauso freut wie er, verbirgt er es gut.
»Die Zitadelle hat beschlossen, euch besondere Ehre zu erweisen. Einer der euren wird uns begleiten, wird in den Mysterien unterwiesen. Erweist die Person sich als würdig, soll sie auserwählt werden, dem Gelben zu dienen.«
Ein Raunen geht durch die Menge. Kein gewöhnlicher Sterblicher hat den Zauberer je zu Gesicht bekommen. Nach dem wenigen, was er weiß, sind gewöhnliche Sterbliche nicht dazu geschaffen, das Antlitz des Gelben zu schauen – nicht nur, weil sie unwürdig sind, sondern auch, weil ihr schwacher Geist den Anblick nicht aushielte. Nur die Auserwählten können, nach jahrelanger Unterweisung, mit dem Zauberer in Verbindung treten. Und diese Ehre soll einem der ihren zuteilwerden? Das ist kaum vorstellbar.
»Um den besten Mann oder die beste Frau zu finden, werden wir euch prüfen. Fürchtet euch nicht! Die Prüfungen sind weder schmerzhaft noch anstrengend. Es sind vor allem Prüfungen des Verstandes, denn der Erhabene wählt nur die Klügsten und Talentiertesten aus.«
Die Klügsten – das bedeutet, dass man ihn ganz sicher nicht wählen wird. Er kann schneller laufen als die meisten anderen Kinder, schneller sogar als Aljos. Und er kann laut schreien, so laut, dass, wie seine Mutter zu sagen pflegt, davon noch die Fensterläden in Vlik wackeln. Außerdem vermag er sich hervorragend Dinge zu merken, Gedichte, Lieder, Vogelarten. Aber er schreibt und liest viel langsamer als die anderen. Mit dem Rechnen ist es noch schlimmer. Er ist, wie sein Stiefvater regelmäßig bemerkt, »wie gemacht für die Feldarbeit«.
Der Bürgermeister verneigt sich tief und bedankt sich bei den Priestern für die ebenso unverdiente wie unermessliche Ehre, was der Hakennasige mit ungeduldigem Nicken quittiert. Er gibt den Paladinen ein Zeichen, woraufhin diese beginnen, eine Art Zelt zu errichten. Genauer gesagt scheint das Zelt sich selbst zu errichten, ohne dass einer der Männer Hand anlegen muss. Angesichts dieses Wunders geht ein weiteres Raunen durch die Menge.
Ein paar Minuten später haben die vier Auserwählten in dem Zelt Platz genommen. Die Dorfbewohner stehen davor. Einer nach dem anderen werden sie hineingeführt. Juri und er stehen ziemlich weit hinten. Seine Mutter hat es irgendwie geschafft, sich direkt hinter ihnen einzureihen. Während sie warten, redet sie auf ihn ein. Dass er dem Dorf nur ja keine Schande macht. Dass er genau das tut, was die Auserwählten von ihm verlangen. Dass er nicht respektlos ist, so wie ihr gegenüber. Er quittiert es mit »Ja, Mamuschka«.
Sie erreichen das Zelt. Er steht vor dem Eingang und wartet darauf, dass die Wächter ihm ein Zeichen geben. Er hat beobachtet, dass die Untersuchung durch die Priester stets ein paar Minuten dauert. Danach verlässt der Geprüfte das Zelt durch einen Ausgang auf der anderen Seite und stellt sich auf die Schafswiese. Inzwischen stehen dort bereits zwei Drittel der Dorfbevölkerung.
»Der Nächste«, sagt einer der Paladine. Seine Mutter ruft ihm eine weitere Ermahnung zu, aber er hört es nicht. Sein Blick ist auf den gepanzerten Arm des Paladins gerichtet, der die Zeltplane beiseiteschiebt. Er geht hinein. Rechter Hand ist ein Tisch, an dem drei der Auserwählten sitzen. Der mit der Hakennase steht in der Mitte des Zelts und nickt ihm zu. In seiner Rechten hält er einen kleinen Kasten, auf dem leuchtende Symbole zu sehen sind. Der Priester richtet das Ding auf ihn. Instinktiv weicht er zurück.
»Hab keine Angst«, sagt eine der Priesterinnen. Es ist die Frau, die ihm vorhin zugelächelt hat. Sie mag Ende zwanzig sein, vielleicht auch älter. Das Alter von Erwachsenen ist für ihn immer schwer einzuschätzen. Ihre weite Robe und der rasierte Kopf machen es nicht einfacher.
Als er die Frau und die anderen Auserwählten aus nächster Nähe betrachtet, fällt ihm auf, dass ihre Kronen sehr seltsam aussehen. Möglicherweise sind es überhaupt keine. Es handelt sich um etwa drei Finger breite Metallbänder, die um die Schädel der Priester herumlaufen. Diese Kronen, Stirnreife, was auch immer, sitzen nicht auf dem Kopf, sondern irgendwie darin. Der Übergang zwischen Haut und Metall scheint nahtlos.
Die Hakennase kommt auf ihn zu. »Das, was ich da in der Hand habe«, sagt er, »ist ein Zauberstab. Mit seiner Hilfe kann ich prüfen, ob du gesund bist, verstehst du?«
Er legt den Kopf schief.
»Ich bin kerngesund. Als im letzten Sommer das Kornfieber umging, hab ich’s als Einziger nicht bekommen.«
»Ich verstehe. Wende dich nun bitte dem Tribunal zu.«
»Dem … dem was, oh Auserwählter?«
»Den drei Leuten hinter dem Tisch. Sage zunächst deinen Namen.«
Er wendet sich dem Tisch zu, verneigt sich. »Mein Name ist Franek.«
Sie fragen ihn nach seinem Alter, seinen Eltern, seiner Arbeit. Er beantwortet alle Fragen wahrheitsgemäß. Als Nächstes zeigt der Hakennasige auf die Zeltwand. Offenbar hat er einen Zauber gewirkt, denn auf der Plane sind auf einmal verschiedene Symbole zu sehen, die Franek in eine bestimmte Reihenfolge bringen soll. Dann erscheinen Bilder von Gegenständen. Nachdem sie verschwunden sind, soll er sie aufzählen. Als Letztes kommen Rechenaufgaben. Die bringen ihn mächtig ins Schwitzen.
»Gute mnemonische Anlagen«, sagt eine unfreundlich dreinblickende Frau, »aber sein IQ scheint mir bescheiden.«
Die andere Frau, jene, die ihn angelächelt hat, sagt: »Wir suchen keinen Intellektuellen.«
»Nein. Aber auch nicht den Dorftrottel.«
Er hat bisher nur gesprochen, wenn man ihn dazu aufgefordert hat. Nun aber sagt er ungefragt: »Ich bin kein Trottel.«
»Und vorlaut«, sagt die unfreundliche Frau. »Sei’s drum, Impulsivität könnte von Vorteil sein. Jetzt die Tonalität.«
Die freundliche Frau greift nach einem Apparat, der vor ihr auf dem Tisch liegt. Es scheint ein weiterer Zauberstab zu sein. Er ist schwarz, auf einer Seite ist eine graue Kugel angebracht.
»Komm her, Franek«, sagt sie und hält ihm den Stab hin. Nach kurzem Zögern greift er danach.
»Halte ihn so, dass die Kugel ein Stück von deinen Lippen entfernt ist. Ja, so ist es gut.«
Sie schaut ihm direkt in die Augen.
»Sag, kannst du singen?«
Er nickt.
»Dann sing uns ein Lied.«
Er überlegt einen Moment. Dann beginnt er leise, die erste Strophe von »Des Frühlings goldnes Band« zu singen.
»Du singst sehr schön. Aber lauter jetzt«, sagt die freundliche Frau.
Von diesem unerwarteten Lob angespornt legt er richtig los. Diesmal gibt er »Den Reigen der Maid« zum Besten, schmettert die erste Strophe in den Zauberstab. Vermutlich hört man seine Stimme noch am anderen Dorfende.
»Vielen Dank. Und nun wirst du verschiedene Töne und Tonfolgen hören. Versuch bitte, sie nachzusingen, so gut du kannst.«
»Soll ich laut singen?«
»Wichtiger ist, dass du die Töne triffst. Weißt du, was das heißt?«
Er nickt. Die Frau drückt auf einen Knopf auf dem Tisch, woraufhin aus dem Nichts Töne erklingen, erst einzelne, dann ganze Melodien. Dazwischen gibt es Pausen, in denen er das Gehörte nachsingt, so gut er kann. Nach einiger Zeit hebt die unfreundliche Frau die Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen.
»Und?«, sagt sie.
Die freundliche Frau schaut auf ein kleines Gerät und schüttelt den Kopf. Sie lächelt. »Unglaubliche siebenundneunzig Komma vier. Ein Naturtalent.«
Sie schaut ihn an. »Du bist es Franek. Du bist der Erwählte.«
4
Fran setzte sich an einen der Tische in der Lobby und sah sich um. Das »Stansgate« war ein Fünfsternehotel in der Nähe des Covent Garden. Es versuchte, gleichzeitig modern-international und traditionell-britisch daherzukommen – eine stilistische Quadratur des Kreises. Die Lobby schien Fran denn auch ziemlich misslungen. Auf den Zimmern war es kaum besser: futuristische Designerlampen, Regency-Stühle, Chippendale-Sofas. Nichts passte zusammen. Den meisten Gästen waren derlei Feinheiten vermutlich schnuppe, Fran Bittner aber nicht. Er war ein feinsinniger Mensch mit einem ausgeprägten ästhetischen Empfinden, weswegen er unter derartigen stilistischen Vergehen beinahe körperlich litt.
Eine Kellnerin kam an den Tisch.
»Was darf ich Ihnen bringen, Sir?«
»Einen doppelten Espresso und ein stilles Wasser, bitte.«
Die Kellnerin nickte und verschwand. Fran musterte sich in einem der goldgerahmten Spiegel auf der anderen Raumseite. Er war sehr schlank, mit olivfarbenem Teint und einer Physiognomie irgendwo zwischen südamerikanisch und italienisch – melting pot style, wie Gefäßdesigner es zu nennen pflegten. Fran trug einen leichten Sportanzug in Prince-of-Wales-Karo, dazu hellbraune Brogues und Strickkrawatte. Einige Sekundenbruchteile lang schien ihm, er betrachte nicht sich selbst. Es war, als habe sein Verstand jemand anderen erwartet, beispielsweise die Eurasierin mit der Vorliebe für Hosenröcke, die er gestern gewesen war.
Man bezeichnete das Phänomen als vessel vertigo, Gefäßschwindel. Es trat auf, wenn man zu oft den Körper wechselte, und glich in gewisser Weise jenem Effekt, mit dem manche Geschäftsreisende nach einer langen Tour zu kämpfen hatten: Man wachte morgens in einem Hotelbett auf und war sich nicht sicher, in welcher Stadt man sich befand. So war es beim vessel vertigo auch. Wenn man viel reiste und gleichzeitig viele Bodyswaps machte, konnte man, wie Fran wusste, sogar beide Effekte erleben: Man wachte auf und wusste weder wo noch wer man war.
Der Moment verging so schnell, wie er gekommen war. Bei manchen dauerten die Schwindelanfälle mehrere Minuten oder noch länger. Bei Fran waren es stets nur Sekundenbruchteile, einer der Gründe, warum er für diesen Job wie geschaffen war.
Der Espresso kam. Fran dankte der Kellnerin, die ihn, wie er feststellte, ein wenig schmachtend musterte. Er schenkte ihr ein Lächeln, freundlich zwar, jedoch ohne jedwedes romantische Versprechen darin. Sobald sie fort war, schaute er sich nochmals in der misslungenen Lobby um. Unter normalen Umständen hätte er sich niemals hier einquartiert. Aber Calvary Doyle hatte im »Stansgate« eine Suite reserviert, als Ersatzdomizil. Sein Apartment in Fitzrovia war unbewohnbar. Es stand sogar zu befürchten, dass das ganze Haus abgerissen werden musste.
Er schaute auf die Uhr. Wenn Doyle nach der Morgenvisite entlassen wurde, trudelte er vermutlich gegen elf oder halb zwölf ein. Ihm blieb also noch Zeit. Er würde sich den Rest von Doyles Doku anschauen. Fran steckte sich einen Kopfhörer ins Ohr und rief über dem Tisch ein Holofenster auf.
»Film fortsetzen«, sagte er. »Das Æther-Mysterium.«
… wurde die Æther-Anlage seinerzeit an einem geheimen Ort errichtet: in einer unterirdischen Anlage auf einer der abgelegensten Inseln der Welt.
Eine Erdkugel erschien. Die Kamera zoomte heran, in eine Region irgendwo zwischen Kap der Guten Hoffnung und Antarktis, auf der nichts außer Wasser zu sehen war. Erst als sich der Ausschnitt noch weiter vergrößerte, wurde eine Insel sichtbar.
Die Île de la Possession ist ein unbewohntes vulkanisches Eiland unter UNO-Verwaltung. Hier nahm die Æther-Einrichtung im Jahr 2045 ihren Betrieb auf. Es gibt keine Bilder von der Anlage, weder Fotos noch Videos. Diese Skizze, die der Computertechniker Leslie Woo seinerzeit trotz schärfster Kontrollen von der Insel nach Hause schmuggelte, ist die einzige Visualisierung des Herzens von Æther.
Eine Zeichnung wurde eingeblendet. Sie zeigte einen Raum, der kugelförmig zu sein schien. Er war leer, bis auf ein Podest in der Mitte. Die Zeichnung war mit grauem Bleistift ausgeführt, mit einer Ausnahme: Das Objekt auf dem Podest war blau schraffiert. Es handelte sich um einen Würfel.
Æther war in der Lage, selbst komplexe Probleme wie den Klimawandel selbstständig zu analysieren, technische Lösungen zu erarbeiten und diese umzusetzen. Der kleine blaue Würfel war ein Symbol der Hoffnung, aber nicht lange. Æther drehte durch, 2048 wurde die Anlage gesprengt, um der entfesselten KI Einhalt zu gebieten. Zurück blieb eine mit B-Waffen verseuchte Insel, abgeschnitten vom Rest der Welt. Æthers Kern wurde unter Schutt und Trümmern begraben.
Doch dann, im Jahr 2088, mehrten sich die Anzeichen dafür, dass jemand die Æther-Anlage wieder in Betrieb genommen hatte. UNANPAI-Spezialisten wurden auf die Insel geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Zu ihrem Erstaunen fanden sie den Æther-Rechner voll einsatzfähig vor.
Nun erschien ein Trupp Soldaten, auf deren Uniformen die UNO-Kokarde zu sehen war. Mit grimmigen Mienen und schwer bewaffnet stapften sie über eine Vulkaninsel mit dürftiger Vegetation. Vor ihnen konnte man einen Hang erkennen, auf dessen Kamm ein hoher weißer Felsen aufragte. Fran spürte, wie sich seine Nackenmuskeln verkrampften.
Es gab einen Schnitt. Als Nächstes waren die Soldaten in der Sphäre zu sehen, in deren Mitte der kleine blaue Würfel stand. Sie hatten ihre Gewehre im Anschlag. Einige von ihnen waren dabei, Sprengstoffladungen an den Wänden anzubringen. Frans Hand begann zu zittern. Er musste die Tasse abstellen, damit nichts danebenging. Am unteren Bildrand erschien eine Einblendung: »NACHGESTELLT – NICHT DIE TATSÄCHLICHEN EREIGNISSE«.
Fran schnaubte. »Ach was.«
Das Einzige, was die Menschheit 2088 rettete, war, dass die KI aufgrund der isolierten Lage der Île de la Possession keine Verbindung zu den globalen Datennetzen aufbauen konnte. Und so ließ sich die Katastrophe im letzten Augenblick verhindern. Bei der ersten Æther-Deaktivierung im Jahr 2045 hatte man sich damit begnügt, die Insel mit Marschflugkörpern zu bombardieren – ein katastrophaler Fehler von UNANPAI. Diesmal ging man auf Nummer sicher.
Die Soldaten klebten den Plastiksprengstoff nicht nur an die Wände, sondern brachten auch an dem Würfel eine Sprengladung an, so groß, dass sie das kleine Objekt vollständig pulverisieren musste. Ein Schnitt, die Soldaten hasteten den Hang hinab. Hinter ihnen explodierte die Bunkeranlage, Gesteinsbrocken flogen in alle Richtungen. Die Kamera zoomte heraus. Über der Insel stand eine gigantische Rauchlohe.
Ein zweites Mal wurde die Menschheit gerettet. Aber viele Fragen bleiben offen. Bis heute weigern sich die UNO sowie die an der Kommandoaktion im südlichen Atlantik beteiligten Föderativen, zu enthüllen, wer eigentlich für Turing II verantwortlich ist. Wer nahm die deaktivierte KI wieder in Betrieb? Wer ist für den größten Computer-GAU der Geschichte verantwortlich? Und ist die Menschheit nun wirklich sicher? Oder könnte es wieder passieren? Und war Æther wirklich noch eine Bedrohung? Oder ist das nur etwas, das die KI-Behörde uns glauben machen will?
Rauchende Trümmer waren zu sehen. Zwischen den Brocken lag ein kleines Objekt, ein verschrammter blauer Würfel. Auf einmal begann der Würfel aus seinem Inneren heraus zu leuchten und zu pulsieren, begleitet von bedrohlich klingender Musik. Fran musste ein Lachen unterdrücken. Nicht die tatsächlichen Ereignisse – aber selbst wenn dies eine dramatisierte Nacherzählung war, was glaubte dieser Doyle? Dass sich im Inneren des Æther-Qubes eine Glühbirne befand?
Schnitt. Eine Frau erschien. Ihren Look individualistisch zu nennen wäre eine Untertreibung gewesen. Oszillierende grüne Dreadlocks, Kinnverlängerung, Katzenpupillen, außerdem ein Gesichtsfilter mit Lackeffekt – es sah aus, als habe jemand der Frau mehrere Schichten Epoxidharz auf die Visage gepinselt. Auf ihrem T-Shirt stand »IT IS OUT THERE«. Der Bauchbinde zufolge hieß sie Fatima Tits und war »Ætherianica-Expertin«. Sie begann zu sprechen.
»In der Ætherianica-Community gibt es natürlich Hunderte Theorien und Hypothesen zum genauen Ablauf von Turing II, aber letztlich sind sie alle Varianten von drei Szenarien. Nummer eins: Die KI hat die ganze Zeit geschlafen, vielleicht hat sie Energie konserviert oder so. Irgendwann ist es ihr gelungen, sich selbst wieder hochzufahren. Dass sie dafür über vierzig Jahre gebraucht hat, mag uns seltsam erscheinen. Aber für eine unsterbliche Superintelligenz wie Æther ist das nur ein Wimpernschlag.
Nummer zwei: Jemand anderes hat sie hochgefahren. Jemand, der meinte, das sei die einfachste Möglichkeit, an eine KI zu kommen. Selbst eine zu bauen ist zwar theoretisch machbar, genau wie bei der Atombombe sind die Baupläne bekannt. Aber es ist aufwendig, und UNANPAI kontrolliert den Einsatz von Qubes, registriert alle Programmierer und so weiter. Einige glauben, dass ein Verbrecherkartell für die Æther-Reaktivierung verantwortlich war, vermutlich die Solntsevkaya Bratva.«
»Völlig daneben«, murmelte Fran und nippte an seinem inzwischen ziemlich kalten Espresso.
»Oder es könnte ein Supernational gewesen sein. Viele hatten Arkenziel im Verdacht, bei denen hat es zeitgleich eine große Polizeiaktion gegeben damals. Aber konnte nie bewiesen werden. Und die dritte Theorie ist natürlich, dass UNANPAI den ganzen Zirkus selbst veranstaltet hat. Ich meine, überlegen Sie mal. Nach Turing I wurde diese KI-Stasi mit extrem weitreichenden Kompetenzen ausgestattet. Die dürfen jeden überwachen, in fast allen Föderativen tätig werden, ohne irgendwelche richterlichen Beschlüsse. Und vierzig Jahre nach Turing I kam UNANPAI allmählich die Existenzberechtigung abhanden – keine KI weit und breit, ja? Das Budget der Behörde sollte massiv gekürzt werden. Egal ob sie es selbst inszeniert haben oder nicht – Turing II war ein Glücksfall für UNANPAI.«
Fatima Tits verschwand, worüber Fran nicht unglücklich war. Lange hätte er sich diesen Schwachsinn nicht mehr anhören können. Nun wurde erneut die Insel gezeigt. Die Kamera zoomte hinaus, bis eine Nachtansicht der kompletten Erde zu sehen war.
»Die Frage ist: Sind wir wirklich sicher? Turing II hat viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Sind wir gut genug gerüstet gegen weitere KI-Zwischenfälle? Gibt es Kriminelle oder Konzerne, die trotz des Verbots nach dieser Technologie streben? Und ist Æther wirklich für immer zerstört oder schlummern irgendwo weitere Überraschungen, welche die KI uns hinterlassen hat? War es überhaupt richtig, die wiedererwachte KI, in gewisser Weise schließlich eine intelligente Lebensform, zu vernichten? Einige Experten sind der Ansicht, Æther hätte ein Beschützer und Freund der Menschheit sein können. Professor Attila Boisenberg von der Universität Oxford glaubt, dass …«
Aus dem Augenwinkel sah Fran einen Mann die Lobby betreten. Sein Kopf wurde von einer Wollmütze bedeckt, seine Augenpartie von einer großen Sonnenbrille verborgen. Ein Brassard am Ärmel zeigte an, dass sein Gesicht holographiert war. Es konnte sich nur um Calvary Doyle handeln. Rasch schaltete er den Film ab und machte sich an die Arbeit.
5
Nicht zum ersten Mal an diesem Tag fragte Fran sich, was sein Zielobjekt eigentlich vorhatte. Entweder besaß Calvary Doyle einen extrem ausgefeilten Plan oder, was wahrscheinlicher schien, gar keinen. Das Hotel hatte der Journalist kurz nach dem Einchecken wieder verlassen. Fran war ihm in einen Coffeeshop gefolgt, in ein Geschäft für Küchenbedarf, zu einem Herrenausstatter. Danach war Doyle das halbe Victoria Embankment entlangflaniert, trotz der drückenden Schwüle. London im Mai war warm und feucht, die Stadt kroch einem unter den Hemdkragen. Fran sehnte sich nach einer Dusche.
Er beschattete Doyle relativ eng. Sorge aufzufliegen hatte er nicht. Schließlich trug er einen Jedermann-Anzug, ein holographisches Kleidungsstück, das sein Aussehen kontinuierlich veränderte. Dies geschah nicht ruckartig, vielmehr vollzog sich der Wandel in Zeitlupe. Silhouette, Größe und Kleidung, alles war im stetigen Fluss. Ein Beobachter hätte ihn sehr genau betrachten müssen, um zu bemerken, dass sein chinesisches Gesicht allmählich eurasisch und dann kaukasisch wurde, dass seine hohen Boots sich in Stiefeletten und später in Halbschuhe verwandelten.
Doyle bemerkte davon sicher nichts. Der Journalist bewegte sich, als habe ihm jemand mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Das war angesichts seiner Verletzung vielleicht nicht verwunderlich. Andererseits konnte der Mann eigentlich keine Schmerzen mehr haben. Seine OP lag vier Tage zurück, dank Regenerationsbeschleunigern war er vermutlich so gut wie neu. Nein, Doyle bewegte sich nicht wie jemand, der litt. Sondern eher wie jemand, der nicht wusste, was er tun sollte. Sein Gesicht strahlte tiefe Ratlosigkeit aus.
Fran folgte ihm zur Tube-Station Temple. Doyle nahm die District Line in Richtung Westen. An der Station Hammersmith stieg er aus. In der Nähe befanden sich die Büros von Doyles Produktionsfirma.
Als sie wieder auf der Straße waren, ging der Journalist zunächst zu einem Gebäude auf der anderen Straßenseite, über dessen Flachdach ein dampfender Kaffeebecher schwebte. Fran fror den Jedermann-Anzug in seiner momentanen Einstellung ein. Als Schwarzer mit Trilbyhut betrat er den Laden. Doyle stand bereits in der Take-away-Schlange. Als er an die Reihe kam, bestellte er zwei große Iced Cappuccini. Er traf sich also mit jemandem. Schon lief Doyle mit den zwei Bechern an ihm vorbei in Richtung Ausgang. Fran gab seinen Platz in der Schlange auf, zählte leise bis fünf und verließ dann den Coffeeshop.
Auf dem Trottoir stand Doyle und redete mit einer Frau. Sie war Anfang sechzig und hatte einen jener Sonnenschirme aufgespannt, ohne die viele Londoner morgens gar nicht erst aus dem Haus gingen. Außerdem trug sie eine Brille. Fran hielt kurz inne. Menschen mit Brillen machten ihn stets nervös, denn als Sehhilfen waren sie seit Jahrzehnten obsolet. Wer solch ein Gestell aufhatte, trug es entweder aus modischen Gründen oder um die Hologrammatica zu manipulieren. Die unzähligen Projektionen um sie herum, all die Werbebotschaften, Verkehrsschilder und Fassadenverschönerungen ließen sich mit einer geeigneten Stripperbrille ausblenden. Und das galt natürlich auch für Frans holographische Tarnung. Aber die Brille der Frau sah eigentlich nicht nach Stripper aus. Vielleicht war sie schlichtweg eine Exzentrikerin.
Doyle und seine Begleiterin überquerten die Straße und liefen bis zu einer kleinen Kirche, vor der es einen Grünstreifen mit Parkbänken gab. Fran folgte den beiden und schoss währenddessen mit seiner Ringkamera Fotos. Er bat seinen Amanuensis darum, diese mit den gängigen Datenbanken abzugleichen. Als sich die beiden auf einer der Bänke niederließen, hatte sein Assistenzsystem ihm bereits den Namen der Frau geliefert: Voltairine Urquhart, Redaktionsleiterin von Total Exposure. Fran setzte sich in zehn Metern Entfernung auf die nächste Bank und fror sein Aussehen erneut ein. Der Jedermann war gespickt mit Richtmikros, und er befahl dessen Software nun, die beiden zu belauschen. Umgehend verschwand der Straßenlärm. Aus seinem Ohrmikro drangen stattdessen die Stimmen Doyles und Urquharts:
»Aber du musst doch irgendeine Idee haben, wer es getan haben könnte, Cal.«
»Bisher überhaupt keine, Voltairine. Ich habe keine Feinde.«
Sie lachte.
»Was?«
»Mein Lieber, mit deinen Reportagen hast du dir einen Haufen Feinde gemacht. Und wenn ich das richtig sehe, wird deine nächste dir noch mehr Feinde machen. Auch wenn der Drehbeginn jetzt wohl erst mal passé ist, hm?«
Doyle seufzte. »Völlig passé. Vielleicht … ich weiß nicht.«
»Du brauchst ein bisschen Zeit, vermute ich. Was du aber auch brauchst, ist ein Bodyguard.«
»Ach, komm. Unsinn. Ich will keinen …«
Urquhart ergriff Doyles Hand und musterte ihn.
»Cal, Schätzchen, jetzt kommst du mir wie ein trotziger kleiner Bengel vor. Ein Mordattentat! Mitten in London.«
»Sie werden es kein zweites Mal versuchen«, erwiderte er.
Urquhart ließ seine Hand los und schaute ihn verwundert an.
»Weil?«
»Weil sie ihr Ziel erreicht haben.«
Der Ausdruck der Verwunderung auf ihrem Gesicht verwandelte sich in eine Mixtur aus Entsetzen und Empörung.
»Du willst aufgeben? Du willst wirklich aufgeben? Das ist doch genau das, was diese Leute wollen. Ich weiß, dass du dich immer sehr bedeckt hältst und niemand von deinen Recherchen erzählst. Verdammt, ich bin deine Producerin und selbst ich weiß bisher nur, dass es um einen Scoop in einer KI-Geschichte geht.«
Doyle schlug die Hände vor das Gesicht. Leise sagte er: »Ja? Da weißt du mehr als ich. Es gibt keine Geschichte.«
»Was? Keine … aber du hast mir gesagt, ich soll drei Teams buchen. Das wäre erderschütternd, es wäre die größte …«
»Es gibt«, brüllte Doyle in dem Moment, »keine verdammte Geschichte!«
Nicht nur Urquhart zuckte zusammen. Auch Fran wich instinktiv vor der Quelle des Lärms zurück. Er musste sich beherrschen, um sich das Ohrmikro nicht herauszureißen. Rasch regelte er die Lautstärke herunter.
Die Produzentin sah ihren Schützling an, nippte an ihrem Kaffee. Der Ausbruch schien sie nicht verletzt zu haben. Vielleicht kannte sie so etwas schon.
»Sorry«, sagte Doyle leise. »Aber ich glaube, du kapierst es nicht.«
»Na, dann erleuchte mich mal.«
»Diese Recherche … es war anfangs nur eine vage Idee. Erst vor einigen Wochen habe ich etwas gefunden, das … vermutlich dazu geführt hat, dass ich dich angerufen habe, wegen dem Dreh. Habe ich echt gesagt, das sei erderschütternd?«
»Erderschütternd und episch, um genau zu sein. Aber daran wirst du dich doch wohl erinnern.«
»Nein. Nein, tue ich nicht.«
Urquhart schaute irritiert. Fran hingegen musste all seine Selbstbeherrschung aufwenden, um ruhig sitzen zu bleiben. Natürlich – wie hatte er das übersehen können? Nun machte Hardhouse’ seltsame Andeutung, dass dies ein kurioser Fall werden würde, Sinn.
»Überleg mal, Voltairine. Ich bin viel gereist in letzter Zeit. Weit gereist. Ich hatte vor, den KOC zu nehmen, glaube ich zumindest.«
»Den Koimala Orbital Crawler? Ins All? Warum das?«
Doyle ignorierte den Einwurf und fuhr fort: »Ich habe eine Menge rausgefunden, vermutlich. Aber das … das war alles nach meinem Brainscan, verstehst du?«
»Brainscan? Um ein Hohlkopf zu werden?«
»Wollte ich eigentlich nie, aber anscheinend habe ich vor dem Trip ins All einen Scan machen lassen. Ich habe eine digitale Kopie meines Gehirns, also ein Cogit, angefertigt und einen Qube gekauft. Ist in einem Quant-Zentrum in Twickenham gemacht worden, so zumindest steht’s in den Unterlagen, die ich bei meiner Entlassung bekommen habe. Außerdem hatte ich eine Patientenverfügung, für den Fall des Falles.« Doyle musterte Urquhart. »Sie haben’s mir eingesetzt, gleich nach dem Attentat.«
Die Produzentin schlug die Hände vor den Mund. Fran registrierte es mit einer gewissen Verärgerung. Es gab bereits Millionen von Quants, aber einige Leute fanden die Konversion immer noch schockierend. Vielleicht galt Urquharts Entsetzen aber auch gar nicht dem Umstand, dass Doyle sein lädiertes organisches Gehirn ausgemustert hatte wie ein Paar löchrige Strümpfe, sondern dem, was Fran bereits vor einer Minute realisiert hatte.
»Sie sind weg, Voltairine.«