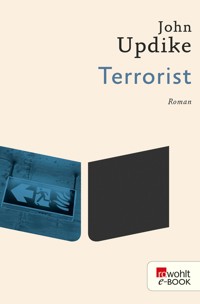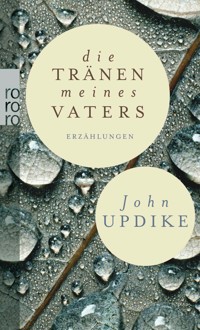9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rabbit-Romane
- Sprache: Deutsch
Harry Angstrom ist tot, aber seine Lebensenergie ist noch nicht erschöpft. Seine uneheliche Tochter Annabelle steht eines Tages bei seiner Witwe vor der Tür.: «Ich glaube, Sie waren mit meinem Vater verheiratet.» Sie wird zum Thanksgiving Dinner eingeladen, der Abend artet aus, ein hässlicher Streit, Tränen Krach, Sohn Nelson verlässt das Haus. Updike gelingen herrliche Passagen, etwa Nelsons plötzliche Geschwisterliebe, der Familienkrach beim Truthahnessen, ein verrückter Silvesterabend zur Jahrtausendwende. «Updikes Prosa gehört zum Unterhaltendsten, was sich in der Weltliteratur unserer Jahre finden lässt.» (Marcel Reich-Ranicki)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
John Updike
Rabbit, eine Rückkehr
Über dieses Buch
Harry Angstrom ist tot, aber seine Lebensenergie ist noch nicht erschöpft.
Seine uneheliche Tochter Annabelle steht eines Tages bei seiner Witwe vor der Tür: «Ich glaube, Sie waren mit meinem Vater verheiratet.» Sie wird zum Thanksgiving Dinner eingeladen, der Abend artet aus, ein hässlicher Streit, Tränen, Krach, Sohn Nelson verlässt das Haus.
Updike gelingen herrliche Passagen, etwa Nelsons plötzliche Geschwisterliebe, der Familienkrach beim Truthahnessen, ein verrückter Silvesterabend zur Jahrtausendwende.
«Updikes Prosa gehört zum Unterhaltendsten, was sich in der Weltliteratur unserer Jahre finden lässt.» (Marcel Reich-Ranicki)
Vita
John Updike, 1932 in Shillington, Pennsylvania, geboren, studierte in Harvard, bevor er als Redakteur des «New Yorker», als Lyriker, Essayist und Romancier hervortrat. Er wurde unter anderem mit dem National Book Award, dem National Book Critics Circle Award, dem Prix Médicis und zweimal mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.
John Updike starb am 27. Januar 2009 in Beverly Farms, Massachusetts. Sein gesamtes Werk ist auf Deutsch im Rowohlt Verlag erschienen.
Impressum
Mit Zustimmung des Autors entnommen der Originalausgabe «Licks of Love. Short Stories and a Sequel, Rabbit Remembered», 2000 bei Alfred A. Knopf, Inc., New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2019
Copyright © 2002 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Licks of Love» Copyright © 2000 by John Updike
Umschlaggestaltung: any.way, Hamburg
ISBN 978-3-644-05691-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
i.
Janice Harrison geht an die Haustür, als die Klingel die Stille zerschrammt. Jahrzehntelang hat der Rost an der alten Glocke gefressen, sie krächzt nur noch, und eines Tages wird sie überhaupt keinen Ton mehr von sich geben, weil der Klöppel festsitzt oder sie einen Kurzschluss hat oder was sonst mit diesen Dingern passiert. Jedes Mal, wenn sie sagt, sie möchte den Elektriker anrufen, sagt Ronnie ihr, er habe eine Liste, was im Haus alles in Ordnung gebracht werden muss, die Klingel sei mit drauf, er werde sich drum kümmern. Er nimmt die Dinge gern selber in die Hand. Harry war mehr dafür, andere alles machen zu lassen.
Wegen eines Ziehens in der Hüfte braucht sie länger als sonst für den Weg von der sonnigen, abgenutzten Küche durchs Esszimmer, in dem die Rouleaus heruntergezogen sind, damit der Perser nicht verschießt und die polierte Platte des Mahagonitisches nicht austrocknet, ins Wohnzimmer, wo man jedes Mal um den niedrigen, einer alten Schusterbank nachgebildeten Tisch vor dem grauen kurzflorigen Plüschsofa herumgehen muss, sodass sich im Auslegeteppich eine helle Trittspur gebildet hat. Ein großer brauner Zenith-Fernseher, auf dem sich der staubige Schnickschnack ihrer Mutter drängt, starrt blind dorthin, wo früher der Barcalounger ihres Vaters gestanden hat. Sie halten sich kaum noch hier auf, hocken nicht mehr wie früher auf dem Sofa und sehen fern. Ronnie sieht sich lieber in der Küche in dem kleinen Sony die Abendnachrichten an, während er isst, und wenn Nelson nach der Arbeit zu Hause bleibt, hat er oben den Computer, er sagt, sich mit dem Computer zu beschäftigen, macht mehr Spaß als Fernsehen, weil es interaktiv ist. Mit seiner Frau Teresa war er nicht so interaktiv, die ist vor über einem Jahr mit beiden Kindern nach Ohio zurückgegangen. Er und Roy, der jetzt vierzehn ist, schicken sich gegenseitig E-Mails, meist anstößige Witze (diesen Sommer gab’s einen besonders grässlichen: Weißt Du noch, als die Kennedys jeweils nur eine Frau ersäuft haben?), als ob der Austausch von E-Mails ebenso gut wäre, wie mit einem leibhaftigen Vater unterm selben Dach zu leben.
Oft hört Janice die Klingel überhaupt nicht, obwohl sie im Haus ist oder gleich hinten im Garten. Sie findet dann in die Tür geklemmte Benachrichtigungen von Lieferanten vor, die wieder abziehen mussten, oder Visitenkarten von Vertretern, die keine Gelegenheit bekommen hatten, ihre Sache vorzubringen. Sie ist dankbar dafür, aber es gibt ihr doch auch das Gefühl, isoliert zu sein; angenommen, jemand klingelte, den sie für ihr Leben gern sähe? Sie weiß allerdings nicht, wer das sein sollte. So viele, an denen ihr gelegen war, sind tot.
Die schwere Nussbaumtür mit den schmalen hohen Seitenfenstern aus Mattglas, das mit floralen Arabesken gemustert ist, diese Tür, durch die sie, mit einigen Unterbrechungen, fast ihr ganzes Leben lang ein und aus gegangen ist, hat sich in der Feuchtigkeit des Sommers, die nie Regen gebracht hat, verzogen und die ganze Zeit geklemmt. Jetzt, wo es endlich herbstlich wird, geht sie leichter auf, mit einem trockenen Knacken. Das Mädchen – eigentlich eine Frau, ungefähr in Nelsons Alter –, das auf der Vorderveranda steht, kommt ihr irgendwie bekannt vor. Ein breites weißes Gesicht, weit auseinander liegende Augen mit ein wenig Milch im Blau und in den Winkeln die ersten Krähenfüße. Um einiges größer als Janice, füllt sie ihr beigefarbenes Sommerkleid gut aus, der Baumwollstoff spannt überm Busen und über den Schenkeln. Sie hat sich einen marineblauen Sweater um die Schultern drapiert, wie die jungen Frauen im Immobilienbüro Pearson und Schrack, die ihre leuchtenden Computer bedienen und sehr geschäftsmäßig tun. Sie fragt: «Mrs. Angstrom?»
Janice ist verblüfft. «Das war mal», sagt sie. «Mein jetziger Mann heißt Harrison.»
Das Mädchen wird rot. «Verzeihen Sie, ich wusste das nicht. Ich hab nicht dran gedacht.» Die milchig blauen Augen des Mädchens weiten sich, und Janice fühlt, wie diese Fremde regelrecht zittert, wie ein Beben ihren sorgfältig und zurückhaltend gekleideten Körper durchläuft, ein Wesen, das da auf der Fußmatte im rechteckigen Schatten der Veranda mit den Backsteinsäulen steht, als sei es in einer Falle gefangen.
Hinter ihr, auf der Joseph Street, wischen Autos mit einem frischen trockenen Geräusch vorbei. Ein glänzend neuer ziegelroter Lexus steht am lichtgesprenkelten Bordstein, unter den einstweilen noch grünen Ahornen. Eine Wolke zieht vorüber, und der Schatten, den sie wirft, ist fast kalt; daran erkennt man die neue Jahreszeit, die Schatten sind schärfer und dunkler, und unter allem liegt der Gesang der Grillen. Wegen der schrecklichen Dürre in diesem Sommer verfärbt das Laub sich früh, die Blätter der Rosskastanien rollen sich an den Rändern braun ein, und der Rasen in den Vorgärten, wo die Leute nicht gesprengt haben, sieht wie platt gedrücktes Stroh aus, ein Anblick, den Janice aus Kindertagen kennt, wenn man dem Erdboden näher ist und der Sommer endlos scheint.
«Meine Mutter ist vor zwei Monaten gestorben», setzt das Mädchen noch einmal an und holt tief Luft, damit das Zittern aufhört; mit beiden Händen hält sie sich eine kleine gestreifte Tasche vor den Bauch.
«Das tut mir Leid», sagt Janice. Nelson hat bei seiner Arbeit dauernd mit verrückten Leuten zu tun und sagt, man braucht keine Angst vor ihnen zu haben. Sie selber hat mit Leuten zu tun, die Häuser kaufen oder verkaufen wollen, die höchsten Summen, über die viele von ihnen sich je Gedanken machen müssen, und da reagieren manche auch nervös und irrational.
«Ich war nie verheiratet, sie war alles an Familie, was ich hatte.»
Also eine Bettlerin, trotz ihrer ordentlichen Aufmachung. «Das tut mir Leid», sagt Janice noch einmal, in abweisenderem Ton, «aber ich glaube nicht, dass ich helfen kann.» Sie hebt die Hand, um die schwere Tür zu schließen. Nelson ist im Therapiecenter, und Ronnie ist im Club und spielt Golf mit ein paar anderen Pensionären, sie ist also allein im Haus. Nicht, dass das Mädchen gewalttätig aussähe. Aber sie ist größer als Janice, großknochiger, von einer gefährlich fülligen Präsenz, mit der sie da steht, als hätte sie lange geschwankt und nun einen trotzigen Entschluss gefasst, wie eine Kundin, die den Sprung wagt und dreißigtausend mehr bietet, als sie sich leisten kann. Ihre Augenhöhlen sind leicht eckig und haben das Verquollene, das von Schlaflosigkeit kommt, und ihr Haar, fransig kurz geschnitten, wie man es heute trägt, ist ein Gemisch aus hellem Braun und dunklerem Braun, durchzogen von grauen Strähnen.
«Ich glaube das auch nicht», stimmt sie zu, «aber meine Mutter meinte, Sie könnten es vielleicht doch.»
«Habe ich Ihre Mutter gekannt?»
«Nein, Sie sind ihr nie begegnet. Aber Sie haben beide voneinander gewusst.»
Janice wünschte wirklich, Nelson wäre hier. Ein Blick würde ihm genügen, und er wüsste, was mit dieser Person nicht stimmt, und hätte gleich den richtigen Ausdruck dafür – manisch-depressiv, schizophren, paranoid, psychotisch. Wenn man psychotisch ist, sieht und hört man Dinge und kann morden, ohne es zu wollen, und vor Gericht dann ganz unschuldig wirken. Die lasierte Maserung des Nussbaumholzes unter ihrer Hand gibt zu verstehen, dass die Tür ein Schutzschild ist, dass man sie zuschlagen und dieser Begegnung ein Ende machen könnte, aber das Angenehme, Freundliche, Ruhige, das von dem Mädchen ausgeht, obwohl es so zittert und so verstört wirkt, hält die Tür offen. Die trockene warme Luft dieses frühherbstlichen Tages im südöstlichen Pennsylvania – die Kinder alle wieder sicher in der Schule verstaut, die vormittäglichen Straßen still, das Gemüse in den Hintergärten geerntet oder in Samen geschossen – liegt auf Janices Gesicht wie ein Hauch aus der Vergangenheit, und ihre Besucherin stammt aus derselben Gegend.
«Ich habe sie zum Schluss gepflegt, sie mochte Krankenhäuser nicht, sie hat sich in denen eingesperrt gefühlt», fährt die leise, behutsame, unsichere Stimme fort.
«Ihre Mutter», sagt Janice und lässt sich, ohne es zu wollen, auf das Mädchen ein.
«Ja, und als Krankenschwester konnte ich das natürlich – ihr die Medikamente geben und dafür sorgen, dass sie im Bett regelmäßig von einer Seite auf die andere gedreht wurde und all das. Eigenartig war nur, das für die eigene Mutter zu tun. Ihr Körper hatte doch so eine Bedeutung für mich. Sie mochte nicht angefasst werden, solange sie noch bei Kräften war. Mit manchen Leuten konnte sie ganz locker und unbefangen sein, aber ihre Privatsphäre hat sie geradezu fanatisch gehütet, auch mir gegenüber. Sie hat sich geweigert, mir irgendetwas zu sagen, außer, als sie dann wusste, dass sie sterben würde.»
Das Mädchen hat, während seine Nervosität nachließ, eine Etappe seiner Geschichte übersprungen, ohne es zu merken. «Was, sagten Sie, hat das alles mit mir zu tun?», fragt Janice.
«Oh. Ich glaube – ich glaube, Sie waren mit meinem Vater verheiratet.»
Ein Postauto zieht vorbei, einer dieser nasenlosen Vans, die sie jetzt benutzen, weiß mit rotem und blauem Streifen. Früher waren sie einfarbig grün, wie Militärfahrzeuge. Und Postboten waren Männer; jetzt kommt eine Postbotin zu ihnen, eine junge Frau mit langen sonnengebleichten Haaren und stämmigen gebräunten Beinen in Shorts, die ihre große Tasche in einem dreirädrigen Karren auf dem Gehweg vor sich herschiebt. Es ist noch zu früh, um diese Zeit kommt sie noch nicht, aber eine andere junge Frau ist zu sehen, sie tritt auf die Veranda der rechten Doppelhaushälfte drüben auf der anderen Seite der Joseph Street. Viele Jahre hat dort ein Ehepaar gewohnt, das Janice alt und unveränderlich erschienen war. Dann sind die beiden in ein Seniorenheim übergesiedelt, und ein junges Paar ist eingezogen, mit Ampelpflanzen auf der Veranda, um die sie viel Getue machen, und mit Musik, die durch die Fliegenfenster dröhnt und die ganze Nachbarschaft belästigt, und mit zwei kleinen Kindern, die in die Vorschule gehen.
«Vielleicht kommen Sie besser herein», sagt Janice und tritt einladend beiseite, obwohl es ihr widerwärtig ist und ihr zugleich Angst macht, diese Person aus einer beschämenden toten Vergangenheit über ihre Schwelle zu lassen.
Das Mädchen, dessen Gesicht und Arme so weiß sind, als hätte es nie einen Sommer gegeben, steht im dämmrigen, voll gerümpelten Wohnzimmer herum wie ein zusätzliches Möbel, das das mähliche Erdbeben der Zeit von seinem Platz geruckelt hat. Sie scheint, ebenso wie Harry früher, ein bisschen überproportioniert. Janice ist daran gewöhnt, durchschnittlich große Leute in ihrem Haus zu haben, sie selbst und Nelson und Ronnie, allerdings kommt manchmal Ronnies Sohn Alex aus Virginia zu Besuch, und der ist ziemlich groß, und als Judy und Roy hier noch wohnten, haben sie eine Menge Platz beansprucht mit ihrer Musik und ihren Spielen und ihrem geschwisterlichen Konkurrenzkampf. Obwohl das eine Kind ein Mädchen ist und das andere ein Junge und sie im Alter mehr als vier Jahre auseinander sind, war es nicht so schlimm, wie es hätte sein können.
«Möchten Sie einen Kaffee?», fragt Janice. «Oder Tee – mein Mann trinkt jetzt immer Tee, wegen seines Blutdrucks, und da habe ich’s mir auch angewöhnt.»
«Nein, ehrlich nicht – ich krieg jetzt nichts runter. Ich habe mir so lange überlegt, wie ich alles sagen soll, und dann hab ich es völlig falsch angefangen. Ich heiße Annabelle Byer.»
Janice versteht darunter «buyer», «Käufer». Es gibt so viele Käufer, wie es Verkäufer gibt.
«Wie gesagt, ich bin ledig. Nächstes Jahr werde ich vierzig. Ich bin praktisch ausgebildete Schwester und habe dreizehn Jahre im St. Joe’s gearbeitet, und die letzten fünf Jahre war ich im ambulanten Pflegedienst und habe die Leute zu Hause versorgt, aber die Zahl der Patienten, die sich das leisten können, geht zurück, weil Medicare die Bestimmungen so verschärft hat und sich kaum noch an den Kosten beteiligt.»
«Setzen Sie sich wenigstens hin», sagt Janice, um die helle, beunruhigend ragende Masse dieser ungebetenen Besucherin zu reduzieren. Das Mädchen setzt sich aufs Sofa, wo es, wie jeder andere, tiefer einsinkt, als es vermutet, die nackten Knie leuchtend weiß hochgereckt. Hastiges Zupfen am Rock verringert die Schenkelmenge, die zu sehen ist. Janice nimmt in dem grünen Ohrensessel mit den grünen Zierdeckchen auf den Armlehnen Platz, faltet die Hände mit den Innenflächen nach oben im Schoß, wie ihre Mutter es immer gemacht hat, und setzt sich zurecht, um zuzuhören, falls das Hämmern ihres Herzens das zulässt. Ihr Herz ist in einem Netz aus überschlägiger Berechnung gefangen, inwieweit diese naiv geschmacklose Aufdringlichkeit ihr Leben beeinträchtigen und ihren Frieden stören wird. Bei Ronnie, der, verglichen mit Harry, so stetig ist, hat sie erfahren, was Friede ist.
«Meiner Mutter hat es Sorgen gemacht, dass ich nicht geheiratet habe», erzählt Annabelle ihr; nach ihrem entspannten Ton zu urteilen, fühlt sie sich hier schon wohler, als Janice für angebracht hält. «Sie dachte, dass es vielleicht an ihr liegt, dass sie mir vielleicht Misstrauen eingeimpft hat gegen Männer, gegen Sex, gegen ich-weiß-nicht-was, wegen der Erfahrungen, die sie selber gemacht hat. Ich sagte dann immer, das ist doch Unsinn. Dad, so habe ich ihn genannt, war ein wunderbarer Mann. Er ist gestorben, als ich sechzehn war, aber ich bin trotzdem mit diesem guten Männerbild aufgewachsen. Er hat mich immer im Kreis herumgeschwenkt, auch noch, als ich schon elf war oder so, und er hat mir beigebracht, wie man mit dem Mähtrecker fährt und was man als Kind sonst noch alles tun kann, um sich auf einer Farm nützlich zu machen – Äpfel und Erdbeeren pflücken und Hühner füttern und Büsche und Giftsumach zurückschneiden. Wir haben sogar zusammen getischlert, und er hat mir gezeigt, wie ich mit seinem Gewehr umgehen muss. Ich hatte zwei Brüder, Scott und Morris, mit denen bin ich immer gut ausgekommen – als Landkinder haben wir viel gemeinsam unternommen. Und später hatte ich dann Freunde, klar, obwohl ich glaube, dass sie ziemlich schüchtern waren, verglichen mit Stadtjungen, aber nach der High-School bekam ich einen Job als Schwesternhelferin in einem Pflegeheim, im Sunnyside, draußen, wo’s zum alten Jahrmarktsgelände geht –?»
Sie vergewissert sich, ob Janice zuhört. Janice nickt und sagt: «Ich habe davon gehört. Sunnyside.»
«Und dann bin ich ein Jahr zur Ausbildung gegangen und habe die Prüfung bestanden, und als ich meinen Dienst im St. Joe’s antrat, waren die Jungs nicht mehr so schüchtern, manche von ihnen waren sogar verheiratete Ärzte, aber manche auch nicht, und irgendwie war alles ganz normal, außer, wie soll ich sagen, außer dass nie der Blitz einschlug, niemand mit einem Heiratsantrag kam. Vielleicht wollte ich auch keinen haben. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, was soll schon sein, wenn’s passiert, dann passiert es, in jedem Fall ist man doch ein ganzer Mensch, aber sie war krank vor Sorge darüber, dass ich ungebunden blieb, sie hatte irgendwie Angst, dass sie ein Hinderungsgrund sein könnte, besonders, nachdem sie die Farm verkauft hatte und ich ihr vorschlug, zu mir zu ziehen, zusammen konnten wir eine größere Wohnung nehmen, drüben an der Eisenhower Avenue –»
Janices Herz macht einen Satz. Sie hat mal an der Eisenhower Avenue gewohnt, mit Charlie Stavros, Eisenhower Avenue Nr. 1204, damals in den Sechzigern, als alle verrückt spielten. Aber kein Grund, überrascht zu sein; die vornehme Straße ist auch nach ihrer Blütezeit, da eine Einfamilienvilla neben der anderen stand und alle von schwarzen oder irischen Dienstboten in Schuss gehalten wurden, eine Gegend gewesen, wo es die besseren, sichereren Mietobjekte gegeben hat, für Außenseiter wie sie und Charlie oder dann dies Mädchen und seine Mutter.
«– sie wollte nicht im Weg sein, sie sagte immer, sie würde in ihrem Zimmer bleiben, wenn ich einen Mann mit nach Haus bringe, aber ich hatte lange genug in Brewer allein gelebt, so leicht brachte ich keine Männer mehr mit nach Haus. Sie können unangenehm werden, ich war zu der Zeit Mitte dreißig, und die guten Männer waren mit anderen Frauen verheiratet. Als ihr klar war, dass sie sterben muss – als der Tumor entdeckt wurde, ein kleinzelliges Lungenkarzinom, hatte der Krebs schon aufs Lymphsystem und auf die Knochen übergegriffen –, da sagte sie mir, dass ich mehr Familienangehörige hätte, als mir bewusst sei. Sie sagte, dass Dad nicht mein richtiger Vater war, dass er sie aber genug geliebt hat, um sie mit dem Kind von einem andern zu nehmen. Ich war noch kein Jahr alt, meine Großeltern in West Brewer haben sich um mich gekümmert, solange sie in diesem Restaurant drüben bei Stogey’s Quarry gearbeitet hat, da hat sie meinen – da hat sie Frank Byer kennen gelernt. Er hat nicht lange gefackelt – ich glaube, seine Mutter war kurz vorher gestorben, und eine Farm braucht eine Frau. Nicht, dass er nicht verknallt in sie gewesen wäre – und wie. Er war in den Vierzigern und sie Ende zwanzig, ich konnte sehen, als ich, wie soll ich sagen, einen Blick für so was bekam, dass sich immer noch ganz schön was zwischen ihnen abspielte. Er hat sie immer damit aufgezogen, dass sie so dick war, aber er war ja selber dick.»
Janice mag gar nichts hören von diesen schrecklich ordinären Leuten. «Haben Sie sich nie gewundert», fragt sie unwirsch, «wieso Sie auf die Welt kommen konnten, bevor Ihre Eltern verheiratet waren?» Durch die fast durchsichtigen Gardinen des Panoramafensters – Glasgardinen sagt man dazu, dabei sind sie aus Stoff – kann sie sehen, dass die Frau gegenüber immer noch draußen auf der Veranda ist und mit einer langschnabligen Gießkanne herumtrödelt, so als ob sie lauscht. Aber auf diese Entfernung ist das nicht möglich. Dass das Mädchen hier ist, empfindet Janice als beschämend. Als beschämend und als unverschämt.
«Ach, das ist nie zur Sprache gekommen», sagt Annabelle. «Sie wissen ja, wie das ist, als Kind denkt man, alles um einen herum ist ganz normal so, wie es ist, man kennt es nicht anders. Scott war in der Schule nur eine Klasse unter mir; ich wurde im Januar geboren und er ein Jahr drauf im November. Ich war immer die Jüngste in meiner Klasse, vielleicht ist das einer der Gründe, verstehn Sie, weshalb ich mir immer so unschuldig vorgekommen bin. Die andern Kids haben irgendwie immer mehr gewusst als ich, und bei denen lief auch so einiges. Ich war immer das brave Mädchen, das nach dem Unterricht gleich nach Hause fuhr, sowie der Schulbus kam.»
Das Mädchen fängt an zu reden, als ob Janice eine Tante wäre, womöglich gar so etwas wie eine Mutter. Janice hält sich als Mutter für nicht besonders erfolgreich und möchte es nicht noch einmal versuchen. Trotzdem fragt sie: «Sind Sie sicher, dass Sie keinen Kaffee wollen? Ich muss mir jetzt eine Tasse Tee machen, mir schwirren so viele Fragen im Kopf herum. Die Neuigkeit, mit der Sie da kommen, muss man erst mal verdauen, falls sie überhaupt stimmt.»
Sie steht auf, Annabelle allerdings auch, und nicht nur das, sie folgt ihr auch in die Küche, dabei hatte Janice gehofft, ein bisschen Abstand zu gewinnen, um nachzudenken. Es ist wie mit den Zeugen Jehovahs, arme käsige Gestalten, denkt man, aber wehe, man lässt sie ins Haus, dann setzt es ein Bibelzitat nach dem andern und alle diese Zeitungsschlagzeilen, die irgendwas aus der Offenbarung beweisen, damit wickeln sie einen so ein, dass man das Gefühl hat, da kommt man nie wieder raus. Sie mag es nicht, wenn man ihr in ihrer eigenen Küche auf die Pelle rückt. Sie ist in Haushaltsdingen nie sehr geschickt gewesen, etwas, das Harry mit bissigem Spott quittiert hat (obwohl seine Mutter auch nicht gerade eine Martha Stewart war und er selber wahrhaftig nicht Mr. Heimwerker, im Gegensatz zu Ronnie oder diesem netten Webb Murkett, den sie mal gekannt haben); es ist für sie also eine Erleichterung gewesen, mit Ronnie zusammen zu Tee überzuwechseln, als der Arzt ihm empfahl, keinen Kaffee mehr zu trinken. Beim Kaffeekochen hat sie das mit der Pulvermenge nie richtig hingekriegt, mit Tee dagegen ist es ein Klacks, man tut den Beutel in den Becher und den Becher in die Mikrowelle und fertig. Sie nimmt ganz normalen Lipton, Lipton hat ein Radioprogramm gesponsert, das sie sich als Kind immer angehört hat, den Tropftropf-Song, oder war das Maxwell House? Doris Kaufmann und andere liegen ihr immerfort damit in den Ohren, sie solle Kräutertee oder Jasmintee trinken oder grünen Tee, der angeblich Wunder wirkt und gegen alles hilft, von Schluckauf bis Dickdarmkrebs, aber Janice sieht nicht ein, wozu man etwas trinken soll, das einem überhaupt keinen Kick gibt.
Es dauert zwei Minuten und zwanzig Sekunden, bis das Wasser heiß ist. Annabelle beobachtet eine Weile den elektronischen Countdown, geht dann zu den rückwärtigen Fenstern und schaut durch die Sonnenveranda ins Freie. «Was für ein angenehmer heller Garten hier hinten», sagt sie. «Die Vorderseite ist so dunkel.»
«Wegen der Ahorne. Die werden immer höher. Im Lauf der Jahre haben wir ein paar Bäume verloren. Die Seite des Hauses wurde früher von einer wunderschönen großen Blutbuche beschattet, sie fehlt mir. Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch etwas wollen, irgendeinen Drink?» Janice bringt es nicht über sich, den hochtrabenden Märchenbuchnamen des Mädchens auszusprechen. Sie denkt, dass das, was sie selbst jetzt wirklich brauchen könnte, um den Schock abzumildern und diese seltsame Situation durchzustehen, ein trockener Sherry ist.
«Ein Glas Wasser wäre wunderbar.»
«Einfach nur Wasser? Mit Eis?»
«O nein, kein Eis. Sie würden staunen, wie viele Mikroben in Eis leben.»
Harry hat ihr immer das Gefühl gegeben, unsauber zu sein, auch wenn es gar nicht gestimmt hat. Sie reicht dem Mädchen das Glas mit der klaren Flüssigkeit. Fingerabdrücke noch und noch. Sie kriegen es jetzt mit DNS-Analyse raus – nicht, dass O.J. nicht trotzdem freigekommen wäre. Diese langbeinige Staatsanwältin hat sich selber ausgetrickst, und der schwarze Verteidiger war raffiniert. Nach der Art, wie das Mädchen sich umdreht, scheint es zur Hintertür hinausgehen und sich in die Sonnenveranda mit Blick auf den Gemüsegarten und das alte Schaukelgerüst setzen zu wollen, aber Janice steuert entschlossen zurück zum dämmrigen, wenig benutzten Wohnzimmer. Es liegt näher beim Ausgang. Sie lässt dem Mädchen den Vortritt und bleibt ein paar Schritte zurück, damit sie sich von der Kredenz im Esszimmer die Flasche mit dem Taylor-Sherry schnappen, den Verschluss abschrauben und einen kleinen Schuss in ihren Tee geben kann. Das herzhafte braungelbe Aroma des Alkohols steigt auf und überdeckt den antiseptischen Geruch – frisches Mundwasser oder so ähnlich –, der vom Nacken und von den nackten Armen des Mädchens zu Janice hinweht. «Ich nehme an, Sie haben mir nun so ziemlich alles Wissenswerte mitgeteilt», sagt sie, als sie wieder ihre Plätze eingenommen haben.
Annabelle stimmt dem nicht zu. Sie nimmt ihren Faden wieder auf: «Ich war eben dabei zu sagen, dass ich als Kind nicht gewusst habe, wann meine Eltern geheiratet haben, und als ich dann alt genug war, um mich dafür zu interessieren, hat meine Mutter eingeräumt, dass ich möglicherweise vor der Ehe geboren wurde, weil Dads Mutter zu der Zeit noch lebte, aber leidend war und eine Heirat vielleicht ihren Tod beschleunigt hätte. Das klang plausibel, es war ja 1960, bevor alles liberaler gehandhabt wurde.»
Was wurde liberaler gehandhabt?, fragt Janice sich. Abtreibung, nimmt sie an. Und junge Paare konnten ohne Trauschein zusammenleben. Aber das gab’s alles auch schon damals, bloß mehr im Verborgenen. Das Jahr 1959 erscheint ihr sehr nah, so nah wie das Klopfen ihres Herzens, das damals auch geklopft hat, am Anfang des Tunnels der Zeit, derselbe treue Muskel in seinem Dunkel, seinem Blut. Sie möchte die Unterhaltung aber nicht weiter ausdehnen; sie möchte sich heraushalten, obschon ein Ziehen da ist, ein Ziehen zurück in den traurigen klammen Abgrund der Vergangenheit.
Das Mädchen scheint ihre Gedanken zu lesen. «Ja, meine Mutter hat mir davon erzählt», sagt sie, «von dem, wie soll ich sagen, Verhältnis. Sie und mein – sie und Ihr Mann, Mr. Angstrom, haben, glaube ich, drei Monate in der Summer Street zusammengelebt. Er hat nie erfahren, ob sie mich bekommen hat oder nicht. Ich habe ihn gekannt – ich habe ihn ein paar Mal getroffen, ohne zu wissen, wer er war. Ich meine, in welcher Beziehung er zu mir stand. Er war mal Patient im St. Joe’s, als ich da noch gearbeitet habe. Er hat eine Dilatation machen lassen, glaube ich. Er war ein Charmeur. Hat immer Scherze gemacht.»
«Er ist in Florida gestorben», sagt Janice vorwurfsvoll, «keine sechs Monate danach. An einem Herzinfarkt. Er war erst sechsundfünfzig.» Als könnten diese unumstößlichen Tatsachen, so hart für sie damals, Harry und dies Mädchen auseinander sprengen.
«Klingt, als hätte er einen Bypass gebraucht. Aber das war damals noch nicht so die Norm.»
«Er wollte nicht. Er wollte nicht, dass man in seinem Körper herummurkst. Er hatte Angst davor.» Janice erschrickt, als ihr plötzlich die Stimme versagt und ihre Augen brennen und kurz davor sind, sich mit Tränen zu füllen, als werfe sie es sich vor, Harry das Leben nicht lebenswert gemacht zu haben. Sie hat ihn nicht angerufen, als er allein unten in Florida war und auf ihren Anruf gewartet hat. Er hat sie um Verzeihung gebeten, und sie hat ihm nicht verziehen.
«Und davor», redet das Mädchen gefühllos weiter, «als ich noch Schwesternhelferin im Sunnyside war, bin ich mit einem Jungen, den ich aus Galilee kannte und der Jamie hieß und mit dem ich übrigens zusammengelebt habe, in einem kleinen Apartment am Youngquist Boulevard – das Haus wurde in Eigentumswohnungen aufgeteilt, und das hat uns auseinander gebracht, aber das ist wohl eine andere Geschichte – Jamie und ich, wir sind zu dem Autogeschäft an der Route 111 gegangen und haben uns Toyotas angesehen. Wir haben auch einen gekauft, aber erst später, nicht an dem Tag, als Mr. Angstrom da war. Er war so nett, ich wollt’s gar nicht glauben. Er ist auch auf mich eingegangen, hat nicht nur mit dem Mann geredet und nicht versucht, uns unter Druck zu setzen, wie Autohändler das sonst gern machen.»
«Er war nicht gerade dazu berufen, etwas zu verkaufen», sagt Janice. «Er war eigentlich zu gar nichts berufen, nach der High-School.»
Aber wie schön er war, in den High-School-Fluren damals, denkt Janice – seine Größe, das feine Wikingerhaar nass zurückgekämmt und am Hinterkopf übereinander geschlagen, ihm aber immer wieder sexy quer über die Stirn fallend, in glatten Strähnen, wie bei Alan Ladd, und wie er die dann mit seinen großen eleganten weißen Händen zurückflippte, während er mit den anderen aus der obersten Klasse herumalberte, mit dieser Mary Ann zum Beispiel, der groß gewachsenen Freundin, die er damals hatte, seine Augenlider immer versnobt schläfrig auf halbmast, die Welt jener Schulflure sein Element, sie, eine Neuntklässlerin, eine Zwergin, sah er natürlich gar nicht. Sie fingen erst was miteinander an, als sie beide bei Kroll’s in Brewer arbeiteten, sie hinter dem Tresen mit den Nüssen und den Süßwaren und er gerade zurück von seinen zwei Jahren in der Army, er war in Texas gewesen, war nie zum Sterben nach Korea geschickt worden. Er redete oft von Korea, als habe er etwas verpasst, indem er dort nicht hatte kämpfen müssen, sondern stattdessen nach Hause durfte und ein friedliches Leben führen konnte. Niemand will Krieg, aber immer bloß Frieden ist Männern auch nicht recht.
«Ja», sagt Annabelle zu eifrig, um es als Zustimmung zu meinen, sie versteht nicht wirklich, wie einfach wir damals alle waren, «er war ein großartiger Sportler, ich erinnere mich an die Zeitungsausschnitte an der Wand im Ausstellungsraum, und außerdem hat meine Mutter es mir erzählt. Sie war auf einer anderen High-School, die oft gegen seine gespielt hat. Als sie erst mal angefangen hatte, von ihm zu reden, konnte sie kaum noch aufhören, bis sie dann … bis sie gehen musste. Ich weiß von Ihnen und Nelson und wie Ihr Haus abgebrannt ist, meine Mutter hat das alles in der Zeitung verfolgt, nehme ich an. Es hat sie interessiert. Nach der Art, wie sie zum Schluss geredet hat, war sie ohne Groll. Die Zeiten waren eben so, hat sie gesagt. Er saß in der Falle, was sollte er machen? ‹Sowieso war ich nicht gerade ein Hauptgewinn›, hat sie zu mir gesagt.»
Ruth und ihre Ansichten, keines Gedankens wert in diesen vielen Jahren, sind ins Wohnzimmer eingedrungen. «Du meine Güte» ist alles, was Janice zu sagen einfällt, während der Sherry ihr ins Blut geht und anfängt, diesem Albtraum eine freundlichere Farbe zu geben. Geschichten, die vor vierzig Jahren passiert sind, wie könnten die ihr heute noch etwas anhaben?
«Er hat sie übrigens mal besucht», redet diese junge Frau weiter; ihre Bewegungen werden ungezwungener, ihr Körper wird immer größer, sie schlägt die weißen Beine auf dem Sofa übereinander, bald das rechte übers linke, bald das linke übers rechte, und das beigefarbene Baumwollkleid rutscht ihr immer höher an den Schenkeln hinauf. Auch ihr Haar ist irgendwie zu kurz, und es hüpft ein bisschen zu sehr, wenn ihr Kopf sich vorreckt. Es hat etwas Anmaßendes, Auftrumpfendes, dies Haar – seine vielfarbige Üppigkeit, der modische Straßengörenschnitt, teils ganz kurz, teils etwas länger, alles wild durcheinander. «In dem Jahr, als er starb, glaube ich. Irgendwie hat er unsere Farm ausfindig gemacht.»
«Er hat sie besucht?» Das ist fürchterlich. Harrys Affäre mit Thelma haben sie und Ronnie gemeinsam begraben, sie haben nie mehr davon gesprochen, als sie über das Verliebtheitsstadium, in dem man einander alles erzählt, hinaus waren. Sie hatten triumphiert, sie waren die Überlebenden, Harry und Thelma waren Schatten, Leichen, sanken in ihren beerdigten Särgen immer tiefer in die Blutlosigkeit ab, ihre Haut verdorrte, spannte sich straff über die Knochen wie bei dem kleinen geopferten peruanischen Mädchen, das man auf dem Berggipfel gefunden hat, unerträglicher Gedanke. Aber jetzt zu erfahren, dass Harry zur selben Zeit, als er sich mit Thelma traf, im ganzen Diamond County nach dieser fetten alten Schlampe gesucht hat, ist, als verweigere er ihr von jenseits des Grabes ihren Frieden, wie er es schon getan hat, als er noch am Leben war. Er konnte einfach nicht normal sein, solide, verlässlich. Über so was war er erhaben, hat er gedacht. Dieses Mädchen, schüchtern und forsch zugleich, nett, aber etwas an sich habend, das nicht ganz stimmt, ist seine Abgesandte aus dem Grab. Janice will mit ihr nichts zu tun haben. Sie fragt: «Warum hat er das gemacht?»
Das Mädchen stellt die Beine dicht nebeneinander, um sich des größeren Nachdrucks wegen vorzubeugen, aber das Kleid ist so kurz, dass das Dreieck des Slips trotzdem zu sehen ist. «Um etwas über mich herauszukriegen, hat meine Mutter gesagt. Sie hat ihn die ganze Zeit im Unklaren gelassen. Sie wollte mich von ihm fern halten. Als sie dann wusste, dass sie, also, dass sie mich würde verlassen müssen, hat sie es sich anders überlegt, da wollte sie dann, dass ich Bescheid weiß.» Die Augen des Mädchens sind jetzt nicht mehr so milchig, hier im gedämpften Wohnzimmerlicht, sie blitzen vor Wichtigkeit, der Wichtigkeit, die ihre Geschichte ihr gibt.
«Warum?», schreit Janice, sich gegen die Bedrängnis wehrend, «warum lässt man die Vergangenheit nicht ruhen? Warum rührt man etwas auf, was sich doch nicht mehr ändern lässt? Entschuldigen Sie, ich brauche noch einen Tee.» Sie tut nicht einmal so, als gehe sie in die Küche, sie geht gleich zur Kredenz hinüber und gießt sich ein wenig von dem trockenen Sherry in den Becher; wenn das Mädchen den Kopf zur Seite drehte, könnte es sehen, was sie tut. Aber als sie ins Wohnzimmer zurückkehrt, sitzt Annabelle still da und starrt zum schweren grünen Glasei mit der Blase im Innern hinüber, das auf dem toten Fernsehapparat liegt, zusammen mit den anderen Nippsachen, die Bessie Springer zum Zeichen ihres Wohlstands gesammelt hatte, als Daddys Autohandel in Gang kam. Mutter und ihr Pelzmantel, Mutter und ihr blauer Chrysler – es war eine einfachere Welt damals, als man seinen Stolz mit solchen Dingen befriedigen konnte. Das Mädchen, das tief im Sofa sitzt, mit bis obenhin entblößten Beinen und mit nackten Armen, weil der marineblaue Pullover heruntergerutscht ist, hat eine nachlässige Art, seinen Körper auszustellen – wahrscheinlich ist das die Mutter, die in der Tochter weiterlebt. Und diese Farblosigkeit, diese vaterlose Leere; ihr Profil fängt das Licht ebenso stumm auf wie das Ei aus grünem Glas.
Sie spürt Janices Blick, wendet ihr das Gesicht zu und sagt: «Es ist peinlich, nicht? Dass ich hier einfach so aufkreuze. Peinlich für mich, peinlich für Sie.» Sie hat eine fleischige Oberlippe, die ihrem Lächeln etwas Kindliches, Fragendes gibt. Sie sieht aus, als sei sie leicht zu verletzen.
«Nun», sagt Janice, als sie wieder im Ohrensessel sitzt, in der Hand den Becher mit dem angereicherten Tee, dessen wohltuend strenger Geschmack ihr zu einer breiteren Autoritätspose verhilft. Sie hat sich vor Jahren geschworen, niemals so dick zu werden wie ihre Mutter, aber sie hat doch bewundert, wie Mutter in ihren letzten Jahren, als ihr Mann tot war und ihre Generation ringsum nach und nach wegstarb, sich um alles kümmerte, die Familienfinanzen im Griff behielt und für ihre Vorstellungen von Sitte und Anstand eintrat. Janice ist hier in diesem Haus immer noch von ihrer Mutter umgeben – von Bessie Springers unverrückbarer, unveränderlicher Einrichtung, ihrem unerschütterlichen Selbstwertgefühl. Das kommt von der Koerner’schen Sturköpfigkeit, pflegte Mutter zu sagen, wenn sie Späße auf eigene Kosten machte. «Vielleicht war’s die Absicht Ihrer Mutter, allen Leuten Peinlichkeit zu bereiten», macht Janice dem Mädchen klar. «Was hat sie damit bezweckt, dass sie Ihnen all das erzählt hat, was sollte das nützen, so alt, wie Sie inzwischen sind? Sie wollte Ärger machen, darauf läuft es hinaus. Und wer sagt überhaupt, dass irgendwas an der ganzen Sache wahr ist?» Doch sie spürt, dass es wahr ist – ein Harryhauch, ein blasses Leuchten, eine beunruhigende Strömung kommt von diesem Mädchen her, diesem neununddreißigjährigen Beweisstück.
«Oh, sie hätte sich so was nicht ausgedacht, es floss nur so aus ihr heraus. Es war nicht ihre Art, sich etwas auszudenken. Von den Kriminalromanen, die sie dauernd las, hat sie gesagt: ‹Wie denken die Leute sich das bloß alles aus? Bei denen muss eine Schraube locker sein.› Und sie hat mir meine Geburtsurkunde gezeigt, von einer Klinik in Pottstown. ‹Vater unbekannt› stand da.»
«Bitte, da haben wir’s, unbekannt», drängt Janice, wie eine Anwältin, die einen Fall durchboxen will, von dem sie weiß, dass er verloren ist.
«Sie wollten wissen, warum», sagt Annabelle. «Ich glaube, sie hat gedacht» – plötzlich spiegeln Tränen in ihren Augen das Licht, und ihre aufgeworfene Oberlippe zittert unkontrolliert –, «ihr könntet mir helfen, irgendwie.» Sie lacht über ihre Tränen und fegt sich rasch und energisch übers Gesicht mit geübten Händen, Händen, die es gewohnt sind, reibend, haltend, klopfend, zupackend Pflegerinnenhilfe zu leisten. «Ich war so allein, darüber hat sie sich wohl Gedanken gemacht. Ich habe seit Jahren keine ernsthafte Beziehung mehr gehabt. Und meine Brüder – Scott ging nach Seattle und Morris nach Delaware, er war wütend, als sie die Farm verkaufte und zu mir nach Brewer zog. Er hat geglaubt, er könnte die Farm bewirtschaften und dort leben, aber es wäre für ihre Begriffe nicht fair gewesen, wenn sie alles nur ihm hinterlassen hätte. Nicht, dass eine Farm von der Größe überhaupt noch jemanden ernähren könnte. Sogar mein Dad – ich meine Frank – musste zusätzlich die Township-Schulbusse fahren, um finanziell über die Runden zu kommen.»
«Geht es also um Geld?», fragt Janice, auf der Hut jetzt, da das Durcheinander seinen wahren Kern erkennen lässt. Geld ist etwas, für das sie ein Gefühl hat; es liegt ihr im Springer-Blut. Sie hat für ihren Vater die Buchführung gemacht und dann für Nelson, so gut sie konnte, bis er so viel zu verbergen hatte. Ronnie hat seine eigenen Ersparnisse und seine Pension, aber um das, was sie geerbt hat, kümmert sie sich nach wie vor selbst: wann die Depotbescheinigungen fällig sind und wie viel Zinsen die einzelnen Anlagen bringen und dass die Kapitalgewinnsteuern nicht zu viel von den Investmentfonds abknapsen (manche Fondsmanager schrauben die Gewinne hoch, nur damit ihre Jahresberichte gut aussehen). Dieses Mädchen kriegt keinen Penny von ihr. Janice nippt an ihrem Becher und sieht den Eindringling kühl an.
Annabelle denkt über die Frage nach und verdreht dabei die Augen nach oben. «Nnnein, ich glaube nicht. Die Vermittlungsstelle zahlt mir zwanzig Dollar pro Stunde, und ich arbeite oft in Zwölf-Stunden-Schichten. Meine Mutter hat uns eine nette Summe hinterlassen, auch wenn wir sie durch drei teilen mussten. Ihre Farm war, nach heutigen Maßstäben, nur mit einer winzigen Hypothek belastet. Und sie hat in den letzten fünfzehn Jahren eine angesehene Stellung gehabt bei dieser Anlageberatungsfirma in dem neuen Glasgebäude im Stadtzentrum. Sie musste über sich selber lachen: jeden Morgen eine Strumpfhose anziehen und Schuhe mit hohen Absätzen, wo sie vorher doch so ein Trampel vom Land gewesen war. Sie hat sich auf zweiundsiebzig Kilo heruntergehungert.»
«Zu arbeiten ist wundervoll», räumt Janice ein. «Frauen unserer Generation sind erst spät dazu gekommen.» Es ist ihr unangenehm, sich und Ruth in Verbindung zu bringen, Ruth die Unaussprechliche, die ihren, Janices, Mann auf der anderen Seite von Mt. Judge festgehalten hat, Ruth, das tückische, sudelige Gegenstück zu allem, was anständig ist.
«Nein, mit Geld hat es nichts zu tun», sagt Annabelle; sie schiebt sich auf dem Sofa nach vorn, um aufstehen zu können, legt sich wieder den Sweater um die Schultern und greift nach ihrer kleinen gelb, schwarz und rot gestreiften Tasche. «Es hatte eher was mit Familie zu tun. Aber lassen Sie nur, Mrs. Harrison. Ich merke, dass Sie sich lieber nicht darauf einlassen wollen, und das überrascht mich nicht, um ehrlich zu sein. Meine Mutter hat diese Idee gehabt, aber wegen der Medikamente war sie manchmal nicht richtig klar im Kopf. Sterbende sind oft nicht so vernünftig, wie man denkt, dass sie sein sollten. Ich habe dies nicht für mich getan, sondern für sie, weil sie mich darum gebeten hat.» Sie ist aufgestanden und sieht auf Janice nieder.
«Nun warten Sie doch.»
«Sie sind wirklich sehr geduldig gewesen. Ich weiß, was für ein Schock es sein muss.» Mit den geschickten, stabilen Händen zupft sie an ihrem Haar herum, diesem kunstvoll zerzausten Schopf, als ob sie es sei, die den Schock erlitten hat.
Janice sagt, sich verteidigend: «Sie können nicht mal eben kurz hereinschneien und einen Menschen mit so einer Sache überfallen.»
«Ich wusste nicht, wie ich es sonst tun sollte. Einen Brief schreiben oder anrufen, das schien mir in diesem Fall irgendwie nicht das Richtige.» Dazu ausgebildet, sich schnell zu bewegen, ist sie mit wenigen Schritten an der Haustür und legt die Hand auf den Türknauf, einen altmodischen mit erhabenem Muster, das im Lauf der Jahre blank gewetzt ist und so flach wie Messinglitze. Sie zieht die klemmende Tür auf, und von dem Knacken bleibt ein leiser Nachhall in der Luft, ein Schrei, der verklingt.