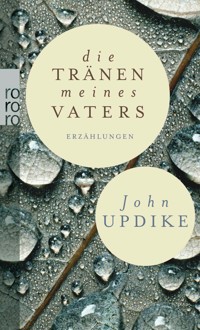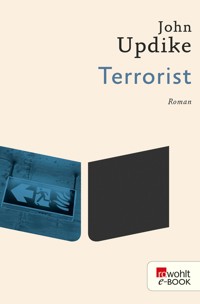
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie wird ein Terrorist zum Terroristen? Der achtzehnjährige Ahmed wächst bei seiner irischen Mutter in New Jersey auf. Sein Vater, ein Araber, hat die Familie früh verlassen. Aber die Trennung der Eltern liegt lange zurück, und in der Gegend gibt es viele kaputte Familien. Außerdem ist Ahmed ein ausgezeichneter Schüler, der im amerikanischen System Karriere machen könnte. Doch er ist auch ein Grübler und ein Idealist und auf der Suche nach seinen Wurzeln. Immer weiter kapselt er sich von seiner Umwelt ab. Und dann sitzt er eines Tages am Steuer eines Wagens voller Sprengstoff … "Updike zielt mit diesem Aufklärungsthriller in das Herz des amerikanischen Traumas" (Focus)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
John Updike
Terrorist
Roman
Über dieses Buch
Wie wird ein Terrorist zum Terroristen?
Der achtzehnjährige Ahmed wächst bei seiner irischen Mutter in New Jersey auf. Sein Vater, ein Araber, hat die Familie früh verlassen. Aber die Trennung der Eltern liegt lange zurück, und in der Gegend gibt es viele kaputte Familien. Außerdem ist Ahmed ein ausgezeichneter Schüler, der im amerikanischen System Karriere machen könnte. Doch er ist auch ein Grübler und ein Idealist und auf der Suche nach seinen Wurzeln. Immer weiter kapselt er sich von seiner Umwelt ab. Und dann sitzt er eines Tages am Steuer eines Wagens voller Sprengstoff …
«Updike zielt mit diesem Aufklärungsthriller in das Herz des amerikanischen Traumas» (Focus)
Vita
Geboren am 18.03.1932 in der Kleinstadt Shillington, Pennsylvania, als einziges Kind des Sekundarschullehrers und Diakons Wesley Russel Updike und dessen Frau Linda Grace Hoyer. Kindheit in materieller Bedrücktheit. Schulbesuch weiterhin in Shillington. 1950 Stipendium zum Studium am Harvard College, Hauptfach Anglistik; Abschluss des Untergraduiertenstudiums 1954 mit summa cum laude. Er heiratete 1953 die Kunststudentin Mary Entwistle Pennington, mit der er nach Abschluss des Studiums ein Jahr an die Ruskin School of Drawing and Fine Art in Oxford, England, ging. Nach Rückkehr in die USA von 1955 bis 1957 fest angestellt beim Magazin «The New Yorker». Danach verfasste er als freier Mitarbeiter Kurzgeschichten und einflussreiche literarische Kritiken. 1957 Umzug nach Ipswich im neuenglischen Massachusetts. 1964 Vortragsreisen durch die UdSSR, Rumänien, Bulgarien und die Tschechoslowakei. Seit 1964 war Updike Mitglied des National Institute of Arts and Letters. 1973 Fulbright-Lektor in Afrika. 1976 Mitglied der American Academy of Arts and Letters. Auszeichnungen: Guggenheim Fellowship in Poetry für «The Carpendered Hen and Other Tame Creatures» (1959); Rosenthal Foundation Award des National Institute of Arts and Letters für «Das Fest am Abend» (1960); Pulitzer Price for Fiction für «Bessere Verhältnisse» (1982); Lincoln Literary Award (1983); Distinguished Pennsylvania Artist Award (1983); National Book Critics Circle Award for Criticism für «Amerikaner und andere Menschen» (1984); St. Louis Literary Award (1988); Bobst Award for Fiction (1988); National Medal of Arts (1989); Premio Scanno (1991); O’Henry Award für «A Sandstone Farmhouse» aus «The Afterlife and Other Stories» (1991); Common Wealth Award (1993); Conch Republic Prize for Literature (1993); Commandeur de l’ordre des arts et des lettres (1995); The Howells Medal from the Academy of Arts and Letters (1995). John Updike starb am 27. Januar 2009 in Massachusetts. Sein gesamtes Werk ist auf Deutsch im Rowohlt Verlag und im Rowohlt Taschenbuch Verlag erschienen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel «Terrorist» bei Alfred A. Knopf, New York.
Die Zitate aus dem Koran folgen der Übersetzung von Rudi Paret (Verlag Kohlhammer, Stuttgart) unter gelegentlicher Benutzung der Übersetzung von L. Assmann (Bibliothek der Weltreligionen, Voltmedia, Paderborn). Die Bibel wird nach der Einheitsübersetzung zitiert.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2019
Copyright © 2006 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Terrorist» Copyright © 2006 by John Updike
Redaktion Hans Georg Heepe
Umschlagkonzept any.way, Hamburg, Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung Kanoke_46/iStock
ISBN 978-3-644-05711-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Darum nimm mir jetzt lieber das Leben, Herr!
Denn es ist für mich besser zu sterben als zu leben.
Da erwiderte der Herr:
Ist es recht von dir, zornig zu sein?
Jona 4:3–4
Der Unglaube ist robuster als der Glaube,
denn er stützt sich auf das sinnlich Wahrnehmbare.
Gabriel García Márquez, Von der Liebe und anderen Dämonen
I
Teufel, denkt Ahmed. Diese Teufel wollen mir meinen Gott nehmen. Den ganzen Tag wiegen sich an der Central High School die Mädchen, verhöhnen dich, stellen ihr verlockendes Haar und ihre weichen Körper zur Schau. Ihre nackten, mit funkelnden Nabelpiercings und abenteuerlich tief ansetzenden lila Tattoos geschmückten Bäuche fragen: Gibt’s vielleicht sonst noch was zu sehen? Jungen mit stumpfen Augen stolzieren oder zotteln umher und tun mit ihren kantigen Killergesten und ihrem achtlosen, abschätzigen Lachen kund, dass es keine andere Welt gibt als diese hier – ein von Lärm erfüllter, schmutzabweisend gestrichener, von Metallspinden gesäumter Gang mit der weißen Wand am Ende, die so oft durch Graffiti geschändet und wieder übertüncht worden ist, dass es einem vorkommt, als rücke sie Millimeter um Millimeter näher.
Die Lehrer, schlaffe Christen oder nichtpraktizierende Juden, halten im Unterricht demonstrativ zu Tugend und redlicher Selbstbeherrschung an, doch ihre unsteten Augen und leblosen Stimmen verraten ihren fehlenden Glauben. Sie werden von der Stadt New Prospect und dem Staat New Jersey dafür bezahlt, dass sie diese Dinge sagen. Es mangelt ihnen am wahren Glauben; sie sind nicht auf dem rechten Weg; sie sind unrein. Ahmed und die zweitausend anderen Schüler können sie nach der Schule auf dem rissigen, mit Abfall übersäten Parkplatz in ihre Autos huschen sehen wie Krebse, bleiche oder dunkle, die sich in ihre Schalen zurückziehen; sie sind Männer und Frauen wie alle anderen, voller Ängste und Gelüste und besessen von käuflichen Dingen. Als Ungläubige glauben sie, irdischen Besitz anzuhäufen und sich durch den flackernden Fernsehapparat zerstreuen zu lassen, verleihe Sicherheit. Sie sind Sklaven von Bildern, von falschen Bildern, die Glück und Reichtum vorgaukeln. Doch selbst wahrhafte Bilder sind sündige Nachahmungen Gottes, der allein erschaffen kann. Vor Erleichterung, ihren Schülern für einen weiteren Tag unbeschadet entkommen zu sein, schnattern die Lehrer, wenn sie sich auf den Fluren und auf dem Parkplatz voneinander verabschieden, zu laut, wie Trinker, deren Erregungspegel steigt. Die Lehrer lassen sich’s gut sein, wenn sie nicht in der Schule sind. Manche haben die geröteten Lider, den Mundgeruch und den schwammigen Körper von Leuten, die gewohnheitsmäßig zu viel trinken. Manche lassen sich scheiden; manche leben unverheiratet mit anderen zusammen. Ihr Leben außerhalb der Schule ist unordentlich, lüstern und zügellos. Die Regierung des Bundesstaats unten in Trenton und die satanische Regierung noch weiter unten, in Washington, bezahlt sie dafür, dass sie ihren Schülern Tugendhaftigkeit und demokratische Werte nahe bringen, doch die Werte, an die sie glauben, sind gottlos: Biologie, Chemie und Physik. Von deren Fakten und Formeln bestärkt, scheppern ihre falschen Stimmen durch die Klassenzimmer. Sie sagen, alles entsteht aus erbarmungslosen, blinden Atomen, die das kalte Gewicht von Eisen, die Durchsichtigkeit von Glas, die Reglosigkeit von Ton, die Erregung des Fleisches erzeugen. Elektronen strömen durch Kupferdrähte und Computerzugänge und sogar durch die Luft, wenn sie durch die Interaktion von Wassertröpfchen zum Blitzen gebracht werden. Nur was wir messen und aus den Messungen schließen können, ist wahr. Das Übrige ist der Traum, den wir Ich nennen.
Ahmed ist achtzehn. Es ist Anfang April; wieder kriecht müdes Grün in die erdigen Risse der Stadt. Von seiner neu erlangten Höhe blickt Ahmed hinab und denkt, wenn die unsichtbaren Insekten im Gras ein Bewusstsein hätten wie er, dann wäre er für sie Gott. Im vergangenen Jahr ist er um fast acht Zentimeter auf einen Meter achtzig gewachsen – weitere unsichtbare, materielle Mächte, die ihn ihrer Willkür unterwerfen. Größer, glaubt er, wird er nicht werden, weder in diesem noch im nächsten Leben. Falls es ein nächstes gibt, raunt ein Teufel in ihm. Was außer den flammenden, göttlich inspirierten Worten des Propheten beweist schon, dass es ein nächstes Leben gibt? Wo würde es sich verbergen? Wer würde das Feuer der Hölle in alle Ewigkeit schüren? Welche nie versiegende Energiequelle würde den Überfluss des Paradieses speisen, die dunkeläugigen Huris dort nähren, die strotzenden Früchte zum Schwellen bringen, die Bäche und plätschernden Springbrunnen erneuern, an denen Gott, wie in der neunten Sure des Korans beschrieben, stets Wohlgefallen hat? Wo bliebe da das zweite thermodynamische Gesetz?
Das Sterben von Würmern und Insekten, deren Körper so rasch in der Erde, im Unkraut und im Teer der Straßen verschwinden, spricht dafür, dass sein eigener Tod ebenso unbedeutend und endgültig sein wird. Auf dem Weg zur Schule ist Ahmed ein Zeichen aufgefallen, eine Spirale, auf das Pflaster geschrieben mit dem leuchtenden Schleim, den engelgleichen Körpersäften eines Wurms oder einer Schnecke, irgendeines niedrigen Lebewesens, von dem nur diese Spur übrig geblieben ist. Wohin war das Geschöpf, dessen Pfad sich ohne Ziel einwärts ringelt, unterwegs? Wenn es dem heißen Gehweg entkommen wollte, auf dem es in der glühenden Sonne verbrannte, dann war es ihm nicht gelungen, und es hatte sich fatal im Kreis bewegt. Doch in der Mitte der Spirale gab es keinen kleinen Wurmkörper mehr.
Wohin also war der Körper geflogen? Vielleicht hatte Gott ihn aufgepickt und geradewegs in den Himmel geholt. Ahmeds Lehrer Scheich Rashid, der Imam der Moschee in der ersten Etage der West Main Street 2781½, sagt, dass sich nach der geheiligten Tradition der hadith solche Dinge manchmal ereignen: Der Bote, der das geflügelte weiße Pferd Buraq ritt, wurde vom Engel Gabriel durch die sieben Himmel an einen Ort geleitet, wo er mit Jesus, Moses und Abraham betete, bevor er auf die Erde zurückkehrte und zum letzten der Propheten wurde, dem letzten und höchsten. Den Beweis für seine Abenteuer an jenem Tag bildet der deutliche Hufabdruck, den Buraq auf dem Felsen unter der heiligen Kuppel im Zentrum von Al-Quds hinterließ, der Stadt, welche die Ungläubigen und Zionisten – deren Qualen im Feuer von djehannim in der siebten, elften und fünfzehnten Sure des Buchs der Bücher beschrieben stehen – Jerusalem nennen.
Wunderbar klangvoll rezitiert Scheich Rashid die einhundertvierte Sure, die al-Hutama, das alles fressende Feuer, behandelt:
Doch wie kannst du wissen, was al-Hutama ist?
Es ist das Feuer Gottes, das in der Hölle angefacht ist
und den Verdammten bis ins Herz dringt.
Seine Flammen schlagen über ihnen zusammen
in langgestreckten Feuersäulen.
Als sich Ahmed bemüht, den Bildern im Arabischen des Korans – den langgestreckten Säulen, fi amadin mumaddada, dem Gewölbe hoch über den Herzen der Menschen, die sich angsterfüllt zusammenkauern und in den sich auftürmenden Dunst weißer Hitze, nāru ’l-lāhi ’mūqada, hineinzuspähen versuchen – irgendeinen Hinweis darauf zu entnehmen, dass der Barmherzige Nachsicht walten lässt und al-Hutama Einhalt gebietet, da senkt der Imam, dessen Augen von einem überraschend hellen Grau sind, sanft und unbestimmbar wie die einer Heidenfrau, den Blick und sagt, dass diese Beschreibungen von Visionen des Propheten im übertragenen Sinn zu verstehen sind. In Wahrheit geht es in ihnen um die glühende Pein der Trennung von Gott und um unser loderndes Bereuen von Sünden wider seine Gebote. Der Ton jedoch, in dem der Imam dies sagt, gefällt Ahmed nicht. Er erinnert ihn an den wenig überzeugenden Ton seiner Lehrer an der Central High. Er vernimmt darin das Raunen Satans, eine Verneinung im Mantel einer positiven Aussage. Der Prophet meinte physisches Feuer, wenn er unversöhnliches Feuer predigte; er konnte die Tatsache ewigen Feuers gar nicht oft genug betonen.
Scheich Rashid ist nicht so viel älter als Ahmed – vielleicht zehn, vielleicht zwanzig Jahre. Die weiße Haut seines Gesichts weist kaum Falten auf. Seine Bewegungen sind scheu, aber sicher. In den Jahren, die er Ahmed an Alter übertrifft, hat die Welt ihn geschwächt. Wenn ihm das Raunen der Teufel, die von innen an ihm nagen, anzuhören ist, hat Ahmed das Gefühl, er könnte sich erheben und den Imam vernichten, so wie Gott den armen Wurm im Zentrum der Spirale verglühen ließ. Der Glaube des Schülers ist fester als der des Lehrers. Es ängstigt Scheich Rashid, das geflügelte, unaufhaltsam vorwärts stürmende weiße Ross des Islam zu reiten. Er ist bestrebt, die Worte des Propheten abzumildern, sie mit unserem Denken zu verschmelzen, doch dafür sind sie nicht geschaffen: Sie dringen in unsere menschliche Weichheit ein wie ein Schwert. Allah ist der Höchste und über jegliche Besonderheit erhaben. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem lebendigen, dem unwandelbaren. Er ist das Licht, neben dem die Sonne schwarz wirkt. Er verschmilzt nicht mit unserer Vernunft, sondern zwingt sie, sich so tief zu neigen, dass sie sich im Staub die Stirn aufschürft und wie Kain mit dem Mal dieses Staubs gezeichnet ist. Mohammed war ein Sterblicher, doch er hat das Paradies gesehen und die Wirklichkeit dort erfahren. Unsere Taten und Gedanken wurden dem Bewusstsein des Propheten in goldenen Lettern eingeschrieben wie die lodernden Worte von Elektronen, die ein Computer aus Pixeln erzeugt, während wir auf der Tastatur tippen.
Auf den High-School-Fluren riecht es nach Parfüm und Körperausdünstungen, nach Kaugummi, unreinem Kantinenessen und nach Stoff, erwärmt von jungen Körpern – Baumwolle, Wolle und das synthetische Material der Sneakers. Zwischen den Unterrichtsstunden herrscht ein tosendes Hin und Her; der Krach überdeckt als dünne Schicht die darunter brodelnde, gerade noch gezügelte Gewalt. In der Flaute am Ende des Schultages, wenn der auftrumpfende, höhnische Rummel des Aufbruchs sich gelegt hat und nur noch die Schüler, die an Arbeitskreisen teilnehmen, in dem großen Gebäude zurückbleiben, macht sich Joryleen Grant manchmal an Ahmed heran, wenn er in seinem Spind kramt. Er treibt im Frühjahr Leichtathletik; sie singt im Mädchenchor. Nach den Maßstäben von Central High sind sie beide «brave» Schüler. Ihn hält seine Religion von Laster und Drogen fern, allerdings auch auf Distanz zu seinen Klassenkameraden und zu den Fächern des Lehrplans. Joryleen ist klein und rundlich, sie weiß sich im Unterricht gut auszudrücken, was dem Lehrer gefällt. Sie verströmt ein gewinnendes Selbstvertrauen, wenn ihre braunen Rundungen so prall die Sachen füllen, die sie trägt – heute mit Flicken und Strass besetzte Jeans, auf der Sitzfläche verblichen und abgewetzt, und darüber ein dunkelrotes, geripptes ShortyOberteil, das sowohl weiter ausgeschnitten als auch kürzer ist, als es sich schickt. Blaue Plastikspangen ziehen ihr Haar so glatt nach hinten, wie es nur geht; im wulstigen Rand ihres rechten Ohrs stecken mehrere kleine Silberringe. Sie singt bei Schulanlässen, immer Lieder, in denen es um Jesus oder um sexuelles Verlangen geht, beides Themen, die Ahmed zuwider sind. Dennoch freut es ihn, dass sie von ihm Notiz nimmt und ihn ab und zu umspielt wie eine Zunge einen empfindlichen Zahn.
«Kopf hoch, Ahmed», sagt sie neckisch. «So schlimm kann’s doch gar nicht stehen.» Sie rollt mit der halbnackten Schulter, deutet ein Achselzucken an, um ihm zu zeigen, dass sie es nicht ernst meint.
«Tut’s auch nicht», sagt er. «Ich bin nicht traurig.» Vom Duschen nach dem Lauftraining kribbelt es ihn unter den Kleidern – weißes Hemd, schmale schwarze Jeans – an seinem ganzen langen Körper.
«Du siehst unheimlich ernst aus», stellt sie fest. «Du solltest dir angewöhnen, mehr zu lächeln.»
«Warum? Warum sollte ich denn lächeln, Joryleen?»
«Weil dich die Leute dann mehr mögen.»
«Das ist mir egal. Ich will gar nicht gemocht werden.»
«O doch», sagt sie. «Jeder will gemocht werden.»
«Du bestimmt», sagt er höhnisch von seiner jüngst erlangten Höhe hinab. Wie große Blasen wölben sich ihre Brüste in den runden Ausschnitt ihres unanständigen Oberteils, das an seinem unteren Saum das Fett auf ihrem Bauch und den Umriss ihres tief liegenden Nabels entblößt. Ahmed stellt sich vor, wie ihr glatter brauner Körper, dunkler als Karamell, jedoch heller als Schokolade, in jener Feuerhölle schmort und sich mit Brandblasen überzieht; ein Anflug von Mitleid überkommt ihn, denn sie versucht ja, nett zu ihm zu sein, wie es dem Bild, das sie von sich hat, entspricht. «Hauptsache, du bist beliebt –», sagt er verächtlich.
Das kränkt sie, und sie wendet sich ab, wobei sie den Stapel von Büchern, die sie mit nach Hause nehmen will, von unten gegen ihre Brüste presst, sodass sich die Kluft zwischen ihnen vertieft. «Du bist ein Arsch, Ahmed», sagt sie, versuchsweise noch eine Spur liebevoll, und lässt ihre weiche, volle Unterlippe ein wenig hängen. Das Licht der Neonröhren an der Decke, die den Gang in sichere Helligkeit tauchen, bricht sich funkelnd auf ihrem speichelnassen Zahnfleisch. Zwar hat sich Joryleen schon abgewandt, um dem Gespräch ein Ende zu machen, versucht aber noch zu retten, was zu retten ist, und setzt hinzu: «Wenn’s dir egal wär, würdst du dich doch nicht in Schale werfen wie ein Prediger und jeden Tag ein frisches weißes Hemd anziehen. Wieso lässt deine Mutter sich das eigentlich gefallen, die ganze Bügelei?»
Er spricht nicht aus, dass seine wohlüberlegte Art, sich zu kleiden, eine neutrale Botschaft aussendet, da sie sowohl Blau, die Farbe der Rebellen, der afroamerikanischen Clique von Central High, als auch Rot meidet, die Farbe, mit der sich die Diabolos, die Hispano-Gang, zu erkennen geben, und sei es auch nur an einem Gürtel oder Stirnband. Ebenso wenig lässt er Joryleen wissen, dass seine Mutter selten bügelt, da sie Schwesternhelferin am Saint Francis Community Hospital und in ihrer verbleibenden Zeit Malerin ist und ihren Sohn in vierundzwanzig Stunden oft kaum eine Stunde sieht. Seine Hemden kommen, auf Pappe gefaltet, aus der Reinigung zurück, deren Rechnungen er mit dem Geld bezahlt, das er bei Shop-a-Sec verdient, wo er an zwei Abenden in der Woche und am Wochenende, wenn die meisten Jungen seines Alters die Straßen unsicher machen, sowie an christlichen Feiertagen arbeitet. Dennoch, seine Kleidung verrät Eitelkeit, das weiß er, einen Stolz, der die Reinheit des Allumfassenden verletzt.
Er spürt, dass Joryleen nicht nur versucht, nett zu sein: Er weckt ihre Neugier. Sie möchte ihm nahe kommen, ihn besser beschnüffeln können, obwohl sie bereits einen Freund hat, der bekanntermaßen zu den «Schlimmen» gehört. Frauen sind Tiere, die sich leicht führen lassen, hat Scheich Rashid ihm warnend erklärt, und Ahmed sieht selbst, dass die High School und die weitere Welt voller Schnüffelschw…, voll blinder Herdentiere ist, die einander anrempeln auf ihrer Suche nach einem tröstlichen Geruch. Trost aber, sagt der Koran, gibt es nur für jene, die an das nie gesehene Paradies glauben und das Gebot, fünfmal am Tag zu beten, befolgen, das der Prophet von seiner nächtlichen Reise auf Buraqs breitem, leuchtend weißem Rücken auf die Erde mitgebracht hat.
Joryleen steht noch immer da, beharrlich, zu nah. Ihr Parfüm dringt Ahmed in die Nase; die Kluft zwischen ihren Brüsten beunruhigt ihn. Sie verlagert die schweren Bücher, die sie in den Armen hat. Auf dem Rücken des dicksten liest er, mit Kugelschreiber geschrieben, JORYLEEN GRANT. Ihr Mund, matt pink geschminkt, damit er schmaler wirkt, verblüfft ihn durch verlegenes Stammeln. «Eigentlich wollte ich dich ja fragen», bringt sie so zögernd hervor, dass er sich zu ihr hinunterbeugt, um sie besser zu verstehen, «ob du am Sonntag vielleicht in die Kirche kommen möchtest, um mich zu hören – ich singe da im Chor ein Solo.»
Er ist schockiert, abgestoßen. «Ich gehöre nicht deinem Glauben an», ruft er ihr nachdrücklich in Erinnerung.
Darauf reagiert sie locker und sorglos. «Ach, so ernst nehme ich das alles nicht», sagt sie. «Ich singe einfach gern.»
«Jetzt hast du mich doch traurig gemacht, Joryleen», sagt Ahmed. «Wenn du deine Religion nicht ernst nimmst, dann solltest du nicht in die Kirche gehen.» Er schlägt seine Spindtür mit einem Zorn zu, der vor allem ihm selbst gilt, weil er sie getadelt und abgewiesen hat, wo sie doch verwundbar geworden war, als sie die Einladung aussprach. Mit glühendem Gesicht wendet er sich verwirrt von seinem zugeknallten Spind ab, um sich den Schaden zu betrachten, den er angerichtet hat, und sie ist weg. Sorglos saust ihr ausgebleichtes, strassbesticktes Jeanshinterteil den Gang entlang. Die Welt ist schwierig, denkt er, weil sich Teufel darin herumtreiben, alles durcheinander bringen und das Gerade krumm machen.
Als die High School im letzten Jahrhundert errichtet wurde, im zwanzigsten nach christlicher Zeitrechnung und im dreizehnten nach der Hegira des Propheten von Mekka nach Medina, ragte sie über der Stadt auf wie ein Schloss, wie ein Palast der Gelehrsamkeit für die Kinder von Fabrikarbeitern wie deren Vorgesetzten, geschmückt mit Säulen und Simsen und einem in Granit gemeißelten Motto: WISSEN IST FREIHEIT. Nun steht das Gebäude, reich an Narben und unausrottbarem Asbest, hart und glänzend vor Bleifarbe und mit Gittern vor seinen hohen Fenstern, am Rand eines breiten Sees von Schutt, der einst Teil einer von Straßenbahngeleisen geäderten Innenstadt war. Auf alten Fotografien schimmern die Geleise inmitten von Männern mit Strohhüten und Krawatten und kastenförmigen Automobilen, die alle die Farbe von Leichenwagen haben. So viele Kinomarkisen ragten damals über die Trottoirs und warben für rivalisierende Hollywood-Streifen, dass man in einem Regenschauer von einem Vordach zum nächsten flitzen konnte, ohne groß nass zu werden. Es gab sogar eine öffentliche Toilette, auf deren Scheiben in dezenten Lettern LADIES und GENTLEMEN geschrieben stand und die man von East Main Street auf Höhe der Tilden Avenue aus über zwei verschiedene Treppen erreichte. In jeder der unterirdischen Toiletten hielt eine ältere Person die Schüsseln und Becken sauber; zu Beginn der sechziger Jahre wurde die Einrichtung geschlossen, nachdem sie zu einem übelriechenden Ort des Drogenhandels, homosexueller Kontakte und gelegentlicher Überfälle geworden war.
Zweihundert Jahre zuvor hatte man die Stadt New Prospect getauft, weil sie einen so großartigen Blick auf den Wasserfall bot, jedoch auch wegen ihrer Zukunft, die man sich mit Inbrunst ausmalte. Der Fluss mit seinen pittoresken Kaskaden und strudelnden Stromschnellen, der sie durchfloss, würde Fabriken anziehen, glaubte man, als die Nation noch jung war, und nach vielen Fehlstarts und Bankrotten tat er dies auch – Webereien, Seidenfärbereien, Ledermanufakturen, Fabriken, die Lokomotiven herstellten, pferdelose Wagen und Kabel für die mächtigen Brücken, die sich über die Flüsse und Häfen der mittleren Atlantikküste spannten. Als das neunzehnte Jahrhundert ins zwanzigste mündete, gab es ausgedehnte, blutige Streiks; die Wirtschaft gewann nie wieder den Optimismus zurück, der den Emigranten aus Osteuropa, dem östlichen Mittelmeerraum und aus dem Nahen Osten half, VierzehnStunden-Tage voll mühseliger, giftiger, ohrenbetäubender, monotoner Plackerei zu ertragen. Die Fabriken zogen nach Süden und Westen, wo die Arbeitskräfte billiger und fügsamer und die Transportwege für Eisenerz und Kohle kürzer waren.
Die Menschen, die heute die Innenstadt bewohnen, sind in ihrer Mehrzahl braun, in sämtlichen Schattierungen dieser Farbe. Die wenigen verbliebenen weißen Geschäftsleute erzielen noch einen mageren Profit aus dem Verkauf von Pizza, Chili con Carne, bunt verpacktem Junkfood, Zigaretten und Lotterielosen, weichen jedoch mehr und mehr neu eingewanderten Indern und Koreanern, die sich bei Einbruch der Dunkelheit weniger gezwungen fühlen, in die noch gemischt bewohnten Randbezirke und Vororte der Stadt zu flüchten. Weiße Gesichter wirken in der Innenstadt zweifelhaft und schäbig. Spätabends, wenn ein paar schicke Folklore-Restaurants ihre Gäste aus den Vororten entlassen haben, hält schon einmal ein Streifenwagen, und weiße Fußgänger werden verhört, weil man sie für Dealer hält. Oder über die Gefahren dieser Gegend aufklären will. Ahmed selbst ist das Produkt einer rothaarigen amerikanischen Mutter irischer Abstammung und eines ägyptischen Austauschstudenten, dessen Vorfahren seit der Zeit der Pharaonen auf den heißen, schlammigen Feldern der überfluteten Nilufer gebräunt worden sind. Der Teint des Sprosses dieser Mischehe ließe sich als lohfarben bezeichnen, eine matte Nuance heller als beige; der seines Ersatzvaters Scheich Rashid ist von einem weißlichen Wachston, den er mit Generationen vielschichtig verhüllter jemenitischer Krieger teilt.
Wo einst fünf Stockwerke hohe Kaufhäuser und die dicht gedrängten Kontore jüdischer und protestantischer Ausbeuter eine ununterbrochene Fassade aus Glas, Backstein und Granit bildeten, tun sich nun von Bulldozern gerissene Lücken auf, und die Sperrholzflächen, die einmal Schaufenster waren, sind mit einem Gewirr von Graffiti besprüht. In Ahmeds Augen behaupten die wulstigen Lettern der Graffiti, ihr aufgedunsenes Protzen mit dieser oder jener Bandenzugehörigkeit, eine Bedeutung, an der es den Tätern sonst erbärmlich mangelt. Diese Schmierereien sollen verlorenen jungen Männern, die im Morast der Gottlosigkeit versinken, eine Identität verleihen. Inmitten der Ruinen stehen einige wenige neue Kästen aus Aluminium und blauem Glas, Beschwichtigungszeichen der Fürsten des westlichen Kapitalismus – Niederlassungen von Banken, deren Zentralen in Kalifornien oder North Carolina liegen, und Außenposten der zionistisch beherrschten Bundesregierung, die mit Wohlfahrtsmaßnahmen und Anwerbung von Rekruten versucht, die Verarmten von Aufruhr und Plünderung abzuhalten.
Und doch macht das Zentrum am Nachmittag einen festlichen, geschäftigen Eindruck: Auf East Main Street herrscht, zumindest ein Stück südlich und nördlich der Tilden Avenue, der Karneval des Müßiggangs, bevölkert von dem Gewimmel dunkelhäutiger, grell und bunt gekleideter Bürger, ein Mardi-Gras-Umzug von Kostümen, liebevoll komponiert von Menschen, deren Rechte kaum eine Fingerlänge über ihre Haut hinaus Geltung besitzen und die ihre dürftigen Vermögenswerte sichtbar mit sich führen. Ihre schrille Fröhlichkeit grenzt an Trotz. Aus ihren gackernden, lärmenden Stimmen dröhnt dörfliche Kumpanei, die überschwängliche wechselseitige Beachtung von Menschen, die wenig zu tun und keine fernen Ziele haben.
Nach dem Bürgerkrieg hielt in New Prospect das Streben nach Pracht Einzug, und ein stattliches Rathaus wurde errichtet, ein ausladendes, mit Türmchen verziertes, maurisch inspiriertes Gebilde aus Rundbögen und kunstvollen Schmiedearbeiten im Rokokostil, gekrönt von einem grandiosen Turm mit vielen Luken, dessen gewölbte Außenseite wie Fischschuppen vielfarbige Schindeln bedecken und der vier weiße, mit römischen Ziffern versehene Uhrblätter trägt, jedes von der Größe eines Brunnens. Die breiten kupfernen Dachrinnen und Fallrohre, die von den Fertigkeiten der damaligen Metallhandwerker künden, sind im Lauf der Zeit minzgrün geworden. Dieses Gebirge des Bürgersinns, dessen wichtigste bürokratische Funktionen längst in flachere, modernere, weniger imposante, jedoch klimatisierte und leichter beheizbare Gebäude dahinter verlagert worden sind, wurde vor kurzem, nach langem Schieben und Zerren, in den Rang eines nationalen Architekturdenkmals erhoben. Es steht in Sichtweite der High School, eine Querstraße von ihr entfernt, und das einst großzügig bemessene Grundstück, auf dem es steht, ist infolge von Straßenverbreiterungen und unverfrorenen Immobiliengeschäften, ermöglicht durch bestochene Beamte, stark geschrumpft.
Am östlichen Rand des Sees von Schutt, wo befriedete Parkplätze sich mit dem kabbeligen Wellengang abgerissenen Mauerwerks abwechseln, trägt eine dickwandige Kirche aus Eisenstein einen wuchtigen Kirchturm und lockt auf einem gesprungenen Anzeigebrett mit ihrem preisgekrönten Gospel-Chor. Die Fenster dieser Kirche, auf denen Gott blasphemischerweise ein Gesicht, gestikulierende Hände, Füße mit Sandalen und farbige Gewänder zugewiesen werden – kurz, ein menschlicher Körper samt allem, was daran unrein und beschwerlich ist –, sind vom Fabrikruß von Jahrzehnten geschwärzt und durch schützende Drahtgitter noch weiter unkenntlich gemacht. Heute zieht die religiöse Bildlichkeit Hass auf sich, wie in den Reformationskriegen. Die gesittete Glanzzeit der Kirche, als fromme weiße Bürger ihre Bänke füllten, ist ebenfalls lange vorbei. Nun bringen afrikanisch-amerikanische Gemeindemitglieder ihre unordentliche Schrei-Religion hierher, und ihr preisgekrönter Chor zersetzt ihnen das Hirn, bis sie in eine rhythmische Verzückung geraten, die ebenso illusorisch ist wie (Scheich Rashid hat höhnisch die Analogie hervorgehoben) die schlurfende, brabbelnde Trance brasilianischer Candomblé. An diesem Ort singt Joryleen.
An dem Tag, nachdem sie Ahmed eingeladen hat, sie im Chor singen zu hören, steuert auf dem Schulflur ihr Freund, Tylenol Jones, auf Ahmed los. Tylenols Mutter hatte das Wort während ihrer Schwangerschaft einmal in einem Werbespot für Schmerzmittel gesehen, und der Klang hatte ihr gefallen. «He, du, Araber», sagt Tylenol. «Du bist Joryleen quer gekommen, hör ich.»
Ahmed versucht, in der Sprache des anderen zu reden. «Quer? Ich? Nicht die Bohne. Wir haben ein bisschen palavert. Sie hat mich angequatscht.»
Genau abschätzend streckt Tylenol die Hand aus, legt sie dem schmächtigeren Jungen auf die Schulter und bohrt seinen Daumen in die empfindliche Stelle unter dem Schultergelenk. «Sie sagt, du respektierst ihre Religion nicht.» Sein Daumen dringt tiefer, bis an Nerven, die Ahmed noch nie im Leben gespürt hat. Tylenol hat ein quadratisches Gesicht von der Farbe feuchter Möbelpolitur auf Nussbaumholz. Er ist Stürmer der Central-High-Football-Mannschaft und im Winter Turner an den Ringen, und daher sind seine Hände stark wie Eisen. Sein Daumen zerknittert Ahmeds gestärktes weißes Hemd. Mit einem ungeduldigen Schulterrucken versucht der größere Junge, die feindselige Hand abzuschütteln.
«Sie hat die falsche Religion», erklärt er Tylenol, «und außerdem bedeutet sie ihr nichts, hat sie gesagt, von der blöden Chorsingerei mal abgesehen.» Der eiserne Daumen drückt weiter zu, doch aus einem Adrenalinschub heraus schlägt Ahmed mit der Handkante den dicken Muskelstrang weg.
Tylenols Gesicht verdunkelt sich und kommt mit einem Ruck näher. «Komm du mir bloß nicht blöd, Araber – du bist ja selber so blöd, dass keiner was von dir will.»
«Außer Joryleen», gibt Ahmed mit adrenalinverstärkter Kühnheit flink zurück. Innerlich fühlt er sich puddingweich, und er befürchtet, dass sein Gesicht vor Angst beschämend starr wirkt, doch einem überlegenen Gegner Paroli zu bieten und die massige Kraft der Wut in sich zu spüren, erfüllt ihn mit frommer Seligkeit. Man wird fest, wenn manWiderstand leistet, und ganz ruhig. Er wagt sich weiter vor. «Und blöd fand sie mich auch nicht gerade. Dass jemand wie Joryleen einfach nur freundlich sein kann, rafft ein Typ wie du natürlich nicht.»
«Ein Typ wie ich? Wie ist der denn? Ein Typ wie ich hat nichts übrig für einen Typ wie dich, merk dir das, du Blödmann. Du schwuler Arsch. Du Tunte.»
Sein Gesicht ist so nah, dass Ahmed den Käse von den Makkaroni in der Schulkantine riecht. Er setzt Tylenol die Faust auf die Brust und sorgt für Abstand. Andere scharen sich nun auf dem Flur um sie, die Cheerleader-Girlies und Computer-Freaks, die Rastas und die Grufties, die Mauerblümchen und die Schlaffis, und warten darauf, dass etwas Unterhaltsames passiert. Tylenol behagt das Publikum; er blubbert: «Gegen Black Muslims hab ich nichts, aber du bist ja keiner. Gar nichts bist du, bloß ein armer Spinner. Kein Wollkopf, bloß ein Wirrkopf.»
Ahmed rechnet damit, dass Tylenol ihn ebenfalls zurückschubsen wird, was er hinnehmen würde, um auf billige Weise aus dieser Konfrontation herauszukommen, zumal es gleich zur nächsten Unterrichtsstunde läuten muss. Tylenol ist jedoch nicht auf Waffenstillstand aus; er versetzt ihm einen hinterhältigen Hieb in den Magen, von dem Ahmed die Luft wegbleibt. Ahmeds verdutzte Miene, sein aufgerissener Mund bringen die zuschauenden Mitschüler zum Lachen, einschließlich der kalkgesichtigen Grufties, einer Gruppe von Weißen an Central High, die stolz darauf sind, nie ein Gefühl zu zeigen wie ihre Idole, die nihilistischen Punk-Rock-Stars, und samt einiger quirliger, draller brauner Mädchen, denen es nur darum geht, wie beliebt sie sind, und die, findet Ahmed, freundlicher sein sollten. Eines Tages werden sie Mütter sein. Eines baldigen Tages. Kleine Huren.
Er ist dabei, das Gesicht zu verlieren, und hat keine andere Wahl, als sich in Tylenols eiserne Pranken zu stürzen und, wenn er kann, dessen panzergleichen Brustkorb und quadratisches poliertes Nussbaumgesicht ein bisschen zu verbeulen. In dieser Runde bleibt es weitgehend bei Gerempel, Geschubse und Gegrunze, denn bei einem richtigen Boxkampf würden sie gegen die Spinde prallen, und der Krach würde Lehrer und Sicherheitskräfte auf den Plan rufen. In diesem Moment, kurz bevor die Glocke ertönt und sie in ihre verschiedenen Unterrichtsräume sausen müssen, gibt Ahmed die Schuld weniger dem anderen Jungen – der ist schließlich nur ein Roboter aus Fleisch und Blut, ein junger, von seinen Körpersäften und Reflexen gelenkter hirnloser Koloss – als Joryleen. Warum musste sie ihrem Freund auch in allen Einzelheiten von einem Gespräch unter vier Augen erzählen? Warum müssen Mädchen überhaupt immer alles erzählen? Um sich wichtig zu machen, genau wie die Typen, die diese aufgepumpten Graffiti-Lettern auf wehrlose Wände sprayen. Sie hatte von Religion zu reden angefangen – mit ihrer blöden Einladung in ihre Kirche, wo er mit kruselhaarigen Heiden zusammensitzen würde, die vom Höllenfeuer so angesengt sind wie rösch gegrillte Hühnerschlegel. Die Teufel in ihm müssen ja erwachen und zu murmeln beginnen, wenn Gott es so vielen grotesk irrigen, korrupten Religionen gestattet, Millionen von Menschen auf ewig in die Hölle hinabzulocken, wo der Allmächtige ihnen doch mit einem einzigen aufblitzenden Lichtstrahl den Weg zeigen, den Rechten Weg weisen könnte. Es ist, als wäre es dem Barmherzigen, dem Gütigen (raunen Ahmeds Teufel, während er und Tylenol fuchtelnd und schubsend aufeinander losgehen und sich bemühen, keinen Lärm zu machen), egal.
Die Glocke in ihrem kleinen, gegen unbefugte Eingriffe gesicherten Kasten hoch oben an der senffarbenen Wand ertönt. Ein Stück weiter den Flur entlang öffnet sich klickend eine Tür mit großer Milchglasscheibe; Mr. Levy, ein Schülerberater, erscheint. Sein Jackett passt nicht zu seiner Hose, es sieht aus, als hätte er sich blindlings einen zerknüllten Anzug zusammengesucht. Erst abwesend, dann alarmiert starrt er auf die verdächtige Schar von Schülern. Sofort muckst sich keiner mehr, Ahmed und Tylenol lassen voneinander ab und frieren den Tumult ein. Mr. Levy, ein Jude, der schon seit einer Ewigkeit in diesem Schulsystem tätig ist, sieht alt und müde aus. Er hat Tränensäcke unter den Augen, sein schütteres Haar ist ungekämmt, und ein paar Strähnen stehen ihm wirr vom Kopf ab. Bei seinem plötzlichen Erscheinen fährt Ahmed zusammen, wie von Gewissensbissen überkommen: Später in der Woche hat er einen Termin bei Mr. Levy, um mit ihm seine Zukunft nach dem High-School-Abschluss zu besprechen. Ahmed braucht eine Zukunft, das weiß er, aber sie kommt ihm unwirklich vor, und sie weist seine Annäherungsversuche ab. Die Leitung ist Leitung Gottes, heißt es in der dritten Sure.
Tylenol und seine Gang werden ihm von jetzt an auflauern. Nachdem der Quälgeist mit dem eisernen Daumen so ziemlich aufgelaufen war, würde er sich mit weniger als einem blauen Auge, einem ausgeschlagenen Zahn oder gebrochenen Finger nicht zufrieden geben – es musste zu sehen sein. Ahmed weiß, dass es Sünde ist, eitel auf die äußere Erscheinung Wert zu legen: Eigenliebe ist eine Form des Wetteiferns mit Gott, und Gott duldet das nicht. Wie aber kann ein Junge umhin, seine herangereifte Männlichkeit zu lieben, seine lang gewordenen Glieder, seinen vollen, glänzenden Haarschopf, seine makellose, beigefarbene Haut, heller als die seines Vaters, jedoch nicht so sommersprossig und fleckig rosa wie die seiner rothaarigen Mutter und die der Wasserstoffblondinen, die im Weißbrot essenden Amerika als Inbegriff der Schönheit gelten? Obwohl Ahmed die verweilenden, interessierten Blicke der dunkelhäutigen Mädchen, von denen er an Central High umgeben ist, als ungesittet und unrein meidet, möchte er seinen Körper doch nicht verunstaltet sehen. Er möchte ihn so bewahren, wie der Schöpfer ihn geschaffen hat. Tylenols Feindschaft ist ein weiterer Grund, diese Höllenburg zu verlassen, wo die Jungen andere nur zum Spaß quälen und verletzen und die ungläubigen Mädchen hautenge Hüfthosen tragen, die fast – bis auf einen Zentimeter, hat Ahmed geschätzt – so tief sitzen, dass sie den Blick auf die obersten Schamhaarlöckchen freigeben. Die ganz schlimmen Mädchen, die bereits durch und durch verdorbenen, haben Tattoos an Stellen, an denen nur ihre Freunde sie zu sehen bekommen und in die der Tätowierer seine Nadel höchst behutsam stechen musste. Die teuflischen Verrenkungen nehmen kein Ende, sobald sich Menschen frei fühlen, mit Gott zu konkurrieren und sich selbst zu erschaffen.
Ahmed hat nur noch zwei Monate Schulzeit vor sich. Hinter den Backsteinmauern, den hohen, vergitterten Fenstern liegt Frühling in der Luft. Die Kunden von Shop-a-Sec erledigen ihre armseligen Einkäufe neuerdings mit guter Laune und wiedererwachter Redseligkeit. Ahmeds Füße fliegen über die alte Aschenbahn der Schule, als träfe jeder seiner Schritte auf eine Feder. Als er auf dem Gehweg stehen geblieben war, um über die gewundene Spur des versengten und verschwundenen Wurms zu rätseln, brachten rings um ihn her junge grüne Sprösslinge, Knoblauch, Klee und Löwenzahn, die vom Winter erschöpften Grasflecken zum Leuchten, und Vögel erkundeten in flinken, aufgekratzten Bögen die unsichtbare Substanz, die sie trug.
Jack Levy wacht jetzt, da er dreiundsechzig ist, zwischen drei und vier am Morgen auf, den Geschmack von Angst im Mund, den, während er träumte, schleppende Atemzüge ausgetrocknet haben. Jack Levys Träume sind düster vollgesogen mit dem Elend der Welt. Er liest die an mangelnden Anzeigen sterbende Lokalzeitung New Prospect Perspectiveund die New York Times oder Post, wenn jemand sie im Lehrerzimmer liegen gelassen hat, und – als hätte er damit noch nicht genug von Bush, Irak und hiesigen Morden, solchen in Queens und East Orange, sogar an Kindern von zwei, vier oder sechs Jahren, so jung, dass es ihnen wie Blasphemie vorkäme, sich lauthals gegen die Mörder, ihre Eltern, zur Wehr zu setzen, so wie es Blasphemie gewesen wäre, hätte Isaac sich Abraham widersetzt – am Abend zwischen sechs und sieben wendet sich Levy, während die korpulente Frau, die Bestandteile des Abendessens vom Kühlschrank zum Mikrowellenherd trägt, sich immer wieder vor dem kleinen Bildschirm des Fernsehers in der Küche vorbeischiebt, der Nachrichtenzusammenfassung aus dem Großraum New York und den Nachrichtensprechern der Networks zu, bis ihn die Werbespots, die er alle bereits des Öfteren gesehen hat, ihn so aufregen, dass er das elende Gerät abstellt. Über die Nachrichten hinaus hat Levy eigenes Unglück zu ertragen, Unglück, das er «stemmen» muss, wie man heutzutage sagt – die Bürde des kommenden, des hinter all diesem Dunkel grauenden Tages. Angst und Ekel rumoren in ihm gleich den Bestandteilen einer dieser miesen Restaurantmahlzeiten, wie sie einem heutzutage zugemutet werden – doppelt so viel Essen, wie man braucht. Die Angst schlägt die Tür vor ihm wieder zu und wirft Levy in den Schlaf zurück, in das sich von Tag zu Tag verstärkende Gefühl, dass es für seinen Körper auf der Erde nichts weiter mehr zu tun gibt, als sich auf den Tod vorzubereiten. Seine Balz- und Paarungspflicht hat er erfüllt; er hat ein Kind gezeugt; er hat gearbeitet, um dieses Kind, den kleinen Mark mit seinen scheu blickenden Augen und der feuchten Unterlippe, zu ernähren und mit all dem Ramsch auszustatten, den er gemäß der diktatorischen Kultur der Zeit haben musste, um nicht hinter seine Altersgenossen zurückzufallen. Jetzt bleibt Jack Levy nur noch die Pflicht, zu sterben und damit auf diesem überfrachteten Planeten ein bisschen Platz, ein bisschen Luft freizumachen. Diese Aufgabe hängt dicht über seinem schlaflosen Gesicht wie ein Spinngewebe mit einer reglosen Spinne in der Mitte.
Seine Frau Beth, ein Wal von weiblichem Wesen, das durch seine Speckschicht zu viel Wärme absondert, atmet hörbar neben ihm. Ihr unermüdlich scharrendes Schnarchen ist die Fortsetzung ihrer Monologe während des Tages. Wenn er sie mit der unterdrückten Wut vergeblichen Tuns mit dem Knie oder Ellbogen anstößt oder ihr sanft die Hand auf eine unter dem hochgerutschten Nachthemd entblößte Pohälfte legt, dann verstummt sie brav, und dann befürchtet Jack, sie geweckt und das unausgesprochene Gelübde gebrochen zu haben, das zwischen zwei Menschen besteht, die irgendwann einmal, vor wie langer Zeit auch immer, übereingekommen sind, ein Bett zu teilen. Er möchte nur, dass ihr Schlaf so leicht wird, dass ihre Atemzüge nicht mehr geräuschvoll in ihrer Nase vibrieren. Es gleicht dem Stimmen der Geige, die er als Junge gespielt hat. Ein neuer Heifetz, ein neuer Isaac Stern – hatten sich seine Eltern das von ihm erhofft? Er hatte sie enttäuscht, und das war einer der Punkte, an denen sein Unglück mit dem der Welt zusammenfiel. Seine Eltern waren tief bekümmert gewesen. Trotzig hatte er ihnen erklärt, er gehe nicht mehr zum Geigenunterricht. Das Leben in den Büchern und auf der Straße hatte ihm mehr bedeutet. Da war Jack elf oder zwölf, und er hat die Geige seither nie wieder angerührt, obwohl er manchmal – wenn er im Autoradio einen Fetzen von Beethoven, ein Mozart-Konzert oder Dvořáks Zigeunermusik hört, die er einst in einer Bearbeitung für Schüler geübt hat – zu seiner Überraschung merkt, wie seine linke Hand die Griffe wiederzufinden sucht und auf dem Lenkrad zuckt wie ein sterbender Fisch.
Warum sich geißeln? Er hat sich ganz ordentlich geschlagen, mehr als ordentlich sogar: mit Auszeichnung von Central High abgegangen, Abschlussjahrgang 59, als einem die Schule noch nicht wie ein Gefängnis vorkam, als man noch fleißig lernen und das Lob der Lehrer mit Stolz entgegennehmen konnte; als Student emsig zum Community College von New York gependelt, dann die Wohnung in SoHo, die er mit zwei jungen Männern und einem Mädchen geteilt hatte, das seine Zuneigung mal diesem, mal jenem von ihnen gewährte; nach dem College-Abschluss zwei Jahre in der Armee, zu der Zeit, als es noch die Wehrpflicht gab und bevor der Vietnam-Konflikt heißlief; Grundausbildung in Fort Dix, Schreibstubenhengst in Fort Meade, Maryland, immerhin so weit südlich der Mason-Dixon-Linie, dass es dort von antisemitischen Südstaatlern wimmelte; das letzte Jahr dann in Fort Bliss in El Paso, in der Personalabteilung, wo sie die passenden Leute für bestimmte Aufgaben ausgesucht hatten und wo er begonnen hatte, Teenager zu beraten; danach das Master-Studium an der Rutgers University, finanziert mit den bereits gekürzten Mitteln aus dem gesetzlichen Weiterbildungsprogramm für GIs; seitdem einunddreißig Jahre High-School-Lehrer für Geschichte und Gemeinschaftskunde, die letzten sechs Jahre dann ausschließlich als Schülerberater tätig. Die bloßen Fakten seiner Laufbahn gaben ihm das Gefühl, in eine Falle geraten zu sein, in einen Lebenslauf, so dicht verschlossen wie ein Sarg. Im Dunkeln bekam er nun nur noch mühsam Luft, und verstohlen drehte er sich von der Seitenlage auf den Rücken, lag nun wie eine katholische Leiche bei der Aufbahrung.
Wie laut Bettlaken sein können, so nah am Ohr, wie brechende Wellen! Er möchte Beth nicht wecken. Wo er schier am Ersticken ist, kann er nicht auch noch mit ihr zurande kommen. Einen Moment lang mildert die neue Lage seine Pein, wie der erste Schluck aus einem Glas, bevor die Eiswürfel den Whisky verwässern. Auf dem Rücken liegend, erfüllt ihn die Ruhe eines Toten, nur dass er nicht gleich über der Nasenspitze einen Sargdeckel hat. Es ist still auf der Welt – der Berufsverkehr hat noch nicht eingesetzt, die Nachtschwärmer mit ihren kaputten Auspuffrohren haben endlich ins Bett gefunden. Jack hört einen einsamen Laster vor der blinkenden Ampel an der nächsten Kreuzung den Gang wechseln und, zwei Zimmer weiter, Carmela, die kastrierte, klauenlose Katze der Levys, auf weichen Pfoten einen rastlosen Galopp hinlegen. Ihrer Krallen beraubt, wie sie ist, kann man sie nicht ins Freie lassen, denn die Katzen aus der Nachbarschaft könnten sie umbringen. Im Haus gefangen, verbringt sie den Tag meist schlafend unter dem Sofa, doch des Nachts, wenn es im Haus still geworden ist, halluziniert sie anscheinend und besteht in ihrer Phantasie die animalischen Abenteuer, die Kämpfe und das Davonkommen, was sie zu ihrem eigenen Wohle nie erleben darf. So trostlos ist die sinnlich wahrnehmbare Umwelt in diesen Stunden vor dem Morgengrauen, und so allein kommt sich Jack Levy vor, dass ihn der leise Aufruhr einer wahnsinnigen, kastrierten Katze beinahe so weit besänftigt, dass sein Verstand, seiner Wächterpflichten enthoben, in den Schlaf zurückgleitet.
Und doch liegt er, von einer quengelnden Blase wachgehalten, da, wie einem Übelkeit erregenden Ausbruch von Radioaktivität dem Eindruck ausgeliefert, sein Leben sei ein überflüssiger Fleck – ein Klecks, ein lang nachwirkender Fehler – auf der sonst makellosen Fläche dieser unmenschlichen Stunde. Er hat im finsteren Wald der Welt den rechten Weg verpasst. Aber gibt es denn einen rechten Weg? Oder ist es bereits ein nicht wieder gutzumachender Fehler, am Leben zu sein? In der abgespeckten Fassung von Geschichte, wie er sie lange Schülern vermittelt hat, die Mühe hatten zu glauben, dass die Welt nicht mit ihrer eigenen Geburt und der Verbreitung von Computerspielen begann, erreichten selbst die größten Männer nichts als ein Grab; ihre Visionen blieben unerfüllt – Karl der Große, Karl V., Napoleon, der unaussprechliche, jedoch recht erfolgreiche und in gewissen arabischen Ländern noch immer bewunderte Adolf Hitler. Geschichte ist eine Maschine, welche die Menschheit unablässig zu Staub zermahlt. Die Beratungsgespräche hallen in Jacks Kopf nach als kakophonischer Wust von Missverständnissen. Er sieht sich als erbärmliche ältliche Gestalt an einem Ufer, die einer Flotte von jungem Leben Warnungen zuruft, während sie in den fatalen Sumpf der Welt hineingleitet – der Welt mit ihren schrumpfenden Ressourcen, ihren schwindenden Freiheiten, ihrer gnadenlosen Werbung und ihrer absurden, auf Bier, Musik und unglaublich dünnen, fitten jungen Frauen beruhenden Popularkultur.
Oder waren die meisten Frauen in ihrer Jugend einmal so dünn gewesen wie die Geschöpfe in den Werbespots für Bier und Coke, selbst Beth? Wahrscheinlich, aber sich daran zu erinnern, fällt ihm so schwer, wie den Bildschirm im Auge zu behalten, wenn sie davor hin- und hergeht, um das Abendessen zusammenzutragen. Sie hatten sich während seiner anderthalb Jahre an der Rutgers University kennen gelernt. Beth war ein Mädchen aus Pennsylvania, aus der East-Mount-Airy-Gegend Philadelphias, das Bibliothekswissenschaften studierte. Ihre Leichtigkeit hatte ihn angezogen, ihr Lachen, ihr listiges Geschick, alles, sogar sein Werben um sie, ins Komische zu ziehen. Was für männliche Babys würden wir wohl haben? Ob sie halb beschnitten auf die Welt kommen? Sie, Elizabeth Fogel, war Deutschamerikanerin und hatte eine weniger liebenswerte ältere Schwester namens Hermione. Er war Jude, jedoch kein stolzer, vom Alten Bund bestärkter Jude. Sein Großvater hatte in der Neuen Welt jegliche Religion abgeworfen und gläubig auf eine Welt nach der Revolution gesetzt, in der die Mächtigen nicht mehr mittels Aberglauben herrschen konnten und wo ein gut gedeckter Tisch und ein solides, schützendes Dach über dem Kopf die unzuverlässigen Versprechen eines unsichtbaren Gottes ersetzten.
Nicht dass der Gott der Juden je zu großartigen Versprechen geneigt hätte – ein zerbrochenes Glas zur Hochzeit, ein hastiges Begräbnis im Leichentuch, wenn man stirbt, keine Heiligen, kein Leben nach dem Tod, nur lebenslange, loyale Plackerei für den Tyrannen, der von Abraham verlangt hatte, ihm seinen einzigen Sohn als Brandopfer darzubringen. Der arme Isaak, dieser vertrauensselige Esel, der fast von seinem eigenen Vater getötet worden wäre, wurde als alter blinder Mann auch noch von seinem Sohn Jakob und seiner eigenen, verschleiert aus Paddan-Aram herbeigeführten Frau Rebekka um seinen Segen betrogen. Wenn man sämtliche Regeln befolgte – und für die orthodoxen Juden war die Liste der Regeln lang –, erhielt man dafür in jüngster Zeit einen gelben Stern und eine Karte einfache Fahrt in die Gaskammern. Nein, danke: Jack Levy fand ein halsstarriges Vergnügen darin, einer der halsstarrigen Neinsager des Judentums zu sein. Er hatte seine Umgebung darin bestärkt, «Jacob» in «Jack» zu verwandeln, und sich der Beschneidung seines Sohnes widersetzt, obwohl ein aalglatter weißer Protestant von Krankenhausarzt Beth dazu überredete, «aus rein hygienischen Gründen»; Studien hätten gezeigt, behauptete er, dass dadurch für Mark das Risiko sinke, sich mit Geschlechtskrankheiten zu infizieren, und für seine Partnerinnen dasjenige, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Da hatten sie einen Neugeborenen vor sich, gerade eine Woche alt, dessen Schwanz noch nicht größer war als ein Knopf auf dem gesäumten Nadelkissen seiner Eier, und schon wollten sie sein Sexleben verbessern und noch ungeborene weibliche Säuglinge vor Gefahren bewahren!
Beth gehörte als Lutheranerin einem herzhaften christlichen Bekenntnis an, das mehr auf Glauben als auf Arbeit setzte und mehr auf Bier als auf Wein, und Jack erwartete, sie werde mäßigend auf seine sture jüdische Tugendhaftigkeit einwirken, die älteste der aussichtslosen Lehren, die in der westlichen Welt noch aktiv sind. Selbst der sozialistische Glaube seines Großvaters war ob der Entwicklung, die der Kommunismus in der Praxis genommen hatte, sauer und schal geworden. Jack hatte seine und Beth’ Verehelichung – im ersten Stockwerk des lächerlichen Rathauses von New Prospect, in Anwesenheit lediglich ihrer Schwester sowie seiner Eltern – als tapfere Mesalliance betrachtet, als ein aus historischer Sicht belangloses Liebeskuddelmuddel wie so vieles, was sich im Jahr 1968 ereignete. Nach sechsunddreißig gemeinsam im Norden von New Jersey verbrachten Jahren haben sich die religiösen und ethnischen Unterschiede zwischen ihnen abgeschliffen und einer glanzlosen Gleichartigkeit Platz gemacht. Sie sind zu einem Paar geworden, das am Wochenende gemeinsam bei ShopRite und Best Buy einkauft und das unter einem vergnügten Abend eine Bridge-Runde an zwei Tischen versteht, zusammen mit drei anderen Paaren von der Schule oder der Clifton Public Library, wo Beth an vier Tagen in der Woche arbeitet. An einem Freitag oder Samstag versuchen sie sich gelegentlich aufzumuntern, indem sie abends essen gehen, abwechselnd in dem chinesischen oder dem italienischen Restaurant, wo sie Stammgäste sind und wo der lächelnde Oberkellner sie an einen Tisch führt, an dem Beth ein wenig mehr Platz hat, oder indem sie sich einen Film ansehen, wenn sie einen finden können, in dem nicht allzu viel Gewalt oder Sex vorkommt und der nicht gar zu offensichtlich die idiotische Zielgruppe der vierzehn- bis siebzehnjährigen männlichen Zuschauer anpeilt. Um die Zeit, als Beth und Jack sich kennen lernten und dann frisch verheiratet waren, brach das System der Studios zusammen, und atemberaubende, subversive Filme kamen heraus – Midnight Cowboy, Easy Rider, Bob & Caroline & Ted & Alice, The Wild Bunch, Uhrwerk Orange, Dirty Harry, Die Kunst zu lieben, Der letzte Tango in Paris, Der Pate, Die letzte Vorstellung, American Graffiti –, ganz zu schweigen von den späten Bergman-Werken und jenen französischen und italienischen Filmen, die noch voll existenzieller Angst, Schärfe und nationaler Eigenart waren. Gute Filme waren das gewesen, die ein Paar nicht geistig erschlaffen ließen. Damals hatte als Relikt von 68 noch das Gefühl in der Luft gelegen, die Welt könne von jungen Leuten nach deren Vorstellungen umgemodelt werden. In sentimentaler Erinnerung an jene damals gemeinsam erlebten Offenbarungen, als das gemeinsame Erleben in einer Ehe für sie beide neu gewesen war, stiehlt sich Jacks Hand im Kino auch heute noch manchmal zu Beth hinüber, findet auf ihrem Schoß ihre leicht gedunsene, heiße Hand und hält sie fest, während die Explosionen irgendeines viel späteren, auf simplere Erwartungen hin kalkulierten Reißers ihre Gesichter überfluten und die unverfrorenen Grobheiten und eiskalt berechneten Schocks in dessen kindischem Script ihr Alter verhöhnen.
Schlaflos, der Verzweiflung nahe, erwägt Jack, unter der Decke nach Beth’ Hand zu tasten; wenn er jedoch versucht, inmitten der Wülste ihres bewusstlosen Körpers ihre Hand zu finden, könnte er Beth stören und ihre unermüdliche, unersättliche, immer noch kindliche Stimme wecken. Fast so verstohlen wie ein Krimineller zieht er die Füße auf dem Betttuch an, schiebt behutsam die Decke beiseite und entkommt aus dem ehelichen Bett. Als er über den Bettvorleger hinaustritt, spürt er an den bloßen Füßen die Aprilkälte. Der Thermostat ist noch auf die Nachttemperatur eingestellt. Jack tritt an ein Fenster mit vergilbten Spitzenvorhängen und betrachtet im grauen Licht der Quecksilberdampflampen die Gegend, in der er wohnt. Das Orange des Gulf-Schilds an der rund um die Uhr geöffneten Tankstelle an der übernächsten Straßenecke sticht als einzig deutlicher Farbtupfer in der nächtlichen Szenerie hervor. Hier und da in der Nachbarschaft erwärmt ein fahles Niedrigvoltlicht das Fenster eines Kinderzimmers oder eines Treppenabsatzes. Im unentschiedenen Dunkel unter einem lackschwarzen Gewölbe, an dem der aufsteigende Schimmel des städtischen Glimmens nagt, verschwinden die verkürzten Winkel von Dachlinien, Schindeln und Fassadenverkleidungen im Unendlichen.
Siedlung, denkt Jack Levy. Häuser sind zu Siedlungen aneinander gerückt, aufgrund von steigendenGrundstückspreisen und Parzellierung enger aneinander geschoben. Wo es seiner Erinnerung nach hinter und zwischen den Häusern Gärten mit blühenden Bäumen, Gemüsebeeten, Wäscheleinen und Schaukeln gegeben hatte, herrschen nun betonierte Wege und asphaltierte Parkflächen vor, die man den einst – wie es den Vorstellungen des Planers vom Wohnglück im Grünen entsprach – großzügig bemessenen Rasenstücken abgeknapst hat und an denen ein paar struppige Büsche um Kohlendioxyd und feuchte Erde kämpfen. Als maßgebend haben sich die Bedürfnisse des Automobils erwiesen. Die entlang der Bordsteine gepflanzten Robinien, die an den Zäunen und Hausmauern rasch Wurzel fassenden wilden Akazien, die wenigen Rosskastanien, die aus der Zeit der Eiswagen und Kohlelaster überlebt haben – all diese Bäume, ihre Knospen und kleinen jungen Blätter, die sich im Lampenlicht als silbriger Flaum frischen Wachstums zu erkennen geben, sind in Gefahr, bei der nächsten Straßenverbreiterung entwurzelt zu werden. Die schlichten Konturen der Doppelhäuser aus den dreißiger Jahren und die Ranch-Häuser im Kolonialstil der fünfziger sind bereits überfrachtet mit nachträglich eingefügten Dachfenstern, aufgesetzten Terrassendecks und spirrigen Außentreppen, mit denen der gesetzlich vorgeschriebene Zugang zu Studio-Apartments geschaffen wurde, die einmal Gästezimmer gewesen waren. Die Fläche bezahlbarer Grundstücke wird immer kleiner, wie ein Blatt Papier, das gefaltet und noch einmal gefaltet wird. Aussortierte Scheidungswitwen, überflüssig gewordene Facharbeiter aus Industriezweigen, die ins Ausland verlagert wurden, und hart arbeitende Menschen dunkler Hautfarbe aus den innerstädtischen Slums, die nach der nächsten Sprosse der Aufstiegsleiter grapschen, ziehen in diese Wohngegend und können es sich nicht leisten, wieder fortzuziehen. Junge Paare richten heruntergekommene Doppelhaushälften wieder her und hinterlassen darauf ihre Markierung, indem sie die Veranden, Giebeleinfassungen und Fensterrahmen in ausgefallenen Farben streichen – Neon-Flieder, Giftgrün –, und die grellen Kleckse an der Straße werden von den älteren Anwohnern als Beleidigung empfunden, als Fanale der Verachtung, als unansehnliche Spielerei. Die kleinen Lebensmittelgeschäfte an den Ecken sind eines nach dem anderen eingegangen und haben das Feld Kettenläden überlassen, deren Logos und Dekor so unbekümmert schrill sind wie die gigantischen Farbabbildungen ihres fettmachenden Fast Foods. Amerika ist, wenn man Jack Levy fragt, lückenlos mit Fett und Teer zugepflastert, ein von Küste zu Küste reichender Fliegenfänger, an dem wir alle festkleben. Selbst auf unsere vielgerühmte Freiheit brauchen wir uns nicht mehr viel einzubilden, nachdem die Kommunisten aus dem Rennen ausgeschieden sind: Sie macht es nur leichter für Terroristen, unauffällig ein- und auszureisen, Flugzeuge und Transporter anzumieten und Webseiten einzurichten. Religiöse Spinner und ComputerFreaks: eine sonderbare Kombination für Jack, der altmodischerweise Intellekt und Glauben als Gegensätze empfindet. Diese Irren, die die Flugzeuge in das World Trade Center geflogen haben, waren technisch gut ausgebildet. Der Anführer hatte einen deutschen Universitätsabschluss in Stadtplanung. New Prospect hätte seine Fachkenntnisse brauchen können.
Ein positiverer, vitalerer Mensch als er, nimmt Jack an, würde diese Stunden nutzen, bevor seine Frau aufwacht, die Zeitung auf der Veranda landet und der sternenlose Himmel über den Dächern zu schmutzigem Grau gerinnt. Er könnte hinuntergehen und nach einem der Bücher suchen, von denen er die ersten dreißig Seiten gelesen hat, oder Kaffee machen oder sich ansehen, wie sich die Muntermacher in den TV-Frühnachrichten heiser quasseln. Aber er steht lieber hier und flutet seinen leeren Kopf mit dem sehr irdischen Anblick der Straße.
Eine gestreifte Katze – oder ist es ein kleiner Waschbär? – flitzt über die leere Fahrbahn und verschwindet unter einem geparkten Auto, dessen Marke Jack nicht benennen kann. Autos sehen jetzt alle gleich aus, gar nicht mehr wie die mit den großen Flossen und den chromblitzenden, grinsenden Mäulern in der Zeit, als er ein Junge war; der Buick Riviera hatte sogar Bullaugen und der Studebaker eine Boxernase; und erst die tollen langen Cadillacs der fünfziger Jahre – die waren wirklich aerodynamisch. Angeblich der Aerodynamik und des Benzinsparens wegen sind heutzutage sämtliche Autos, vom Mercedes bis hinab zum Honda, ein bisschen pummlig und gedrungen und neutral lackiert, damit man den Straßenschmutz weniger sieht. Ein großer Parkplatz wird dadurch zum Albtraum, und man fände nie den eigenen Wagen wieder, wenn es den kleinen Blipp nicht gäbe, der aus einer gewissen Entfernung die Lichter aufblinken lässt oder, wenn auch das nicht hilft, ein Hupsignal auslöst.
Eine Krähe mit etwas Bleichem und Langem im Schnabel schwingt sich träge von dem Loch auf, das sie in einen grünen Plastiksack gehackt hat, der gestern Abend für die Müllabfuhr hinausgestellt worden ist. Ein Stück weiter unten an der Straße eilt ein Mann im grauen Anzug von einer Veranda hinunter, steigt in einen Wagen, einen bulligen, durstigen Geländewagen, und braust dröhnend – ist ihm doch gleich, ob irgendwelche Nachbarn wach werden – davon, vermutlich nach Newark, zu einem frühen Flug, nimmt Jack an. Da steht er, starrt durch die frostigen Fensterscheiben und denkt: Das also ist das Leben. In einer Siedlung zu wohnen, Essen runterzuschlingen, sich am Morgen zu rasieren und zu duschen, damit man den anderen am Konferenztisch nicht mit seinen Pheromonen den Atem nimmt. Ein ganzes Leben hat es gedauert, bis ihm klar wurde, dass Menschen stinken. Als er noch jünger war, ist ihm der schale Geruch nie aufgefallen, der jetzt von ihm ausgeht, wenn er sich einfach nur ruhig durch den Tag bewegt, ohne je ins Schwitzen zu geraten.
Nun – wenn er all das sieht, ist er immerhin noch am Leben. Vermutlich ist das nicht das Schlechteste, aber es strengt an. Wer war noch der Grieche in diesem Buch, von dem sie damals am Community College alle so hingerissen waren? Oder vielleicht war es später, an der Uni, beim Masterstudium. Sisyphus. Der bergan zu wälzende Felsen, der unweigerlich abwärts rollt. Jack steht noch am Fenster, aber er sieht nichts mehr, sondern sein Bewusstsein kämpft gegen die Gewissheit an, dass all das eines Tages für ihn enden wird. Die Bilder in seinem Kopf werden vollkommen erlöschen, und doch wird alles ohne ihn weitergehen – immer neue Tage werden anbrechen, Autos werden anspringen und wilde Geschöpfe auf vom Menschen vergiftetem Land nach Nahrung suchen. Carmela ist unhörbar die Treppe hinaufgeschlichen und reibt sich unter lautem Schnurren an Jacks nackten Knöcheln, in der Hoffnung, früh gefüttert zu werden. Auch das ist das Leben, ein Leben, das ein anderes berührt.
Jacks Augen fühlen sich sandig und tranig an. Er hätte nicht aufstehen sollen, meint er nun; an der Seite seiner massigen, warmen Frau hätte er vielleicht noch eine Stunde Schlaf ergattert. Jetzt muss er seine Müdigkeit durch einen langen, mit Terminen voll gepackten Tag schleppen, an dem in jedem Moment jemand etwas von ihm will. Er hört das Bett quietschen; Beth hat sich bewegt und die Matratze von ihrem Gewicht erlöst. Die Badezimmertür geht auf und zu, der Riegel klickt ein und springt wieder heraus, was Jack schon lange aufbringt. Als er noch jünger war, hätte er versucht, das zu beheben, doch seit Mark in New Mexico lebt und allenfalls einmal im Jahr nach Hause kommt, gibt es keinen sonderlichen Grund mehr, für Diskretion im Bad zu sorgen. Beth’ Verrichtungen bringen das Wasser in den Rohren im ganzen Haus zum Gurgeln.
Eine Männerstimme, sehr schnell sprechend und mit Musik unterlegt, quillt vom Nachttisch her in den Raum; wenn Beth aufwacht, stellt sie als Erstes das verdammte Ding an und geht dann davon. Ständig nimmt sie elektronisch Verbindung mit einer Welt auf, in der sie beide physisch in zunehmender Isolation leben, ein alterndes Paar, dessen einziges Kind ausgeflogen ist. Dabei versetzt sie ihre Tätigkeit tagtäglich unter unbekümmert junge Leute. In der Bücherei war Beth gezwungen zu lernen, mit Computern umzugehen, nach Informationen zu suchen, sie auszudrucken und Halbwüchsigen auszuhändigen, die zu blöd sind, Bücher zu durchstöbern, soweit es zu ihren Fragen noch Bücher gibt. Jack hat versucht, die ganze Revolution zu ignorieren, er kritzelt die Aufzeichnungen zu seinen Beratungsgesprächen stur weiter mit der Hand und macht sich nur selten die Mühe, sich in den Computer einzuloggen, in dem die Daten der zweitausend Schüler von Central High gespeichert sind. Wegen dieses Versagens oder dieser Weigerung rügen ihn oft seine Berater-Kollegen, deren Zahl sich in dreißig Jahren verdreifacht hat, zumal Connie Kim tut es, eine zierliche Koreaamerikanerin, deren Spezialität Problemkinder sind, farbige Schulschwänzerinnen, und Wesley Ray James, ein ebenso korrekter wie effizienter Schwarzer, dessen noch nicht lange zurückliegende sportliche Leistungen ihm bei den Jungen helfen. Jack verspricht zwar, dass er sich ein oder zwei Stunden hinsetzen und die Daten nachtragen wird, aber Wochen vergehen, ohne dass er dafür Zeit findet. Es hat mit Vertraulichkeit zu tun; es liegt ihm nicht, den Inhalt vertraulicher Gespräche in ein elektronisches Netzwerk einzufüttern, das jedermann in der Schule zugänglich ist.
Beth ist da mehr auf dem Laufenden, bereiter, nachzugeben und sich zu verändern. Sie hat damals die standesamtliche Trauung akzeptiert, obwohl sie ihm errötend gestanden hatte, es würde ihren Eltern das Herz brechen, wenn die Hochzeit nicht in ihrer Kirche stattfände. Was es ihrem eigenen Herz antun würde, hatte sie nicht gesagt, und er hatte erwidert: «Lass es uns schlicht halten. Ohne Hokuspokus.» Die Religion bedeutete ihm nichts, und als sie zum Ehepaar verschmolzen, bedeutete sie auch Beth nichts mehr. Heute fragt er sich, ob er ihr damit nicht etwas genommen hat, wie grotesk es auch sein mag, und ob sie sich dafür nicht durch ihr unaufhörliches Geplapper und Gefutter Ersatz verschafft. Mit einem halsstarrigen Juden verheiratet zu sein ist sicher nicht leicht.
In Bahnen von Frotteestoff gehüllt, taucht sie aus dem Bad auf, sieht ihn stumm und reglos am Fenster des oberen Flurs stehen und ruft erschrocken aus: «Jack! Was ist mit dir?»
Mit einem gewissen ehelichen Sadismus beschützt er seinen Trübsinn, indem er ihn nur halbherzig vor ihr verbirgt. Jack möchte Beth das Gefühl geben, sie sei an seinem Befinden schuld, obwohl der Verstand ihm sagt, dass dem nicht so ist. «Das Übliche», sagt er. «Ich bin wieder mal zu früh aufgewacht. Und konnte nicht wieder einschlafen.»
«Das ist ein Anzeichen von Depressionen, haben sie neulich im Fernsehen gesagt. Oprah hatte eine Frau in der Sendung, die ein Buch dazu geschrieben hat. Vielleicht solltest du einen … ich weiß ja auch nicht, das Wort ‹Psychiater› macht jedem, der nicht reich ist, Angst, hat die Frau gesagt. Also, vielleicht solltest du einen Spezialisten für seelische Gesundheit konsultieren, wenn es dir so elend geht.»
«Einen Weltschmerz-Spezialisten.» Jack wendet sich um und lächelt sie an. Obwohl auch sie über sechzig ist – einundsechzig, zwei Jahre jünger als er –, ist ihr Gesicht faltenlos; was bei einer schlanken Frau tiefe Furchen wären, sind auf ihrem runden Gesicht zarte Striche; das Fett glättet ihre Haut und verleiht ihr eine mädchenhafte, zarte Straffheit. «Nein, danke, Liebes», sagt er. «Ich gebe den ganzen Tag lang weise Sprüche von mir, da schaffe ich es nicht, selbst welche entgegenzunehmen. Ich habe zu viele Antikörper.»
Wenn er Beth bei einem Thema abwehrt, dann wirft sie sich, wie er im Lauf der Jahre herausgefunden hat, rasch auf ein anderes, um seine Aufmerksamkeit nicht gänzlich zu verlieren. «Apropos Antikörper, Herm hat mir gestern am Telefon gesagt – das ist absolut vertraulich, Jack, nicht mal ich dürfte es wissen, versprich mir, dass du’s keinem erzählst –»
«Versprochen.»