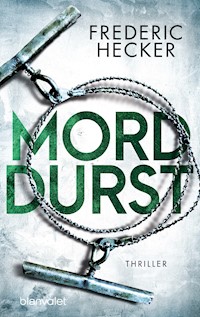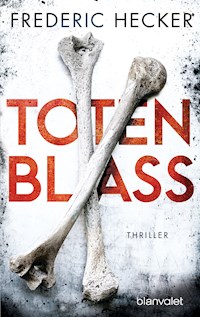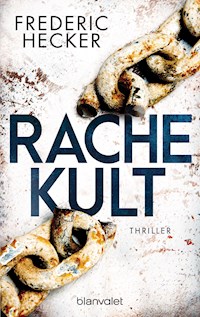
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Fuchs & Schuhmann
- Sprache: Deutsch
Eine Mordserie, so grausam wie willkürlich. Und ein Ermittler, dessen Vergangenheit ihn das Leben kosten könnte …
In Frankfurt herrscht drückende Hitze, als ein enger Freund von Kriminalhauptkommissar Fuchs an ominösen Verbrennungen stirbt. Während Fuchs gemeinsam mit der jungen Fallanalystin Lara Schuhmann in dem rätselhaften Fall ermittelt, geschieht ein weiterer Mord. Der perfide Killer arbeitet mit ebenso ungewöhnlichen wie brutalen Mordwerkzeugen, doch die Taten erscheinen willkürlich. Bis eine Spur mitten in die Reihen der Polizei führt. Fuchs muss sich dem dunkelsten Kapitel seiner Vergangenheit stellen, um weitere Morde zu verhindern – und nicht selbst zum Opfer zu werden.
Die »Fuchs & Schuhmann«-Thriller:
Totenblass (Bd. 1)
Rachekult (Bd. 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
In Frankfurt herrscht drückende Hitze, als ein enger Freund von Kriminalhauptkommissar Fuchs an ominösen Verbrennungen stirbt. Während Fuchs gemeinsam mit der jungen Fallanalystin Lara Schuhmann in dem rätselhaften Fall ermittelt, geschieht ein weiterer Mord. Der perfide Killer arbeitet mit ebenso ungewöhnlichen wie brutalen Mordwerkzeugen, doch die Taten erscheinen willkürlich. Bis eine Spur mitten in die Reihen der Polizei führt. Fuchs muss sich dem dunkelsten Kapitel seiner Vergangenheit stellen, um weitere Morde zu verhindern – und nicht selbst zum Opfer zu werden.
Autor
Frederic Hecker wurde 1980 in Offenbach am Main geboren. Er studierte Medizin in Frankfurt und hat nach seiner Promotion im Institut für Rechtsmedizin zwei chirurgische Facharztbezeichnungen erlangt. Heute lebt er mit seiner Frau und ihren beiden Hunden in Hannover, wo er als Plastischer Chirurg tätig ist. Seine Freizeit widmet er dem Schreiben.
Die »Fuchs & Schuhmann«-Thriller bei Blanvalet:
Band 1: Totenblass
Band 2: Rachekult
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.instagram.com/blanvalet.verlag
Frederic Hecker
Rachekult
Thriller
Das Zitat von Hans Christian Andersenstammt aus »Das Märchen meines Lebens«, 1847
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2021 bei Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Ivana Marinovic
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: plainpicture/Anja Weber-Decker
JB· Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26390-4V001
www.blanvalet.de
Für meine Familie
Es gibt keinen anderen Teufel als den, den wir in unserem eigenen Herzen haben.
Hans Christian Andersen, dänischer Dichter
Prolog
Kurz bevor Linda in einer Blutlache zusammensackte, hatte sie auf bessere Zeiten gehofft. Dabei war sie nicht so naiv gewesen, dies der Hoffnung zu überlassen, denn die war der Wille der Schwachen. Das Leben aber glich einer Pokerpartie. Ein Teil war Glück, der andere Strategie. Egal wie mies die Hände, die man erhielt, waren, man hatte immer die Wahl, welche man spielte. Ob man sie spielte. Nur Aussteigen war nicht so leicht wie am Pokertisch. So oft ihr der Gedanke daran in letzter Zeit auch gekommen war – sie hatte es einfach nicht fertiggebracht. Immer schien es einen Grund zu geben, warum man am Leben festhalten sollte. Selbst, wenn man ihn kaum erkennen konnte. Doch seit Kurzem gab es ihn wieder. Spürbar, sichtbar und hoffnungsgeladen.
Es war an der Zeit für eine Veränderung.
»Schneid sie ab«, sagte Linda schon zum zweiten Mal.
Die Frau im Spiegel legte die Stirn in Falten. Ihre Schere blitzte im Deckenlicht auf.
»Nun mach schon«, bekräftigte Linda.
Angelika ließ die Schere sinken und sah sich hilfesuchend im Raum um. Dann schnellte ihr Arm hoch. Ein manikürter Nagel deutete auf die Zeitschrift in der Hand der benachbarten Kundin. »So?«
Linda betrachtete das Cover, erkannte Cameron Diaz mit einem modischen Bob an der Seite ihres neuen Lovers. Matt Dillon hieß er doch. Ja, die Welt drehte sich weiter. Bei ihr selbst zwar in einer Abwärtsspirale, aber bei Cameron schien wie immer alles in bester Ordnung zu sein. Dieses Lächeln. Kleiner Breitmaulfrosch. Trotzdem bezaubernd. Und die Augen. Strahlend wie blaue Topase. Als sie zwei Jahre zuvor an der Seite von Jim Carry in Die Maske gespielt hatte, war sie für Linda die schönste Frau auf Erden gewesen. Und jetzt? Selbst dieser dämliche Bob stand ihr. Natürlich, was sonst? Leider war die Haarfarbe das Einzige, was Cameron mit ihr teilte.
Lindas Blick streifte den der anderen Kundin. Die Silberfolie auf ihrem Kopf erinnerte an einen Alu-Hut, als sollte er die Frau vor Gedankenklau schützen. Dabei waren ihre Gedanken ebenso leicht zu lesen wie die von Angelika. Sie standen beiden mit riesigen Lettern in ihre dummen Gesichter geschrieben.
Bist du noch ganz bei Trost?
Wieso um Himmels willen willst du dir dein schönes Haar abschneiden, Kind?
Linda betrachtete sich im Spiegel. Seit Jahren kam sie in diesen Salon. Stets zum Quartalsende, fast immer samstags. Immer derselbe Stuhl, immer dieselbe Friseurin. Immer derselbe Schnitt. Nur, dass eben nichts mehr so war wie die Jahre zuvor. Alles hatte sich verändert. Die Blicke der Menschen sowie ihr eigener Blick auf die Menschen. Selbst die Frisur von Cameron Diaz. Ihr war, als hätte sich mit dem Vorfall vor einigen Wochen ein Schleier gehoben, der bis dahin die wahre Sicht auf die Welt verhängt hatte. Auf einmal schien sie imstande, hinter die Masken der Leute zu schauen.
»Nein«, sagte Linda, »ab.«
»Okay …«, kam es gedehnt von Angelika, »… wir können uns ja rantasten. Ich fange mal hiermit an.« Mit Zeige- und Mittelfinger umklammerte sie zehn Zentimeter von den Spitzen entfernt eine Strähne.
»Was genau an ab hast du nicht verstanden?«, fragte Linda.
Angelika sah sie erst überrascht an und legte dann eine Mitleidsmiene auf. »Ich weiß nicht … Du hast so schönes Haar. Ich bringe das einfach nicht übers Herz.«
Linda stand auf, riss sich den Umhang vom Hals und warf ihn über die Stuhllehne. »Dann vergiss es.« Sie schnappte sich ihre Tasche von der Ablage und verließ den Salon.
Draußen auf dem Bordstein blieb sie kurz stehen, um zu verschnaufen, ging aber weiter, als ihr der Schweiß ausbrach. Sie sah in den Himmel. Keine einzige Wolke. Die Sonne erschien ihr wie die Öffnung eines riesigen Schneidbrenners. Sie trat in den Schatten unter dem Vordach einer Konditorei. In der Auslage drängten sich quietschbunte Fruchttörtchen unter glibbrigem Tortenguss, die mit schokoglasierten Krapfen, Baiserhäubchen und sahnegefüllten Windbeuteln um die Kundschaft wetteiferten. Linda watschelte weiter, denn unter dem Vordach war es kaum kühler. Zudem wurde ihr beim Anblick des Süßkrams bloß schlecht.
Zu Beginn, als sie nicht gewusst hatte, woher die Übelkeit kam, hatte sie morgens nicht mal die Zahnbürste im Mund ertragen. Vom Löffel fürs Müsli ganz abgesehen. Also hatte sie eine Weile aufs Frühstück verzichtet. Dann waren die beiden Striche auf dem Teststäbchen erschienen, und nach dem ersten Schock hatte zaghafte Freude ihr Leid verdrängt. Bis das ständige Erbrechen folgte. Kaum etwas war dringeblieben, sodass sich bald Ängste hinzugesellt hatten. Eine allumfassende Sorge um das, was da in ihr heranreifte. Ein Kind, das sie im Grunde ebenso wenig kannte wie all die Fremden, die in diesem Moment an ihr vorübergingen. Trotzdem spürte sie diese unglaubliche Verbundenheit. Das also war das sagenumwobene Band zwischen Mutter und Kind. Ein Geniestreich für den Artenerhalt, gefertigt in der göttlichen Schmiede, aus der auch der Überlebenstrieb stammt.
Wie als Antwort auf ihre Gedanken nahm sie ein Ziehen im Unterleib wahr. Einmal. Zweimal. Großer Gott! Sie blieb stehen, krümmte sich, vergaß zu atmen. Waren das Tritte, oder hatte der Kleine sich inzwischen bewaffnet? Es fühlte sich an, als wäre er mit einem Messer in ihr zugange. Doch ebenso schnell, wie die Schmerzen gekommen waren, verschwanden sie wieder.
Linda richtete sich auf, blies Luft durch die Lippen. Was war das? Hatte er sie gekratzt? War das überhaupt möglich? Konnten Fuß- oder Fingernägel von Föten so lang werden, dass sie die Gebärmutter verletzten? Sie versuchte, sich an den Nachwuchs ihrer Freundinnen zu erinnern, an deren winzige Fäustchen, wenn die sich mit beachtlicher Kraft um ihren Zeigefinger geballt hatten. Die waren doch immer kurz und absolut sauber gewesen. Wie frisch getrimmt. Ab wann musste man Babys die Nägel schneiden? Darüber hatte sie noch gar nichts gelesen. Bestimmt gab es auch zu diesem Thema etwas in einem der Ratgeber, die sich in ihrer Wohnung stapelten. Sie war mit der Lektüre bloß nicht so weit gekommen. Doch sie hatte ja noch etwas Zeit. Wenn die Ärztin mit ihrer Berechnung richtiglag, gute vier Monate. Genauer gesagt, einhundertsiebenundzwanzig Tage. Einhundertsiebenundzwanzig Tage inmitten von Menschen, die ihr zwar das Gefühl gaben, nicht alleine zu sein, aber dennoch nichts gegen die Einsamkeit in ihrem Innern ausrichten konnten.
Sie kam an der Blumenhandlung der Wittigs vorbei, in der ihre Mutter über zwanzig Jahre lang Kundin gewesen war. Vermutlich die beste, die das Geschäft bisher erlebt hatte. Deko, Sträuße, Gestecke, Kränze … Ihre Mutter war wirklich für jeden Anlass in diesen Laden gerannt, und wäre sie nicht letztes Jahr im Urlaub bei einem Erdbeben gestorben, hätte sie ihn wohl auch vor acht Wochen aufgesucht, um die Liegesträuße und Trauergestecke zu holen. Doch wenigstens Mama war dieser Tag erspart geblieben, dachte Linda und erkannte durch die Glasfront, wie Frau Wittig einer alten Dame ein Gesteck überreichte. Wahrscheinlich würde die Alte es gleich zum Friedhof tragen und auf das Grab eines geliebten Menschen legen. Was sonst.
Frau Wittig geleitete ihre Kundin zum Ausgang, hielt ihr die Tür auf und winkte ihr nach. Lange hat die Oma nicht mehr, dachte Linda, und bemerkte dann, wie sehr auch die Floristin in die Jahre gekommen war. Der Zahn der Zeit hatte ihr tiefe Furchen ins Gesicht genagt. Sie kannte Frau Wittig schon seit ihrer Kindheit, aus einem Alter, als sie gerade so über die Ladentheke hatte schauen können. Nun trafen sich ihre Blicke wieder. Linda hob eine Hand zum Gruß. Etwas geschah mit dem Lächeln auf dem Gesicht der Floristin. Als erstürbe die Herzlichkeit, um einer Mischung aus Mitleid und Skepsis zu weichen. Inzwischen erkannte Linda so etwas. Es folgte ein förmliches Nicken. Dann wandte Frau Wittig sich wieder ab und verschwand hinter Blumenampeln mit Grünzeug und Hängebegonien im Laden.
Linda ging weiter. Die Blumenfrau konnte ihr mal am Arsch vorbeigehen. So wie der Rest dieser einfältigen Dorfbewohner. Der Rest der verdammten Menschheit!
Sie steuerte auf das Parkhaus zu, wo ihr Wagen stand. Zwischendurch blieb sie einige Male stehen, um zu verschnaufen. Wie sollte das erst in den kommenden Monaten werden, wenn sie sich jetzt schon so anstellte? Bei der letzten Voruntersuchung hatte das Baby gerade einmal zehn Zentimeter gemessen und laut Schätzung der Ärztin höchstens einhundert Gramm auf die Waage gebracht. Daran konnte es also kaum liegen. War heute vielleicht einfach nicht ihr Tag? Genauso wenig wie der gestrige. Und der davor. Was würde wohl morgen sein? Daran wollte sie gar nicht erst denken.
Linda wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Hitze hatte sich zwischen den Häuserreihen gestaut, sodass selbst das zarte Lüftchen, das wehte, null Erleichterung brachte. Sie fühlte sich wie in einem riesigen Ofen, die Regler auf zweihundert Grad und Umluft gestellt. Als sie den Durchgang zum Parkhaus betrat, legte sich eine erfrischende Kühle auf ihre Haut, und der typische Geruch nach Abgasen schlug ihr entgegen. Doch was war das? Sie schnüffelte, sah sich um und bemerkte den feuchten Fleck an der Wand. Hatte doch tatsächlich jemand hier in die Ecke gepisst, obwohl überall Kameras hingen. Hinter ihr fiel die Tür ins Schloss, und fast in derselben Sekunde stach ihr Sohn wieder zu. Nur dass er scheinbar auf ein größeres, grobzackiges Messer umgestiegen war. Linda krümmte sich erneut unter Schmerzen, spürte, wie etwas Warmes ihre Schenkel hinablief. Fiel auf die Knie, hob ihr Kleid, erblickte das Blut. Vor ihrem inneren Auge sah sie den Fötus, der seine Klauen in ihre Gebärmutter schlug wie ein wild gewordenes Tier. Aus Lindas Kehle drang ein erstickter Laut. Was um Himmels willen passierte mit ihr? Wieder und wieder stach ihr Sohn zu. Linda kippte zur Seite, spürte den kalten Beton an ihrer Wange, roch den Gestank der Urinlache keine Armlänge von ihr entfernt. Mit letzter Kraft rollte sie sich zusammen, lag nun selbst da wie ein Embryo. In ihrem Kopf eine einzige Frage: Fühlt es sich so an zu sterben?
1
»Sie sind von der Kripo, nehme ich an?« Der Polizist stand breitbeinig vor dem Gebäude und erinnerte Hauptkommissar Fuchs an einen Türsteher, der erklärte, dass Einlass nur für geladene Gäste war.
Er nickte, hob eine Hand. »Joachim Fuchs.«
»Jens Arnold. Sind Sie allein?«
Fuchs sah sich um. »Meine Kollegin kommt mit dem Rad. Sie hat es nicht weit. Ich dachte, sie wäre schon da.«
Arnold schüttelte den Kopf. »Nein, hier sind nur wir drei.« Fuchs grüßte den zweiten Beamten, der trotz der warmen Sommernacht nervös von einem Bein aufs andere trat, als würde er frieren. »Der Notarzt ist schon wieder weg. Da war nicht mehr viel zu machen. Zeugen gibt’s keine. Wenn man die Leiche sieht, erübrigt sich die Frage nach der Todesart. Also haben wir Sie verständigt. Dennoch wollte ich Ihnen mit den weiteren Schritten nicht vorweggreifen. Manche Ihrer Kollegen hassen es ja, wenn die Spurensicherung schon herumwuselt. Die wollen sich lieber erst mal selbst ein Bild machen.« Er wies mit dem Daumen über die Schulter. »So was haben Sie noch nicht gesehen. Garantiert.«
Fuchs folgte dem Fingerzeig zu einer hellblauen Tür. Lack blätterte davon ab, als würde sich das Metall häuten. Auf Höhe der Klinke war das Türblatt verbogen. Vermutlich war dort mal ein Brecheisen angesetzt worden. Da die Stelle verrostet war, musste der Einbruch aber länger zurückliegen.
»Der Schließzylinder fehlt«, bemerkte Fuchs.
»Ja, wurde wohl schon vor geraumer Zeit ausgeschlagen. Seither ist das Gebäude für jeden frei zugänglich. Richtig widerlich da drin. Scheint ein Platz für Mittellose oder Menschen mit besonderen Vorlieben zu sein. Penner, Sprayer, Junkies oder Lost-Place-Touristen. Ist ja mittlerweile ein richtiger Hype geworden, solche verlassenen Orte auszukundschaften. Dabei hat dieser hier eigentlich nicht viel zu bieten. Wenn man mal von der Leiche da drin absieht.« Er lachte. Tatorthumor.
Fuchs sah auf die Uhr. Viertel nach neun. Wo zum Teufel blieb Lara? Er ließ seinen Blick über die angrenzenden Gebäude schweifen, den von Laternen in schwefelgelbes Licht getauchten Platz bis vor zur Straße jenseits des Stacheldrahtzauns, der das Grundstück umschloss wie ein Gefängnis.
Er wandte sich wieder um, legte den Kopf in den Nacken und sah an der Fassade empor. Versuchte, den geschwungenen Schriftzug daran zu entziffern.
»BonTex«, beantwortete Arnold die stumme Frage. »Früher wurden hier Leder und Textilien verarbeitet. Taschen, Portemonnaies, Möbelbezüge. Liegt aber schon ewig brach. Sind irgendwann pleite gegangen.«
»Wer hat Sie informiert?«
»Anonymer Anrufer. Schätze mal, einer der Meth-Männer, die hier abhängen. Aber wir waren schon drin, Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Momentan ist da niemand, bis auf … na ja, Sie werden es ja gleich sehen.«
Fuchs schaute sich noch einmal auf dem beleuchteten Platz um. Als er Lara immer noch nicht entdeckte, nickte er Arnold zu. »Na gut, gehen wir rein.«
»Und Ihre Kollegin?«
»Wird schon kommen.«
»Okay, dann los.« Er wandte sich dem Beamten neben ihm zu. »Du bleibst hier, Thomas. Ich will da drin keine Überraschung erleben, verstanden? Wenn seine Kollegin gleich kommt, bringst du sie rein.«
Der junge Polizist nickte wortlos, tippte sich an den Schirm seiner Mütze.
Militärischer Gehorsam par excellence, dachte Fuchs, während Arnold unter kreischenden Angeln die Tür aufzog.
Das Erste, was er wahrnahm, waren eine undurchdringliche Schwärze sowie ein modriger Geruch, der ihm entgegenströmte. »Ich hoffe, Sie haben eine Lampe dabei?«
Arnold zog eine Maglite von seinem Gürtel. »Klar. Da drin ist es dunkel wie in einem Bärenarsch.« Er knipste die Lampe an und ging mit großen Schritten voraus. »Folgen Sie mir.«
Fuchs hängte sich hinter ihn. Bei jedem Schritt knackte und knirschte es unter seinen Sohlen. Zudem stieg ihm ein beißender Gestank in die Nase. Der Strahl der Lampe schnitt wie ein Lichtschwert durch den Raum, huschte hektisch über den Boden und ließ zerbrochene Flaschen, Dosen sowie Einwegspritzen aufleuchten. Arnold hatte nicht zu viel versprochen. Widerlich war noch wohlwollend ausgedrückt. An einer der mit Graffitis verunzierten Wände lehnte eine schimmlige Matratze. Daneben stand ein Einkaufswagen, für eine Münze zur ewigen Leihgabe gemacht.
»Passen Sie auf, dass Sie nirgends reintreten!«, rief Arnold, der schon ein Stück weitergegangen war. Seine Stimme hallte von den Wänden wider wie in einer Kathedrale. »Vor allem vor den Pfützen sollten Sie sich in Acht nehmen. Aber Sie haben es sicher schon gerochen.«
»Allerdings«, brummte Fuchs und schloss zu ihm auf. Bei dem schmatzenden Geräusch seiner Sohlen verfluchte er sich, nur Turnschuhe angezogen zu haben. Auch eine eigene Lampe wäre von Vorteil gewesen. Doch als ihn die Meldung eine halbe Stunde zuvor erreicht hatte, war er aus seinem Fernsehsessel gesprungen, in Jeans und Hemd geschlüpft und aus dem Haus gestürzt, als hätte er nur auf diesen Anruf gewartet.
Seitdem Sophia vor zwei Wochen nach Afrika aufgebrochen war, um als Ärztin am Einsatz einer Hilfsorganisation teilzunehmen, schien eine Lethargie von ihm Besitz ergriffen zu haben, wie er sie seit der Trennung von seiner Ex-Frau nicht mehr erlebt hatte. Es machte den Anschein, als wäre er plötzlich nicht mehr imstande, allein etwas Sinnvolles mit seiner Zeit anzufangen. Als sei sämtliche Farbe aus seinem Leben gewichen. Trotzdem hätte ein bisschen weniger Eifer, dafür etwas mehr Vorbereitung nicht geschadet. Denn nun hechtete er wie ein Hündchen dem Lichtkreis von Arnolds Maglite hinterher und wünschte sich mit jedem Schritt mehr in seinen geliebten Chesterfield-Sessel zurück. Falls sich hier etwas in seine Fußsohle bohrte, würde er sicher binnen weniger Stunden an einer Sepsis krepieren.
»Ein paar Tretminen gibt es übrigens auch«, warnte ihn Arnold, als hätte er seine Gedanken gelesen. »Zum Glück liegen die in den Ecken. Ich frage mich immer, was Menschen zu solchem Verhalten antreibt.« Er leuchtete nacheinander einige Haufen an wie ein Lichttechniker die Darsteller auf einer Bühne. »Nicht mal Hunde scheißen freiwillig in ihr Zuhause. Bin jedenfalls heilfroh, dass Thomas Wache hält, damit uns nicht hinterrücks eine dieser Kreaturen überrascht. Haben Sie mal so ein Meth-Opfer gesehen? Dagegen sehen die Zombies aus The Walking Dead wie Wellnessurlauber aus.« Er verlangsamte seine Schritte, wartete, bis Fuchs zu ihm aufgeschlossen hatte, und schien ihm dann mit der Maglite ins Gesicht. »Was ich Sie draußen schon fragen wollte – Joachim Fuchs sagten Sie? Dann ist Ihre Kollegin diese Profilerin, oder?«
Fuchs nickte. Er ahnte, was nun kommen würde. Diese Unterhaltung hatte er schon einige Male geführt und war immer wieder erstaunt darüber, wie wacker sich die offizielle Version der damaligen Ereignisse um die Ergreifung des Aderlass-Mörders selbst in den eigenen Reihen hielt. Die Medien hatten ihre Arbeit getan. Dabei war Fuchs nicht so naiv zu glauben, sie hätten bloß als argloses Sprachrohr fungiert. Die Story mit Lara als Heldin hatte sich schlicht besser verkauft. Doch die Sache war eine tickende Zeitbombe, die irgendwann hochgehen würde, da war er sich sicher.
»Ist nicht mal dreißig, Ihre Kollegin, oder?«, fragte Arnold.
»Doch, gerade geworden.«
»Und dann schon einen Serienmörder auf dem Kerbholz …« Arnold grunzte anerkennend. »Hut ab.«
»Ein Tipp«, bremste ihn Fuchs. »Sprechen Sie Frau Schuhmann lieber nicht darauf an. Sie ist diesbezüglich etwas eigen, empfindet Komplimente schnell als Lobhudelei und stößt den Leuten dann nur unnötig vor den Kopf. Und den Begriff Profilerin mag sie auch nicht besonders. Fallanalystin ist ihr lieber.«
»Klingt ja nach einer richtigen Zicke.« Abrupt blieb Arnold stehen. »Da vorne ist es.« Der Lichtkreis seiner Lampe glitt über den Boden, bis er auf einen reglosen Körper traf. Langsam ließ er den Schein von den Füßen der Leiche an aufwärts wandern. Sie lag auf dem Rücken, die Beine lang ausgestreckt. Bevor Arnold das Gesicht beleuchtete, hielt er inne wie für ein großes Finale. »Bereit?«
Fuchs spielte mit. »Bereit.«
Obwohl er vorgewarnt worden war, schreckte er bei dem Anblick zurück.
»Und? Was sagen Sie?«
»So was ist mir in der Tat noch nicht untergekommen. Das sieht ja aus wie …«, Fuchs trat einen Schritt näher, »… Der Schrei.«
»Wie was?«
»Das Gemälde von Edvard Munch.«
Arnold grunzte erneut, wobei Fuchs diesmal nicht wusste, wie er den Laut deuten sollte. Abfällig? Beeindruckt? Oder hatte Arnold schlicht keine Ahnung, wovon er sprach? War auch egal. Er ging in die Hocke und streckte den Arm nach hinten aus. »Geben Sie mir mal die Lampe.«
Arnold schlurfte heran und überreichte Joachim die Maglite, die er sogleich auf das Gesicht des Toten richtete. Die Züge des Mannes waren zu einer grotesken Grimasse verzerrt, als wären sie im Moment des größten Schmerzes erstarrt. Durch den weit aufgerissenen Mund waren die Lippen ganz schmal, sodass sie ihn an vertrocknete Würmer erinnerten. Doch nicht nur der Mund des Toten, auch seine Augen schienen zu schreien. Stumm schrien sie dem Betrachter das Grauen entgegen, das sie kurz vor dem Tod hatten mit ansehen müssen. Dieser Eindruck wurde durch die Hände verstärkt, die seitlich am Kopf anlagen. Fuchs kam es vor, als hielten sie das Entsetzen des Opfers selbst noch im Tode fest.
Er variierte den Einfallswinkel des Lichts. Unter diesen Umständen war es schwer zu sagen, aber der Mann durfte in seinem Alter gewesen sein. Vielleicht hatte er die fünfzig aber auch schon geknackt. Fuchs neigte den Kopf, stockte …
Was war das?
Der Lichtstrahl der Lampe fiel durch zwei Reihen gepflegter Zähne und wurde von etwas Glänzendem reflektiert. Auf den ersten Blick wirkte es wie ein metallischer Gegenstand, doch dann erkannte er, dass diese spiegelnde Oberfläche den Mundraum vollständig ausfüllte. Selbst ringsherum war nicht der kleinste Spalt zur Schleimhaut zu erkennen. Handelte es sich um einen Flüssigkeitsspiegel?
»Mir war gleich klar, dass das hier kein gewöhnlicher Todesfall ist«, hörte er Arnolds Stimme hinter sich.
»Es sieht auch nicht nach einem gewöhnlichen Mord aus«, entgegnete Fuchs. »Haben Sie das hier gesehen?«
»Was meinen Sie?«
»Das in seinem Mund.«
Arnold schaute ihm über die Schulter. »Was ist das?«
»Ich habe da so eine Vermutung …« Fuchs wich ein Stückchen zurück, denn er erinnerte sich, wie ihm als Kind ein Fieberthermometer zerbrochen war. Das Quecksilber hatte sich auf dem Boden verteilt und wie von Geisterhand zu dicken Tropfen zusammengerottet. Durch Anpusten waren sie über den Teppich geflitzt wie winzige Hockeypucks auf dem Eis. Zum Glück hatte sein Vater dem ein Ende bereitet und ihm eine so detailreiche Standpauke über die giftigen Dämpfe dieses Schwermetalls gehalten, dass Joachim selbst heute noch einen Heidenrespekt davor hatte.
Er zog ein Paar Latexhandschuhe aus seiner Hosentasche, streifte sie über und schob einen Finger in den Mund des Toten. »Falsch gedacht«, sagte er mehr zu sich selbst.
»Was war Ihre Vermutung?«
»Quecksilber.«
»Woher wissen Sie, dass es keins ist?«
»Die Oberfläche ist fest. Quecksilber aber ist bei Raumtemperatur flüssig.«
»Okay. Was könnte es dann sein?«
»Blei. Silber. Arsen. Cadmium. Wobei ich glaube, dass nur Silber und Cadmium so glänzen.«
»Ist Cadmium nicht giftig?«
»Doch, ziemlich.«
Arnold trat einen Schritt zurück. »Sollten wir dann nicht besser auf die Kriminaltechniker warten?«
Fuchs sah zu ihm auf. »Ich habe kein Problem damit, wenn Sie draußen warten wollen – solange Sie mir Ihre Lampe dalassen.«
»Nein, nein, schon gut.«
Fuchs führte ein Auge an die Mundhöhle heran und entdeckte einen Saum aus verkrusteter Schleimhaut, die sich entlang der Metalloberfläche erstreckte.
Auf einmal waren andere Stimmen zu hören, die lauter wurden. Ein zweiter Lichtstrahl schnitt durch die Dunkelheit.
»Ich bringe Ihre Kollegin«, hallte die Stimme des anderen Polizisten durch den Raum.
»Falls Sie es noch nicht getan haben …«, rief Fuchs ihm entgegen, »… Sie könnten die Spurensicherung rufen! Die Staatsanwaltschaft werde ich informieren.«
»Wird erledigt«, gab der Beamte zurück, lieferte Lara bei ihnen ab und ging wieder nach draußen auf seinen Posten.
»Hübsch hier«, sagte Lara leicht außer Puste.
Joachim warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu. »Wann kaufst du dir endlich ein Auto?«
»Ich weiß … Entschuldige.« Schuldbewusst kräuselte sie ihre etwas zu spitz geratene Nase. »Falls es dich beruhigt – ich habe mir neulich eins angesehen. Das wird es vielleicht.«
»Na, dann …« Fuchs stellte seine Kollegin Arnold vor, der ihre Hand einen Moment länger drückte als nötig.
»Übrigens – herzlichen Glückwunsch nachträglich«, sagte er.
Verdutzt sah Lara ihn an.
»Zum Geburtstag«, erklärte Arnold und schob sogleich hinterher: »Hat mir Ihr Kollege verraten. Er hat mich zwar auch gewarnt, Sie lieber nicht auf Ihren Job anzusprechen, aber man bekommt ja nicht jeden Tag die Gelegenheit, einer Fallanalystin über die Schulter zu schauen.«
Lara schielte ratlos zu Fuchs hinüber, doch der zuckte nur mit den Schultern.
»Dann will ich mal hoffen«, sagte sie zu Arnold, »dass ich Sie mit meiner Performance nicht enttäusche, denn so mystisch ist meine Arbeit nicht.«
Fuchs schmunzelte. Lara Schuhmann war keine Zicke, wie Arnold gemutmaßt hatte. Sie hasste nur den Umstand, dass sie wegen des spektakulären Aderlass-Falls immer wieder zum Lügen gezwungen wurde, und es die letzten Monate schon öfter zu ähnlichen Situationen gekommen war. Sie fühlte sich dabei jedes Mal schlecht. Geradezu schäbig.
»So, was haben wir hier?« Sie wandte sich von Arnold ab. Ein klares Signal, dass dieses leidige Thema beendet war.
Als Joachim das Gesicht des Opfers erhellte, entfuhr Lara ein verblüffter Laut. »Das … erinnert mich an etwas.«
»Vielleicht an Munchs Schrei?«
»Ja, könnte sein.«
»Hatten wir auch dran gedacht. Schau mal in seinen Mund.«
»Moment …« Lara, die das Haus nach dem Anruf offenbar ebenfalls überstürzt verlassen hatte, zog ein Haargummi aus ihrem Blouson und band sich rasch das glatte braune Haar zusammen, bevor sie sich tiefer über das erstarrte Gesicht des Toten beugte. »Was ist das?«
»Metall, schätze ich. Siehst du den geröteten Rand?«
»Ja. Eine Verbrennung?«
»Nehme ich an. Bei welcher Temperatur schmilzt Metall? Sechs-, siebenhundert Grad? Oder mehr?« Fuchs schluckte, da er sich vorzustellen versuchte, welche Schmerzen der Mann wohl hatte ertragen müssen.
»Hast du mal Handschuhe für mich?«, fragte Lara.
Fuchs zog wortlos ein weiteres Paar aus der Tasche. Ein Glück für Lara, dass er die Dinger ständig in seinem Handschuhfach hatte und seine Kollegin zudem so gut kannte.
Lara schlüpfte hinein, umfasste den Arm des Toten und zog daran. Die Leichenstarre schien zwar gelöst zu sein, doch die Hand entfernte sich kein bisschen vom Kopf. Stattdessen folgte der Kopf der Bewegung, genau wie der andere Arm. »Die wurden festgeklebt!«
»Scheiße«, entfuhr es Arnold, »was soll der Mist?«
»Gib mir mal die Lampe«, sagte Lara.
Nachdem Fuchs ihr die Maglite gereicht hatte, richtete Lara sich auf, um sich einen Überblick zu verschaffen. Einige Male ließ sie den Strahl über den Körper wandern, zog dann ein Diktiergerät aus der Tasche und begann zu sprechen.
»Es ist der 13. Juli«, sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr, »21:36 Uhr. Wir befinden uns auf einem stillgelegten Firmengelände am Rande von Bornheim, nahe der 661. Um diese Zeit eine ruhige Gegend. Innerhalb des Gebäudes ist es stockdunkel. Offenbar gibt es kein elektrisches Licht.« Sie hielt die Aufzeichnung an, sah mit der stummen Frage auf den Lippen zu Arnold hinüber.
Der schüttelte den Kopf. »Nein, kein Strom. Muss irgendwann abgestellt worden sein.«
Sie ging in die Hocke. »Das Opfer ist männlich und schätzungsweise um die fünfzig. Er sieht nicht aus wie jemand, der sich für gewöhnlich an einem solchen Ort aufhalten würde. Er trägt auffallend gute Kleidung und wirkt insgesamt sehr gepflegt. Segelschuhe, Bundfaltenhose, Poloshirt von Lacoste. Guter Zahnstatus. Kurz geschnittene, saubere Nägel. Auch wenn die Handflächen selbst nicht beurteilbar sind, macht es nicht den Anschein, als hätte das Opfer zu Lebzeiten schwere Arbeit mit den Händen verrichten müssen. Ich würde auf einen Akademiker oder zumindest jemanden in einer gehobenen Position tippen. Die Auffindesituation zeigt eine außergewöhnliche Inszenierung. So wurden die Hände des Opfers seitlich am Kopf festgeklebt und die Mundhöhle vermutlich mit erhitztem Metall ausgegossen. Der Mund ist weit geöffnet. Das sich hieraus ergebende Bild erinnert an das Gemälde Der Schrei. Ob diese Parallele beabsichtigt war oder nicht, bleibt zunächst offen. Der Fundort entspricht mutmaßlich nicht dem Tatort, es sei denn, der Täter hat all seine Utensilien hierher mitgenommen. Diverse Hinterlassenschaften von Leuten in dem Gebäude lassen aber vermuten, dass der Ort zur Ausübung einer solchen Tat wenig geeignet ist. Dann würde jedoch das Abladen der Leiche hier bereits eine gewisse Risikobereitschaft des Täters verraten.« Sie stoppte die Aufnahme.
»Lass uns mal nachsehen, ob er was bei sich hat, das uns bei seiner Identifizierung hilft«, nutzte Fuchs die Lücke in Laras Monolog und betastete bereits die vorderen Hosentaschen des Opfers. »Hier ist schon mal nichts. Sehen wir hinten nach.« Er packte die Leiche am Gürtel und rollte das Becken zur Seite.
Nachdem Lara das Diktaphon eingesteckt hatte, klopfte sie die Gesäßtaschen ab. »Hier!« Sie förderte ein braunes Lederportemonnaie zutage. »Das wird ja leichter als gedacht.« Sie klappte es auf. »Dann wollen wir doch mal sehen, wer …«
»Was ist?«, fragte Fuchs.
Kommentarlos hielt sie ihm die Geldbörse entgegen, sodass er den Ausweis darin sehen konnte.
Joachims Mund blieb offen stehen, wenn auch nicht so weit wie der des Mannes, der hier zu ihren Füßen lag.
2
Bis zu dem Moment, als ihr Mann brannte, war es ein herrlicher Julimorgen gewesen. Irene Kröll war vom Schein des Lichtweckers langsam aus ihren Träumen gehoben worden, bis sie das um sieben Uhr einsetzende Vogelduett geweckt hatte. Seitdem sie diesen Wecker besaß, fiel ihr das Aufstehen leichter. Nur bei Konrad brauchte es mehr als einen simulierten Sonnenaufgang. Selbst der Vogelgesang, der nach einer Weile in solch penetrantem Gezwitscher gipfelte, dass man eine Invasion durch die Vögel aus Hitchcocks gleichnamigem Film fürchten könnte, ließ ihn selig weiterschlummern. Da ihre Kinder für einige Tage außer Haus waren, hatte Irene sich spontan überlegt, Konrad mit einer Runde Morgensex zu überraschen.
Anschließend war sie ins Bad getaumelt, um sich frisch zu machen, und dann in die Küche gegangen, wo sie Kaffee gekocht und Müsli mit Beeren zubereitet hatte. Als Konrad rasiert und in seinem blauen Anzug dazugestoßen war, hatte ihn der hinreißende Duft ihres Parfums umweht. Wie schon so oft dachte Irene auch jetzt, was für ein Glück sie mit ihrem Mann gehabt hatte. Egal wohin sie sah – überall um sie herum Scheidungen oder in Trümmern liegende Ehen, die des äußeren Anscheins oder der Kinder wegen aufrechterhalten wurden. Doch sie war offenbar ein Glückskind.
»Gibst du mir mal den Zucker, Schatz?« Konrad streckte die Hand aus.
»Es ist schon genug drin.«
Er lächelte. »Bitte. Nur noch ein bisschen.«
Sie schob ihm die Dose über den Tisch. »Wenn du das immer so überzuckerst, kann ich auch gleich den Fertigkram aus dem Supermarkt holen und muss keine teuren Gojibeeren reinmachen.«
Konrad stand auf und trat hinter Irene, vergrub sein Gesicht an ihrem Hals. »Du weißt doch, wie sehr ich auf Süßes stehe.«
Kichernd zog sie die Schulter zum Kinn, ließ ihn ihre Brüste massieren, schob seine Hände dann aber weg. »Guck mal auf die Uhr, du kommst noch zu spät.«
Er sah zum Ofen. Sie hatte recht. Es war schon kurz nach acht. Andererseits war er der Chef.
»Meinst du nicht auch, ich könnte es mir erlauben, wenigstens einmal zu spät zu kommen? Einige meiner Mitarbeiter sehen das mit der Pünktlichkeit jedenfalls nicht so eng.«
»Aber nicht heute.«
Siedend heiß fiel ihm der Termin wieder ein. Er küsste sie auf den Scheitel, ging zu seinem Platz zurück, klappte die Krawatte über die Schulter und schaufelte das Müsli in sich hinein.
»Wann kommen die Kinder wieder?«, fragte er, bevor er den Kaffee hinunterkippte.
»Morgen.«
»Okay, dann machen wir heute Abend da weiter, wo wir eben aufgehört haben.« Er zwinkerte ihr über den Rand seiner Tasse hinweg zu.
Sie lächelte.
Er stand auf, wollte sein Geschirr abräumen, aber Irene nahm es ihm ab.
»Geh schon. Ich mach das. Du musst los.«
Vor dem Spiegel in der Diele prüfte er den Sitz seiner Krawatte und verließ anschließend das Haus.
Während Irene die Müslischale unter dem laufenden Hahn abspülte, sah sie aus dem Fenster. Konrad war in der Einfahrt stehen geblieben, bückte sich und hob etwas vom Boden auf. Sie ahnte schon, um was es sich dabei handelte. Bestimmt wieder eine Schnecke, die zum Beet strebte, um sich über ihr Gemüse herzumachen. Sie klopfte an die Scheibe und drohte ihm spielerisch mit dem Finger. Konrad gab sich ertappt.
Schmunzelnd prüfte Irene die Schale im Licht der Morgensonne und sah sich nach einem Geschirrtuch um. Da sie keines entdeckte, war jetzt wohl der Moment für Konrads Mikrofasertücher gekommen, die er ihr neulich von einer seiner berühmten Einkaufstouren mitgebracht hatte. Für gewöhnlich vergaß er dabei die Hälfte von dem, was er eigentlich besorgen sollte, brachte dafür aber allerhand Krempel mit, den kein Mensch brauchte. Süßkram für die Kinder, magische Küchenhelfer für sie. Vermutlich waren die Teile bloß überteuert und konnten auch nicht mehr als die alten Lappen.
Nachdem sie den Schrank geöffnet hatte, fand sie die Tücher unter einem Berg zerknüllter Einkaufstüten. Sie riss das Zellophan runter und stopfte es in den gelben Sack. Als sie sich wieder aufrichtete, nahm sie im Augenwinkel etwas wahr. Sie richtete den Blick nach draußen und traute ihren Augen nicht. Gütiger Gott! Was war denn das? Eine Lichtspiegelung auf der Scheibe? Mit einer Hand schirmte sie das Sonnenlicht ab, das sich in Glasschlieren zu brechen schien und sie blendete. Es musste eine Spiegelung sein. Eine Art Fata Morgana. Anders war das nicht zu erklären. Sie näherte sich dem Fenster, schnappte nach Luft. Wünschte, sie würde träumen.
Doch dort in der Einfahrt stand eine Gestalt und wedelte mit den Armen. Flammen züngelten an ihr empor wie bei einer mystischen Erscheinung. Die Kreatur lief blindlings los, stieß gegen den Zaun der Nachbarn, fiel um, rappelte sich wieder auf …
Als Irene sich die Hand vor den Mund schlug, sank die Gestalt draußen auf die Knie und begann zu schreien. Ein animalischer Schrei, so gellend, dass er Irene selbst hinter der Dreifachverglasung des Fensters bis ins Mark fuhr. Und obwohl dieser Laut nichts Menschliches mehr hatte, wusste sie, dass es Konrad war, der sich dort in der Einfahrt krümmte, weil er lichterloh brannte.
3
»Es ist doch ganz einfach«, Dezernatsleiter Hermann Kreiling fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, »die Leiche lag auf Frankfurter Boden, also gehört der Fall uns. Alles aus dem Kreis Offenbach bekommt Kleiber. Fertig.«
Mit der beigefarbenen Tolle erinnerte sein Chef Fuchs immer an Trump, wobei er sich weitere Parallelen zum US-Präsidenten aus Fairness verkniff.
»Wäre es umgekehrt, Chef, wäre das Opfer ein Kollege aus unserem Team, würden Sie sicher auch um den Fall bitten, oder?«
»Herr Fuchs, wir können doch auf solche Befindlichkeiten keine Rücksicht nehmen. Falls der Tatort tatsächlich nicht dem Fundort entspricht, wir ihn trotzdem finden und er dann noch im Zuständigkeitsbereich der Kollegen liegt, können wir gerne noch mal darüber sprechen. Aber bis dahin ist der Gerichtsstand hier.« Er sah zur Staatsanwältin Annika Mills hinüber, die nickte, aber zugleich mit den Schultern zuckte.
Fuchs wertete ihre Reaktion als Zeichen, dass Mills solche Dinge nicht allzu eng sah. Im vergangenen Jahr hatte er sie einmal zum Schauplatz eines Verbrechens gerufen. In jener regnerischen Novembernacht hatte er bei der jungen Frau mit den dunkel geschminkten Lippen, dem schwarzen Pagenschnitt und dem glänzenden Ledermantel an eine Domina denken müssen. Aber heute früh, im Neonlicht des Präsidiums, wirkte sie auf ihn wie ein anderer Mensch. Der Long Bob mit Pony und die weiße, hochgeschlossene Bluse ließen sie geradezu unschuldig wirken. Nur ihr Schmollmund wie auch die funkelnden Augen bildeten einen starken Kontrast dazu und sprudelten nur so vor Sexappeal.
Kreiling hatte Mills Geste offenbar anders interpretiert, wie sein schulmeisterliches Gebaren verriet.
Fuchs hob kapitulierend die Hände. Dabei begegnete sein Blick dem von Annika Mills.
Ihre Augen waren der Knaller. Diese Farben!
Im Geiste ging er die Tuben in seinem Hobby-Atelier zu Hause durch. Vielleicht Lichtgrün? Nein, Jade. Der äußere Ring ihrer Iris war braun. Siena? Zimt? Oder doch lieber Karamell?
»Wenn es Ihnen aber so wichtig ist«, riss ihn Kreiling aus seinen Gedanken, »können wir die Offenbacher ja im Rahmen einer Sonderkommission einbinden. Sie bekämen die Leitung.«
Fuchs brummte. Der Gedanke an eine Zusammenarbeit mit den Offenbachern klang nicht gerade verlockend, denn weder Kleiber noch sein Gefolge waren für kollegiales Verhalten bekannt.
Zum Glück vertiefte Kreiling das Thema nicht weiter, sondern bat Fuchs, vom gestrigen Abend zu berichten.
Der nickte und löste die Klebelasche eines Umschlags. »Das Opfer wurde in einem abbruchreifen Fabrikgebäude bei Bornheim gefunden. Früher war dort eine Firma namens BonTex ansässig gewesen, wo Lederwaren und Möbelbezüge hergestellt wurden. Das Anwesen liegt aber schon geraume Zeit brach. Es gehört einer gewissen Tamara Mannschuk, eine alleinstehende Dame in fortgeschrittenem Alter, die nach einem schweren Schlaganfall in einem Pflegeheim lebt und nicht mehr geschäftsfähig ist. Deshalb ist das Gelände noch nicht unter den Hammer gekommen oder neu bewirtschaftet worden. Ein übler Ort. Alles voller Müll, und es stinkt nach Urin und Fäkalien.«
Inzwischen hatte er das Kuvert geöffnet und zog einige Bildabzüge heraus, wovon er einen in die Tischmitte schob. Er zeigte das verzerrte Gesicht des Opfers, den der Blick in dessen Portemonnaie als Polizisten entlarvt hatte. »Axel Jacobs«, fuhr Fuchs fort, »dreiundfünfzig Jahre, Leiter der Stabsstelle für Prävention im Präsidium Südosthessen. Wie die bisherigen, wenn auch noch nicht sonderlich umfangreichen Befragungen ergeben haben, war er wohl ein äußerst beliebter Mitarbeiter. Keine offenkundigen Feinde. So zumindest der Tenor in seinem Kollegium.« Er legte das nächste Foto auf den Tisch. »So sah er vor seinem Martyrium aus.«
Das zweite Bild zeigte einen sympathisch in die Kamera lachenden Mann, dem das Posieren offenbar leichtgefallen war. Wie Fuchs hatte auch Jacobs gräuliche Schläfen, nur die Geheimratsecken des Kollegen waren wesentlich weiter fortgeschritten.
»Kannte ihn zufällig jemand?«, fragte Kreiling in die Runde, erhielt aber nur ein kollektives Kopfschütteln zur Antwort. »Dann fahren Sie bitte fort.«
»Das Besondere an der Auffindesituation war zum einen der Fundort in dieser heruntergekommenen Halle sowie die Tatsache, dass ihm flüssiges Metall in den Schlund gegossen wurde. Laut vorläufigem Befund der Kriminaltechnik handelt es sich dabei um Silber. Das schmilzt übrigens erst ab neunhundertzweiundsechzig Grad. Es ist anzunehmen, dass Jacobs zum Tatzeitpunkt noch lebte.« Er deutete auf das Bild. Das schmerzverzerrte Gesicht schien seine Aussage zu untermauern. Fuchs trank einen Schluck Wasser, da seine Kehle plötzlich wie ausgedörrt war.
»Dann haben wir es offenbar mit einem wohlhabenden Täter zu tun«, mutmaßte Kreiling.
»Wieso?« Olaf Kern schien belustigt. »Wegen des Silbers?«
Im Gegensatz zum Dezernatsleiter machte sich der gerade mal einen Meter siebenundsechzig große Kern nicht viel aus seiner Frisur. Strubbelig standen die Haare von seinem Kopf ab, als hätten sie nie eine Bürste gesehen. Mit seiner überaus lebhaften Art hätte man Kern heutzutage als Kind sicher Ritalin in die Brotdose gepackt. Sein neben ihm sitzender Partner, Martin Huber, der ihn um eineinhalb Köpfe überragte, sorgte mit seiner ruhigen Art für den nötigen Ausgleich. Die Spitznamen Ernie und Bert hatte man den beiden aber vor allem des Aussehens wegen verpasst.
»Natürlich wegen des Silbers, Sie Schlaumeier«, motzte Kreiling. Selbst nach dreißig Jahren in Deutschland war ihm die Wiener Abstammung anzuhören, am deutlichsten, wenn er sich echauffierte.
»Was ich sagen wollte …«, setzte Kern etwas devot zu einem Erklärungsversuch an, »… Silber ist längst nicht so teuer, wie man denkt.«
Kreiling schien noch nicht überzeugt. »Das hängt doch wohl vom Reinheitsgrad ab, oder nicht?«
»Ja, doch … schon. Und von der Menge natürlich.«
»Na, dann los!« Kreiling klatschte in die Hände. »Jetzt will ich aber auch Fakten.«
»Wir müssen erst die Obduktion abwarten«, eilte Fuchs Kern zur Hilfe. »Davor wissen wir nicht sicher, ob vielleicht ein Teil des Silbers die Kehle hinuntergelaufen ist, bevor es erstarrte. Aktuell haben wir aber glatt zweihundertfünfzig Gramm.«
Kern, wieder ganz der Alte, winkte ab. »Sag ich ja. Selbst wenn es 999er Silber war, sind das vielleicht einhundert Euro, mehr nicht.«
»Damit hat er recht«, sagte Fuchs.
»Klar hab ich recht.« Kern grinste. »Ich hab mal das Silberbesteck meiner Oma versetzt. Selbst heute kommen mir noch die Tränen, wenn ich an die magere Ausbeute denke.«
Auf Kreilings Stirn entstand eine Falte. »Woher haben Sie denn das aktuelle Gewicht? Sie sagten doch, die Mundhöhle des Opfers sei damit ausgegossen gewesen. Hat sich das Silber dann nicht regelrecht eingebrannt?«
»Doch«, Fuchs nickte, »aber nachdem uns Frau Mills die Freigabe erteilt hatte, hat sich der Rechtsmediziner noch gestern Abend erbarmt, das Silber zu bergen, damit wir parallel schon ermitteln können. Er hat übrigens auch einen Abdruck an der Stirn des Opfers entdeckt. Offenbar wurde der Kopf mit einem Gurt oder Riemen fixiert. Die eigentliche Obduktion soll aber erst heute Nachmittag stattfinden.«
»Nun gut, warten wir die Ergebnisse ab.« Kreiling schürzte die Lippen. »Wo waren wir stehen geblieben?«
»Beim Silberpreis«, griff Fuchs das Thema wieder auf. »Er liegt aktuell bei siebenundvierzig Cent pro Gramm. Wenn wir also nichts mehr in der Speiseröhre oder dem Magen des Opfers finden – wovon der Rechtsmediziner ausgeht –, musste der Täter gerade mal einhundertsiebzehn Euro berappen.«
»Warum erwartet er, nichts im Magen zu finden?«, wollte Kreiling wissen.
»Weil flüssiges Silber beim Kontakt mit Wasser sofort erstarrt. Und da auch wir zu zwei Dritteln aus Wasser bestehen …«
»Hilft uns die Frage nach dem Gewicht denn bei den Ermittlungen?«, wollte Kreiling wissen.
Fuchs zuckte die Schultern. »Ich habe mal etwas recherchiert. Wenn es bei den zweihundertfünfzig Gramm bleibt, könnte das Silber von einem Barren stammen. Die gibt es zu einhundert, zweihundertfünfzig, fünfhundert oder eintausend Gramm. Allerdings werden die von unzähligen Internetshops verkauft. Zudem ist es genauso gut möglich, dass etwas anderes aus Silber eingeschmolzen wurde, das zufällig dieses Gewicht hatte. Zum Beispiel eine Handvoll Besteckteile von Olafs Oma.«
Gelächter. Selbst an den sonst immer nach unten gebogenen Mundwinkeln Kreilings zupfte ein Lächeln.
»Aber warten wir mal die Analyse ab, vielleicht wissen wir dann mehr.«
Kreiling lockerte seine Krawatte. »Dann sollten wir mal überlegen, was hinter der Tat stecken könnte.« Er sah zu Lara hinüber. »Frau Schuhmann?«
Lara nickte und griff nach ihren Aufzeichnungen. Inzwischen war sie darauf vorbereitet, dass Kreiling ihr unvermittelt das Wort erteilte und plötzlich alle Augen auf sie gerichtet waren. Vor etwas mehr als einem halben Jahr, als sie noch die Neue gewesen war, hatte sie das jedes Mal ziemlich aus dem Konzept gebracht. Doch mit jeder Teamsitzung, in der ihre Expertise gefragt war, hatte sie – trotz gelegentlicher Rückschläge – mehr Selbstvertrauen gewonnen.
»Betrachten wir zunächst einmal das Offensichtliche«, begann sie. »Warum hat der Täter gerade Silber gewählt? Es hätte ja auch jedes andere schmelzbare Metall sein können. Vielleicht ein Hinweis auf die bekannte Redewendung Reden ist Silber, Schweigen ist Gold? Möglicherweise hat das Opfer ja etwas ausgeplaudert, das es besser für sich behalten hätte. Oder umgekehrt. Er hat geschwiegen, obwohl er besser geredet hätte.«
»Naheliegend«, sagte Kreiling. »Vielleicht zu naheliegend. Da kommt mir gleich wieder unser früherer Fall in den Sinn, als uns die vermeintliche Symbolik mächtig auf den Holzweg geführt hat. Aber machen Sie mal weiter.«
»Das kann natürlich auch ein Ablenkungsmanöver sein«, räumte Lara ein. »Ted Bundy hat in einem Interview auch mal gestanden, absichtlich falsche Spuren gelegt zu haben, nur um die Polizei zu verwirren. Aber abseits einer etwaigen Symbolik steht eins wohl außer Frage: Die Schmerzen, die das Opfer ertragen musste, dürften jenseits jeder Vorstellungskraft liegen. Hätte der Täter nur eine Botschaft übermitteln wollen, hätte es genauso gut eine Silbermünze auf der Zunge getan. Doch er hat sich für diesen grausamen und zudem umständlichen Weg entschieden. Da Silber erst bei über neunhundert Grad schmilzt, lässt sich das auch nicht mal eben schnell mit einem Feuerzeug bewerkstelligen. Man braucht zudem ein spezielles Gefäß, beispielsweise einen Schmelztiegel aus Schamotte. Und dann muss man solche Temperaturen auch erst mal erzeugen, was selbst ein Bunsenbrenner gerade so schafft. Allerdings haben wir gesehen, dass es für dreihundert Euro kleine Schmelzöfen zu kaufen gibt, die sich bis auf elfhundert Grad erhitzen lassen. Wie auch immer der Täter es getan hat – sein Vorgehen legt nahe, dass er Zugang zu gewissem Equipment und sicherlich auch einem Rückzugsort hat, wo er ungestört agieren kann. Er verfügt über bestimmte technische wie auch handwerkliche Fähigkeiten. Die können, müssen aber keine beruflichen Wurzeln haben, da sich auch Laien detailreiches Wissen sowie Fertigkeiten bis auf Expertenniveau aneignen können. Wichtig für die Profilerstellung ist in meinen Augen die Tatsache, dass er das Opfer leiden lassen wollte. Neben den Infos bezüglich des Modus operandi haben wir mit dem flüssigen Metall möglicherweise auch seine Signatur, wobei wir bei einer Einzeltat korrekterweise nicht von Signatur, sondern von Personifizierung sprechen.«
»Ich muss zugeben, dass ich diese Begriffe immer wieder verwechsle«, sagte Huber.
»Geht vielen so.« Lara nickte. »Die Handschrift ist eine meist konstante Handlung, die Ausdruck des Motivs, der Begierden oder Fantasien des Täters ist. In der Praxis hilft dir folgende Frage: Was hat der Täter getan, das er nicht hätte tun müssen? Die Antwort führt dich zur Signatur. Klar könnte man sagen, unser Täter hätte Jacobs nicht an diesem Ort ablegen müssen. Dennoch könnte es hierfür einen ganz logischen und nachvollziehbaren Grund geben, den wir bloß noch nicht kennen. Das Ausgießen des Mundes ist für die Ausübung eines Mordes dagegen nicht erforderlich und spräche somit für die Signatur. Dieser Begriff ist aber für Mordserien reserviert. Bei Einzelfällen nennt man es Personifizierung.«
»Personifizierung schön und gut, aber warum Silber?«, fragte Kreiling, dem die Frage nach dem Metall offenbar keine Ruhe ließ. »Wenn es ihm nur um die Qualen des Opfers gegangen wäre, hätte es doch auch geschmolzenes Blei getan und dabei sicher nur einen Bruchteil gekostet.«
Fuchs’ Finger glitt über seine Notizen und blieb abrupt stehen. »Stimmt. Der Kilopreis liegt bei einem Euro und zehn. Die Schmelztemperatur bei dreihundertsiebenundzwanzig Grad.«
»Da hätte dann auch schon ein Feuerzeug zum Erhitzen gereicht«, pflichtete Huber bei.
»Aus den zuvor erwähnten Gründen«, nahm Lara den Faden wieder auf, »gehe ich mit einiger Sicherheit davon aus, dass Fundort und Tatort verschieden sind. Zu klären bliebe also die Frage, was es mit diesem Fundort auf sich hat. Gestern Abend drängte sich mir die offensichtliche Diskrepanz zwischen dem gepflegten, gut gekleideten Opfer und diesem heruntergekommenen Schauplatz auf. Als wollte der Täter das Opfer noch nach dem Tod denunzieren. Natürlich kann auch das eine sekundäre Tarnhandlung sein, mit welcher der Täter von sich ablenken will.«
»Spräche so eine Entwürdigung nicht für einen persönlichen Bezug zwischen Täter und Opfer?«, fragte Kern.
»Absolut«, gab Lara ihm recht.
Huber runzelte seine buschigen Brauen. »Vielleicht war unser Opfer ja doch nicht so ein Saubermann, wie seine Kollegen behaupten. Mal sehen, was bei den weiteren Befragungen noch so herauskommt.«
Die Tür ging auf, Kreilings Sekretärin lugte ums Eck. »Herr Fuchs, kann ich Sie bitte kurz sprechen?«
Ihr ernster Ton jagte ihm unwillkürlich einen Schauder über den Rücken. Auch die anderen horchten auf. Sein erster Gedanke galt Sophia, die sich in einer politisch instabilen Region herumtrieb, wo oppositionelle Milizen ganze Dörfer auslöschten. Genauso konnte sie mit Malaria im Krankenhaus liegen. Raubtierattacke, Schlangenbiss, Skorpione … Dieses Land hatte viele Gefahren zu bieten. Oder ging es um seine Kinder? Seine Eltern? War seinem dementen Vater etwas passiert? Er beschleunigte seine Schritte, schloss die Tür hinter sich. »Was gibt es?«
»Ich habe eben einen Anruf von einer Frau Kröll bekommen. Sie sagt, sie sei eine Freundin.«
»Irene?«
»Ja, so hieß sie.«
»Was wollte sie?«
Frau Möller suchte nach den richtigen Worten. »Ihr Ehemann«, brachte sie schließlich hervor, »ist heute Morgen verstorben.«
»Was?« Die Nachricht erwischte Joachim eiskalt. Mit einem Schlag war ihm schlecht. Konrad ist tot? Er wandte den Blick ab. Das konnte nicht sein! Wie ferngelenkt zog er sein Telefon aus der Tasche. Wieso hatte Irene ihn nicht auf dem Handy angerufen? Dann fiel ihm ein, dass er ja seit Kurzem Besitzer eines Smartphones mit neuem Handyvertrag war, das ihm Sophia geschenkt hatte, damit er endlich mal mit der Zeit ging. Demnach hatte Irene seine neue Nummer noch nicht gehabt.
Er wandte sich wieder Frau Möller zu und fragte mit heiserer Stimme: »Hat sie gesagt, wie er gestorben ist?«
Die Sekretärin zögerte. »Sie war ziemlich aufgebracht, aber wenn ich sie richtig verstanden habe, ist er verbrannt.«
»Verbrannt?« Fuchs war wie vom Donner gerührt.
»Das hat sie gesagt. Vor ihrem Haus. Aber mehr weiß ich nicht. Nur, dass sie explizit nach Ihnen verlangt hat.« Sie berührte ihn sachte am Arm. »Mein Beileid, Herr Fuchs. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, lassen Sie es mich wissen.« Ihre Stimme klang dumpf. Sein Körper war wie betäubt.
»Ja«, brachte er schließlich hervor, »teilen Sie dem Chef bitte mit, dass ich dringend wegmusste.«
4
Als Fuchs das am Waldrand gelegene Buchschlag erreichte, rebellierte sein Magen. So stark, als hätte er den Entschluss gefasst, nicht nur sich selbst, sondern auch seine Nachbarorgane zu verdauen. Wie erwartet, war die Bahnschranke geschlossen, und während Fuchs dabei zusah, wie ein Waggon nach dem anderen vorbeiratterte, wuchs seine Anspannung mit jeder Sekunde. Seine Finger trommelten nervös auf das Lenkrad, und immer wieder geisterten ihm die Worte der Sekretärin durch den Kopf. Verbrannt. Vor ihrem Haus. Sie hat explizit nach Ihnen verlangt. So unglaublich, so unfassbar diese Nachricht auch war – Irene hätte nie blinden Alarm geschlagen. Blöderweise hatte er sie während der Fahrt nicht erreicht. Was war nur passiert? Ein Unfall? War einer von Konrads Garagenversuchen schiefgelaufen? Erst kürzlich hatte er an dieser neuen Einbrecherabwehr herumgetüftelt, einer Anlage, die Räume binnen Sekunden einnebelte, sodass Diebe nicht mehr sehen konnten, was es zu klauen gab. Hatten sich hierbei vielleicht Chemikalien entzündet? Ein Benzinkanister? Oder der Tank von Konrads Rasentraktor?
Endlich hob sich die Schranke. Fuchs fuhr los, bog die vierte Straße links ab und folgte ihrem Verlauf. Während er die Siedlung durchquerte, hatte er dieses Mal kein Auge für die Villen, die noch aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts stammten. Stattdessen hatte er den Blick stur auf die Straße gerichtet und rauchte schon die dritte Zigarette in Folge.
Als er nach rechts in die Straße der Krölls abgebogen war, erkannte er sofort, dass er falschgelegen hatte. Das Polizeiaufgebot mit dem Bus der Spurensicherung sprach eine eindeutige Sprache. Er parkte den Wagen am Fahrbahnrand und näherte sich auf weichen Knien der Hofeinfahrt, wo ein dunkler Passat mit Blaulicht den Bordstein blockierte.
»Ach nee, der Kollege aus Frankfurt!«
Fuchs kannte die Stimme. Dann sah er Constantin Rupp, der sich vor dem Hoftor breitmachte. Der bullige Hauptkommissar aus dem Präsidium Offenbach und sein Partner wollten offenbar gerade gehen. »Was verschafft uns denn die Ehre?«
Fuchs nickte den beiden zu. »Frau Kröll hat bei uns im Präsidium angerufen und darum gebeten, dass ich vorbeikomme. Was ist denn passiert?«
»Das ist noch unklar«, sagte Rupp. »Aber Ihnen ist hoffentlich klar, dass dieser Fall in unseren Zuständigkeitsbereich fällt?«
Fuchs nickte. »Ich bin als Privatperson hier.«
Rupp sah auf die Uhr. »Als Privatperson? Um diese Zeit?« Er sah zu seinem Partner hinüber, einem hageren Kerl mit hervorstehendem Adamsapfel, dem die Situation sichtlich unangenehm war. »Was meinst du, Maisel? Wenn das so ist, dürfen wir ihm ja erst recht nichts sagen, oder?«
Maisel blieb ihm eine Antwort schuldig.
»Würden Sie mir wenigstens sagen, warum Sie hier sind?«, fragte Fuchs.
Rupp breitete die Arme aus. »Nicht natürlicher Tod im Kreis Offenbach. Sollte als Antwort genügen.«
Fuchs dämmerte, dass Rupps abwehrende Haltung nicht aus der uralten Fehde zwischen Frankfurt und Offenbach herrührte. Vermutlich war er verärgert, dass Kreiling ihr Gesuch, den Fall Jacobs zu übernehmen, abgelehnt hatte, bloß, weil man die Leiche auf Frankfurter Boden entdeckt hatte.
Fuchs versuchte sich an einem Lächeln. »Lassen Sie gerade an mir aus, dass mein Chef – überkorrekt und stur, wie er manchmal ist – seinen Revieranspruch geltend macht? Das ist doch albern.«
Rupp hob die Arme. »Ich halte mich nur an die Vorgaben.«
Fuchs seufzte. »Sie können natürlich nicht wissen, dass die Zuständigkeit im Fall Jacobs heute Morgen schon Thema in unserem Meeting war«, startete er einen Rettungsversuch. »Wie viele meiner Kollegen, habe auch ich die Halsstarrigkeit meines Chefs moniert.«
Rupp schnaubte. »Moniert.«
»Kennen Sie das Wort nicht?«, fragte Fuchs. »Es stammt jedenfalls nicht von Manieren, die Ihnen ja auch fremd zu sein scheinen.«
Rupp sah erneut zu Maisel. »Witzig ist er auch noch.«
Doch sein Partner reagierte nicht, sondern schien hochkonzentriert damit befasst zu sein, ein Kabel um ein schwarzes Kästchen in seiner Hand zu wickeln.
Langsam hatte Joachim die Faxen dicke. »Ich werde da jetzt reingehen«, sagte er und machte Anstalten, sich an den beiden vorbeizudrängeln, doch Rupps Arm fuhr herunter wie eine Schranke. Fuchs musste an sich halten, den Arm nicht einfach wegzuschlagen.
»Sie haben mich aber schon verstanden?«, fragte Rupp. »Wie es aussieht, ist das hier ein Tatort. Unbefugte haben da keinen Zutritt.«
Fuchs hielt dem Blick des Offenbacher Hauptkommissars stand. Sah ihm in seine Schweinsäuglein in dem aufgedunsenen Gesicht. Er war hier, um Irene beizustehen, und das würde ihm dieser Arsch nicht verbieten.
»Ich wiederhole«, sagte Fuchs betont ruhig, »ich bin als Privatperson hier, und wenn es nach mir ginge, könnten wir den Fall Jacobs an Sie übergeben. Genau das habe ich heute früh auch angeregt, aber mein Chef wollte das nicht. Immerhin hat er eingeräumt, dass Ihre Abteilung im Rahmen einer Sonderkommission eingebunden werden könnte. Aber wenn ich mir Ihren Auftritt hier so ansehe, habe ich darauf eigentlich keine Lust mehr.«
Rupps Zunge befeuchtete seine Lippen, so als bereitete er sich auf einen Gegenstoß vor, doch dann trat er überraschenderweise beiseite. »Aber keine Ermittlungen hier, verstanden?«
Fuchs nickte bloß, dachte sich seinen Teil und betrat das Grundstück. Als er den Blick nach vorne richtete, wurde ihm mit einem Schlag wieder der Grund für sein Kommen bewusst. Die Auseinandersetzung mit Rupp hatte ihn kurzzeitig abgelenkt. Retrospektiv betrachtet, fast eine Wohltat.
5
Auch wenn es noch früh war, konnte man erahnen, dass es ein heißer Tag werden würde. Die Thermik flirrte schon jetzt über dem Pflaster der Einfahrt. Ein Spurensicherungsbeamter tauchte hinter dem Sichtschutz, einer mit Stoff bespannten Faltwand aus Zeltstangen, auf. Als er Joachim bemerkte, beschrieb er mit der Hand einen Bogen.
»Außen rum, bitte!«
Während Fuchs die Stelle passierte, sah er zwei weitere Beamte in weißen Tyvek-Anzügen, die neben Rußspuren auf dem Boden knieten. Mit der Aussparung in der Mitte, welche die Umrisse von Körperteilen erkennen ließ, drängten sich bei Joachim Erinnerungen an die mysteriösen Schatten Hiroshimas auf, wo die Atombombenexplosion menschliche Schemen in Stein gebrannt hatte. Sofort rumorte es wieder in seinem Bauch. War Konrad an dieser Stelle gestorben? Auch der Gedanke, gleich Irene gegenüberzutreten, die nicht wie sonst fröhliche Gastgeberin, sondern am Boden zerstörte Witwe sein würde, war unbegreiflich. So lange er Irene kannte, hatte er sie noch nie schlecht gelaunt oder traurig erlebt.
Er folgte dem beschriebenen Bogen und ging Richtung Haus. Die Einfahrt führte rechts am Gebäude vorbei zur Garage, die, soweit Fuchs wusste, nie dem Abstellen von Autos, sondern nur Konrad als Erfinderwerkstatt gedient hatte. Die Haustür stand offen. Dennoch trat er nicht ein; es widerstrebte ihm, einfach ins Haus zu marschieren, obwohl es die Tatortgruppe vermutlich schon den ganzen Morgen lang tat. Also entschied er sich, zu klingeln und zu warten. Nach einer Weile tauchte Irene im Flur auf. Verheultes Gesicht, der Rücken gebeugt. Wie um Jahre gealtert. Als sie Fuchs sah, lief sie los und fiel ihm wortlos um den Hals. Weinte. Er drückte sie an sich, hielt sie ganz fest und spürte das Beben ihres Körpers, wobei er selbst gegen die Tränen ankämpfen musste. Vorsichtig streichelte er ihr über den Kopf. Er war nie gut im Kondolieren gewesen. Beileidsbekundungen wirkten auf ihn häufig floskelhaft. Irene wusste auch so, dass es ihm leidtat. Sie lösten sich aus der Umklammerung, sahen einander an.
Er kannte Irene, seitdem sie vor elf Jahren in Konrads Leben getreten war, etwa ein Jahr nach dem verfrühten Krebstod seiner Frau Hanna. Irene und Konrad hatten ein paar Anläufe gebraucht, bis sie zusammengekommen waren, da Konrad erst Hannas Tod hatte verkraften müssen, bevor er sich auf eine andere Frau einlassen konnte. Ihr gemeinsamer Kinderwunsch war aufgrund einer Eileitererkrankung Irenes lange Zeit ausgeblieben, was die beiden aber nur fester zusammengeschweißt hatte. Zwei Jahre später hatten sie ein Kind adoptiert. Drei Jahre später das zweite. Sören stammte aus Indien, Lina aus Vietnam. Irene wiederum hatte russische Wurzeln. Selbst unter Patchworkfamilien stachen die Krölls heraus, und doch schienen sie wie füreinander geschaffen.
Er folgte Irene ins Innere, vorbei an der Familiengalerie, die in geordnetem Chaos die Wand beherrschte. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus Rahmen, die alle auf unterschiedlichen Höhen hingen und doch in ihrer Gesamtheit ein stimmiges Bild ergaben. Als repräsentierten sie die Familie selbst, dachte Fuchs und betrachtete Konrad, der ihn mit seinem gewinnenden Lachen von einer der Aufnahmen anstrahlte. Die Kinder waren auf den meisten Fotos noch klein, hatten aber seither einen gewaltigen Schuss gemacht. Mit ihren sechs und neun Jahren waren sie in einem Alter, in dem sie der Tod ihres Vaters hart treffen würde. Fuchs wurde schwer ums Herz.
Als sie das Wohnzimmer betraten, saß dort ein grauhaariger Mann. Fuchs schätzte ihn auf Mitte fünfzig. Die lila Weste mit dem rot-gelben Logo, die sich über seinem Bauch spannte, verriet, dass er von der Notfallseelsorge kam. Das Auffälligste an ihm war jedoch seine Brille. Sechseckige Gläser in einer knallbunten Fassung. Unweigerlich fragte Fuchs sich, ob der Mann die Traumatisierten damit aufheitern wollte oder sie Ausdruck des verzweifelten Versuchs waren, um jeden Preis flippig zu wirken. Zwar wäre es Fuchs lieber gewesen, mit Irene unter vier Augen zu sprechen, aber da sie nichts gegen die Anwesenheit des Seelsorgers zu haben schien, ließ er es dabei bewenden. Er nahm neben ihr auf der Couch Platz, sah sie an. Bisher hatten sie noch kein Wort miteinander gewechselt, und er ahnte, wie belegt seine Stimme gleich klingen würde.
Er räusperte sich. »Wissen es die Kinder schon?«
Irene schüttelte den Kopf, begann wieder zu weinen.
Fuchs streichelte ihre Hand.
»Die sind diese Woche bei meinem Vater«, antwortete sie, nachdem sie sich etwas beruhigt hatte. »Zum Glück! Wenn ich mir vorstelle, sie hätten das mit angesehen …«
»Was ist denn passiert?«, fragte Fuchs.
»Ich weiß es nicht. Ich habe keine Erklärung dafür.«
»Für was hast du keine Erklärung? Was hast du gesehen?«
Sie starrte in den erloschenen Kamin, als spiegelten sich ihre Erinnerungen in den Flammen eines imaginären Feuers. »Er hat gebrannt. Einfach so.«
»Hast du gesehen, wie es dazu gekommen ist? Kam er aus der Garage? Hat er an irgendwas herumexperimentiert?«
Irene schüttelte den Kopf. »Nein. Er war auf dem Weg zur Arbeit. Wir hatten gefrühstückt. Er war spät dran. Als er das Haus verlassen hat, habe ich aus dem Küchenfenster gesehen, und dann stand er plötzlich in Flammen.«
Fuchs sah zum Seelsorger hinüber, der aber nur die Schultern zuckte.
»Ich weiß, wie das klingt. Aber genau so war es.«
Fuchs ließ die Luft aus seinen Lungen entweichen. »Okay, ich weiß, dass es nicht leicht für dich ist, aber am besten, du fängst noch mal ganz von vorne an. Ihr seid aufgewacht – Was war dann?«
»Wir sind aufgestanden. Konny war im Bad, ich habe Frühstück gemacht. Er kam in die Küche, hat sein Müsli gegessen, seinen Kaffee getrunken und wir haben uns kurz unterhalten. Er wollte noch seine Schüssel abspülen, weil er weiß, wie sehr ich es hasse, wenn die Haferflocken daran festkleben. Die gehen dann immer so schwer ab, weißt du? Aber ich habe ihn aus dem Haus gescheucht, damit er nicht zu spät kommt. Er kommt nie zu spät.« Sie riss die Augen auf. Offenbar war sie zu einer Erkenntnis gelangt. »Was, wenn ich ihn nicht gedrängt hätte? Wäre das dann vielleicht gar nicht …?«
»Nein, nein, nein«, unterbrach Fuchs sie. »So darfst du gar nicht erst anfangen. Sieh mich an.« Er wartete, bis sie seinem Blick begegnete. »Du trägst hieran keine Schuld, okay?«
Ein Schniefen. Ein Nicken.
»Gut. Was geschah, nachdem er aus dem Haus gegangen war?«
»Ich stand am Waschbecken, um die Schale abzuwaschen. Als ich nach draußen sah …« Sie hielt inne, ihre Augen füllten sich wieder mit Tränen.
Fuchs drückte ihre Hand. »Ist gut, lass es raus.«
Doch statt eines Heulkrampfs fing sich Irene. »Als ich nach draußen sah, stand er in Flammen.«
Fuchs wusste nicht, was er mit dieser Aussage anfangen sollte. Was Irene ihm da erzählte, klang völlig absurd. »War das wirklich das Erste, was du gesehen hast? Versuch, dich genau zu erinnern.«
Sie dachte nach. »Er … blieb in der Einfahrt stehen, um etwas aufzuheben. Ich glaube, es war eine Schnecke, die er ins Beet gesetzt hat. Ich habe an die Scheibe geklopft und geschimpft, weil die Viecher nur meinen Salat zerfressen.« Eine Träne lief ihr über die Wange. Sie wischte sie mit dem Handrücken weg.
»Und was hat Konrad gemacht?«
»Er hat gelacht.«
»Was war dann?«
»Dann … habe ich ein Geschirrtuch aus dem Schrank unter der Spüle geholt.«
»Das heißt also, es gab einen Moment, in dem du ihn nicht beobachtet hast?«
»Ja.«
»Wie lange war das etwa?«
Sie zuckte die Schultern. »Vielleicht dreißig Sekunden.« Joachims Blick veranlasste sie zu einer Erklärung. »Konny hat mir mal so spezielle Putztücher mitgebracht. Die lagen unter allerhand Krempel im Schrank. Bis ich sie gefunden und ausgepackt hatte, war vielleicht eine halbe Minute vergangen. Und als ich mich dann wieder aufgerichtet und nach draußen geschaut habe, brannte er schon.«
Sichtlich betreten beäugte der Seelsorger die Szene. Entweder fühlte er sich seiner Aufgabe beraubt, oder auch er war mit der Situation überfordert. Wahrscheinlich war selbst ihm eine solche Geschichte noch nicht untergekommen.
»Gab es jemanden, der Konrad Böses gewollt haben könnte?«, fragte Fuchs.