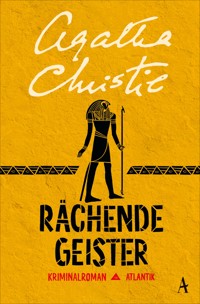
10,99 €
Mehr erfahren.
Im Alten Ägypten einem Serienmörder auf der Spur Ägypten, 2000 v. Chr. Das ohnehin schon angespannte Zusammenleben einer Großfamilie wird zusätzlich strapaziert, als ihr Oberhaupt eine neue Geliebte mit nach Hause bringt. Jung, wunderschön und zutiefst boshaft, sät diese Zwietracht, wo sie nur kann. Als sie stirbt, glaubt niemand an einen Unfall. Dann gibt es weitere Tote – ein Fluch? Oder allzu menschliches Tun? "Unglaublich lebhaft geschrieben – man muss die Autorin einfach bewundern!" (The Observer) --- Neuübersetzung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Agatha Christie
Rächende Geister
Kriminalroman
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini
Atlantik
Für Prof. S. R.K. Glanville
Lieber Stephen,
Sie waren es, der mich seinerzeit auf die Idee brachte, eine Kriminalgeschichte zu schreiben, die im Alten Ägypten spielt, und ohne Ihre Ermutigung und aktive Unterstützung wäre dieses Buch nie zustande gekommen.
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel Freude mir die viele interessante Literatur gemacht hat, die Sie mir geliehen haben, und ich danke Ihnen noch einmal für die Geduld, mit der Sie meine Fragen beantwortet, und für die Zeit und Mühe, die Sie für mich aufgewandt haben. Wie viel Freude und welchen Gewinn es für mich bedeutet hat, das Buch zu schreiben, wissen Sie ja bereits.
In Zuneigung und Dankbarkeit
Ihre Freundin
Vorbemerkung der Verfasserin
Dieser Roman spielt um das Jahr 2000 v. Chr. im alten Ägypten, am Westufer des Nils, in der Nähe von Theben. Weder Zeit noch Ort sind für die Geschichte von Belang. Jeder andere Ort und jede andere Zeit hätten es ebenso gut getan; wie es der Zufall aber so wollte, verdanke ich die Inspiration sowohl zu den Personen als auch zur Handlung zwei, drei Briefen aus der XI. Dynastie, die vor ungefähr zwanzig Jahren von der Ägyptischen Expedition des Metropolitan Museum of Art, New York, in einem Felsengrab gegenüber von Luxor entdeckt und von Prof. (damals noch Mr) Battiscombe Gunn übersetzt und im Bulletin des Museums veröffentlicht wurden.
Es wird meine Leserinnen und Leser vielleicht interessieren, dass eine Stiftung für den Ka-Dienst – ein fester Bestandteil der altägyptischen Kultur – grundsätzlich eine große Ähnlichkeit mit den mittelalterlichen Stiftungen für Seelenmessen aufwies. Dem designierten Ka-Priester wurden Ländereien vermacht, und im Gegenzug wurde von ihm erwartet, dass er das Grab des Erblassers pflegte und an bestimmten, über das Jahr verteilten Festtagen in der Grabkapelle Opfergaben darbrachte, um das Wohlergehen der Totenseele zu garantieren.
In altägyptischen Texten werden die Wörter »Bruder« und »Schwester« durchweg im Sinne von »Geliebter« und »Geliebte« verwendet und stehen oft für »Ehemann« und »Ehefrau«. In diesem Sinne werden sie auch in diesem Buch gelegentlich verwendet.
Der altägyptische landwirtschaftliche Kalender, bestehend aus drei Jahreszeiten zu je vier Monaten mit jeweils dreißig Tagen, bildete den Rahmen, in dem sich das bäuerliche Leben abspielte; durch Hinzufügung von fünf Zusatztagen am Ende des Jahres wurde er zum offiziellen Verwaltungskalender mit 365 Tagen. Das landwirtschaftliche Jahr begann ursprünglich mit dem Eintreffen der Nilflut in Ägypten in der dritten Juliwoche; doch das Fehlen eines Schaltjahres hatte zur Folge, dass der Kalender sich immer weiter von der Wirklichkeit entfernte, sodass zur Zeit unserer Geschichte der offizielle Neujahrstag ungefähr sechs Monate vor den Beginn des landwirtschaftlichen Jahres fiel, das heißt, statt in den Juli in den Januar. Um den Leserinnen und Lesern die Mühe des dauernden Umrechnens zu ersparen, richten sich die als Kapitelüberschriften verwendeten Daten nach dem damals gültigen landwirtschaftlichen Kalender, das heißt: Überschwemmung – Ende Juli bis Ende November; Winter – Ende November bis Ende März; und Sommer – Ende März bis Ende Juli.
A.C. 1944
Teil IÜberschwemmung
Kapitel 1Zweiter Monat – 20. Tag
Renisenb blickte über den Nil hin.
Von ferne konnte sie, leise, die erregten Stimmen ihrer Brüder vernehmen, Yahmose und Sobek, die sich gerade darüber stritten, ob an einer bestimmten Stelle die Deiche verstärkt werden müssten oder nicht. Sobeks Stimme klang so hell und selbstbewusst wie immer. Er hatte die Angewohnheit, seine Meinung mit unbekümmerter Entschiedenheit zu äußern. Yahmoses Stimme dagegen klang tief und mürrisch, sie brachte Zweifel und Sorge zum Ausdruck. Yahmose machte sich ständig wegen irgendetwas Sorgen. Er war der älteste Sohn, und während der Zeit, da sein Vater sich auf den Nördlichen Gütern aufhielt, lag die Bewirtschaftung des Ackerlandes mehr oder weniger in seiner Hand. Yahmose war langsam und vorsichtig und neigte dazu, überall Schwierigkeiten zu wittern, wo es keine gab. Er war ein massiger, schwerfälliger Mann, der nichts von Sobeks Munterkeit und Zuversicht besaß.
Schon als kleines Kind, erinnerte sich Renisenb, hatte sie ihre älteren Brüder in diesen Tonfällen zanken hören. Es flößte ihr mit einem Mal ein Gefühl von Geborgenheit ein … Sie war wieder zu Haus. Ja, sie war heimgekehrt …
Doch als sie wieder über den blassen, glänzenden Strom hinwegblickte, wallten der Schmerz und die Empörung erneut in ihr auf: Chay, ihr junger Gemahl, war tot … Chay mit seinem lachenden Gesicht und seinen kräftigen Schultern. Chay war bei Osiris, im Totenreich – und sie, seine innig geliebte Gemahlin, war einsam zurückgeblieben. Acht Jahre hatten sie miteinander gehabt – sie war als wenig mehr denn ein Kind mit ihm fortgezogen –, und jetzt war sie, mit Chays Kind, Teti, als Witwe ins Haus ihres Vaters zurückgekehrt.
In diesem Augenblick kam es ihr so vor, als wäre sie nie fort gewesen …
Sie freute sich über diesen Gedanken …
Sie würde diese acht Jahre vergessen – so erfüllt von gedankenlosem Glück, so zerrissen und zunichtegemacht durch Leid und Verlust.
Ja, vergessen würde sie sie, sich aus dem Kopf schlagen. Und wieder zu Renisenb werden, des Ka-Priesters Imhotep Tochter, dem gedankenlosen, gefühllosen kleinen Mädchen. Diese Liebe eines Gemahls und Bruders war grausam gewesen und trügerisch in ihrer Süße. Sie rief sich die breiten bronzefarbenen Schultern ins Gedächtnis, den lachenden Mund – jetzt war Chay einbalsamiert, mit Binden umwickelt, durch Amulette geschützt auf seiner Reise durch die andere Welt. In dieser Welt gab es keinen Chay mehr, der auf dem Nil segelte und Fische fing und die Sonne am Himmel anlachte, während sie, mit der kleinen Teti im Schoß im Boot ausgestreckt, sein Lachen erwiderte …
Renisenb dachte: Ich will nicht darüber nachgrübeln. Es ist vorbei! Hier bin ich zu Haus. Alles ist genau so, wie es früher war. Auch ich werde bald wieder dieselbe sein. Alles wird so sein wie früher. Teti hat bereits vergessen. Sie spielt mit den anderen Kindern und lacht.
Kurz entschlossen drehte sich Renisenb um und machte sich auf den Heimweg, vorbei an einigen beladenen Mauleseln, die zum Flussufer getrieben wurden. Sie passierte die Kornspeicher und Scheunen und gelangte schließlich durch das Tor in den ummauerten Hof. Im Hof war es sehr angenehm. Hier gab es den künstlichen Teich, von blühenden Oleandern und Jasminsträuchern umgeben und von Maulbeerfeigen beschattet. Hier spielten Teti und die anderen Kinder und ließen ihre schrillen, klaren Stimmen vernehmen. Sie rannten im kleinen Pavillon ein und aus, der an einer Seite des Teiches stand. Renisenb bemerkte, dass Teti mit einem Holzlöwen spielte, dessen Schnauze sich dadurch öffnen und schließen ließ, dass man an einer Schnur zog: ein Spielzeug, das sie als Kind selbst geliebt hatte. Wieder dachte sie dankbar: Ich bin heimgekehrt … Nichts hatte sich hier geändert, alles war so, wie es gewesen war. Hier war das Leben behütet, beständig, unveränderlich. Jetzt war Teti das Kind und sie eine der zahlreichen Mütter, die die heimischen Mauern umschlossen – aber das Grundgerüst, das Wesentliche, war unverändert.
Der Ball, mit dem eines der Kinder spielte, rollte vor ihre Füße, und sie hob ihn auf und warf ihn lachend zurück.
Renisenb ging weiter zur Vorhalle mit ihren bunt bemalten Säulen und durch diese ins Haus, durchquerte den großen Hauptraum mit seinem farbenfrohen Fries von Lotos, Mohn und anderen Blumen und begab sich zum hinteren Teil des Hauses und den Frauengemächern.
Erregte Stimmen drangen an ihr Ohr, und sie blieb wieder stehen, um die altvertrauten Klänge auszukosten. Satipy und Kait – wie immer zankend! Wie gut sie sich an Satipys Stimme erinnerte, hoch, befehlsgewohnt und gebieterisch! Satipy war die Gattin ihres Bruders Yahmose, eine hochgewachsene, energische Frau mit einer gellenden Stimme, gutaussehend auf eine harte, herrische Weise. Ständig machte sie allen Vorschriften, scheuchte die Dienerschaft herum, fand an allem etwas zu mäkeln, erzwang durch die schiere Kraft ihrer Persönlichkeit und ihres Gezeters selbst das Unmögliche. Jeder fürchtete ihre Zunge und beeilte sich, ihren Befehlen zu gehorchen. Yahmose hegte die größte Bewunderung für seine resolute, temperamentvolle Gattin und ließ sich von ihr auf eine Weise schurigeln, die Renisenb oft genug empört hatte.
In Abständen, wenn Satipys schrilles Organ eine Pause zwischen den Sätzen entstehen ließ, war Kaits ruhige, starrsinnige Stimme zu vernehmen. Kait war eine stämmige, unscheinbare Frau, die Gattin des gutaussehenden, munteren Sobek. Sie hatte nur ihre Kinder im Kopf und sprach selten von irgendetwas anderem. Ihren Part in ihren täglichen Auseinandersetzungen mit ihrer Schwägerin bestritt sie mit der simplen Taktik, was immer sie eingangs gesagt hatte, mit ruhigem, unerschütterlichem Starrsinn zu wiederholen. Sie legte weder Eifer noch Zorn an den Tag und schenkte keinem anderen Standpunkt als ihrem eigenen auch nur die geringste Beachtung. Sobek war seiner Frau sehr zugetan und besprach mit ihr bedenkenlos alle seine Angelegenheiten, weil er wusste, dass sie eine Miene machen würde, als ob sie ihm zuhörte, angemessene bestätigende oder verneinende Geräusche von sich geben und nichts Unpassendes im Gedächtnis behalten würde, da sie mit Sicherheit die ganze Zeit über irgendein Problem nachgedacht hatte, das mit den Kindern zusammenhing.
»Es ist ein Skandal, sage ich!«, schrie Satipy. »Wenn Yahmose auch nur das Herz einer Maus hätte, würde er es keinen Augenblick dulden! Wer hat denn hier das Sagen, wenn Imhotep nicht da ist? Yahmose! Und als der Gattin Yahmoses sollte die erste Wahl der Webmatten und Sitzpolster mirzustehen. Diesem Nilpferd von einem schwarzen Sklaven sollte man …«
Kaits träge, tiefe Stimme unterbrach ihre Tirade: »Nein, nein, meine Kleine, du darfst das Haar deiner Puppe nicht essen. Schau, hier hast du etwas Besseres, etwas Süßes – hmmmh, wie lecker …!«
»Und was dich betrifft, Kait, hast du überhaupt keine Kinderstube, du hörst mir nicht einmal zu … gibst keine Antwort – du hast entsetzliche Manieren!«
»Das blaue Sitzpolster war schon immer meins … Oh, schau dir nur die kleine Anch an – sie versucht zu laufen …«
»Du hast nicht mehr Verstand als deine Kinder, Kait, und das will wahrlich was heißen! Aber so einfach kommst du mir nicht davon. Ich werde kriegen, was mir zusteht, das versichere ich dir!«
Renisenb zuckte zusammen, als hinter ihr leise Schritte ertönten. Sie drehte sich abrupt um und verspürte den altbekannten, vertrauten Anflug von Unbehagen, als sie das Weib Henet vor sich stehen sah.
Henets mageres Gesicht verzog sich zu ihrem üblichen kriecherischen Lächeln.
»Viel hat sich ja nicht geändert, sagst du dir bestimmt gerade, Renisenb«, meinte sie. »Wie wir Satipys Zunge ertragen, weiß ich wirklich nicht! Kait kann ihr natürlich Widerworte geben. Aber manche von uns haben dieses Glück nicht! Was sich mir ziemt, weiß ich gottlob – und welchen Dank ich deinem Vater dafür schulde, dass er mir ein Heim und Speise und Kleidung gewährt. Ach, er ist ein guter Mann, dein Vater! Und ich habe mich von jeher bemüht, mein Bestes zu geben. Ich arbeite unentwegt – helfe hier aus und da –, und ich erwarte dafür weder Dank noch Lob. Wenn deine liebe Mutter uns nicht verlassen hätte, wäre es jetzt anders. Sie wusste, was sie an mir hatte. Wie Schwestern waren wir! Und eine schöne Frau war sie. Nun, ich habe meine Pflicht getan und mein Versprechen gehalten. ›Kümmer dich um die Kinder, Henet‹, sagte sie, als sie im Sterben lag. Und ich habe Wort gehalten. Wie eine Sklavin habe ich für euch alle geschuftet, ohne auch nur ein Dankeschön. Habe ich nie erwartet und auch nie bekommen! ›Es ist ja bloß die alte Henet‹, sagen die Leute, ›sie zählt nicht.‹ Niemand hält das Geringste von mir. Und warum auch? Ich versuche ja nur, zu helfen, wo ich kann, das ist alles.«
Sie schlüpfte wie ein Aal unter Renisenbs Arm hindurch und glitt ins innere Gemach.
»Was diese Sitzpolster betrifft, Satipy … du wirst entschuldigen, aber rein zufällig hörte ich Sobek sagen …«
Renisenb ging weiter. Die altvertraute Abneigung gegen Henet wallte in ihr auf. Komisch, wie wenig sie alle Henet leiden mochten! Es lag an ihrer weinerlichen Stimme, ihrem ständigen Selbstmitleid – und der boshaften Freude, die es ihr bereitete, bei Meinungsverschiedenheiten gelegentlich Öl ins Feuer zu gießen.
Was soll’s, dachte Renisenb, warum auch nicht? Das war vermutlich Henets einziges Vergnügen. Ihr Leben musste ja ziemlich trostlos sein – und es stimmte, dass sie sich tagein, tagaus abrackerte und keiner es ihr jemals dankte. Aber es war einfach unmöglich, Henet gegenüber Dankbarkeit zu empfinden – sie wies so penetrant auf ihre Verdienste hin, dass es jegliches herzliche Gefühl abtötete, das man ihr ansonsten entgegengebracht hätte.
Henet, dachte Renisenb, war einer von diesen Menschen, deren Schicksal es ist, anderen ergeben zu sein und keinen zu haben, der ihnen ergeben wäre. Sie war alles andere als ein Fest für die Augen und dazu dumm wie Bohnenstroh. Dennoch war sie stets bei allem auf dem Laufenden. Ihr lautloser Gang, ihre scharfen Ohren und ihre flinken forschenden Augen sorgten dafür, dass nichts lange vor ihr geheim blieb. Manchmal behielt sie ihr Wissen geradezu eifersüchtig für sich – zu anderen Gelegenheiten machte sie bei allen die Runde, flüsterte ihnen etwas zu und trat dann einen Schritt zurück, um mit diebischem Vergnügen die Wirkung ihrer Tratscherei zu beobachten.
Im ganzen Haus gab es keinen, der nicht schon irgendwann Imhotep angefleht hätte, Henet vor die Tür zu setzen, aber Imhotep wollte nichts davon wissen. Er war vielleicht der einzige Mensch, der sie gern hatte; und sie vergalt ihm seine Huld mit einer knechtischen Ergebenheit, die dem Rest der Familie regelrecht den Magen umdrehte.
Renisenb zögerte kurz an der Tür und lauschte dem Gekeife ihrer Schwägerin, das, von Henets Einmischung angefacht, an Intensität zugenommen hatte, dann ging sie langsam weiter, bis zu der kleinen Kammer, in der ihre Großmutter Esa saß, von zwei kleinen schwarzen Sklavenmädchen bedient. Im Augenblick war sie damit beschäftigt, gewisse Leinengewänder zu begutachten, die die Kleinen ihr vorlegten, und diese auf ihre charakteristische, gütige Weise zu schelten.
Ja, es war alles genauso wie früher. Renisenb stand unbemerkt da und lauschte. Die alte Esa war ein wenig zusammengeschrumpft, das war alles. Aber ihre Stimme war noch dieselbe, und die Dinge, die sie gerade sagte, waren ebenfalls fast wortwörtlich die gleichen, die Renisenb so häufig vernommen hatte, bevor sie, vor acht Jahren, ihr Elternhaus verlassen hatte …
Renisenb schlich sich wieder hinaus. Weder die alte Frau noch die zwei kleinen schwarzen Sklavenmädchen hatten ihre Anwesenheit bemerkt. Einen kurzen Augenblick lang verweilte Renisenb an der offenen Küchentür. Ein Duft von gebratener Ente, viel Reden und Lachen und Schimpfen, alles zugleich; und ein Haufen Gemüse, das darauf wartete, zubereitet zu werden.
Die Augen halb geschlossen, stand Renisenb bewegungslos da. Von dort, wo sie stand, konnte sie alles hören, was überall im Haus gerade vor sich ging. Die kernigen, mannigfaltigen Geräusche aus der Küche, die hohe, schrille Stimme der alten Esa, die kreischenden Töne Satipys und, ganz leise, Kaits tieferer, unbeirrbarer Alt. Ein Babel von Frauenstimmen – plappernden, lachenden, sich beschwerenden, schimpfenden und sich empörenden Frauenstimmen …
Und plötzlich fühlte sich Renisenb wie erstickt, von dieser nie erlahmenden lautstarken Weiblichkeit erdrückt. Frauen – geschwätziges, lärmendes Volk! Ein Haus voller Frauen – niemals still, niemals ruhig –, die in einem fort redeten, riefen, Dinge sagten, anstatt sie zu tun!
Wie anders Chay – Chay, stumm und wachsam in seinem Boot, ganz auf den Fisch konzentriert, nach dem sein Speer zielte … Nichts von dieser Geschwätzigkeit, von diesem geschäftigen, unaufhörlichen Getue.
Eilig kehrte Renisenb aus dem Haus in die heiße, klare Stille zurück. Sie sah Sobek von den Feldern zurückkommen und sah in der Ferne Yahmose zum Grab hinaufsteigen.
Sie wandte sich ab und schlug den Pfad zur Kalksteinwand ein, in der sich das Grab befand. Es war das Grab des großen Edelmanns Meriptah, und ihr Vater war der für dessen Pflege verantwortliche Totenpriester. Das ganze Gut mit all seinen Ländereien war Teil der Stiftung, die dem Unterhalt des Grabes diente.
Wenn ihr Vater nicht da war, oblagen die Pflichten des Ka-Priesters ihrem Bruder Yahmose. Als Renisenb nach ihrem langsamen Aufstieg den steilen Pfad hinauf beim Grab anlangte, saß Yahmose in der kleinen Felsenkammer, die sich direkt neben der Opferkapelle befand, und besprach sich mit Hori, dem Wirtschafter ihres Vaters.
Hori hatte ein Blatt Papyrus auf seinen Knien ausgebreitet, und Yahmose und er beugten sich darüber.
Beide Männer lächelten Renisenb zu, als sie eintrat, und sie setzte sich in ihrer Nähe in den Schatten. Sie hatte ihren Bruder Yahmose schon immer sehr gern gehabt. Er war ihr gegenüber freundlich und liebevoll und hatte ein sanftes, gütiges Wesen. Auch Hori war der kleinen Renisenb immer mit einer ernst-feierlichen Freundlichkeit begegnet und hatte manchmal das eine oder andere Spielzeug für sie repariert. Als sie ihr Elternhaus verließ, war er ein ernsthafter, schweigsamer junger Mann mit feinfühligen, geschickten Fingern gewesen. Renisenb dachte bei sich, dass er jetzt zwar älter aussah, sich aber ansonsten kaum verändert hatte. Das ernste Lächeln, das er ihr schenkte, war genau so, wie sie es in Erinnerung hatte.
Yahmose und Hori murmelten miteinander.
»Dreiundsiebzig Scheffel Gerste von Ipi dem Jüngeren …«
»Das ergibt dann insgesamt zweihundertdreißig Dinkel und einhundertzwanzig Gerste.«
»Ja, aber da ist noch der Preis für das Bauholz, und das Getreide wurde in Perhaa in Öl bezahlt …«
So ging es weiter. Von den murmelnden Stimmen der zwei Männer eingelullt, döste Renisenb zufrieden vor sich hin. Schließlich gab Yahmose Hori den Papyrus zurück, erhob sich und ging.
Renisenb blieb sitzen und genoss das gesellige Schweigen.
Dann berührte sie eine andere Papyrusrolle und fragte: »Ist die von meinem Vater?«
Hori nickte.
»Was sagt er?«, fragte sie neugierig.
Sie entrollte den Papyrus und starrte auf die für ihre ungeschulten Augen unverständlichen Zeichen.
Mit einem kleinen Lächeln beugte sich Hori über ihre Schulter und las vor, während er mit dem Finger die Zeilen entlangfuhr. Das Sendschreiben war im geschwollenen Stil der professionellen Briefschreiber von Herakleopolis abgefasst.
Der Diener des Gutes, der Ka-Diener Imhotep sagt:
Möge Dein Befinden sein wie das eines, der eine Million Mal lebt. Mögen Gott Herischef, der Herrscher von Herakleopolis, und alle Götter, die da sind, Dir beistehen. Möge Gott Ptah Dein Herz erfreuen als eines, der lange lebt. Der Sohn spricht zu seiner Mutter, der Ka-Diener zu seiner Mutter Esa: Wie geht es Dir? Du sollst in Leben, Heil und Gesundheit sein. Zum ganzen Haushalt: Wie geht es Euch? Zu meinem Sohn Yahmose: Wie ergeht es Dir in Leben, Heil und Gesundheit? Machet das Beste aus meinem Land. Strebt mit all Euren Kräften, grabt das Land um mit Euren Nasen in der Scholle. Sehet, wenn Ihr fleißig seid, werde ich Gott lobpreisen um Euretwillen …
Renisenb lachte.
»Der arme Yahmose! Er arbeitet bestimmt schon hart genug!«
Die Ermahnungen ihres Vaters hatten sein Bild klar vor ihr inneres Auge treten lassen – seine geschwollene, leicht betuliche Art, seine fortwährenden Ermahnungen und Belehrungen.
Hori fuhr fort:
Achte wohl auf meinen Sohn Ipy. Ich vernehme, dass er unzufrieden ist. Trage auch dafür Sorge, dass Satipy Henet gut behandelt. Dies präge Dir ein. Versäume nicht, mir von dem Flachs und dem Öl zu berichten. Hüte den Ertrag meiner Getreidefelder – hüte alles, was mein ist, denn ich werde Dich zur Rechenschaft ziehen. Wenn mein Land fortgeschwemmt wird, wehe Dir und Sobek!
»Mein Vater ist immer noch derselbe«, sagte Renisenb vergnügt. »Glaubt nach wie vor, dass nichts richtig gemacht wird, wenn er nicht hier ist.« Sie ließ die Papyrusrolle aus ihrer Hand gleiten und fügte leise hinzu: »Alles ist genauso wie früher …«
Hori erwiderte nichts.
Er breitete ein Blatt Papyrus aus und begann zu schreiben. Renisenb sah ihm eine Zeit lang müßig zu. Sie verspürte ein zu tiefes Behagen, um sprechen zu können.
Schließlich sagte sie träumerisch: »Es wäre schön zu wissen, wie man auf Papyrus schreibt. Warum lernen es nicht alle?«
»Es ist nicht nötig.«
»Nötig vielleicht nicht, aber es wäre erfreulich.«
»Glaubst du, Renisenb? Was würde es denn für dich ändern?«
Renisenb dachte eine Weile darüber nach. Dann sagte sie zögernd: »Wenn du mich so fragst, dann weiß ich es wahrhaft nicht zu sagen, Hori.«
Hori fuhr fort: »Gegenwärtig sind eine Handvoll Schreiber alles, was auf einem großen Gut benötigt wird, doch ich glaube, der Tag wird kommen, an dem es Heerscharen von Schreibern geben wird, überall in Ägypten.«
»Das wird eine gute Sache sein«, sagte Renisenb.
Hori entgegnete gedehnt: »Da bin ich mir nicht so sicher.«
»Wieso bist du dir nicht sicher?«
»Weil es so einfach ist, Renisenb, und es so wenig Mühe erfordert, ›zehn Scheffel Gerste‹ zu schreiben oder ›einhundert Stück Vieh‹ oder ›zehn Äcker Dinkel‹ – und das, was geschrieben steht, wird bald so scheinen, als wäre es das Wirkliche, und so wird der Schreibende und der Schreiber bald den Mann verachten, der die Äcker pflügt und die Gerste erntet und das Vieh züchtet – dennoch sind die Äcker und das Vieh wirklich, sie sind nicht lediglich Tintenzeichen auf Papyrus. Und wenn einst alle Aufzeichnungen und alle Papyrusrollen zugrunde gegangen sind und die Schreiber in alle Winde zerstreut, werden die Männer, die da fronen und ernten, weiterbestehen, und Ägypten wird immer noch leben.«
Renisenb sah ihn aufmerksam an. »Ja«, sagte sie bedächtig, »ich verstehe, was du meinst. Nur die Dinge, die man sehen und berühren und essen kann, sind wirklich … ›Ich habe zweihundertundvierzig Scheffel Gerste‹ aufzuschreiben hat keine Bedeutung, solange man die Gerste nicht wirklich hat. Man könnte schließlich Lügen aufschreiben.«
Hori lächelte über ihre ernste Miene.
Dann sagte Renisenb unvermittelt: »Du hast mal meinen Löwen für mich repariert – vor langer Zeit, erinnerst du dich?«
»Ja, ich erinnere mich, Renisenb.«
»Jetzt spielt Teti damit … Es ist derselbe Löwe.« Sie schwieg kurz und sagte dann schlicht: »Als Chay zu Osiris ging, war ich sehr traurig. Jetzt aber bin ich heimgekehrt, und ich werde wieder glücklich werden und vergessen – denn alles ist hier immer noch so, wie es war. Es hat sich überhaupt nichts verändert.«
»Glaubst du das wirklich?«
Renisenb warf ihm einen scharfen Blick zu.
»Was meinst du damit, Hori?«
»Ich meine damit, dass es immer Veränderung gibt. Acht Jahre sind acht Jahre.«
»Hier ändert sich nichts«, sagte Renisenb zuversichtlich.
»Dann sollte es vielleicht Veränderung geben.«
Renisenb sagte mit Schärfe in der Stimme: »Nein, nein, ich will, dass alles so bleibt!«
»Aber du selbst bist nicht mehr dieselbe Renisenb, die mit Chay fortzog.«
»Bin ich doch! Oder wenn nicht, so werde ich es bald wieder sein.«
Hori schüttelte den Kopf.
»Du kannst nicht zurück, Renisenb. Es ist wie mit meinen Mengeneinheiten hier. Ich nehme ein Halbes und füge ihm ein Viertel hinzu und dann ein Zehntel und dann ein Vierundzwanzigstel – und am Ende, siehst du, ist es eine ganz andere Menge.«
»Aber ich bin einfach Renisenb.«
»Aber zur Renisenb wird fortwährend etwas hinzugefügt, dadurch wird sie fortwährend zu einer anderen Renisenb!«
»Nein, nein. Du bist noch derselbe Hori.«
»Das mag dir so scheinen, aber es ist nicht so.«
»Doch, doch, und Yahmose ist immer noch derselbe, so besorgt und so ängstlich, und Satipy drangsaliert ihn so wie eh und je, und sie und Kait zanken wie gewohnt über Matten oder Glasperlen, und wenn ich gleich wieder zurückgehe, werden sie miteinander lachen und wieder die besten Freundinnen sein, und Henet schleicht nach wie vor durch das Haus und lauscht und winselt von ihrer Ergebenheit, und meine Großmutter regte sich vorhin gegenüber ihrer kleinen Dienerin über irgendwelche Leinentücher auf! Es war alles so wie immer, und bald wird mein Vater zurückkommen, und es wird viel Aufhebens geben, und er wird sagen: ›Warum hast du nicht dies gemacht?‹, und ›Du hättest das machen sollen‹, und Yahmose wird bekümmert dreinschauen, und Sobek wird lachen und freche Bemerkungen dazu machen, und mein Vater wird Ipy, der jetzt sechzehn ist, genauso verhätscheln, wie er ihn schon verhätschelte, als er acht war, und nichts, rein gar nichts wird das kleinste bisschen anders sein!« Sie hielt inne und schnappte nach Luft.
Hori seufzte. Dann sagte er sanft: »Du verstehst nicht, Renisenb. Es gibt ein Übel, das von außen kommt, das so heftig zuschlägt, dass die ganze Welt es sehen kann, aber es gibt auch eine andere Sorte von Verderbnis, die innen entsteht – die von außen nicht wahrnehmbar ist. Sie wächst langsam, Tag für Tag, heran, bis am Ende die ganze Frucht verdorben ist – vom Brand zerfressen.«
Renisenb starrte ihn an. Er hatte fast geistesabwesend gesprochen, nicht so, als spräche er zu ihr, sondern mehr wie ein Mann, der vor sich hin sinnt.
Sie stieß hervor: »Was meinst du damit, Hori? Du machst mir Angst!«
»Auch ich habe Angst.«
»Aber was meinst du damit? Was ist dieses Übel, von dem du sprichst?«
Er sah sie an und lächelte dann plötzlich.
»Vergiss, was ich gesagt habe, Renisenb. Ich hatte an die Krankheiten gedacht, die die Feldfrüchte befallen.«
Renisenb seufzte erleichtert.
»Da bin ich froh! Ich dachte – ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe.«
Kapitel 2Dritter Monat – 4. Tag
Satipy sprach mit Yahmose. Ihre Stimme hatte einen hohen, kreischenden Klang, der nur selten in seiner Tonlage variierte.
»Du musst dir Geltung verschaffen. Das ist, was ich sage! Man wird dich nie wertschätzen, solange du dir keine Geltung verschaffst. Dein Vater sagt, dies muss erledigt werden und das muss erledigt werden, und warum hast du jenes noch nicht erledigt. Und du hörst brav zu und antwortest ja, ja und entschuldigst dich für die Dinge, die seiner Meinung nach hätten erledigt werden müssen – und die, das wissen die Götter, oft genug völlig unmöglich waren! Dein Vater behandelt dich wie ein Kind – wie einen kleinen, verantwortungslosen Jungen! Du könntest so alt wie Ipy sein!«
Yahmose sagte friedfertig: »Mein Vater behandelt mich nicht im Mindesten so, wie er Ipy behandelt.«
»Das kannst du laut sagen!« Satipy stürzte sich mit frischer Giftigkeit auf das neue Thema. »Er ist völlig vernarrt in diesen verzogenen Balg! Mit jedem Tag wird Ipy unerträglicher. Stolziert herum und tut keinen Handschlag, vor dem er sich irgendwie drücken kann, und behauptet bei allem, was von ihm verlangt wird, es gehe über seine Kräfte. Es ist eine Schande! Und das einfach, weil er weiß, dass euer Vater ihm alles nachsieht und ihn immer in Schutz nimmt. Du und Sobek solltet euren Standpunkt in aller Deutlichkeit vorbringen.«
Yahmose zuckte mit den Schultern.
»Was sollte das nützen?«
»Du treibst mich zum Wahnsinn, Yahmose – das ist so typisch für dich! Du hast überhaupt keinen Schneid. Du bist so gefügig wie eine Frau! Was dein Vater auch sagt – sofort sagst du dazu Ja und Amen!«
»Ich hege eine tiefe Zuneigung zu meinem Vater.«
»Ja, und er nutzt das aus! Zu jedem Vorwurf, den er dir macht, sagst du nur ja, Papa, und entschuldigst dich für Dinge, für die du gar nichts kannst! Du solltest endlich den Mund aufmachen und ihm widersprechen, so wie Sobek es tut. Sobek hat vor niemandem Angst!«
»Ja, aber vergiss nicht, Satipy, dass ich derjenige bin, dem unser Vater vertraut, nicht Sobek. Mein Vater verlässt sich nie auf Sobek. Er überlässt immer alles meiner, nicht seiner Beurteilung.«
»Und genau deswegen solltest du offiziell zum Teilhaber gemacht werden! Du vertrittst deinen Vater, wenn er nicht da ist, du fungierst in seiner Abwesenheit als Ka-Priester, alles wird auf dich abgeladen – und dennoch hast du von Rechts wegen keinerlei Befugnisse. Es sollte ein richtiger Vertrag aufgesetzt werden. Mittlerweile hast du fast das mittlere Alter erreicht. Es ist nicht recht, dass du weiterhin wie ein Kind behandelt wirst!«
Yahmose sagte wenig überzeugt: »Mein Vater behält eben gern die Zügel in der Hand.«
»Ganz genau. Es gefällt ihm, dass jeder im Haus von ihm abhängig ist – und von seiner jeweiligen Laune. Das ist schlecht, und es wird schlimmer werden. Diesmal musst du ihm, wenn er zurückkommt, kühn entgegentreten – du musst sagen, dass du eine schriftliche Vereinbarung verlangst, dass du auf einer klar definierten Stellung bestehst.«
»Er würde mir gar nicht zuhören.«
»Dann musst du dir eben Gehör verschaffen! Ach, wäre ich doch bloß ein Mann! Wenn ich an deiner Stelle wäre, wüsste ich, was zu tun ist! Manchmal kommt es mir so vor, als wäre ich mit einem Wurm verheiratet!«
Yahmose errötete.
»Ich werde sehen, was sich machen lässt … vielleicht, ja, vielleicht könnte ich mit meinem Vater reden, ihn bitten …«
»Nicht bitten – verlangen musst du! Schließlich sitzt du am längeren Hebel. Außer dir hat er niemanden, von dem er sich hier vertreten lassen könnte. Sobek ist zu ungebärdig, dein Vater vertraut ihm nicht, und Ipy ist noch zu jung.«
»Es gibt immer noch Hori.«
»Hori gehört nicht zur Familie. Dein Vater verlässt sich auf seinen Sachverstand, aber die Macht würde er, selbst nur zeitweise, immer ausschließlich an einen Blutsverwandten abtreten. Aber ich mache mir keine Illusionen; du bist zu zahm und zu fügsam – und in deinen Adern fließt kein Blut, sondern Milch! Du denkst überhaupt nicht an mich oder an unsere Kinder. Solange dein Vater lebt, wird uns die Stellung, die uns eigentlich zusteht, verwehrt bleiben!«
Yahmose fragte bitter: »Du verachtest mich, habe ich recht, Satipy?«
»Du machst mich wütend.«
»Hör zu, ich verspreche dir, dass ich mit meinem Vater reden werde, sobald er zurückkommt. So, jetzt hast du mein Wort darauf.«
Satipy murmelte leise: »Ja, aber wie wirst du reden? Wie ein Mann – oder wie eine Maus?«
Kait spielte mit Anch, ihrem jüngsten Kind. Die Kleine machte gerade ihre ersten Gehversuche, und Kait ermutigte sie, mit ausgebreiteten Armen vor ihr kniend, mit lachenden Worten, bis das Kind sich todesmutig in Bewegung setzte und auf unsicheren Füßchen in die Arme seiner Mutter taperte.
Kait hatte Sobek diese Fortschritte vorführen wollen, aber plötzlich merkte sie, dass er überhaupt nicht aufpasste, sondern nur, die schöne Stirn in Falten gelegt, ins Leere starrte.
»Ach, Sobek … du hast gar nicht hingeguckt! Du siehst überhaupt nichts. Kleine, sag deinem Vater, dass es gemein ist, dir nicht zuzugucken!«
Sobek sagte gereizt: »Ich habe anderes im Kopf – und, ja, auf dem Herzen.«
Kait ließ sich auf die Fersen zurückfallen und strich sich das Haar, nach dem Anchs Fingerchen gegriffen hatten, aus der dunklen Stirn.
»Warum? Gibt es irgendein Problem?«
Kait war nicht ganz bei der Sache. Ihre Frage hatte sie eher mechanisch gestellt.
Sobek entgegnete zornig: »Das Problem ist, dass ich kein Vertrauen genieße. Mein Vater ist ein alter Mann mit lächerlich altmodischen Ansichten, und er versteift sich darauf, jeden einzelnen Handschlag, der hier getan wird, persönlich anzuordnen. Er überlässt nichts meinem Urteil!«
Kait schüttelte den Kopf und murmelte unverbindlich: »Ja, ja, das ist wirklich schlimm.«
»Wenn Yahmose nur ein bisschen mehr Mumm hätte und mir den Rücken stärkte, bestünde zumindest eine gewisse Hoffnung, meinen Vater zur Vernunft bringen zu können. Aber Yahmose ist ein Angsthase. Er befolgt jede Anweisung meines Vaters bis aufs i-Tüpfelchen.«
Kait ließ ein paar Glasperlen vor den Augen des Kindes klimpernd baumeln und murmelte: »Ja, das ist wahr.«
»Wegen der Sache mit dem Bauholz werde ich meinem Vater gleich nach seiner Rückkehr sagen, dass ich eine eigene Entscheidung getroffen habe. Es war weit besser, es sich in Flachs bezahlen zu lassen als in Öl.«
»Du hast bestimmt recht.«
»Aber mein Vater ist so darauf versessen, dass alles nach seinem Willen läuft, wie man überhaupt nur sein kann! Er wird ein gewaltiges Geschrei anstimmen und sagen: ›Ich hatte dir aufgetragen, das Geschäft in Öl abzurechnen. Kaum bin ich nicht da, läuft alles verkehrt. Du bist ein dummer Junge, der von nichts eine Ahnung hat!‹ Was glaubt er wohl, wie alt ich bin? Ihm ist nicht klar, dass ich ein Mann in den besten Jahren bin und er die seinigen längst hinter sich hat! Seine Anordnungen und seine starrsinnige Weigerung, die ausgetretenen Pfade auch gelegentlich zu verlassen, führen dazu, dass wir nicht annähernd so gute Geschäfte machen, wie wir eigentlich könnten. Reich wird nur, wer bereit ist, auch einmal Risiken einzugehen. Ich habe Weitblick und Mut. Mein Vater hat keines von beiden!«
Die Augen auf das Kind gerichtet, murmelte Kait leise: »Du bist so kühn und so klug, Sobek.«
»Aber diesmal wird er sich ein paar unbequeme Wahrheiten anhören müssen, wenn er es wagen sollte, an mir zu mäkeln und mich anzuschreien! Wenn er mir keine freie Hand lässt, gehe ich. Ich verlasse dieses Haus!«
Kait, die die Hand nach dem Kind ausgestreckt hatte, erstarrte in dieser Bewegung und drehte sich abrupt um.
»Du gehst? Wohin denn?«
»Egal wohin! Ich ertrage es nicht länger, von einem engstirnigen, aufgeblasenen alten Mann herumkommandiert und bemäkelt zu werden, der mir überhaupt keine Möglichkeit lässt, zu zeigen, wozu ich eigentlich fähig bin!«
»Nein!«, sagte Kait scharf. »Ich sage nein, Sobek!«
Er starrte sie an, von ihrem Ton plötzlich wieder an ihre leibliche Anwesenheit erinnert. Er war so daran gewöhnt, Kait lediglich als eine beruhigende akustische Untermalung seiner Selbstgespräche zu betrachten, dass er häufig vergaß, dass sie auch ein lebendiger, denkender Mensch war.
»Was meinst du damit, Kait?«
»Ich meine damit, dass ich dir nicht erlauben werde, dich wie ein Narr aufzuführen. Das ganze Gut gehört deinem Vater, der Boden, die Äcker, das Vieh, das Holz, die Flachsfelder – alles! Wenn dein Vater stirbt, wird es uns gehören – dir und Yahmose und unseren Kindern. Wenn du dich mit deinem Vater überwirfst und fortgehst, könnte er auf die Idee kommen, das, was eigentlich dir zustünde, zwischen Yahmose und Ipy aufzuteilen. Schon jetzt liebt er Ipy viel zu sehr! Ipy weiß das und nutzt es aus. Du darfst ihm nicht in die Hände spielen. Das käme ihm doch nur zupass, wenn du dich mit Imhotep zerstreiten und von hier weggehen würdest. Wir müssen an unsere Kinder denken.«
Sobek starrte sie an. Dann stieß er ein kurzes verwundertes Lachen aus.
»Eine Frau ist immer für eine Überraschung gut. Ich hatte keine Ahnung, dass du so kämpferisch sein kannst, Kait!«
Kait entgegnete ernst: »Streite dich nicht mit deinem Vater. Widersprich ihm nicht. Sei noch ein bisschen länger klug.«
»Vielleicht hast du recht – aber es könnte noch jahrelang so weitergehen. Mein Vater sollte uns zu Teilhabern machen.«
Kait schüttelte den Kopf.
»Das wird er nicht tun. Es gefällt ihm zu sehr, darauf hinweisen zu können, dass wir alle sein Brot essen, dass wir alle von ihm abhängig sind, dass wir ohne ihn gar nichts wären.«
Sobek betrachtete sie neugierig.
»Du magst meinen Vater wirklich nicht besonders, Kait.«
Aber Kait hatte sich wieder dem tapernden Kind zugewandt.
»Komm, Herzchen – schau, hier ist deine Puppe. Na komm, komm …«
Sobek blickte auf ihren gebeugten schwarzen Kopf hinunter. Dann wandte er sich mit einer ratlosen Miene von ihr ab und ging.
Esa hatte ihren Enkel Ipy zu sich rufen lassen.
Der Junge, ein hübsches, unzufrieden dreinschauendes Bürschlein, stand vor ihr, während sie ihn mit hoher, schriller Stimme ausschalt und ihn dabei mit Augen fixierte, die zwar nicht mehr viel sahen, aber klug und wissend waren.
»Was muss ich da hören? Du willst dies nicht machen und das nicht machen? Du willst die Stiere weiden, und du hast keine Lust, Yahmose zu begleiten oder die Feldarbeit zu beaufsichtigen? Was ist nur aus der Welt geworden, wenn ein Kind wie du selbst bestimmen will, was es tut oder nicht tut?«
Ipy entgegnete mürrisch: »Ich bin kein Kind. Ich bin jetzt erwachsen – warum sollte ich mich also wie ein Kind behandeln lassen? Diese oder jene Arbeit aufgetragen bekommen, ohne nach meiner Meinung gefragt zu werden und ohne eine eigene Zuwendung. Mich andauernd von Yahmose herumkommandieren lassen. Was bildet sich Yahmose eigentlich ein, wer er ist?«
»Er ist dein älterer Bruder, und er hat die Befehlsgewalt inne, wenn mein Sohn Imhotep abwesend ist.«
»Yahmose ist dumm, träge und dumm. Ich bin viel gescheiter als er. Und Sobek ist genauso dumm, auch wenn er ständig davon tönt und prahlt, wie gescheit er angeblich ist! Mein Vater hat schon geschrieben und gesagt, ich sollte mir selbst aussuchen dürfen, welche Arbeit ich übernehme …«
»Also gar keine«, warf die alte Esa ein.
»Und dass ich mehr zu essen und zu trinken bekommen soll und dass, wenn er erfährt, dass ich unzufrieden bin und man mich nicht gut behandelt hat, er sehr zornig werden wird.«
Er lächelte, während er das sagte – ein listiges und selbstgefälliges Lächeln.
»Du bist ein verzogener Balg«, sagte Esa mit Nachdruck. »Und das werde ich Imhotep auch genau so sagen!«
»Nein, nein, Großmutter, das tust du bestimmt nicht.«
Sein Lächeln veränderte sich, es wurde einschmeichelnd, wenn auch immer noch etwas frech.
»Du und ich, Großmutter, wir sind die Einzigen in der Familie, die etwas im Kopf haben.«
»Was nimmst du dir heraus!«
»Mein Vater verlässt sich auf dein Urteil – er weiß, dass du weise bist.«
»Das mag sein – es ist tatsächlich so –, aber ich habe es nicht nötig, dass du mich darauf hinweist.«
Ipy lachte.
»Du solltest dich besser auf meine Seite stellen, Großmutter.«
»Was ist das für ein Gerede von Seiten?«
»Die großen Brüder sind sehr unzufrieden, weißt du das nicht? Natürlich weißt du’s. Henet erzählt dir ja alles. Satipy putzt Yahmose Tag und Nacht herunter, wann immer sie ihn zu fassen kriegt. Und Sobek hat sich beim Verkauf des Holzes übervorteilen lassen und hat jetzt Angst, dass mein Vater vor Wut schäumen wird, sobald er davon erfährt. Verstehst du, Großmutter, noch ein, zwei Jahre, und ich werde der Teilhaber meines Vaters sein, und er wird alles tun, was ich möchte!«
»Du, der Jüngste in der Familie?«
»Was spielt das Alter für eine Rolle? Mein Vater ist derjenige, der die Macht besitzt – und ich bin derjenige, der weiß, wie mein Vater zu lenken ist!«
»Das ist übel gesprochen«, sagte Esa.
»Du bist keine Närrin, Großmutter«, sagte Ipy leise. »Du weißt ganz genau, dass mein Vater, trotz all seiner großen Sprüche, in Wirklichkeit ein schwacher Mann ist …«
Er verstummte abrupt, als er bemerkte, dass Esa den Blick von ihm abgewandt hatte und über seine Schulter hinweg starrte. Er drehte sich um und sah, dass Henet dicht hinter ihm stand.
»Imhotep ist also ein schwacher Mann?«, sagte Henet mit ihrer weichen, weinerlichen Stimme. »Er wird, glaube ich, nicht erfreut sein zu hören, dass du so über ihn gesprochen hast.«
Ipy lachte befangen auf.
»Aber du wirst es ihm nicht sagen, Henet … Komm schon, Henet – versprich es mir … liebe Henet …«
Henet glitt auf Esa zu. Sie sprach jetzt lauter, aber mit derselben leicht weinerlichen Stimme.
»Natürlich ist es nie meine Absicht, Unruhe zu stiften – das weißt du … Ich bin euch allen zugetan. Ich gebe Gehörtes niemals weiter – außer ich habe das Gefühl, dazu verpflichtet zu sein …«





























