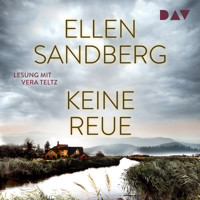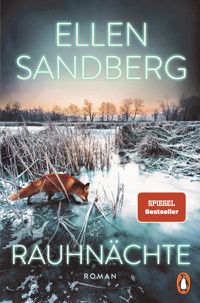
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kalte Nächte, alte Geheimnisse, dunkle Gefahren
„Sie darf das nie erfahren. Du hast es mir versprochen!“ Wie ein Faustschlag trifft dieser Satz die 22-jährige Pia an Heiligabend, als sie ein Streitgespräch ihrer Eltern belauscht. Als sie kurz darauf herausfindet, dass sie mit vier Jahren adoptiert wurde, bricht ihre bis dahin gekannte Welt vollends zusammen. Schon ihr Leben lang fühlte sie sich anders, seltsam fremd, als ob ein Tabu sie umgibt. Nun scheint all das bestätigt. Auf der Suche nach Antworten fährt Pia nach Wasserburg am Inn, dem Heimatort ihrer leiblichen Mutter. Der Raureif hängt tief in den winterlichen Inn Auen und durch das mittelalterliche Städtchen tanzen schauerliche Gestalten, die nach altem Brauch die Geister vertreiben sollen. In den Rauhnächten, so sagt man, drängen alte, gut gehütete Geheimnisse wieder an die Oberfläche. Und je näher Pia der Wahrheit über ihre Mutter kommt, desto enger ziehen die Geister der Vergangenheit ihre Kreise um sie. Bis Pia in tödlicher Gefahr schwebt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kalte Nächte, alte Geheimnisse, dunkle Gefahren: Atmosphärische Spannung von der SPIEGEL-Bestsellerautorin
»Sie darf das nie erfahren. Du hast es mir versprochen!« Wie ein Faustschlag trifft dieser Satz die 22-jährige Pia an Heiligabend, als sie ein Streitgespräch ihrer Eltern belauscht. Als sie kurz darauf herausfindet, dass sie mit vier Jahren adoptiert wurde, bricht ihre bis dahin gekannte Welt vollends zusammen. Schon ihr Leben lang fühlte sie sich anders, seltsam fremd, als ob ein Tabu sie umgibt. Nun scheint all das bestätigt. Auf der Suche nach Antworten fährt Pia nach Wasserburg am Inn, dem Heimatort ihrer leiblichen Mutter. Der Raureif hängt tief in den winterlichen Innauen, und durch das mittelalterliche Städtchen tanzen schauerliche Gestalten, die nach altem Brauch die Geister vertreiben sollen. In den Rauhnächten, so sagt man, drängen alte, gut gehütete Geheimnisse wieder an die Oberfläche. Und je näher Pia der Wahrheit über ihre Mutter kommt, desto enger ziehen die Geister der Vergangenheit ihre Kreise um sie. Bis Pia in tödlicher Gefahr schwebt …
Ellen Sandberg arbeitete zunächst in der Werbebranche, ehe sie sich ganz dem Schreiben widmete – mit riesigem Erfolg: Ihre psychologischen Spannungs- und Familienromane, die immer monatelang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stehen und denen immer ein wichtiges Thema unserer deutschen Vergangenheit zugrunde liegt, bewegen und begeistern zahllose Leserinnen und Leser – wie zuletzt »Das Geheimnis«, »Das Unrecht« und »Keine Reue«. 2022 wurde ihr der Verfassungsorden des Freistaats Bayern verliehen. Unter ihrem bürgerlichen Namen Inge Löhnig veröffentlicht sie erfolgreiche Kriminalromane.
»Ein Familienroman voller psychologischer Abgründe um Ereignisse aus der Vergangenheit.« Bild der Frau über »Die Schweigende«
»Meisterhafte Erzählkunst verbindet sich bei dieser Autorin mit psychologischer Spannung.« Süddeutsche Zeitung
»Ellen Sandberg versteht es, in ihren spannenden Familienromanen meisterlich, glaubwürdige und authentische Figuren zu erschaffen. Sie recherchiert genau und legt größten Wert auf Detailtreue.« Merkur.de
www.penguin-verlag.de
ELLEN SANDBERG
RAUHNÄCHTE
ROMAN
Diesem Buch liegt ein früherer Roman der Autorin Inge Löhnig zugrunde, der bereits 2014 unter dem Titel »Die Flammen flüstern dein Lied« im Arena Verlag erschienen ist. Die Geschichte wurde für diesen Roman durch die Autorin von Grund auf überarbeitet.
Der Verlag dankt Ilona Picha-Höberth und Gerhard Höberth für die freundliche Genehmigung, die Geschichte »Fuxerl« mitsamt den Illustrationen im Anhang abzudrucken.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Dieses Buch wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München.
Umschlaggestaltung: Favoritbuero
Umschlagabbildungen: Shutterstock / Bernulius / Ervin-Edward
Trevillion Images / © Michal Affanasowicz
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-33368-3V001
www.penguin-verlag.de
Prolog
Sie spürte die Gefahr im Schlaf. Ein sanftes Streicheln, ein leichtes Prickeln auf der Haut. Ein kaum wahrnehmbares Knistern und Knacken, das sich anschlich und den Geruch von Rauch und Asche mit sich brachte.
Wach auf!
Murmelnd drehte sich die Kleine auf die Seite. Sie träumte, sie sei bei den Silberfeen und bekäme Flügel geschenkt. Vorsichtig bewegte sie die hauchdünnen Gebilde auf ihrem Rücken. Sie waren zart und durchscheinend und eigens für sie gemacht.
Ein sachter Wind schob eine Wolke vor die Sonne. Zwielicht sickerte in die Traumwelt, und es wurde empfindlich kühl. Das sanfte Brausen verdichtete sich zu einem Raunen und Wispern. Wach auf! Drängend, besorgt. Wach auf!
Furchtsam blickten die Feen zum Saum des Waldes, aus dem eine Horde Trolle stürzte. Schnaubend kamen sie näher. Die Kleine wollte davonlaufen, sie wollte zu ihrer Mutter. Doch mit ihren Blicken bannten die Trolle sie an ihren Platz. Ihr Mund wurde trocken, die Hände schweißfeucht. Ein Schrei löste sich.
»Mama!«
Keuchend wachte die Kleine auf. Ihr Herz raste. Das Haar klebte schweißfeucht an der Stirn. »Mama!« Mit zitternden Fingern tastete sie nach der Nachttischlampe. Doch die Hand griff ins Leere. Da war nichts. Kein Nachttisch, keine Lampe, kein Schalter.
Das Brüllen des Sturms drang in ihr Bewusstsein und fachte die Angst weiter an, während der Wind ums Haus pfiff und an den alten Balken rüttelte, die ihm ächzend Antwort gaben. Fauchend fuhr er in den Kamin und unter die Fensterläden, bis sie in den Angeln quietschten. Die Furcht fraß sich durch das Innerste der Kleinen. Sie wollte schreien, doch nur ein Flüstern kam heraus. »Mama!«
Schatten umtanzten sie. Waren die Trolle etwa mit ihr aus der Traumwelt gekommen? Wo blieb Mama? Sie kam doch sonst sofort, wenn sie rief.
Formen schälten sich aus der Dunkelheit. Eine Kommode, der Schaukelstuhl, und sie erkannte, dass sie nicht in ihrem Bett lag, sondern in der Villa Lavanda war, dem ehemaligen Waschhaus, das Mama als Spielhaus für sie eingerichtet hatte. Jetzt fiel es ihr wieder ein: Mama war böse gewesen. Deshalb hatte das Mädchen sie bestraft und war hinaus in die weite Welt gezogen.
Das Flackern wurde stärker. Schemen tanzten an der Wand. Es waren nicht die Trolle aus ihrem Traum, sondern andere. Stumme Gesellen. Lautlos stampften und torkelten sie durcheinander, hin und her, auf und nieder. Ihr Schweigen war schauriger als jedes Gebrüll.
Angst erstickte den Ruf nach ihrer Mutter. Sie wollte sich zu ihr ins Bett kuscheln und ihren beruhigenden Worten lauschen. Doch Mama war drüben im Haus. Sie musste also alleine vor diesen unheimlichen Kerlen fliehen. Pah, das würde ihr schon gelingen. Schließlich hatte Mama gesagt, dass sie mutig und tapfer sei. Sie würde die Trolle in die Flucht schlagen. Doch wie? Sie waren in der Übermacht und würden sie fressen.
Plötzlich hatte sie eine Idee: Sie musste nur die Augen fest zusammenkneifen, dann konnten die Spukgestalten sie nicht sehen, weil sie sie ja auch nicht sah. Und dann schnell die Stufen hinunter zur Tür und über den Hof ins Haus laufen. Das würde sie schaffen und dem Gesindel die Tür vor der Nase zuknallen und den Schlüssel herumdrehen.
Zögerlich stand das Mädchen auf und presste die Kuscheldecke an sich. Während sie mit den Füßen nach den Hausschuhen hangelte, drang die Kälte durch den Schlafanzug und vertrieb die Wärme des Bettes. Jetzt war sie ganz wach, nahm ihren Mut zusammen, kniff die Augen zu, holte Luft und lief los. Die Sohlen glitten über das glatte Holz. Bei den Stufen musste sie dann doch ein wenig blinzeln. Unten verhedderte sie sich im Flickenteppich. Mit einem Schrei fiel sie auf den Boden und presste die Augenlider fest zu. Doch während sie sich aufrappelte, wagte sie einen raschen Blick zu den lautlosen Gesellen, die sie nicht bemerkten, und lief weiter. Ihr Atem flog, das Herz schlug pochend gegen die Rippen. Die ausgestreckten Hände trafen auf die Tür und zogen sie auf. Sie hatte es geschafft! Jubel stieg in ihr auf. Der Sturm entriss ihr die Tür, schlug sie krachend gegen die Hauswand, griff nach ihren Haaren, zerrte mit Eisfingern daran, wirbelte weiße Atemfahnen in die Winternacht, als wäre er ein lebendiges Wesen. Plötzlich erinnerte sie sich, was die Alten erzählten. Wie angewurzelt blieb das Mädchen stehen.
In Nächten wie diesen war die wilde Jagd unterwegs. Sie zog übers Land und fing die verlorenen Seelen ein. Das Mädchen wollte nicht gefangen werden und sah sich um. Zurück konnte sie nicht. Hinter ihr lauerten die stummen Gesellen. Sie musste also weiter und lief los.
Die Hausschuhe gaben ihren Füßen kaum Halt und rutschten auf dem harschigen Schnee. Sie kam nur stolpernd voran und bemerkte, dass der rote flackernde Schein hier draußen tausend Mal stärker war als im Häuschen. Auch knisterte und knackte es, als ob die Geister in den alten Bäumen erwacht wären. Doch es waren keine Geister. Der Sturm fegte Hitze und Rauch zu ihr. Es war Feuer. Das Haus brannte. Gierige rote Zungen schlugen mit heißem Atem aus den Fenstern, leckten an den Balken, spien Rauch in die Nacht. Der Sturm spielte mit dem Feuer, als wäre das alles ein großer Spaß, ein irrsinniges, übermütiges Spiel. Er ließ Funken in den Nachthimmel stieben und gleich darauf wieder herabregnen, leuchtend und glitzernd, bevor sie verlöschten. Er ließ krachend das Fensterglas zu tausend Scherben bersten, fuhr prustend in die Flammen und fachte das Feuer weiter an.
Die Kleine wollte schreien und konnte nicht. Angst saß wie ein Pfropfen in ihrer Kehle und verschloss sie. Wo war Mama?
Da entdeckte sie eine Silhouette unter dem Baum. Der Korken löste sich, ploppte heraus. Schluchzend lief sie los. Tränen rannen die Wangen hinab. Noch nie hatte sie so große Angst gehabt. Und noch nie war sie so froh gewesen, ihre Mama zu sehen. »Mama! Mama!« Im Laufen breitete sie die Arme aus, bereit, sich in die ihrer Mutter zu werfen, ihre schützende Wärme zu spüren. Alles ist gut, Schatz. Es ist doch alles gut! Sie konnte die erlösenden Worte beinahe schon hören, wie das Murmeln des Bachs im Frühling. Alles ist gut, mein Engel.
Auf einer Eisplatte rutschte sie aus, schlug mit dem Kopf auf den Boden und blieb benommen einen Moment liegen. Ihre Mutter würde gleich bei ihr sein. Doch sie kam nicht. Zitternd stand das Mädchen auf. Etwas lief ihr übers Gesicht. Es war warm und klebrig. Es war Blut. »Mama!«
24. Dezember 2019
Pia Winter wurde an diesem Weihnachtsmorgen vom Rauschen des Regens geweckt. Der Wind trieb ihn gegen die Scheiben, an denen er herablief, bis er schließlich auf das Fensterblech der Altbauwohnung in München Haidhausen tropfte. Es war ein regelmäßiges Klopfen, das Pia einen Moment des Unbehagens bereitete. Wie ein schlechtes Omen, als poche Unheil an. Dieses Gefühl wollte sich in ihr ausbreiten wie eine Schmutzlache. Pia stemmte sich dagegen, atmete entschlossen durch und setzte sich auf. Alles war gut!
Der unheimliche Moment ging vorüber, doch eine leichte Beklommenheit blieb zurück. Aus der Küche drang das Klappern von Geschirr und aus dem Bad das Surren des Rasierapparats ihres Vaters. Pia warf einen Blick aufs Smartphone, zog die Bettdecke wieder hoch und genoss es, Ferien zu haben. Wie früher zu Schulzeiten.
Ihr Abi hatte sie im Mai vorletzten Jahres gemacht. Seither drängte ihre Mutter sie, sich einen Studienplatz zu suchen. Allerdings konnte Pia sich nicht entscheiden, ob sie Sozialpädagogik studieren wollte oder doch lieber Kunstgeschichte. Kunst faszinierte sie. In Ausstellungen konnte sie sich regelrecht verlieren. Manchmal versank sie völlig in sich, beim Betrachten von Gemälden und Skulpturen, von Fotografien und Installationen. Sie fachten ihre Fantasie an, vorausgesetzt, sie berührten ihre emotionale Seite. Häufig brachten sie etwas in ihr zum Klingen, und manchmal erschienen sie ihr wie ein Echo ihrer Seele. Oder wie ein Spiegel ihrer Unsicherheit und Zerrissenheit.
Doch gegen ein Studium der Kunstgeschichte sprachen die schlechten beruflichen Aussichten. Ihre Mutter hatte von einem Orchideenfach gesprochen und vorgeschlagen, Pia solle etwas Aussichtsreicheres studieren. Maschinenbau wäre gefragt und natürlich Wirtschaft. BWL beispielsweise, wofür sich Pias Freundin Tami entschieden hatte. Doch Pia interessierte sich weder für Maschinenbau noch für BWL. Neben Kunstgeschichte kam für sie eigentlich nur Sozialpädagogik infrage. Sie konnte sich vorstellen, dass ihr die Arbeit mit Menschen dabei helfen würde, ihre eigene Unsicherheit zu überwinden. »Ein Studium als Therapie?«, hatte Tami gefragt. »Denkst du, das ist richtig?«
Da Pia sich unsicher war, hatte sie erst mal einige Praktika in verschiedenen Galerien und bei Kunstprojekten absolviert und sich dann in diesem Sommer für den Bundesfreiwilligendienst gemeldet. Seit September arbeitete sie als Schulbegleiterin für Kinder mit Handicap und Unterstützungsbedarf in einer inklusiven Ganztagsschule. Die Arbeit mit den Kindern machte ihr Freude, obwohl sie anstrengend war und sie jeden Abend völlig erledigt nach Hause kam. Noch hatte sie sich an diese Belastung nicht gewöhnt und war daher dankbar, bis nach Heilig Drei König Ferien zu haben.
Eine Böe klatschte die nächste Ladung Wasser gegen die Fenster. Weiße Weihnachten fielen aus, wie beinahe jedes Jahr. Mit ihren beinahe zweiundzwanzig Jahren konnte Pia sich nur an zwei oder drei Weihnachten erinnern, an denen es an den Feiertagen in München geschneit hatte. Meistens hatte die weiße Pracht nur Stunden später matschig und grau an den Straßenrändern gelegen. Mit dieser Erinnerung stellte sich das Unbehagen wieder ein. Wie eine seismische Schwingung, die Unheil ankündigte. Pia atmete durch und schob das unangenehme Gefühl erneut beiseite. Sie glaubte nicht an Vorzeichen oder Ahnungen, und doch blieb ein schaler Nachgeschmack zurück. Etwas würde geschehen.
Sie drehte sich auf die Seite und bemühte sich, an etwas andres zu denken. Schnee wäre natürlich das Sahnehäubchen auf den Bemühungen ihrer Mutter, die Feiertage perfekt zu gestalten. Die Wohnung war schon seit Wochen weihnachtlich dekoriert. Sogar im Bad hing eine Lichterkette und auch auf dem Gäste-WC. Als könnten jederzeit Redakteure einer Wohnzeitschrift hereinschneien für eine Reportage mit der Headline: Wundervolle Festtage bei Familie Winter!
Mit einem leisen Bing ging eine WhatsApp ein. Sie kam von Tami, ihrer besten Freundin. Genau genommen Pias einziger Freundin. Denn sie war seit jeher eine Einzelgängerin und stand lieber am Rand als im Mittelpunkt. War lieber Beobachterin als jemand, der alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Eigentlich hatte sie kein Problem damit. Nur manchmal, wenn sie sich wünschte, besser auf Leute zugehen zu können, schlagfertig zu sein und humorvoll und vor allem spontaner. So wie Tami.
Schon wach?, fragte ihre Freundin.
So halb.
Magst du facetimen?
Gerne.
Eine Sekunde später klingelte ihr Handy, und Tamis Gesicht erschien auf dem Display. Pia steckte sich ein Kissen in den Rücken und nahm den Videocall an.
Vermutlich hatte Tami Ärger mit ihrer Mutter, weil es gestern ziemlich spät geworden und sie erst um drei Uhr nachts nach Hause gekommen waren. Für Tamis Mutter war das viel zu spät. Sie behandelte ihre Tochter immer noch, als wäre sie ein Kind und nicht eine junge Frau von einundzwanzig Jahren. Sicher lag es daran, dass sie seit dem Unfalltod von Tamis Vater überall Gefahren sah und ihre Tochter überbehütete. Kein Wunder, dass Tami das Hotel Mama schnellstmöglich verlassen wollte und ein WG-Zimmer suchte.
Ihre dunklen Haare waren vom Schlaf verstrubbelt, in ihren Koboldaugen tanzten jedoch bereits freche Funken. »Moin. Alles gut?« Tami stammte aus Cuxhaven und hatte das Moin nie gegen ein typisches Münchner Grüß dich oder Servus eingetauscht.
»Bei mir schon, und bei dir?«
Ihre Freundin seufzte. »Mama hat sich wieder einmal unnötig Sorgen gemacht.« Tami berichtete, dass ihre Mutter kurz davor gewesen war, die Krankenhäuser abzutelefonieren. Denn sie konnte nicht schlafen, wenn ihr einziges Kind unterwegs war, und malte sich die schlimmsten Sachen aus.
Pia fand das nicht normal und meinte, es wäre wohl besser, wenn Tami künftig ihr Handy anließ. Doch ihre Freundin wollte sich von ihrer Mutter nicht kontrollieren lassen und erklärte, dass sie die Suche nach einem WG-Zimmer jetzt vorantreiben würde. »Das muss endlich mal klappen. Und bei dir?«
»Ich glaube, meine Eltern haben gar nicht bemerkt, wann ich heimgekommen bin.«
»Beneidenswert.«
Einerseits, dachte Pia. Doch andererseits wäre es schön, wenn sie sich mal Sorgen um mich machen würden.
Ihren Eltern gelang es nur selten, ihre Gefühle zu zeigen. Alles wurde auf einer rationalen Ebene abgehandelt. Sogar wenn es mal Streit gab, lief der zivilisiert ab. Was im Grunde nicht verkehrt war.
Tami fragte, ob sie sich am Nachmittag treffen könnten, und sie verabredeten sich für drei im Café Mozart.
Pia legte das Handy auf den Nachttisch und zog die Decke wieder hoch, um noch ein wenig zu dösen. Doch es gelang ihr nicht. Die Feiertage lagen ihr im Magen. Eigentlich hatte sie keine Lust darauf.
Wie immer würde alles perfekt sein. Der Baum wunderbar geschmückt. Das Essen aufwendig und die Geschenke teuer und hübsch verpackt. Nur ein Fest der Liebe würde es nicht werden. Das war es noch nie gewesen. Denn wenn eines fehlte in dieser vollkommenen Familie in ihrer vollkommenen Wohnung, dann Liebe. So kam es Pia jedenfalls oft vor. Sie existierte nur an der Oberfläche. Freundliche Worte, die eher Floskeln waren und Gleichgültigkeit kaschierten. Nach außen war alles in Ordnung, doch im Innersten fehlte etwas. Wie bei einer Schüssel mit Sprung, die einen falschen Klang hatte. Und Pia befürchtete, dass das mit ihr zusammenhing.
Plötzlich fröstelte sie und zog die Decke enger um sich. Etwas stimmte nicht mit ihr. Sie spürte es schon ihr Leben lang. Es gab einen dunklen Schatten, der in einer Ecke lauerte und sich anschlich, wenn sie nicht aufpasste. So wie jetzt.
Pia schwang die Beine aus dem Bett. Es war Zeit, ins Bad zu gehen. Ihr Vater kam ihr im Flur entgegen. Er trug eine Cordhose und einen Pulli mit Zopfmuster, unter dem sich ein kleiner Bauch wölbte. Wieder einmal erinnerte er Pia an einen gemütlichen Bären. Sie fand, dass ihm saloppe Kleidung viel besser stand als die Anzüge, die er in der Firma tragen musste. »Na, schon ausgeschlafen, obwohl die Nacht so kurz war?«, fragte er mit einem Augenzwinkern. Er hatte also doch bemerkt, wann sie nach Haus gekommen war.
»Nicht wirklich«, antwortete sie und ging ins Bad. Der morgendliche Blick in den Spiegel zeigte ihr das altbekannte Bild. Ein wenig farblos kam es ihr vor, wie ein ausgeblichenes Aquarell. Von blonden Wimpern eingerahmte hellblaue Augen, die Augenbrauen von derselben Farbe wie ihre kupferroten Locken, die sich kaum bändigen ließen und ihren Kopf wie eine vom Wind zerzauste Wolke umgaben. Sommersprossen bedeckten ihren blassen Teint. Das Einzige, das sie an sich hübsch fand, war ihr Mund. Schön geschwungene, volle Lippen und eine schmale Nase, die etwas geradezu Aristokratisches hätte, wenn ihre Spitze sich nicht nach oben biegen würde und ihr so einen kecken Ausdruck verlieh. Was einer glatten Lüge gleichkam, denn sie war weder keck noch wortgewandt oder witzig.
Ihre roten Haare hatte sie noch nie sonderlich gemocht, doch seit Sebastian … Sie atmete scharf aus. »Vergiss ihn endlich!«, sagte sie zu ihrem Spiegelbild. »Lösch ihn aus deinem Gedächtnis.« Doch so einfach war das nicht. Der Stachel saß zu tief.
Nach dem Duschen griff sie zur Bürste, um die Locken zu bändigen. Fuchsrot nannte Oma sie. Du bist ein Fuchserl. Diese Bemerkung fiel Pia wieder ein. Sie legte die Bürste beiseite und sah sich im Spiegel forschend an. Wieder einmal stieg das Gefühl in ihr auf, anders zu sein, nicht dazuzugehören. Und sie hatte keine Ahnung, woher es kam.
*
Als Pia zum Frühstück in die Wohnküche kam, saßen ihre Eltern bereits am Tisch. Am Adventsgesteck brannten alle Kerzen. Es duftete nach Kaffee und Pias Chai Tee, nach Croissants und Rosinenbrötchen. Die Gläser waren mit frisch gepresstem Orangensaft gefüllt, und eine Schale mit Obst stand auf dem Tisch.
Mit Block und Stift saß ihre Mutter an ihrem Platz am Fenster, gegen das der Regen trommelte, und sah auf, als Pia eintrat. »Was für ein Wetter. Und das an Weihnachten. Ostern sitzen wir dann wieder im Schnee.«
»Der Wetterbericht kündigt für morgen leichten Schneefall an«, erwiderte Paps und hob kurz den Blick vom iPad.
Mama wandte sich wieder ihren Notizen zu. Vermutlich legte sie eine ihrer To-do-Listen an, in denen sie festhielt, wie sie die anstehenden Aufgaben am effektivsten auf die Reihe bekam. Der Stift wippte zwischen ihren schmalen Fingern.
Wenn ihr Vater ein kuscheliger Bär war, was war dann ihre Mutter? Ein fleißiges Eichhörnchen? Bei diesem Gedanken musste Pia lächeln. Mamas rotbraune Haare waren zu einem kinnlangen Bob geschnitten. Sie war schlank und drahtig vom Judo. Auch darin war sie perfekt und sogar einmal Bayerische Meisterin in ihrer Altersklasse gewesen. Vor allem aber war sie flink und tatkräftig. Eichhörnchen passte also. Pia setzte sich. Ihre Mutter sah noch immer gut aus. Niemand würde glauben, dass sie bereits siebenundfünfzig war.
Paps hatte das iPad neben sich liegen und las Nachrichten. Sein dunkles Haar wurde allmählich grau. Seit Kurzem brauchte er eine Lesebrille, die er nun auf die Stirn schob. »Hilfst du mir nachher beim Baumschmücken?«
»Natürlich. Das ist doch Tradition.« Solange Pia denken konnte, half sie ihm dabei. Mama erzählte oft, dass das an einem ebenso verregneten Weihnachtstag begonnen hatte wie dem heutigen. Sie musste fünf Jahre oder sechs Jahre alt gewesen sein. Es goss wie aus Kübeln. Unmöglich, einen Spaziergang zu machen, trotzdem versuchte Paps, den Baum heimlich zu dekorieren, bis Pia der Bewachung ihrer Mutter entkommen war und ihn erwischte. Seither durfte sie ihm helfen. Ein Privileg, das endlich weihnachtliche Gefühle in ihr weckte und diesen tristen Tag in freundlicherem Licht erscheinen ließ.
Ihre Mutter legte den Stift beiseite. »Gut geschlafen?«, fragte sie, doch ihr Blick erreichte Pia nicht. Sicher war sie mit ihren Gedanken bei den restlichen Vorbereitungen für den Tag.
»Nicht wirklich.«
Mama nickte nur und ging darauf nicht weiter ein. Ob sie sich in ihrem Job auch so zerstreut und abgelenkt verhielt? Vermutlich nicht. Sie war Grundschullehrerin. Da musste sie bei der Sache sein, sonst würden ihr die Kinder auf der Nase herumtanzen. Doch niemand tanzte ihrer Mutter auf der Nase herum.
Pia bestrich ein Rosinenbrötchen mit Nutella und trank dazu ihren Chai Tee, während sie den Blick durch die Küche wandern ließ. Edel ramponierter Landhausstil, den Mama auf Weihnachten gestylt hatte. Rot lackierte Elche auf dem Fensterbrett. Christbaumkugeln in hohen Gläsern. Kerzenleuchter und Windlichter auf Tisch, Fensterbrett und der Kommode. In dieser Menge war das zu viel. Die Küche sah aus wie ein Geschäft für Weihnachtsdeko.
Während sie ihr Rosinenbrötchen aß, fiel ihr die Stille auf, die zwischen ihren Eltern herrschte. Es war nicht das gewohnte Schweigen, wenn sie in Gedanken versunken waren oder Online-Nachrichten lasen, sondern eine beinahe mit Händen zu greifende, kühle Stille, als hinge etwas unausgesprochen in der Luft. Mit einem Mal war das Unbehagen wieder da, das sie vorhin im Bett gestreift hatte. Wie ein böses Omen. Etwas würde geschehen. Ein flaues Gefühl legte sich in ihre Magengrube, das auch nicht wich, als Pia nach dem Frühstück das Geschenk für Tami verpackte. Eine Beanie-Mütze, die sie selbst gestrickt hatte. Danach half sie ihrem Vater beim Baumschmücken. Wie jedes Jahr schob er eine CD mit kitschigen Weihnachtsliedern in den Player. Doch diesmal sang er nicht mit, wie er es sonst tat. Ihr Eindruck hatte sie also nicht getäuscht. Es herrschte dicke Luft zwischen ihren Eltern. Woran es wohl lag? Pia hatte keine Vermutung, und sie fragte auch nicht, was los war, und spielte so das Spiel ihrer Eltern vom perfekten Weihnachtsfest mit. Und darüber ärgerte sie sich. Allerdings nur ein wenig, denn auch sie legte keinen Wert auf Streit.
Auf dem Diensthandy ihres Vaters ging mit einem Signalton eine Nachricht ein. Immer war er für die Firma erreichbar. Mama hasste das. In diesem Moment verstand Pia sie. Konnte er nicht mal an Weihnachten ein Privatleben haben? Offenbar nicht, wenn man ein auf Sicherheitssoftware spezialisiertes Unternehmen leitete. Denn er las die Nachricht sofort und beantwortete sie.
Pia verlor die Lust aufs Baumschmücken und verließ das Wohnzimmer. Sie waren ohnehin fast fertig, und die Christbaumspitze konnte Paps auch ohne sie aufstecken.
Auch beim Mittagessen besserte sich die Stimmung nicht. Mehr oder weniger schweigend aßen sie Weißwürste mit süßem Senf und Brezen. Auch das war Tradition. Doch Pia war froh, der angespannten Stimmung zu entkommen, als sie sich nach dem Essen auf den Weg ins Café Mozart machte, um Tami zu treffen.
Sie zog die Winterjacke an, steckte das Geschenk ein und fuhr mit dem Lift nach unten. Der Regen hatte nachgelassen. Es nieselte nur noch. Am Haus gegenüber erklomm seit Wochen ein aufblasbarer, überlebensgroßer Nikolaus die Fassade, ohne einen Zentimeter vorangekommen zu sein. Heute hing er nass und schlaff im Seil, wie erhängt. Auf der Rolltreppe zum S-Bahnhof Rosenheimer Platz kam Pia ein grölender Penner entgegen. »Last Christmas I gave you my heart«, brüllte er ihr ins Gesicht. Erschrocken wich sie ihm aus. Über dem Weihnachtsmarkt am Sendlinger-Tor-Platz schwebte eine Duftwolke aus gebrannten Mandeln und Bratwürsten. Während ein paar Passanten noch Maroni und Waffeln aßen, begannen die Standbesitzer, ihre Buden dichtzumachen. Die Mülleimer quollen von ketchupverschmierten Papptellern und Dosen über, aus denen Getränkereste in die Pfützen tropften. Seit sie das Haus verlassen hatte, rutschte in Pias Kehle Schritt für Schritt ein Klumpen tiefer. Alles war so unweihnachtlich. Das Wetter. Die Menschen. Die überdekorierten Schaufenster und die überquellenden Abfalleimer. Pias Laune hatte den Tiefpunkt erreicht, als sie das Café Mozart betrat.
Drinnen war es gemütlich warm. Eine Indie-Pop-Playlist lief, und an ihrem Lieblingsplatz in der Ecke saß bereits Tami. »Ich habe einen Chai Tee für dich bestellt. War doch okay?«
»Prima.« Sie umarmten sich, und Pia reichte Tami ihr Geschenk. »Aber erst heute Abend auspacken.«
»Du aber auch.« Mit diesen Worten drückte Tami ihr ein Päckchen in die Hand. »Frohe Weihnachten, Pia. Das ist von mir. Und das ist von meiner Mutter.« Tami zog eine Dose mit Weihnachtsgebäck aus einer Stofftasche.
Während Pia die Dose entgegennahm, pirschte sich das Unbehagen vom Morgen erneut an.
»Alles in Ordnung?«, fragte Tami. »Du wirkst verärgert.«
»Geht schon.«
Tami stützte das Kinn in die Hand. »Was ist denn los?«
Einen Moment zögerte Pia. »Ich weiß nicht … Meine Eltern … Sie benehmen sich seltsam.«
»Wie meinst du das?«
»Ich kann das nicht beschreiben. Irgendwie liegt Streit in der Luft.«
»Ausgerechnet an Weihnachten. Magst du mit uns feiern?«
Einen Moment spielte Pia mit dem Gedanken, die Einladung anzunehmen. Doch das würde Mama nie zulassen. Die fabelhafte Familie Winter an Weihnachten nicht vereint. Unvorstellbar. »Vielleicht bilde ich mir das auch ein.«
Die Bedienung brachte die Getränke und kassierte gleich ab. Das Café schloss in einer halben Stunde. Alle wollten nach Hause zu ihren Lieben.
»Woran liegt es?«, fragte Tami.
»Du meinst die dicke Luft?« Pia zog die Schultern hoch. »Keine Ahnung. Die beiden streiten ja nicht. Jedenfalls nicht in meiner Anwesenheit. Und vermutlich auch nicht, wenn sie allein sind. Wenn es mal einen Schlagabtausch gibt, dann nur mit wohlgesetzten Worten. Sie fressen alles in sich hinein, bis sie eines Tages platzen.« Erst jetzt merkte Pia, wie verärgert sie war. »Lassen wir das Thema. Schließlich ist Weihnachten. Das Fest der Liebe. Apropos Liebe …?« Nun war sie diejenige, die das Kinn in die Handfläche stützte und Tami abwartend ansah.
Tami hatte eine Schwäche für Tobias, der seit einigen Monaten Mitglied im Alpenverein war und denselben Kletterkurs besuchte wie sie. Doch sie traute sich nicht, den ersten Schritt zu machen, weil sie vermutete, dass er eine Freundin hatte, und sie sich nicht dazwischendrängen wollte.
Jetzt verzog sich ihr Mund zu einem Lächeln. »Von Silvester bis zum Dreikönigstag veranstaltet der Verein einen Tiefschneekurs für Fortgeschrittene in Tirol. Tobi ist dabei, und zwar allein. Er hat keine Freundin. Das Mädchen, mit dem ich ihn gesehen habe, ist seine Schwester.«
»Tolle Neuigkeiten.«
»Es kommt noch besser. Rate mal, wer den letzten freien Platz bekommen hat?«
»Du meinst im Tiefschneekurs?«
»Yep.«
»Du etwa? Du kannst doch gar nicht Skifahren.«
»Dann lerne ich es eben.«
»Das ist ein Fortgeschrittenenkurs. Und noch dazu Tiefschnee. Das ist nichts für Anfänger.«
»Mehr als hinfallen kann ich nicht.«
»Doch. Alle Knochen brechen.«
Tami wischte diesen Einwand beiseite. »Nicht in weichem Pulverschnee. Ich brauche noch eine Ausrüstung. Vielleicht leiht mir meine Cousine ihre Carver.« Tami hatte noch nie auf Skiern gestanden. Da sie schon von Kindesbeinen an kletterte, war sie nach dem Umzug von Cuxhaven nach München dem Alpenverein beigetreten.
Eins musste Pia ihrer Freundin lassen. Sie traute sich etwas, im Gegensatz zu Pia selbst, die den Mut für eine derartige Aktion nicht aufbringen würde.
»Und bei dir so?«, fragte Tami.
Pia verstand nicht, was sie meinte.
»Du wirst demnächst zweiundzwanzig und lebst keusch wie eine Nonne, seit dieser Geschichte mit Basti, die ja längst verjährt ist.«
Pia hatte keine Lust auf dieses Thema und zuckte mit den Schultern. »An meinem Geburtstag bist du dann in Tirol.«
»Stimmt! Daran habe ich gar nicht gedacht. Schlimm?«
»Nein. Wir feiern einfach später.«
Die Kirchturmuhr von St. Matthäus schlug vier. Das Lokal schloss, und Pia bummelte mit Tami zum Marienplatz. Mit einer Umarmung verabschiedeten sie sich im Zwischengeschoss. Tami musste zur U-Bahn, Pia zur S-Bahn.
Während sie am Bahnsteig wartete, begann ihr kleiner Zeh zu jucken. Das tat er immer, wenn ein Wetterwechsel bevorstand. Vielleicht würde es doch noch weiße Weihnachten geben. Das eigentlich Kuriose bei der Sache war jedoch, dass er juckte, obwohl er vor langer Zeit amputiert worden war. Das Jucken machte sie so hibbelig, dass sie sich auf eine Bank setzte, den Turnschuh auszog und den Fuß massierte.
Mit vier Jahren war sie mit dem Fuß in die Fahrradspeichen gekommen, als sie Radfahren lernte. Die Verletzung war so schlimm gewesen, dass der Zeh nicht heilte und abgenommen werden musste. Seltsamerweise konnte Pia sich weder an den Unfall noch an die Operation erinnern.
*
Als Pia nach Hause kam, duftete es in der Wohnung wie in einem edlen Restaurant. Bei Tami gab es an Heiligabend Würstchen mit Kartoffelsalat. Bei den Winters wurde schon am Vierundzwanzigsten ein mehrgängiges Menü serviert. Mama musste Stunden in der Küche verbracht haben. Kochen war ihre große Leidenschaft. Heute war es sicher auch eine gute Möglichkeit gewesen, Paps aus dem Weg zu gehen.
Pia sah in die Küche. »Bin wieder da.« Ihre Mutter pulte die Kerne aus einem Granatapfel und blickte auf. »Die Messe beginnt um sechs. Wir sollten aber um halb sechs los, damit wir einen Platz bekommen.«
Auf die Weihnachtsmesse hatte Pia eigentlich keine Lust. Obendrein empfand sie es als Heuchelei, nur der Stimmung wegen hinzugehen, denn weder sie noch ihre Eltern waren gläubig und gingen sonst nie in die Kirche. Doch Pia wollte nicht für schlechte Laune sorgen, indem sie daheimblieb. Nur kein Streit, das war auch ihr wichtig.
Im Wohnzimmer stand der geschmückte Baum zwischen den beiden Fenstern. Er war schön, aber kalt und abweisend, wie vom Polarkreis importiert, so ganz in Weiß und Silber. Paps saß auf dem Sofa und hörte eine Jazz-Playlist. Lächelnd schrieb er eine Nachricht auf dem Handy. Vielleicht war der Streit ja beigelegt. Erleichtert ging Pia in ihr Zimmer und überlegte, welches Outfit passend wäre. Am liebsten hätte sie die Jeans anbehalten. Doch Jeans und Weihnachtsgottesdienst waren Mamas Meinung nach nicht kompatibel. Pia wollte aber auch kein Kleid anziehen. Daher entschied sie sich für die schwarze Jeans, dazu eine weiße Bluse und darüber den petrolblauen Pulli, der einen schönen Kontrast zu ihrem roten Haar bildete.
Pünktlich um halb sechs drängte Mama zum Aufbruch. Paps kam aus dem Schlafzimmer und trug noch immer Cordhose und Pullover. Der abschätzende Blick, mit dem ihre Mutter ihn musterte, sprach Bände, doch sie kommentierte sein Aussehen nicht.
Die Kirche war schon beinahe voll, als sie kamen. In einer der hinteren Bankreihen fanden sie noch Plätze. Wider Erwarten wurde es Pia während der Messe ganz weihnachtlich ums Herz. Die feierliche Musik, der mit Äpfeln und Strohsternen geschmückte Baum und der Chorgesang versetzten sie in eine erwartungsvolle Stimmung. Nach dem Gottesdienst fühlte sie sich leichter. Auch ihre Eltern strahlten mehr Ruhe aus als noch vor einer Stunde.
Auf dem Heimweg durch die festlich dekorierten und erleuchteten Straßen hellte sich Pias Stimmung weiter auf. Am nachtblauen Himmel über ihr standen die Sterne, und sie erinnerte sich plötzlich, wie sie als kleines Mädchen an einem Weihnachtsabend auf dem Rückweg vom Gottesdienst einen Kometen über den Hausdächern gesehen hatte, und er sah genauso aus wie in ihrem Bilderbuch mit der Weihnachtsgeschichte. Sie erinnerte sich auch, dass sie niemanden darauf aufmerksam gemacht hatte, denn sie ahnte, dass er dann verschwinden würde. Lächelnd ging Pia weiter. An Fantasie hatte es ihr noch nie gemangelt. Woher sie die wohl hatte? Von Mama oder von Paps? Eigentlich von keinem der beiden, denn fantasiebegabt waren sie nicht. Wohl eher von Oma, die gerne Geschichten erzählte.
Vor dem Essen verzog Paps sich in sein Arbeitszimmer, während Pia half, den Tisch im Wohnzimmer zu decken. Ganz in Weiß und Silber, passend zum Baum. Feines Porzellan, dreierlei Gläser und für jeden Gang des Menüs eigenes Besteck. Mama steckte Kerzen in die Leuchter aus Kristallglas und drapierte Servietten aus Leinen auf den Tellern. Als sie fertig war, betrachte sie zufrieden ihr Werk.
Was für ein Prunk. Beschämt dachte Pia an Maria und Joseph im Stall, die nichts gehabt hatten außer einem Dach über dem Kopf und einer Krippe voll Heu als Bett für ihr Kind. Sicher hätten ihnen Milch und Brot genügt. Oder Würstchen und Kartoffelsalat. Irgendwas war in den letzten zweitausend Jahren mit dem Weihnachtsfest schiefgelaufen. Wobei das vermutlich erst in den letzten Jahrzehnten passiert war.
Mama sah auf die Uhr. »Um acht machen wir Bescherung, und danach gibt es Essen.« Ein musternder Blick glitt an Pia hinab, ein Lächeln erschien. »Willst du dich fürs Essen nicht umziehen?«
Eigentlich nicht, hätte Pia am liebsten gesagt. Doch sie schwieg, denn sie hatte keine Lust auf eine Auseinandersetzung und zog dann doch das kleine Schwarze an, wie Mama es erwartete. Es war ja nichts dabei. Einen Farbklecks aber benötigte das biedere Outfit. Pia wand sich ein türkisfarbenes Tuch um den Kopf und bändigte damit die roten Locken.
Als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte, war der verkniffene Zug um den Mund ihrer Mutter nicht zu übersehen. Nicht überraschend, denn Paps trug noch immer die ausgebeulte Cordhose und den Zopfpulli. »Ich hoffe, ihr nehmt so mit mir vorlieb.« Lächelnd breitete er die Arme aus. »Ich fühle mich nun mal in legerer Kleidung am wohlsten, und wir wollen uns heute Abend doch wohlfühlen?« Er zwinkerte Pia zu. »Außerdem bist du schön für zwei. Mein hübsches Mädchen.«
»Aber sicher doch, Paul. Wir nehmen dich so, wie du bist«, sagte Mama, während sie Sekt einschenkte.
Paps schaltete die elektrische Beleuchtung des Baums an und startete die Playlist mit Weihnachtsmusik. Pia wappnete sich für klassische Musik. Denn bei Familie Winter feierte man alle Jahre wieder mit dem Weihnachtsoratorium von Bach. Mama kam mit dem Gläsertablett auf sie zu. Die Musik setzte ein, und Pia wandte verwundert den Kopf. Was aus den Lautsprechern drang, war alles andere als klassisch. Eher irisch oder schottisch. Jedenfalls sehr rhythmisch. Was war das? Etwa Riverdance?
Paps grinste und begann mit einem Fuß zu wippen. »Sting«, erklärte er, als er ihren verwunderten Blick bemerkte. »Mal was anderes.« Das Wippen verstärkte sich, bis er den Takt gefunden hatte, die Hände in die Hüften stemmte und mitzusingen begann. »I saw three ships come sailing in, on Christmas day in the morning.« Der Rhythmus riss ihn mit. Stampfend begann er zu tanzen, wiegte sich wie ein Bär. Pia bekam einen Lachanfall. Und das tat gut. »And what was in those ships all three, on Christmas Day, on Christmas Day? Komm, Pia, tanz mit mir.« Er griff nach ihrer Hand. Sie ließ sich bereitwillig ziehen. Singend tanzten sie durch den Raum. »And what was in those ships all three, on Christmas Day in the morning?« Den Refrain hatte sie schnell raus. Lichter wirbelten vorbei, Mama mit den Gläsern, der gedeckte Tisch, der geschmückte Baum. »The Virgin Mary and Christ were there, on Christmas Day, on Christmas Day; The Virgin Mary and Christ were there, on Christmas Day in the morning.«
Als das Lied endete, blieben sie atemlos stehen. Das Tuch in Pias Haar war verrutscht, Mama lachte kopfschüttelnd, auf Paps Stirn standen feine Schweißperlen. Er nahm Pia in den Arm. »Frohe Weihnachten, meine wunderschöne Tochter.«
»Frohe Weihnachten, Paps.« Sie spürte seine breiten Schultern, seinen mächtigen Körper, und für einen Augenblick fühlte sie Sicherheit und Halt. Dann gab er sie auch schon wieder frei. Es war eine der körperlichen Berührungen gewesen, die in dieser Familie so selten waren. Der nächste Song begann. Ihre Eltern wünschten sich ein frohes Fest und küssten sich flüchtig auf den Mund. Mama reichte die Gläser, sie stießen an und gaben sich die Geschenke. Wieder einmal piepste das Handy ihres Vaters. Doch diesmal ließ er es stecken.
Gott, war es lustig gewesen, mit ihm zu tanzen! Wie leicht und unbeschwert sie sich in diesen Minuten gefühlt hatte, als hätte sie sich die angespannte Stimmung zwischen ihren Eltern eingebildet.
Paps bekam von ihr einen Schal, über den er sich freute. Mama den Roman, den sie sich gewünscht hatte. Zum Schluss überreichte Pia ihr Überraschungsgeschenk.
Vor zwei Wochen war ihr zufällig ein Plakat des Filmmuseums aufgefallen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag lief dort The Purple Rose of Cairo – der Film, bei dem ihre Eltern sich einst kennengelernt hatten. Ihr war sofort klar gewesen, dass das ein perfektes Weihnachtsgeschenk war.
»Ich habe noch etwas für euch.« Sie reichte Paps das Kuvert mit den Kinokarten, er zog sie heraus, und für einen Moment stand sein Mund offen. »Na, so was!«, sagte er gerührt. »Da werde ich ja ganz sentimental.«
»Was ist es denn?«
Er reichte Mama die Karten, und bestürzt bemerkte Pia, wie die Augen ihrer Mutter feucht wurden. »Das ist so lieb von dir, Pia. Dass du dich überhaupt daran erinnerst.« Dabei sah sie Pia nur kurz an, ihr Blick ging gleich weiter zu Paps, der sich abwandte und die Geschenke für Pia unter dem Baum hervorholte.
Sie bekam, was sie sich gewünscht hatte, die Patchworktasche von Desigual und obendrein einen E-Reader, auf den Mama bereits ein Buch geladen hatte. Einen Ratgeber, wie man innere Blockaden löst und so zu mehr Selbstbewusstsein gelangt. Pia bedankte sich, kommentierte das Buch aber nicht. Jedenfalls würde sie als Erstes herausfinden, wie sie es vom E-Reader löschen konnte.
Während Mama in der Küche verschwand, um die Vorspeise anzurichten, packte Pia das Geschenk von Tami aus. Es war ein limettengrüner Schlauchschal, der wunderbar zu ihren roten Haaren passte. Sie tauschte ihn gegen das türkisfarbene Tuch und machte ein Selfie, das sie mit einem Dankeschön an Tami schickte.
Mama servierte voller Stolz das Essen. Zuerst erschien sie mit Gurken-Lachs-Happen als Gruß aus der Küche wie in einem Drei-Sterne-Restaurant. Danach tischte sie verschiedene Blattsalate mit Granatapfelkernen und einem ausgefallenen Dressing auf. Gefolgt von gebratenem Zander auf einem Gemüsebett und Hühnerbrust mit glasierten Karotten. Zu jedem Gang gab es eine kurze Erklärung zu Zutaten und Zubereitung und den passenden Wein. Mama war ganz in ihrem Element. Mit leicht geröteten Wangen und glänzenden Augen sah sie glücklich und zufrieden aus. Doch Pia registrierte auch, dass ihre Mutter zu viel trank.
Während des Essens drehte sich das Gespräch um Belanglosigkeiten. Im Grunde war es nicht mehr als Small Talk, wie Pia auf einmal bewusst wurde. Es versetzte ihr einen Stich. Hatten sie etwa Angst, ein Thema zu streifen, das zu Streit führen könnte? Oder weil sie sich nichts mehr zu sagen hatten?
Bissen für Bissen kehrte die angespannte Stimmung zurück, die schon seit dem Frühstück den Tag bestimmte, und nahm dem Abend den Rest von Feierlichkeit.
Weshalb hatte Paps sich abgewandt, als Mama wegen der Kinokarten beinahe geweint hätte?
»Fünfter und letzter Gang.« Mama schob den Stuhl zurück und ging in die Küche, um das Dessert zu holen. »Ihr werdet Augen machen.« Pia war satt und konnte sich nicht vorstellen, auch nur noch einen Bissen hinunterzubekommen. Mit einem Blick aufs Handy stellte sie fest, dass es schon nach elf war. Als Paps das sah, nahm auch er seines aus der Tasche. »Muss nur kurz nachsehen, wer da vorhin eine Nachricht geschickt hat.« Das tat er und beantwortete sie auch gleich.
Na großartig, dachte Pia. Aber sag mir bitte nie wieder, dass es unhöflich ist, bei Tisch zu texten oder WhatsApps zu lesen.
Paps schrieb noch, als Mama mit einer Glasplatte zurückkehrte, auf der sich kleine gefüllte Windbeutel zu einem Kegel türmten, den Karamellfäden umgaben. Es sah sensationell aus. Sie stellte die Platte ab und fuhr Paps an. »Kannst du nicht mal an Heiligabend dein Handy auslassen.«
»Entschuldige. Ist schon erledigt.« Er steckte das Telefon ein, und ein angespannter Zug legte sich um seine Mundwinkel. Der letzte Rest von so etwas wie guter Stimmung war verflogen. Es war, als wäre ein eisiger Hauch durch den Raum geweht, der Kälte und Feindseligkeit zurückließ. Pia verlor den Appetit und stocherte lustlos in ihrem Dessert herum. Genau wie Mama, die ihr Glas leerte und sich nachschenkte. »Was ist eigentlich los mit dir?«, fragte sie in die Stille hinein. »Wir scheinen dich nicht mehr sonderlich zu interessieren. Immer bist du für die Firma verfügbar. Ständig Nachrichten und Telefonate. Und wenn du daheim bist, sitzt du meistens in deinem Arbeitszimmer.«
Musste das ausgerechnet jetzt sein? Pia wünschte sich beinahe den Small Talk von vorhin zurück.
Paps wischte sich den Mund mit der Serviette ab. »Das ist der Preis für meine Karriere. Immerwährende Erreichbarkeit. Das hast du gewusst, als ich die Stelle angenommen habe. Wir waren uns einig. Im Nachhinein die Spielregeln ändern zu wollen, ist nicht fair.«
»Nicht fair!« Mama schnappte wie ein Fisch auf dem Trockenen und schluckte offenbar herunter, was ihr auf der Zunge lag. »Okay. Lassen wir das«, sagte sie stattdessen. »Ich hole den Käse.«
Sie verschwand wieder in der Küche, und Pia sah ihren Vater an. »Habt ihr Streit?« Die Frage rutschte ihr heraus, und es tat ihr sofort leid. Sie wollte keinesfalls dazu beitragen, dass der Abend weiter aus dem Ruder lief. »Sorry. Es geht mich nichts an.«
»Ist schon gut. Ich hätte das Handy stecken lassen sollen.«
In Pia stieg Ärger auf, weil er sich so offensichtlich dumm stellte und sie nicht ernst nahm. Auch sie hatte ein wenig zu viel getrunken und konnte sich nicht bremsen. »Darum geht’s doch nicht. Ihr beide umkreist euch schon den ganzen Tag mit Sicherheitsabstand, als hättet ihr Angst vor einem Zusammenstoß.«
Paps schüttelte den Kopf. »Es ist nur der übliche Weihnachtsstress. Kathrin macht sich immer zu viel Arbeit. Und ich habe ein kleines Problem in der Firma. Das ist alles.«
Mama kehrte mit dem Käsetablett und einer Flasche Obstbrand zurück. Pia lehnte dankend ab, als ihre Mutter ihr ein Glas einschenken wollte. Sie hatte genug für heute Abend.
Schweigend aßen sie vom Käse. Jeder blickte auf seinen Teller, auch Pia. Sie studierte den Blauschimmel des Gorgonzolas und die Löcher im Emmentaler und bekam nur mühsam einen Bissen davon herunter. Gott sei Dank würde das Essen gleich vorbei sein, dann konnte sie in ihr Zimmer gehen.
Mama schenkte sich einen zweiten Williams ein und wollte auch Paps nachschenken. Doch er legte die Hand auf sein Glas. »Für mich nicht. Danke.« Seine Sprache war ein wenig verwaschen, auch er hatte zu viel getrunken.
Ein Kloß setzte sich in Pias Kehle. Der Abend hatte mit dem Tanz so lustig angefangen, und jetzt endete er in eisigem Schweigen, das kaum zu ertragen war. Sie erklärte sich bereit, den Tisch abzudecken und aufzuräumen, und verschwand mit einem Tablett voller Geschirr in der Küche.
Neben dem Herd türmten sich Teller, Schüsseln und Töpfe. Während Pia die Spülmaschine einräumte, drangen halblaute Gesprächsfetzen aus dem Wohnzimmer zu ihr, bis die Playlist mit Weihnachtsmusik zu Ende war und der Player sich ausschaltete. Nun gelangte jedes Wort zu ihr. Mama erklärte, dass sie langsam genug habe von Pauls Heuchelei. »Ich glaube nicht, dass du mehr Überstunden machen musst als sonst. Ich glaube nicht, dass diese außergewöhnliche Flut an Nachrichten und Telefonaten rein beruflich bedingt ist. Und die Gespräche, die du abbrichst, wenn ich ins Zimmer komme, sind ja wohl auch nicht dienstlich.«
»Du denkst doch hoffentlich nicht, ich hätte eine Affäre«, entgegnete Paps.
Der Kloß in Pias Hals rutschte tiefer.
»Doch, genau. Das glaube ich.« Kathrin klang ruhig und sachlich, als ginge es hier lediglich um eine defekte Waschmaschine.
»Das ist ja lächerlich. Du siehst Gespenster.«
Doch Mama ließ sich nicht beirren. Sie bohrte nach und ließ nicht locker. Sie trieb Paps in die Enge. So kannte Pia ihre Mutter gar nicht und entschloss sich, dazwischenzugehen. In ihrer Anwesenheit würden sie das Thema fallen lassen.
»Ich will wissen, woran ich bin. Das wäre nur fair von dir.«
»Muss das wirklich jetzt sein, Kathrin? Ausgerechnet an Heiligabend?«
Pia warf das Geschirrtuch auf die Ablage und ging in den Flur.
»Es stimmt also.«
Paps seufzte. »Also gut.« Im Bariton ihres Vaters lag Bedauern. »Also gut«, wiederholte er, während Pia über den Flur ging. »Ja. Ich habe eine Freundin.«
Mit einem Mal wurde es Pia ganz flau. Ihr Vater hatte eine Affäre? Das konnte nicht sein. Unwillkürlich schüttelte sie den Kopf. Während sie versuchte, die Tragweite seiner Worte zu erfassen, schlug die Turmuhr von Sankt Johannes Mitternacht.
25. Dezember
Die erste Rauhnacht
Während die Glockenschläge in der Nacht verhallten und Pia sich auf die Bank im Flur setzte, weil ihr elend zumute war, blieb es im Wohnzimmer ruhig. Ihr Gefühl von heute Morgen … Dieses kaum fassbare Unbehagen, das ihr wie ein Unheil verkündendes Omen erschienen war, bewahrheitete sich also.
Die Turmuhr verklang, und ihre Mutter beendete die Stille. »Weißt du, dass gerade die Rauhnächte begonnen haben?«
»Nein. Keine Ahnung.«
»Die nächsten zwölf Tage bestimmen Geister unser Leben. An diesen Schwachsinn habe ich ja nie geglaubt. Doch in diesem Jahr scheint es so zu sein. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen, mir das anzutun?«
Ihre Eltern benahmen sich wie in einem schlechten Film. Nur konnte Pia leider keine Stopptaste drücken. Warum musste Mama auch ständig nachbohren? Wäre es nicht besser, die Wahrheit nicht zu kennen? Doch Pia wusste, dass das ein naiver Gedanke war. Es ließ sich nicht ändern: Paps hatte eine Freundin. Die Sorge stieg in ihr auf, dass ihre Eltern sich trennen könnten, und sie fragte sich, was das für sie bedeuten würde. Prompt kam die Bestätigung ihrer Befürchtung.
»Verlassen ist ein gutes Stichwort«, entgegnete Paps. »Ich wollte es dir eigentlich erst nach den Feiertagen sagen. Ich werde ausziehen. Ich ertrage deine Kälte nicht mehr und auch deinen Perfektionismus. Mir steht’s bis hier.«
Unwillkürlich sah Pia, wie Paps die Hand bis über die Stirn hob und einen Strich zog. Einen Schlussstrich.
»Und auch diese Geschichte mit Pia … Wir müssen ihr endlich die Wahrheit sagen.«
Pia schreckte hoch. Was für eine Geschichte denn?
»Sie muss die Wahrheit erfahren und sollte …«
»Nein!«, unterbrach Mama ihn, und es klang schneidend kalt. »Niemals! Nur über meine Leiche! Wehe, du wagst es! Sie darf das nie erfahren. Du hast es mir versprochen.«
Pias Kehle schnürte sich zu. Was durfte sie um Himmels willen nie erfahren? Etwas rührte sich im tiefsten Winkel ihrer Seele, in ihrem finstersten.
Leise ging sie in ihr Zimmer und legte sich aufs Bett, während ihre Eltern im Wohnzimmer weiter stritten. Wobei streiten nicht das passende Wort war. Nur ab und zu hoben sich die Stimmen und wurden scharf.
Zusammengerollt starrte Pia auf das Schneeflockenmuster der Bettwäsche. »Wir müssen ihr endlich die Wahrheit sagen.« Was hatte Paps damit gemeint? Etwa warum sie anders war? Warum man sie nicht wirklich lieben konnte? Was mit ihr nicht stimmte? Irgendetwas gab es, das sie von allen trennte und sich beinahe selbstverständlich anfühlte, weil es schon immer so gewesen war. Und trotzdem nicht richtig, geschweige denn gut.
Sollte sie Paps morgen darauf ansprechen? Besser nicht, die Wahrheit, die sie nicht erfahren sollte, konnte nichts Gutes sein.
Nach einer Weile griff Pia zum Handy und schrieb Tami, ob sie facetimen könnten.
Während sie noch auf die Antwort ihrer Freundin wartete, schlug am Ende des Flurs die Schlafzimmertür. Paps oder Mama? Sicher nicht beide. Ein Signalton erklang. Tami war online. Sie trug die Beaniemütze, lachte in die Kamera und wollte zu einer ihrer flapsigen Begrüßungen ansetzen, doch als sie Pia sah, wurde sie ernst. »Was ist denn los?«
Pia erzählte Tami von diesem verunglückten Weihnachtsabend, und dass ihr Vater eine Freundin hatte und ausziehen würde. »Meine Mutter hat einfach nicht lockergelassen und ständig nachgebohrt, bis Paps mit der Wahrheit herausgerückt ist. Besser wäre es gewesen, den Mund zu halten.«
»Vielleicht, aber es ändert ja nichts«, meinte Tami. »So zu tun, als gäbe es kein Problem, löst das Problem nicht.«
Es klopfte kurz an der Tür. Paps sah herein. »Ach, da bist du. Alles klar?« Es klang unsicher.
Pia zwang sich zu einem Lächeln. »Alles gut. Ich facetime grad mit Tami.«
»Ja … dann. Gute Nacht.«
Sie wünschte ihm auch eine gute Nacht und wartete, bis er verschwunden war, bevor sie sich wieder an Tami wandte. »Das Problem bin offenbar ich.«
Eigentlich wollte sie nicht darüber sprechen. Das hatte sie noch nie getan. Es war ja nur so ein merkwürdiges Gefühl, das sie begleitete, seit sie denken konnte. Nichts Handfestes. Nichts, was sich belegen ließe. »Irgendwie scheint das mit mir zusammenzuhängen.«
Tami schüttelte den Kopf. »Das ist der Klassiker. Kind fühlt sich schuldig, weil die Eltern sich trennen. Aber du bist kein Kind, sondern erwachsen. Vielleicht liebt er deine Mutter nicht mehr, vielleicht braucht er nur mal Abwechslung. Das hat nichts mit dir zu tun. Rede dir das nicht ein.«
»Und dann gibt es da noch ein Geheimnis, über das er mit mir reden will, doch Mama ist dagegen.«
»Was für ein Geheimnis denn?«
»Wenn ich das wüsste. Aber etwas stimmt nicht mit mir.«
Tami schüttelte den Kopf. »Was soll denn mit dir nicht stimmen?«
»Es gibt etwas, über das in meiner Familie nicht geredet wird, und das hat mit mir zu tun. Etwas hält alle auf Distanz. Das war schon immer so. Doch ich kann das nirgends richtig festmachen. Niemand tuschelt hinter meinem Rücken. Jedenfalls nicht so, dass ich es mitbekommen würde. Niemand sieht mich komisch an oder macht zweideutige Bemerkungen. Ich spüre es nur. Da ist etwas, das mich von ihnen trennt.«
»Du meinst ein Tabu?«
»Ja.«
»Und dein Paps meint, dass man dir die Wahrheit sagen sollte …«
»Und meine Mutter will das nicht. Nur über ihre Leiche, hat sie gesagt.«
»Oh. Gleich so dramatisch.«
»Sie hatte zu viel getrunken.«
»Ich an deiner Stelle würde morgen mit meinem Vater einen Spaziergang machen. Er will es dir ja sagen, also wird er es tun.«
»Da bin ich nicht so sicher. Es gibt anscheinend eine Vereinbarung zwischen meinen Eltern, dass ich es nicht erfahren soll.«
»Aber er will sich nicht mehr daran halten. Wenn du nachhakst, wird er es dir schon sagen.«
Im Grunde war das ein guter Vorschlag. Doch Pia zögerte. »Mal sehen.«
»Das klingt nicht so, als wolltest du das Geheimnis lüften.«
Damit traf Tami ins Schwarze. Alles in Pia sträubte sich gegen ein klärendes Gespräch, gegen eine Wahrheit, die nur schrecklich sein konnte. Sie wollte sie nicht kennen. Alles sollte so bleiben, wie es war. Doch das konnte sie Tami nicht erklären. Sie verstand es ja selbst nicht. »Ich überlege es mir.«
Eine Weile unterhielten sie sich noch, bis Pia müde war und ihr jedes Wort gesagt schien. Kurz vor halb zwei verabschiedete sie sich von Tami und löschte das Licht.
Bevor sie ins Bett ging, sah sie aus dem Fenster. Vereinzelte Schneeflocken taumelten vom Himmel, als könnten sie dieser Weihnachtsnacht doch noch einen Hauch von Zauber schenken.
Vor wenigen Minuten waren ihr beinahe die Augen zugefallen, doch jetzt konnte sie nicht einschlafen. In ihrem Kopf wirbelten Bilder und Gesprächsfetzen des Abends durcheinander und vermischten sich mit alten Erinnerungen. Plötzlich trieb ein Satz an die Oberfläche. Du bist nicht wie die anderen, du bist anders.
Da war er wieder, dieser Satz ihrer Oma.
*
Oma hatte ihn am Dreikönigstag gesagt. Einen Tag nach Pias siebtem Geburtstag. Ihre Eltern fuhren mit ihr nach Wasserburg zu den Großeltern, und erst jetzt fiel Pia auf, dass diese Besuche selten geworden waren, seit sie in München wohnten, obwohl die Fahrt nur eine Stunde dauerte.
Pia mochte Oma und Opa, mit denen sie den Duft nach frischem Gebäck und Torten ebenso verband wie den Geschmack von saftigen Zwetschgenkuchen und salzigen Brezen, von süßen Strauben und gefüllten Krapfen. Ihre Großeltern waren im Ruhestand, hatten früher aber eine Bäckerei in der Altstadt betrieben und backten noch immer gerne. Wenn Pia sie besuchte, gab es immer etwas zu naschen und einen Becher Kakao dazu. Der letzte Besuch hatte kurz nach ihrer Einschulung vor mehr als einem Jahr stattgefunden, und Pia freute sich darauf, die beiden wiederzusehen.
Es war ein strahlend schöner, aber klirrend kalter Dreikönigstag. Sie erreichten Wasserburg, und Paps lenkte den Wagen über die Brücke, unter der sich der Inn dahinzog, um wenig später in einer weiten Schleife die Altstadt zu umfließen. In seiner Oberfläche spiegelte sich der blaue Himmel. In den Sträuchern und Bäumen am Ufer saß ein feiner Raureifpelz, und auf den Dächern und dem Kopfsteinpflaster lag eine hauchdünne Schneeschicht wie gepudert.
Zahlreiche Häuser im mittelalterlichen Stadtkern waren im italienischen Stil gebaut. Schmale pastellfarbene Fassaden. Stuckverzierte Fenster. Flache Dächer. Paps parkte vor einem vanillegelben Haus. Unten befand sich die ehemalige Bäckerei von Oma und Opa, die inzwischen neue Eigentümer hatte, und darüber die Wohnung.
Oma öffnete die Tür, ein Lächeln glitt über ihr Gesicht, als sie Pia sah und an sich zog. »Mei, bist du groß geworden. Aber noch immer mein Fuchserl.« Mit der Hand strich sie Pia durchs rote Haar. »Soll ich dir nachher einen Schlupfzopf flechten?« Das konnte nur Oma. Mama hatte es ein paarmal versucht, doch Pias widerspenstiges Haar ließ sich kaum bändigen. Nur Oma gelang das, und Pia nickte.
Die Wohnung hatte einen ganz eigenen Duft nach Äpfeln und Bohnerwachs, nach Kölnisch Wasser und nach Lavendelpapier, mit dem Oma die Kommodenschubladen auslegte.
Heute duftete es auch nach Weihnachtsgebäck. Der letzte Stollen wurde angeschnitten. Die Erwachsenen unterhielten sich. Pia wurde es bald langweilig, und sie erinnerte sich an ihren Kindergartenfreund, den Florian Lippert, der mit seinen Eltern auf der anderen Seite des Inns wohnte. Pia fragte nicht, ob sie Florian besuchen durfte. Ihre Eltern würden es nicht erlauben. Der Weg war zu weit und sie erst sieben Jahre alt.
Nach dem Kaffeetrinken machten ihre Eltern einen Spaziergang zum Friedhof. Pia war noch nie auf einem Friedhof gewesen und wollte mit. Doch Oma hielt sie zurück. »Das ist kein Ort für Kinder. Außerdem wollte ich dir doch die Haare flechten.« Das tat Oma dann auch, und danach schlug Opa vor, Fotos anzusehen, und holte die Alben aus dem Regal. Er blätterte durch vergilbte Schwarz-Weiß-Aufnahmen und erzählte Geschichten von Leuten, die längst tot waren und auf dem Friedhof lagen. Wen Papa und Mama dort wohl besuchten? Doch bevor Pia fragen konnte, hatte Opa das nächste Album aufgeschlagen, und die Frage verschwand ebenso schnell, wie sie aufgetaucht war.
Jetzt wurden die Bilder im Album bunt, und eines weckte ihr besonderes Interesse. Opa hatte es im Winter unten auf dem Platz vor der Bäckerei aufgenommen. Männer mit furchterregenden holzgeschnitzten Masken und zotteligen Fellumhängen waren darauf abgebildet. Sie trugen mit Schellen und Rasseln besetzte Stöcke, manche auch große Kuhglocken und andere brennende Fackeln. Sie sahen unheimlich aus, aber auch faszinierend. Schrecklich und schön zugleich. Pia fragte, wer sie waren, und Opa erklärte es ihr. »Das sind die Perchten. Sie treiben den Winter und die bösen Geister aus. Das machen sie jedes Jahr um diese Zeit. Auch heute wieder, wenn es dunkel wird. Unten auf dem Platz. Magst du es dir ansehen?«
Pia war sich unsicher.
»Das Perchtentreiben ist ein riesiger Spaß, wenn man mutig ist. Denn sie jagen auch die Kinder. Traust du dich?«
Und plötzlich wusste sie es. Sie traute sich. Sie war mutig. Sie wollte diese schrecklichen Masken mit den riesigen Nasen und den spitzen Zähnen sehen, diese gruseligen, zotteligen, gehörnten Gestalten. Sie wollte sich vor ihnen fürchten, sich vielleicht jagen lassen. Sie wollte dieses schaurig schöne Kribbeln fühlen. »Und ob!«
Oma warf Opa einen warnenden Blick zu und schüttelte den Kopf. »Das ist nichts für dich. Sie werden dich nicht schonen. Du bleibst hier.«
»Ich will aber!« Trotzig zog sie einen Flunsch.
»Am Ende wirst du weinen.«
»Die anderen Kinder dürfen doch auch.«
»Du bist aber nicht wie andere Kinder«, entgegnete Oma. »Du bist …« Einen Augenblick zögerte sie. »Du bist anders. Ein Fuchserl eben. Du bleibst heute im Haus und basta.«
*
Pia setzte sich im Bett auf. Du bist … anders. Oma hatte gezögert. Eigentlich hatte sie nicht anders sagen wollen. Das war ihr damals schon aufgefallen. Pia hatte nachgebohrt. Oma hatte geschwiegen oder eine Ausflucht gesucht. Genau wusste Pia es nicht mehr. Jedenfalls hatte sie keine Antwort auf die Frage bekommen, was denn an ihr anders war.