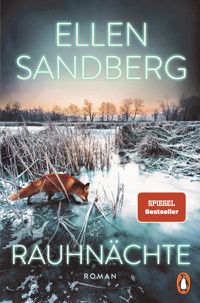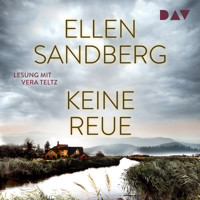9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die einen wollen vergessen. Die anderen können es nicht.
1944. Kathrin Mändler tritt eine Stelle als Krankenschwester an und meint, endlich ihren Platz im Leben gefunden zu haben. Als die junge Frau kurz darauf dem charismatischen Arzt Karl Landmann begegnet, fühlt sie sich unweigerlich zu ihm hingezogen. Zu spät merkt sie, dass Landmanns Arbeit das Leben vieler Menschen bedroht – auch ihr eigenes.
2013. In München lebt ein Mann für besondere Aufträge, Manolis Lefteris. Als er geheimnisvolle Akten aufspüren soll, die sich im Besitz einer alten Dame befinden, hält er das für reine Routine. Er ahnt nicht, dass er im Begriff ist, ein Verbrechen aufzudecken, das Generationen überdauert hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ellen Sandberg
Die Vergessenen
Roman
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichenvon Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2018 Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München. www.ava-international.de
Covergestaltung: Frühling advertising group GmbH
Covermotiv: © istock / ISO 3000
Redaktion: Angela Troni
Umsetzung E-Book: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-20250-7V007
www.penguin-verlag.de
Prolog
Blut klebte an seinen Händen, an seiner Kleidung. Angst scharrte in seiner Brust wie ein in die Enge getriebenes Tier. Atemlos rannte er über den Hof, sah sich um. Wo konnte er sich verstecken?
Da! Die Tür zur Ölmühle stand offen. Er lief hinein. Vor ihm eine Mauer aus gestapelten Pressmatten. Er kletterte hinüber, duckte sich in den Spalt dahinter, spürte kalten Stein im Rücken und den rauen Sisal der öligen Matten an der Wange. Er machte sich winzig, wollte unsichtbar sein, musste das Angsttier in sich beruhigen, seinen Atem kontrollieren. Das Keuchen würde ihn verraten! Er bestand nur noch aus zitternder, japsender, bebender Angst, die jeden Gedanken vertrieb, bis ein Rauschen seinen Schädel füllte und nur eines ihn beherrschte: der archaische Wille zu überleben.
Der vertraute Duft von Oliven stieg aus den Matten auf, weckte die Erinnerung an kargen Boden, an die Weite des Himmels und den sachten Wind, der von Norden her über das Gebirge zum Meer strich. All das, was er vielleicht nie wieder sehen würde, nahm er für einen tröstlichen Augenblick wahr, der ihm Ruhe und Zuversicht schenkte. Sie würden ihn nicht finden.
Aber dann überrollte ihn erneut Panik, und er wollte nach Mama rufen, doch sie lag im Stall, in ihrem Blut, das an ihm klebte. Die Schreie seiner Schwestern in der Küche waren verstummt, und die Stille machte ihm mehr Angst als alles andere.
Ein Geräusch ließ ihn zusammenfahren. Es war über ihm, kam aus dem Zwischenboden. Ein leises Scharren. Mäuse. Sicher nur Mäuse, beruhigte er sich.
Wo waren sein Vater und sein Bruder? Wo waren die Mörder?
Vorsichtig reckte er den Kopf über den Stapel, ließ den Blick durch den Raum gleiten, vorbei an den Mühlsteinen, die im Koller stillstanden, bis zum Fenster, durch das gleißend die Nachmittagssonne fiel. Da sah er sie aus dem Haus kommen, ihre Kleidung blutgetränkt. Einer blieb stehen, schloss den Hosenschlitz und zündete sich eine Zigarette an. Der andere hob die Hand, in der ein Messer aufblitzte, und wies zur Mühle, direkt auf ihn.
1
Es war ein warmer Junitag in München, als Manolis Lefteris nach dem Schlüssel für den Aston Martin griff und die Verantwortung für das Autohaus seinem Geschäftsführer überließ, um sich auf dem Friedhof mit seiner Schwester Christina am Grab der Eltern zu treffen. Zehn Jahre waren es nun schon, und er fragte sich, ob es ihm jemals gelingen würde, seinen Frieden mit Babás zu machen.
Das Leben hat einen Rückspiegel, und in dem sieht man immer die Eltern. Dieser Satz, den er irgendwo einmal gelesen hatte, ging ihm durch den Kopf, als er in den Wagen stieg. Wie wahr! Er war jetzt Mitte vierzig, und nach wie vor gab es dieses Loch in ihm, diese unausgefüllte Nische, etwas, das auf ein Wort der Anerkennung wartete, auf ein »Gut gemacht!«.
Während er durch den dichten Innenstadtverkehr fuhr, zog von Westen eine Wolkenfront heran, die das flirrende Mittagslicht vertrieb, das seit dem Morgen wie eine Verheißung über der Stadt gelegen hatte. Eine Stunde noch oder zwei, dann würde es regnen. So wie vor zehn Jahren, als zwei Polizisten vor seiner Wohnungstür gestanden hatten und er das Klingeln zunächst nicht gehört hatte, weil ein Wolkenbruch niederging und der Regen aufs Dach und gegen die Scheiben prasselte, als forderte die Natur selbst Einlass.
Manolis parkte beim Blumenladen am Friedhof und stutzte, als er das neue Schild sah. Aus der Floristeria war Anna Blume geworden. Unwillkürlich lächelte er. Anna Blume. Etwa nach dem Gedicht von Kurt Schwitters, das er in der Oberstufe auswendig gelernt hatte, weil es so herrlich absurd war? Oder hieß die Floristin am Ende tatsächlich so?
Eine Glocke bimmelte, als er eintrat. Die Luft war schwer vom Duft der Blumen, die in Eimern, Kübeln und Schalen auf schrundigen Tischen und Stellagen standen. Von irgendwoher vernahm er eine Stimme. »Komme gleich.«
Kurz darauf wurde die Tür des Nebenraums aufgestoßen, und eine Frau trat ein, in den Armen einen Korb voller burgunderroter Dahlien. Trotz ihrer schlanken Figur wirkte sie kräftig und robust. Das Grün ihrer Augen war bemerkenswert, außerdem trug sie tatsächlich ein rotes Kleid, wie in dem Gedicht. Für einen Moment spielte er mit dem Gedanken, sie darauf anzusprechen, ließ es dann aber bleiben.
Wie jedes Jahr kaufte er einen Strauß Sommerblumen und achtete darauf, dass auch Löwenmäulchen dabei waren, die seine Mutter so sehr gemocht hatte.
Er zahlte, überquerte die Straße und betrat den Friedhof. Der Lärm der Stadt blieb jenseits der Mauern. Graues Licht sickerte vom Himmel, legte sich wie ein Schleier über Hecken, Wege und Gräber, und in ihm stieg wieder einmal die Frage auf, warum sein Vater das getan hatte. Er würde es nie verstehen, obwohl er die Gründe kannte. Wie hatte Babás nur auf Gerechtigkeit hoffen können? Sie war nicht mehr als eine Illusion, ein selten erreichtes Ideal.
Das hatte er schon als Junge erkannt, kurz nach dem Wechsel aufs Gymnasium, als die anderen ihn aufzogen wegen seines Gastarbeitervaters und seiner Hippiemutter, als er sich gedemütigt fühlte und beschämt, weil alles an ihm falsch zu sein schien, als sie ihn mit Worten schlugen und er sich mit Fäusten wehrte. Er war nicht hilflos. Er war kein Opfer!
Bereits mit zwölf oder dreizehn hatte er gewusst, dass er nie so werden wollte wie sein Vater. So geduckt, so hinnehmend, so schweigend. Wobei das Schweigen in Wahrheit eine Staumauer gewesen war, hinter der sich das Unaussprechliche sammelte, bis sie dem Druck nicht mehr standhielt und barst, was häufig geschah, wenn Babás etwas getrunken hatte und eine gewaltige Wortflut aus ihm strömte.
Manolis atmete durch. Schnee von gestern.
Die Trauer war in zehn Jahren vorübergegangen, doch ein Rest an Wut war neben einem großen Bedauern geblieben. So viele verlorene Möglichkeiten. So vieles, das nie geschehen würde. So viele ungesagte Worte. Warum?
Letztlich war es nicht mehr als eine Vermutung, ein Verdacht. Es konnte tatsächlich ein Unfall gewesen sein. Doch tief in seinem Innern befürchtete Manolis, dass sein Vater den alten Opel absichtlich gegen den Baum gelenkt hatte. Sonst war er immer so defensiv gefahren, ein typischer Mittelspurschleicher.
Manolis überholte eine alte Frau mit zwei Gießkannen, die sie beinahe nicht zu schleppen vermochte. Bei jedem ihrer schwankenden Schritte schwappte Wasser heraus. Ihr Kopf war tief zwischen die Schultern gesunken, sodass sie ihn schief legen musste, um zu ihm aufzusehen, als er anbot, ihr zu helfen.
»Das ist sehr freundlich von Ihnen.« Ihre Stimme war hell und wollte nicht recht zu ihrem Alter passen. »Sie müssen aber beide nehmen. Sie halten mich im Gleichgewicht. Mit nur einer kippe ich um.«
Mit einem Seufzer stellte sie die Kannen ab. Er gab ihr den Strauß und folgte ihr zu einem Grab, dessen Stein die Inschrift Letzte Ruhestätte der Familie Baumeister trug. Mehr als ein Dutzend Namen waren bereits hineingemeißelt. Mehrere Generationen waren hier bestattet. Die Frau wies darauf. »Bald liege ich auch da. Beim Ernst, meinem Mann, und seinen Ahnen.«
Plötzlich wurde ihm bewusst, dass es ein ähnliches Grab geben musste, in dem mehrere Generationen von Lefteris’ lagen. Eine Familie mit zahlreichen Zweigen und Ästen, gefällt von einem gewaltigen Sturm. Übrig geblieben war nur der verdorrte Stamm. Nach ihm würde niemand mehr diesen Namen tragen. Der Gedanke kam völlig unerwartet. Manolis vertrieb ihn mit einem Kopfschütteln. Jahrestage waren etwas Seltsames.
»Bis es so weit ist, sollten Sie das Leben genießen«, sagte er und nahm den Strauß wieder an sich.
»Ach, wissen Sie, ohne meinen Ernst ist es nicht mehr dasselbe. Ich bin jetzt fünfundachtzig und allmählich des Lebens müde.« Ein Seufzer entstieg ihrer Brust. »Danke für Ihre Hilfe, vergelt’s Gott.«
Er glaubte nicht an Gott, und sollte es ihn doch geben, würde seine Vergeltung fürchterlich werden. Manolis verabschiedete sich und ging weiter zum Grab seiner Eltern.
Der Stein war aus Granit und mit einer schlichten Inschrift versehen. Yannis Lefteris und Karin Lefteris, geb. Brändle. Er las die Namen seiner Eltern, die eine große Liebe verbunden hatte, und das tiefe Bedauern stellte sich wieder ein und mit ihm sein Zwilling, der Zorn, der neben der Liebe zu Babás auch Verachtung und Enttäuschung in sich trug, wie eine Frucht ihre Kerne.
Am Brunnen holte Manolis Wasser, füllte es in die Grabvasen und stellte den Sommerstrauß in eine davon. Er war gerade fertig, als er Schritte hinter sich hörte. Seine Schwester Christina kam, und wie immer, wenn er sie sah, stieg Freude in ihm auf. Er liebte dieses Bündel an Hektik und Chaos, aber auch an Zuversicht und Verlässlichkeit. Sie trug ein blaues Kleid mit afrikanischen Mustern. Es spannte über dem Busen und den Rundungen an Bauch und Hüften und betonte ihre Botero-Figur, die er allerdings nicht so nennen durfte, denn sie hielt Boteros Skulpturen für lächerlich übertrieben, während sie ihm in ihrer runden Zufriedenheit gefielen. Die messingfarbenen Locken, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte, kringelten sich in der schwülen Luft um ihr Gesicht. Sie schwenkte einen Strauß Rosen und warf die Arme samt Blumen um Manolis’ Schultern und drückte ihn an sich. Dabei fiel die Tageszeitung aus ihrer offenen Handtasche.
»Hallo, Bruderherz. Schön, dich mal wieder zu sehen.«
»Grüß dich, Mutter Teresa. War das ein leiser Vorwurf?«
Er bückte sich nach der Zeitung, und sein Blick fiel auf die Headline. Milena Veens Mörder erschossen! Seit gestern ging die Meldung durch die Medien, wie nicht anders zu erwarten.
Christina nahm die Zeitung und steckte sie in die Tasche. »Danke. Mein Vorwurf war übrigens ein lauter. Wir sehen uns viel zu selten. Komm doch mal wieder zum Essen zu uns.«
»Ja, gerne. Was machen die Kinder?«
»Stress«, sagte sie lachend. »Elena ist unglücklich in einen Jungen aus der Parallelklasse verliebt. Glaube ich jedenfalls, mit mir redet sie ja nicht darüber. Wie soll ich ihr denn da helfen?«
»Gar nicht. Liebeskummer bespricht man nicht mit den Eltern, man heult sich bei der besten Freundin aus. Hast du doch auch so gemacht. Sie wird das schon durchstehen, schließlich kommt sie nach dir.«
Manolis mochte seine Nichte. Elena war ein taffes Mädchen, unkompliziert und geradeheraus und natürlich mit dem Lefteris’schen Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit ausgestattet. Die Familie hatte sich eine Illusion aufs Wappenschild gemalt.
»Da hast du wohl recht«, sagte Christina. »Außerdem will sie Reiten lernen. Als ob wir uns das leisten könnten. Yannis mutiert zum großen Schweiger. Das hat er von dir. Und um Benno mache ich mir Sorgen. Er arbeitet zu viel. Irgendwann dreht’s ihn zusammen. Was täte ich nur ohne meine Nervensägen?«
»Ohne die drei würdest du wohl all deine Energie in den Verein stecken.«
Christina war Anwältin und Gründerin des Vereins Null Toleranz, mit dem sie gegen häusliche Gewalt kämpfte. Sie engagierte sich für Prävention und schärfere Gesetze und bot den betroffenen Frauen schnelle, manchmal auch unkonventionelle Hilfe an.
»Vermutlich hast du recht«, sagte sie nun und arrangierte die Rosen in der Vase neben dem Sommerblumenstrauß.
Für einen Moment spürte Manolis den vertrauten Stich von Eifersucht. Seine Schwester war der Mittelpunkt einer Familie, und auch im Beruf war sie von Menschen umgeben, die auf sie bauten, und mit allem, was sie tat, rechtfertigte sie dieses Vertrauen.
Christina erhob sich aus der Hocke, zielte mit dem zusammengeknüllten Blumenpapier auf den Abfallkorb, der einige Meter entfernt stand, und traf. »Himmel! Ich bin noch immer wütend auf Babás! Warum konnte er das Urteil nicht akzeptieren und sich des Lebens freuen? Es ist ihm zweimal geschenkt worden. Ein solches Geschenk wirft man doch nicht weg.«
Auch wenn er in manchen Punkten anderer Meinung war, bewunderte Manolis Christinas unbedingten Willen, wenn schon nicht die Welt, dann zumindest misshandelte Frauen zu retten, obwohl die meisten zu ihren prügelnden Männern zurückkehrten. Auch sie glaubte an das Gute im Menschen, an Wahrheit und Gerechtigkeit, genau wie Babás. Sie war ein weiblicher Don Quichotte und hatte keine Ahnung, welche Geister in ihrem Vater gehaust hatten.
»Er war über das Urteil maßlos enttäuscht. Und ganz sicher war er depressiv. Kein Wunder, oder? Nachdem Justitia so eindrucksvoll bewiesen hat, dass sie blind ist.«
»Sie ist unparteilich, nicht blind. Sie urteilt ohne Ansehen der Person. Das bedeutet die Augenbinde.«
»Aber nicht ohne den Einfluss der Mächtigen.«
Wie oft hatten sie dieses Gespräch schon geführt?
Christina starrte auf das Grab. Manolis wusste, was sie dachte, welche stumme Frage sie an Babás richtete. Auch er hatte sie sich schon unzählige Male gestellt. Seine Eltern hatten sich geliebt. Es war möglich, dass Mama sich entschlossen hatte, mit ihm zu gehen, auch wenn Manolis das nicht so recht glauben konnte. Er vermutete, dass sie ihn davon hatte abhalten wollen, indem sie ihn nicht aus den Augen ließ, und deshalb mit ins Auto gestiegen war.
Christina durchbrach seine Gedanken. »Er hätte Mama nicht mitnehmen dürfen.«
»Du sagst das, als hätte er gewusst, was passieren würde. Im Polizeibericht ist von einem Unfall die Rede.« Es war ihm ein Rätsel, weshalb er seinen Vater vor seiner Schwester immer wieder in Schutz nahm, obwohl sie beide das Gleiche dachten.
Sie wandte sich zu ihm um, und ihre Schultern, Arme und Hände sackten herab wie ein einziger großer Seufzer. »Ach, Mani, wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Im Gutachten steht, dass die Ursache nicht geklärt werden konnte. Sie vermuten nur, dass Babás zu schnell gefahren und der Wagen deshalb auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten ist.«
Weshalb hatte Babás nie etwas unternommen, um Justitias Waagschalen ins Gleichgewicht zu bringen? Lange Zeit hätte man noch etwas tun können. Lautlos. Unauffällig.
Manolis kannte die Antwort. Nur nicht auffallen. Niemals aufbegehren. Mach dich unsichtbar. Schwimm mit dem Strom. Das ewige Mantra seines Vaters. Seine Überlebensstrategie.
»Alles in Ordnung mit dir?« Besorgt sah Christina ihn an.
»Natürlich.«
»Wenigstens ist ihm das IGH-Urteil erspart geblieben. Er würde sich im Grab umdrehen, wenn er davon wüsste.«
»Lass es gut sein. Es ist nicht mehr zu ändern.« Sein Tonfall geriet ungeduldiger als beabsichtigt. »Entschuldige.«
Sie strich ihm über den Arm. »Ist schon gut.«
Für eine Weile verharrten sie noch vor dem Grab ihrer Eltern, jeder in seine Gedanken versunken, dann hakte Christina sich bei ihm ein.
»Sollen wir etwas essen gehen, oder musst du gleich zurück ins Autohaus?«
»Schöne Idee. Ich bin der Boss und gebe mir frei.«
»Dein Laden läuft hoffentlich so gut, dass du deiner ewig klammen Schwester eine Pizza spendieren kannst.«
Er war froh, dass sie das Thema gewechselt hatte, und ging erleichtert auf ihren Tonfall ein. »Wenn ich meine letzten Kröten zusammenkratze, sollte es reichen«, meinte er lachend.
»Kaufen die oberen Zehntausend etwa keine Luxusautos mehr?«
»Doch, doch. Ich kann nicht klagen. Mir wird ganz schwindlig, wenn ich daran denke, wie viel ich dieses Jahr ans Finanzamt überweisen muss.«
Christina stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Wenn es dir derart gut geht, hast du sicher eine kleine Spende für meinen Not leidenden Verein übrig. Die Kasse ist ziemlich leer.«
»Wie viel brauchst du denn?«
Ein Lachen war die Antwort. »Frag lieber nicht.«
»Ist dir mit fünftausend geholfen?«
Für eine Sekunde lehnte sie den Kopf an seine Schulter. »Mehr als geholfen. Danke, Mani. Du bist ein guter Mensch.«
Weshalb dachten das alle? Unwillkürlich stieß er ein leises Schnauben aus.
»Was denn? Es stimmt.«
»Ich überweise dir das Geld noch heute. Hast du Lust, den neuen Italiener am Wittelsbacher Platz auszuprobieren? Er soll sehr gut sein.«
Bevor Christina antworten konnte, vibrierte eines der beiden Handys in seiner Sakkotasche. Es war das nicht registrierte.
2
Manolis zog das Smartphone hervor, dessen Nummer außer ihm nur zwei Menschen kannten. Eine leichte Unruhe stieg in ihm auf, als er Bernd Kösters Namen auf dem Display sah. Die Sache mit Huth war reibungslos abgelaufen. Alles eine Frage der Vorbereitung. Er hatte sich keinen Fehler erlaubt. Oder etwa doch?
»Entschuldigst du mich einen Augenblick? Der Anruf ist wichtig.«
»Na klar«, sagte Christina. »Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns am Parkplatz.«
Er sah ihr nach, bis sie außer Hörweite war. »Hallo, Bernd. Gibt es ein Problem?«
»Nein, nein. Alles wie erwartet.« Kösters Bariton rollte mit leichtem Frankfurter Dialekt an Manolis’ Ohr. »Natürlich haben sie die Familie Veen im Visier. Doch alle haben Alibis, und es gibt keine Spuren, was man so hört. Gute Arbeit.«
»Danke.«
»Ich hätte da einen neuen Auftrag für dich, keine große Sache.«
»Worum geht’s?«
»Du sollst nur jemanden für mich im Auge behalten: Christian Wiesinger. Er lebt in München und ist auf der Suche nach Unterlagen, die einem meiner Mandanten gehören. Wenn er sie gefunden hat, nimmst du sie ihm ab. Das ist alles.«
»Klingt nach einem Spaziergang. Gibt’s einen Haken?«
»Kein Haken. Ein einfacher Job. Ich schicke dir die nötigen Informationen noch heute per Kurier. Ins Autohaus?«
»Besser in die Wohnung.«
»Gut. Ruf mich an, wenn sie da sind.«
Manolis steckte das Smartphone ein und ging Richtung Ausgang.
Auch wenn Christina das anders sah, Justitia war gelegentlich blind. Zum Beispiel im Mordfall Milena Veen. Das spurlose Verschwinden der siebzehnjährigen Tochter eines Düsseldorfer Unternehmers hatte vor fünf Jahren für Aufregung gesorgt. Ihre Leiche hatte man schließlich auf einer Müllhalde gefunden. Die junge Frau war über mehrere Tage gefoltert, missbraucht und schließlich ermordet und wie Abfall entsorgt worden. Eine grauenhafte Tat, die ungeklärt und ungesühnt geblieben war, obwohl es einen Tatverdächtigen und einen Prozess gegeben hatte.
Peter Huth war ein Bekannter der Familie, gegen den schon einmal ermittelt worden war. Damals hatte ihn seine ehemalige Lebensgefährtin wegen schwerer Körperverletzung angezeigt. Zur Anklage war es aufgrund fehlender Beweise nie gekommen. Huth geriet in Verdacht, weil er Milena kurz zuvor auf einer Party belästigt hatte und die Auswertung der Funkzellendaten ergab, dass sein Handy sich zur selben Zeit in derselben Funkzelle eingeloggt hatte wie Milenas Handy, bevor es ausgeschaltet worden war, was sie selbst nie tat. Huth bestritt die Tat und nahm sich einen erstklassigen Verteidiger. Am Ende des Prozesses gab es Zweifel an seiner Schuld, vor allem, weil der Tatort nicht ausfindig gemacht werden konnte. Aus Mangel an Beweisen wurde Huth freigesprochen.
Ein rabenschwarzer Tag für die Justiz, denn vor acht Monaten hatten Bauarbeiter beim Abriss einer leer stehenden Ziegelbrennerei ein Verlies mit einer blutigen Matratze und Milenas verschwundener Schmetterlingskette entdeckt. Endlich hatte man den Tatort gefunden. Tatrelevante Spuren konnten nach einer DNA-Analyse zwar Peter Huth zugeordnet werden, doch es gab ein rechtskräftiges Urteil, und damit war Strafklageverbrauch eingetreten. Huth konnte wegen desselben Verbrechens nicht ein zweites Mal vor Gericht gestellt werden. Es sei denn, er hätte gestanden, was er nicht tat. Im Gegenteil. Er inszenierte sich als Opfer einer Verleumdungskampagne, gab Interviews und saß sogar als Gast in einer Talkshow, in der er den Ermittlungsbehörden Fehler bei der DNA-Analyse unterstellte und zum Schluss die Finger zum Victory-Zeichen hob. Eine unerträgliche Geste für Milenas Vater, der sich in seiner Ohnmacht an Köster gewandt hatte. Manolis konnte es Veen nicht verdenken.
Er erreichte den Parkplatz, wo Christina Zeitung lesend auf einer Bank saß und aufsah, als er sich neben sie setzte.
»Hast du von dem Mädchenmörder gehört, den sie laufen lassen mussten?«
»Aber sicher. Es kam ja auf jedem Sender. Jemand hat ihn erschossen.«
Sie zog eine Braue hoch. »Es klingt, als ob du das in Ordnung findest.«
Diese Diskussion würde er nicht führen. »Eigentlich ist es mir egal, obwohl ich eine gewisse Genugtuung nicht leugnen kann.«
»Ja. Ging mir im ersten Moment genauso. Hat der Kerl seine Strafe doch noch bekommen, hab ich gedacht. Aber mit der Todesstrafe hätte er nicht rechnen müssen, jedenfalls nicht in Deutschland. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder, der sich ungerecht behandelt fühlt, Selbstjustiz übt?«
»Huth war schuldig.«
»Nicht, solange er nicht verurteilt war. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.«
»Sie haben seine DNA am Tatort nachgewiesen. Es besteht kein Zweifel daran, dass er der Täter ist. Aber lassen wir das.«
Sie steckte die Zeitung zurück in die Tasche. »Ich glaube ja, dass es Milenas Vater war, obwohl er ein Alibi hat. Immerhin war er beim Bund und hat eine Scharfschützenausbildung. Oder er hat jemanden beauftragt. Über das nötige Kleingeld verfügt er schließlich.«
»Kann es sein, dass du zu viele Krimis liest?« Manolis wollte das Gespräch nicht ausufern lassen.
Doch so schnell lenkte man Christina nicht ab. »Egal wer und wie, er hat die Welt nicht zu einem besseren Ort gemacht, sondern sich mit Huth auf dieselbe Stufe gestellt. Mörder zu Mörder. Das Recht des Stärkeren ist nicht Gesetz.«
»Natürlich ist es das. Der Stärkere und Anpassungsfähigere überlebt, das nennt man Evolution.«
»Genau das ist der Grund, weshalb sich zivilisierte Gesellschaften auf verbindliche Regeln einigen, die auch die Schwachen schützen und ein Zusammenleben möglich machen. Wir leben nicht mehr in Höhlen.«
Seine Schwester irrte sich. Es galt nur ein Recht. Das Recht des Stärkeren. »Aber diese Regeln werden nicht eingehalten. Am Ende sind es immer die Mächtigen, die sich durchsetzen. Du musst nur die Zeitung aufschlagen und bekommst die Bestätigung dafür. Tag für Tag. Fändest du es tatsächlich besser, wenn Huth weiter frei herumliefe und sich neue Opfer sucht? Er war ein sadistischer Mörder. Die hören nicht ohne Weiteres auf.«
»Du klingst nach Stammtisch, Bruderherz.«
»Und du nach Elfenbeinturm.«
»Zugegeben, wie das alles gelaufen ist, ist furchtbar, wenn nicht sogar grauenhaft. Aber das sind nun mal unsere Gesetze, und im Extremfall muss eine Gesellschaft derartiges Unrecht aushalten können. Mit einer Kalaschnikow stellt man keine Gerechtigkeit her. Unabhängig davon müsste das Strafrecht dringend den Möglichkeiten der modernen Kriminaltechnik angepasst werden. Auch wenn man das Problem dadurch nur für die Zukunft löst. Recht darf nicht rückwirkend geändert werden. Wir werden also noch einige derartige Fälle ertragen müssen.«
Es war keine Kalaschnikow gewesen, sondern ein Präzisionsgewehr. Und wer glaubte, dass man die Welt jemals zu einem besseren Ort machen konnte, der war blind oder ein Träumer. Im Fall Milena Veen hatte die Justiz ihre Chance gehabt, und sie hatte sie verspielt.
Manolis hielt Christina die Wagentür auf. »Was ist nun mit dem Italiener? Sollen wir ihn ausprobieren?«
»Gerne.«
Beim Essen redete Christina viel über ihre Arbeit im Verein, kam dann auf die Kinder und brachte das Gespräch irgendwann auf Greta.
Über ein Jahr hatte Manolis mit Greta zusammengelebt und zum ersten Mal in seinem Leben darüber nachgedacht, ob er seine Einstellung zum Thema Ehe überprüfen und ihr einen Antrag machen sollte.
»Ich habe sie vor ein paar Tagen zufällig in der Fußgängerzone getroffen«, sagte Christina. »Es scheint ihr gut zu gehen, allerdings hat sie sehr solo ausgesehen.«
»Wie erkennt man das denn?«
»Jedenfalls war das mein Gefühl. Sie arbeitet nach wie vor am Flughafen beim Bodenpersonal. Ruf sie doch mal an. Vielleicht lässt sich die Sache ja wieder einrenken. Ich habe immer geglaubt, dass ihr mal heiraten werdet.«
Die Hoffnung hatte sich zerschlagen, und es tat noch immer weh, wenn er an Greta dachte, obwohl inzwischen acht Monate vergangen waren, seit sie nach Wochen fruchtloser Diskussionen und dubioser Vorwürfe ihre Sachen gepackt und ihn verlassen hatte. Ich kann nicht mit einem Mann zusammenleben, dem ich nicht vertraue, der Geheimnisse vor mir hat und das auch noch als sein gutes Recht ansieht.
Manolis legte die Gabel beiseite. »Anscheinend bin ich für die Ehe nicht geschaffen.«
»Was soll das denn heißen? Frönst du etwa der Vielweiberei und hast sie wirklich betrogen, wie sie es vermutet?«
»Es soll heißen, dass ich kein Fan davon bin, sich in einer Beziehung völlig nackt zu machen. Man muss nicht alles vor dem anderen ausbreiten und sezieren. Manches ist zu intim und persönlich.«
»Nicht, wenn man sich liebt.«
Er hatte Greta geliebt. Trotzdem … Manolis rang sich ein Lächeln ab. Alles hatte seinen Preis. Vielleicht war der, den er zahlte, ja doch zu hoch. »Du bist eine Romantikerin.«
»Und du weichst wieder einmal aus. Aber bitte, ich mische mich nicht ein.« Sie zuckte mit den Schultern. »Das Saltimbocca ist übrigens köstlich.«
Nach dem Essen verabschiedeten sie sich mit einer Umarmung vor dem Lokal. Christina ging zur U-Bahn, und er fuhr zurück nach Schwabing ins Autohaus.
Während seiner Abwesenheit hatte sein Geschäftsführer Max Hillebrand einen Jaguar F-Type an einen Immobilienmakler verkauft, der zuvor damit zwei Testfahrten unternommen und den Wagen gegen eine symbolische Gebühr übers Wochenende ausgeliehen hatte. Ein lohnender Einsatz, ganz wie Max vorausgesagt hatte. »Nach dem Wochenende wird er ihn haben wollen.« Genau so war es gekommen. Außerdem gab es mehrere Interessenten für Probefahrten, nur in der Werkstatt sorgte ein Lehrling für Probleme, doch Max meinte, den würden sie schon wieder auf Kurs bringen. Er hatte den Laden im Griff, und Manolis entschloss sich, nach Hause zu gehen.
Kösters Kurier würde bald kommen.
3
Mit einem Klick schloss Vera Mändler die Datei. Der Artikel über Hormon-Yoga in den Wechseljahren war fertig. Margot Classen, die Chefredakteurin, wartete bereits darauf. Vera schrieb ihr eine E-Mail, dass sie den Beitrag auf die gewünschte Zeichenzahl gelängt und sogar den Name der Yogastudiokette untergebracht hatte, die das Gewinnspiel sponserte. Product-Placement war das noch nicht, aber zumindest eine Wanderung entlang des Grats journalistischer Unabhängigkeit. Selbstverständlich buchte das Unternehmen im Gegenzug eine Anzeige.
»Fertig?«, fragte Jessica, die Vera gegenübersaß und die Rubrik mit dem aktuellen Promi-Gossip einer letzten Korrektur unterzog.
»Gott sei Dank.« Vera lockerte die verspannten Schultern. Hormon-Yoga. Meine Güte! Wenn man ihr jemals prophezeit hätte, dass sie eines Tages über derartige Themen schreiben würde, hätte sie gelacht. Doch nun war es so, und sie sollte dankbar sein, eine feste Stelle zu haben, und sei es nur bei Amélie, einer Frauenzeitschrift mit Zielgruppe fünfzig plus.
Das Telefon klingelte. Nicole vom Empfang meldete sich. »Besuch für dich. Hast du Zeit, oder soll ich ihn abwimmeln?«
»Wer ist es denn?«
»Oh, ’tschuldigung, ganz vergessen. Christian Wiesinger. Er sagt, er wäre dein Cousin.«
Nur mit Mühe unterdrückte Vera ein Stöhnen. Eigentlich hätte sie es sich denken können, dass Chris hier irgendwann auftauchen würde, nachdem sie ihn am Telefon zweimal abgewimmelt hatte. »Sag ihm, dass ich schon weg bin. Ich muss sowieso gleich los zu einem Termin.«
Wenn sie pünktlich zu ihrer Verabredung mit Viktor Bracht kommen wollte, sollte sie sich sputen. Die fünf Minuten, die ihr noch blieben, benötigte sie für eine kleine Retusche. Der Aufwand wurde täglich größer, um mit dreiundvierzig noch so auszusehen, als wäre sie fünfunddreißig. Nicht dass sie ein Problem damit hatte. Der Mensch alterte nun mal und sollte dankbar dafür sein. Wer wollte schon jung sterben? Doch bei den Frauenzeitschriften galten unausgesprochene Regeln, jedenfalls was die Mitarbeiterinnen betraf. Die männlichen Kollegen durften ergrauen, Falten bekommen und Bäuche ansetzen. Diese Zeichen der Zeit verliehen ihnen eine Patina aus Erfahrung, Würde und Weisheit, während es bei den Frauen gleich hieß, sie ließen sich gehen.
Vera verabschiedete sich von Jessica und überprüfte ihr Make-up vor dem Schminkspiegel auf der Damentoilette. Ein wenig Puder und die Lippen nachziehen. Mehr war mit Blick auf die Uhr nicht drin und eigentlich auch nicht nötig.
Chris fiel ihr wieder ein. Kam einfach in den Verlag. Der Druck musste wirklich groß sein. Trotzdem würde er keinen Cent von ihr bekommen. Seit beinahe fünf Jahren hatte sie ihren Cousin nicht gesehen. Damals hatte er versucht, ihr eine Geldanlage anzudrehen, die ihr sofort suspekt erschienen war. Angeblich kein Risiko und das bei einer verführerisch hohen Rendite. Daran war garantiert etwas faul, und Chris traute sie ohnehin nicht über den Weg. Nur ein Jahr später hatte sich ihre Vorsicht als berechtigt erwiesen. Mehr als zwei Dutzend Anleger hatten sich von ihm übers Ohr hauen lassen. Eine Verurteilung wegen Anlagebetrugs war die Folge gewesen. Chris musste Designerklamotten gegen Gefängniskluft tauschen und das schicke Appartement gegen eine Zelle. Vor sechs Monaten war er vorzeitig entlassen worden. Angeblich weil er den Schaden, soweit möglich, wiedergutgemacht hatte. Sprich: Er hatte jenen Teil des Geldes, den er nicht für seinen aufwendigen Lebensstil verprasst hatte, aus den Geldverschiebebahnhöfen zurückgeholt und an die Geschädigten ausgezahlt. Das hatte Vera von Tante Kathrin erfahren. Offenbar war Chris nun restlos blank und versuchte, jeden anzupumpen.
Vera warf einen prüfenden Blick in den Spiegel. Der hellrote Lippenstift passte gut zu ihren blauen Augen und dem walnussbraunen Haar, und ihr Outfit war für ein informelles Bewerbungsgespräch gerade richtig: Jeans, weiße Bluse, Donna-Karan-Blazer. Mit der Fingerkuppe strich sie eine Augenbraue glatt und beschloss, das Verlagsgebäude über die Tiefgarage zu verlassen. Gut möglich, dass Chris vor dem Haupteingang wartete.
Als der Lift endlich kam, stand Margot Classen in der Kabine. Mit jedem Jahr wurde sie eine halbe Konfektionsgröße weniger. Bald würde sie bei XXXS angekommen sein und in einen Kindersarg passen, wenn sie endgültig verhungert war. Vera schämte sich für diesen Gedanken, aber nur ein wenig, denn es steckte zu viel Wahrheit darin, und eigentlich mochte sie Margot.
»Machst du schon Feierabend?«
Aber nein, dachte Vera. Wie kommst du denn darauf? Ich habe diese Woche doch erst fünfzig Stunden auf der Galeerenbank gerackert, und das für ein lausiges Gehalt. »Ich muss für eine Recherche außer Haus.«
»Worum geht’s?«
»Ist noch nicht spruchreif. Wenn es interessant wird, stelle ich den Stoff bei der nächsten Themenkonferenz vor.«
»Gut«, antwortete Margot. »Ich bin gespannt.«
Vera konnte Margot ja schlecht erklären, dass sie sich mit dem Ressortleiter Politik und Gesellschaft der Münchner Zeitung traf, weil sie sich Hoffnungen auf die in seiner Redaktion frei werdende Stelle machte.
Der Lift ruckelte abwärts.
Margot lehnte sich an die Wand. »Hast du mal einen Moment für mich?«
»Natürlich.«
»Was ich dir jetzt sage, bleibt aber vorerst unter uns.«
Vera lächelte interessiert, während sie am liebsten ihr Smartphone hervorgezogen hätte, um einen Blick auf die Uhrzeit zu werfen. »Jetzt bin ich gespannt.«
Margot strich sich eine blonde Strähne hinters Ohr. »Ich hatte gestern einen Termin beim Verleger. Er will mich in die Geschäftsleitung holen.«
»Das ist großartig, Margot. Gratuliere.«
Margot klopfte dreimal auf die Holzleiste, die auf Hüfthöhe angebracht war. »Danke. Aber noch ist nichts in trockenen Tüchern. Wenn ich in die Geschäftsleitung wechsle, braucht Amélie eine neue Chefredakteurin, und du wärst die ideale Nachfolgerin. Ich würde dich gerne vorschlagen. Was meinst du?«
Es war wie ein Schlag in die Magengrube, obwohl Vera wusste, dass sie eigentlich jubeln sollte. Chefredakteurin! Allerdings von Amélie. Das hieß: auf ewig Hormon-Yoga, Beauty-Tipps für die reife Frau und Lebensberatung frei nach dem Motto: »So halten Sie Ihr Sexleben während der Menopause in Schwung«. Das war nicht das, was sie wollte. Sie wollte zurück in ihr Metier und über Gesellschaft, Politik und Soziales schreiben.
»Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das wäre fantastisch.«
Gott sei Dank kam der Lift in der dritten Etage an, wo sich die Chefredaktion befand, denn Vera hätte keine Sekunde länger Begeisterung mimen können. Das war ihre Achillesferse. Man sah ihr zu schnell an, was sie dachte. Die Türen öffneten sich, Margot stieg aus.
»Okay, dann mache ich mich für dich stark. Aber bis dahin …« Sie legte einen Finger an die Lippen.
»Du kannst dich auf mich verlassen.«
Die Türen schlossen sich wieder. Vera fuhr weiter in die Tiefgarage und verließ über die Zufahrtsrampe das Haus.
Chefredakteurin von Amélie. Nicht wirklich, oder?
Es wäre ein Stück Sicherheit, sagte ihre innere Stimme. Warten wir ab, wie das Gespräch mit Bracht läuft, hielt Vera dagegen.
Um zur U-Bahn-Station zu gelangen, musste sie am Haupteingang vorbei, und dort stand tatsächlich ein Mann im Schatten der Bäume, den sie erst auf den zweiten Blick als Chris erkannte. Er war längst nicht so gepflegt und gut gekleidet wie früher. Statt eines eleganten Anzugs trug er Jeans und Lederjacke, statt Maßschuhen Nikes. Zum Frisör hätte er auch mal wieder gemusst, das war sogar aus dieser Entfernung nicht zu übersehen. Sein Anblick verursachte ihr Unbehagen, und es dauerte einen Moment, bis sie darauf kam, woran es lag. In diesem Aufzug ähnelte er ihrem Vater Joachim, der vielleicht auch seiner war. Womöglich waren sie gar nicht Cousin und Cousine, oder vielmehr doch, denn an einer Tatsache gab es nichts zu rütteln: Seine Mutter war die Schwester ihrer Mutter. Nur wer war sein Vater? Das war die große unbeantwortete Frage.
Ihr Vater hatte die Familie verlassen, als Vera fünf Jahre alt gewesen war. Eines Abends hatte er erklärt, dass er es mit Mama nicht einen Tag länger aushalten würde. Und ja: Es gab eine andere. Wenn Mama es unbedingt wissen wollte, es war Ursula, ihre Schwester.
Tante Ursula nannte sich Uschi und war völlig emanzipiert. Sie arbeitete als Beleuchterin bei einer Filmproduktionsfirma, rauchte Gauloises, las Simone de Beauvoir und war Mutter des zweijährigen Chris, den sie allein großzog und um dessen Erzeuger sie ein Geheimnis machte. Sie hatte von ihm nicht mehr gewollt als ein Kind, das behauptete sie jedenfalls. Doch Veras Mutter Annemie zweifelte daran. Ein Kerl hatte Uschi geschwängert und sitzengelassen, aber das konnte sie natürlich nicht zugeben. Deshalb das ganze Gerede, dass sie ihr Leben niemals in patriarchale Strukturen zwängen und sich einem Mann unterordnen würde. Ihr Scheitern in einen Sieg zu verwandeln, gelang Uschi meist mühelos.
Natürlich war Veras Mutter vom Tag der Trennung an davon überzeugt, dass Joachim der Vater von Chris war, was er nie zugab und Uschi auch nicht. Nur ein Jahr später starb er an einer Herzmuskelentzündung, und Uschi hielt weiterhin den Mund, weil das Schweigen ihr die Macht gab, ihre Schwester zu quälen und sich so für Joachims Tod zu rächen, obwohl Mama dafür nun wirklich nichts konnte.
Was für eine Familie!
Vor zwei Jahren hatte Vera eine Serie über Frauen in ungewöhnlichen Berufen geschrieben und dafür Tatjana Thul interviewt, eine Humangenetikerin, die in Martinsried ein Zentrum für DNA-Analysen betrieb. Damals hatte sie mit dem Gedanken gespielt, sich in dieser Frage Gewissheit zu verschaffen. Doch Chris saß im Gefängnis, und sie hätte ihn besuchen müssen, um an eine DNA-Probe von ihm zu gelangen. Das war es ihr nicht wert gewesen.
Nun stand er dort drüben vor der Drehtür und sah aus wie ihr Vater, und wieder einmal beschäftigte sie die Frage, ob er ihr Halbbruder war.
Vera mischte sich unter eine Gruppe Touristen und erreichte von Chris unbemerkt den U-Bahnhof.
Mit fünf Minuten Verspätung betrat sie das Café Cord und sah sich um. Fünfzigerjahre-Look, modern interpretiert, so würde sie das Ambiente beschreiben. Eine angenehme Atmosphäre mit lauschigen Ecken für erste Dates, großen Tischen für Gruppen und einer langen Bar für alle, die gerne sahen und gesehen wurden. Über eine Treppe ging es nach oben auf die Galerie, und über allem wachte ein raumhohes SchwarzWeiß-Porträt von Maria Callas, das der Innenausstatter auf eine goldfarbene Wand hatte drucken lassen. Nur die Lippen waren rot und Bracht noch nicht da.
Vera nahm an einem Tisch in einer ruhigen Ecke Platz. München war ein Dorf, und sie war nicht erpicht darauf, dass jemand sie mit dem Ressortleiter eines anderen Verlags sah.
Als die Bedienung kam, bestellte sie einen Café au Lait und bemerkte Bracht, der auf sie zusteuerte. Sie war ihm erst einmal persönlich begegnet, als er im Literaturhaus einen Vortrag über die Kostenlosmentalität im Internet gehalten hatte und sie sich beim anschließenden Stehempfang über Internet-Piraterie und das Urheberrecht unterhalten hatten. Die Art, wie er seinen Standpunkt vertrat, hatte auf sie ein wenig rechthaberisch gewirkt.
Vom Typ war er mehr Manager als Ressortleiter, immer busy, stets das Telefon am Ohr, hervorragend vernetzt. Alter: um die fünfzig. Figur: leichtes Übergewicht. Hohe Stirn und die buschigen Brauen im selben Blondgrau meliert wie das lichter werdende Haar.
»Frau Mändler, grüße Sie.« Er reichte ihr die Hand, öffnete den Knopf am Sakko und legte sein Smartphone auf den Tisch. Während er sich setzte, sah er sich um. »Nett hier. Könnte mir gefallen.«
Das war doch ein guter Einstieg für ein wenig Small Talk zum Aufwärmen. »Ich habe das Cord auch erst vor Kurzem entdeckt. Ich mag vor allem die Callas.« Vera wies auf das überlebensgroße Porträt im hinteren Bereich.
Bracht beugte sich vor, um die Grafik besser sehen zu können, rückte dabei die Brille mit dem weinroten Rand zurecht und sah zwischen Vera und der Callas hin und her. »Sie haben denselben Mund«, sagte er schließlich. »Exakt die gleiche Form. Verrückt. Sind Sie etwa verwandt?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Und wie steht es mit dem Gesang?«
Vera lachte. »Für die Bühne reicht es bei mir nicht. Nur für die Dusche.«
»Ach? Da wäre man ja gerne mal dabei.«
Sein Smartphone summte. Er griff danach und las die eingegangene Nachricht, während Vera sich fragte, was das gerade gewesen war. Eine gedankenlose Bemerkung eines zerstreuten Mannes oder eine dämliche Anmache? Warum hatte sie auch die Dusche erwähnt?
Die Bedienung kam mit dem Café au Lait und fragte Bracht nach seinen Wünschen. Er sah kurz auf, bestellte einen Espresso und beantworte die SMS, als wäre Vera gar nicht anwesend. Langsam stieg Ärger in ihr auf, und für einen Moment spielte sie mit dem Gedanken, sich zu verabschieden.
Endlich war er fertig und legte das Handy beiseite. »Entschuldigen Sie. Es ist eine richtige Unsitte geworden, sich ständig diesen Geräten zu widmen. Nicht mehr lange und wir werden vollends ihre Sklaven sein.«
»Ja, das ist eine Befürchtung, die ich durchaus teile.«
»Hoppla. Sie sind ja richtig böse auf mich.«
»Wieso? Ich stimme Ihnen zu. Konventionen ändern sich.«
Damit hatten sie ein Thema gefunden: die Abhängigkeit von Internet und Smartphones. Die ständige Erreichbarkeit und das ungebremste, ungefilterte Mitteilungsbedürfnis in den sozialen Medien. Brachts Espresso wurde serviert, während sie sich die Bälle zuspielten. Nach fünf Minuten war Vera entspannt und bereit, aufs Wesentliche zu kommen. Ihr Gegenüber hatte offenbar dieselbe Idee. Bracht lehnte sich im Stuhl zurück. »Worum geht es denn nun bei unserem konspirativen Treffen?«
»Sagen wir um eine Art Bewerbungsgespräch.«
»Ach? Sie bei uns?« Er zwirbelte eine Braue. »Eine interessante Vorstellung. Habe ich denn eine Stelle zu vergeben?«
Vera gefiel der Tonfall nicht, so halb amüsiert. »Bald. Da dachte ich mir, ich hebe mal kurz den Finger, bevor Sie eine Anzeige schalten.«
»Es hat wohl keinen Sinn, Sie um Ihre Quelle zu bitten.«
Es war eine rhetorische Frage, und Vera sah, wie er in Gedanken die Mitglieder seiner Redaktion durchging. Wer wollte kündigen? Und weshalb?
Es war Anita Lemper.
Vera und sie waren gemeinsam auf der Journalistenschule in Hamburg gewesen. Anitas Mann wurde nach Köln versetzt, und sie ging mit ihm. Von ihr kam auch der Tipp, Bracht auf die Neubesetzung der Stelle anzusprechen, bevor es offiziell war, denn dann würden die Bewerbungen zu Hunderten kommen. Andererseits wollte Anita erst kündigen, wenn der Vertrag ihres Mannes unterschrieben war, und hatte Vera daher gebeten, ihren Namen vorerst nicht zu nennen.
Deshalb nickte sie nur vielsagend, zog aus der Handtasche die Mappe mit ihren Unterlagen und legte sie auf den Tisch. »Ich habe nicht immer für Illustrierte gearbeitet. Nach meiner Ausbildung in Hamburg war ich zehn Jahre bei verschiedenen Tageszeitungen. Ich kenne das Metier also, ebenso den Druck, täglich zu liefern. Meine Ressorts waren Gesellschaft, Politik und Soziales, dorthin würde ich gerne zurück.« Sie zählte die Zeitungen und Magazine auf, für die sie geschrieben hatte, verwies auf die Interviews und Artikel in der Mappe und bemerkte die Abwehr, die sich auf Brachts Miene zeigte.
»Das ist Jahre her, und seither arbeiten Sie für diese Frauenblätter.« Aus seinem Mund klang es, als wäre Amélie der letzte Schund im Morast publizistischer Niederungen. »Botox, Silikontitten, Brazilian Waxing. Ich bitte Sie. Damit sehe ich Sie ehrlich gesagt nicht bei uns. Aber denken Sie jetzt bloß nicht, dass ich Probleme mit Frauen habe. Nicht in meiner Redaktion und schon gar nicht singend unter der Dusche.«
Er bedachte sie mit einem Lächeln, das ihr zeigen sollte, welches Bild er sich gerade ausmalte.
4
Manolis’ Wohnung befand sich nicht weit vom Autohaus entfernt im Dachgeschoss eines Gebäudes aus der Gründerzeit im schönsten Teil Schwabings, in der Nähe des Englischen Gartens. Hohe Zimmer, große Fensterflächen zur Dachterrasse. Helle Farben und moderne Einrichtung, honigfarbenes Fischgrätparkett und stuckverzierte Decken. Er nahm diesen Luxus nicht als selbstverständlich hin und genoss ihn jeden Tag bewusst. Denn er vergaß nie, wie die Alternative aussehen könnte.
Wenn er vor über zwanzig Jahren nicht Köster über den Weg gelaufen wäre, säße er jetzt vermutlich im Gefängnis oder läge bereits six feet under. Ohne ihn, der ihn unter seine Fittiche genommen hatte und in gewisser Weise die Vaterstelle bei ihm vertrat, hätte er weder seine Wut in den Griff bekommen, noch die schönen Seiten des Lebens entdeckt und gelernt, sie zu genießen. Malerei, Musik, das Theater, gutes Essen, Literatur. Auf keinen Fall hätte er es zum eigenen Autohaus gebracht. Ein Zufall hatte seinem Leben eine andere Richtung gegeben.
Mittlerweile regnete es. Rinnsale liefen an den Scheiben hinab. Er machte in allen Räumen Licht, ging in die Küche und bereitete sich ein Kännchen japanischen Sencha zu, bevor er im Arbeitszimmer den PC einschaltete und die versprochenen fünftausend Euro an Christinas Verein überwies. Mit dem Tee kehrte er ins Wohnzimmer zurück, suchte im Regal mit den Vinylplatten nach einem Klavierkonzert von Mozart und legte es auf.
Mozart, Beethoven, Haydn. Früher hätte man ihn damit jagen können. Mit zwanzig hatte er Punk gehört, was seiner damaligen Grundstimmung ebenso entsprochen hatte wie heute die klassische Musik. Er verdankte Köster wirklich viel.
Mit der Tasse in der Hand trat er ans Fenster. Der Wind war stärker geworden, wirbelte altes Laub aus der Dachrinne am Haus gegenüber und ließ es durch die Luft tanzen, wie die Geister längst vergangener Sommer.
Dreiundzwanzig Jahre waren vergangen, seit ein Zufall ihn und Köster in Frankfurt zusammengeführt hatte, in einer schwülen Augustnacht voller Gewalt und Blut. Damals war er ein orientierungsloser Zwanzigjähriger gewesen, der das Gymnasium kurz vor dem Abitur geschmissen und nach einem Jahr auch die Mechanikerlehre abgebrochen hatte. Dafür konnte er eine zur Bewährung ausgesetzte Vorstrafe wegen Körperverletzung, die Enttäuschung seiner Eltern und eine absehbare Zukunft vorweisen. Wenn er so weitermachte, würde er früher oder später im Knast landen. Das war damals sogar ihm klar gewesen. Doch die Kräfte, die in ihm walteten, waren meist stärker als Einsicht oder Vernunft.
Sein größtes Problem war, dass er sich nicht im Griff hatte. Zu unbeherrscht und aufbrausend, zu schnell gekränkt und verletzt, nur allzu schnell bereit, alles aufzugeben, hinzuwerfen und vor allem zuzuschlagen, um sich Luft zu verschaffen und die Wut abzubauen, die in ihm brodelte. Wut, von der er nicht wusste, woher sie kam. Vermutlich hätte ihm ein Psychotherapeut, wenn er denn einen gehabt hätte, erklären können, woran es lag. So hatte er es selbst herausfinden müssen, und das hatte gedauert.
In jener schwülen Sommernacht vor dreiundzwanzig Jahren in Frankfurt war er jedenfalls randvoll damit gewesen und auf der Suche nach Zoff, nach Beef, nach einer Schlägerei. Ein Mädchen hatte ihn abblitzen lassen, und wenn ihm jetzt noch einer blöd käme, würde er Prügel beziehen. So viel war klar, und es schien so weit zu sein, als er mit seinem getunten BMW – den er sich nur leisten konnte, weil er sich mit zwei Polen eingelassen hatte, die Autos verschoben – in eine Fahrzeugkontrolle geriet und ausgerechnet ein Polizist ihn anmachte. Der Beamte, der zur heruntergelassenen Seitenscheibe in den Wagen sah, verlangte in überheblichem Tonfall die Fahrzeugpapiere und den Führerschein und wollte obendrein wissen, woher Manolis kam.
»Ist das wichtig?«
»Nur wenn Sie etwas getrunken haben.« Er klappte den Führerschein zu und gab ihn zurück. »Und? Haben Sie etwas getrunken?«
»Ja klar. Zwei Liter Wasser. Ich achte auf meine Gesundheit.«
Bei der Erinnerung an diese Szene musste Manolis lachen. Herrgott, was für ein arrogantes Arschloch er damals gewesen war. Doch der Polizist hatte die Ruhe bewahrt.
»Ich dachte eigentlich an Alkohol.«
Wieder ließ er ihn auflaufen, bis der Bulle erneut nachfragte und ihn schließlich pusten ließ. Null Komma drei Promille. Manolis dachte schon, er könne weiterfahren, doch dann bemerkte der Wichtigtuer den Heckspoiler, der vom TÜV noch nicht abgenommen und daher in den Papieren nicht eingetragen war, und ein Lächeln zog über sein Gesicht.
»Es ist für Sie sicher kein Problem, wenn Sie den Rest des Wegs zu Fuß gehen müssen. Sie achten ja auf Ihre Gesundheit.«
Ehe er es sich versah, zog der Polizist den BMW aus dem Verkehr und kratzte das TÜV-Siegel ab. Manolis biss die Zähne zusammen, bis sein Kiefer schmerzte, und krallte die Hände ums Lenkrad, damit er sie nur ja nicht einsetzte. Er war auf Bewährung und wollte nicht in den Knast. Doch genau das würde passieren, wenn er diesem Arsch die Faust ins Gesicht rammte.
Also riss er sich zusammen und machte sich zu Fuß auf den Weg. Bald ging er nicht mehr, sondern lief. Der Ärger musste raus und er von seinem Adrenalinrausch runterkommen. Verdammt! Er war stinkwütend und lauschte dem rhythmischen Echo seiner Schritte auf dem Asphalt, spürte das Herz in seiner Brust trommeln und den Schweiß, der ihm über den Oberkörper lief. Das Shirt klebte auf der Haut, und die Nacht war schwül und schwer. Kein Stern am Himmel, kein Lufthauch, der ein wenig Abkühlung brachte. Über ihm ein Wetterleuchten, neben ihm die Lichter des Verkehrs.
Er achtete erst wieder auf seine Umgebung, als er die Stille um sich bemerkte und keine Ahnung hatte, wo genau er sich befand. Irgendwo im Bahnhofsviertel, in einer heruntergekommenen Nebenstraße. Auf der einen Seite mit Metalljalousien verrammelte Läden, auf der anderen ein Spielplatz. Nur jede zweite Straßenlaterne funktionierte, und vom Bordstein stieg der Dunst von Pisse und Kotze auf. Verdammte Scheiße, wo war er hier? Er bog um eine Ecke und erfasste innerhalb einer Sekunde, was fünf Meter vor ihm im dürftigen Lichtkegel einer Laterne geschah. Ein Gerangel zwischen zwei Männern. Übergewichtiger Anzugträger gegen einen Kerl vom Typ Tschetschenen-Inkasso. Mister Pirelli lief Blut übers Gesicht und in die Augen. Es war absehbar, wie das Ganze enden würde. Nicht gut für Mister Pirelli.
Dann das Aufblitzen eines Messers.
Erst Jahre später war Manolis klar geworden, dass das Messer der Trigger gewesen war, der ihn handeln ließ, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Es war der andere Manolis, den er da retten wollte, und mit ihm seinen Vater.
Blindlings warf er sich von hinten auf den Tschetschenen. Er riss ihn um, drückte ihn mit seinem Gewicht auf den Boden und presste die Hand mit dem Messer auf den Asphalt, während sein Gegner versuchte, ihn abzuschütteln und wieder auf die Beine zu kommen. Manolis gelang es nicht länger, die Messerhand unter Kontrolle zu behalten. Der andere war stärker. Der Kerl würde ihn abstechen. Es war ein Impuls. Sein Unterarm schnellte wie von selbst vor, legte sich um den Kopf seines Widersachers und riss ihn zurück. Etwas knackte, und im selben Moment erschlaffte der Körper unter ihm. Ein Röcheln wie ein Seufzer folgte noch, dann löste sich die Hand vom Messer. Das alles hatte keine Minute gedauert und war beinahe lautlos abgelaufen.
Die brennende Wut verlosch. Panik breitete sich in ihm aus. Fassungslos starrte er auf den Toten. Shit! Shit! Shit! Was hatte er getan? Das konnte doch nicht sein. Das hatte er nicht gewollt. Es war doch nur ein kleiner Ruck gewesen. Vielleicht war er ja gar nicht tot.
Manolis warf sich auf den Asphalt, tastete an der Halsschlagader des Tschetschenen nach dem Puls und fand nichts. Hilfe suchend sah er sich um. Mister Pirelli stand an einen schwarzen Audi gelehnt und wischte sich mit einem Tempo das Blut vom Gesicht. Einen Moment sahen sie sich schweigend an. Manolis war unfähig wegzulaufen, der andere sichtlich überrascht.
»Danke«, sagte der Mann schließlich. »Du hast mir das Leben gerettet.«
Ich bin ein Mörder, war alles, was Manolis denken konnte. Er würde in den Bau gehen. Für den Rest seines Lebens.
»Genau«, stieß er hervor. »Das war Notwehr. Das müssen Sie der Polizei so sagen.« Vielleicht war es besser, wenn er schleunigst von hier verschwand. Während er noch zögerte, bückte sich der Mann trotz seiner Körperfülle erstaunlich gewandt, hob eine Aktentasche auf und ein Stück rosa Papier, das direkt vor seinen Füßen lag. Es war Manolis’ Führerschein. Shit!
Der Dicke sah ihn sich an, klappte ihn zu und lächelte. »Weißt du was? Ich habe kein Interesse, die Polizei mit dieser Sache zu belästigen, und du vermutlich auch nicht.«
Das Summen der Türglocke holte Manolis in die Gegenwart zurück. Am Haus gegenüber fegte die nächste Bö eine weitere Ladung Blätter aus der Dachrinne. Einen Augenblick beobachtete er noch den wirbelnden Tanz, dann ging er zur Tür und betätigte die Gegensprechanlage.
»Ja, bitte?«
»Citykurier. Ich habe eine Sendung für Sie.«
Manolis bezahlte den Fahrer und nahm das Päckchen in Empfang. Es trug als Absender die Adresse eines Antiquariats in Frankfurt, von dem sich mit Sicherheit keine Spur zu Kösters Kanzlei zurückverfolgen ließ, falls das überhaupt jemals irgendwer versuchen sollte.
Köster hielt noch immer am bewährten Vorgehen fest. Er war zu alt für die digitale Welt. Er misstraute dem Internet ebenso wie E-Mails und natürlich Smartphones. Was Tor-Server waren und Bitcoins, hatte Manolis ihm mehrfach vergeblich zu erklären versucht.
Im Arbeitszimmer öffnete er das Kuvert. Obenauf lag ein Umschlag, der drei Tagessätze à dreitausend Euro enthielt. Nachdem er nachgezählt hatte, legte er das Geld in den Wandsafe. Manolis war gut in seinem Job als lautloser Problemlöser, und Kösters Mandanten konnten sich ein entsprechendes Honorar leisten.
Aus dem Wohnzimmer klang der dritte Satz des Klavierkonzerts, ein Adagio. Es gab diese eine Stelle im ersten Drittel, die ihm, nicht immer, aber häufig, einen Schauer über die Haut jagte. Dieses ein wenig verrutschte Perlen der Melodie, der leicht verzögerte Anschlag der Tasten, der eine nahezu unerträgliche Spannung erzeugte, und bei dem er sich fühlte, als säße er allein in einem Raum ohne Fenster und Tür. Es war schrecklich und schön zugleich, erfüllte ihn für einen Augenblick mit einer unstillbaren Sehnsucht, und dann war es auch schon wieder vorbei. Die Zeit, die für ein paar Sekunden aus dem Takt geraten war, kehrte in ihren Rhythmus zurück. Alles war wie immer. Alles war gut.
Er wartete den Moment ab, doch heute brachte die Musik keine Saite in ihm zum Klingen, und er ging in die Küche, um einen zweiten Aufguss des Tees zuzubereiten. Damit setzte er sich an den Schreibtisch und sah sich die Unterlagen an. Mehrere Schnappschüsse waren darunter. Jemand hatte sie aus einigen Metern Entfernung vor einem Lokal aufgenommen, vermutlich einer der Privatdetektive, mit denen Köster zusammenarbeitete. Der Mann, auf den Manolis ein Auge haben sollte, war Anfang bis Mitte vierzig und sah aus wie ein Arbeiter. Fleckige Hose, eine Jacke aus schwarzem Leder, die ihm zu groß war, strähnige Haare, kantiges Kinn. Etwas an seiner Haltung strahlte Entschlossenheit aus, doch in seinen Augen lag etwas anderes: Furcht.
5
Manolis las die Angaben zur Person. Christian Wiesinger, einundvierzig Jahre alt, Bankkaufmann, vor einem halben Jahr aus der Haft entlassen. Seine Adresse im Stadtteil Giesing war angegeben, ebenso Autokennzeichen und Handynummer sowie eine E-Mail-Adresse.
Manolis rief Köster an. »Alles angekommen. Worum geht’s?«
»Wiesinger hat eine Tante. Sie heißt Kathrin Engesser und wohnt in München in der Treffauerstraße. Die Unterlagen meines Mandanten befinden sich in ihrem Besitz. Wiesinger sucht danach. Mein Klient weiß, dass sie sicher verwahrt sind, aber nicht, wo. Nur, dass sie nicht in der Wohnung von Frau Engesser sind. Du musst Wiesinger lediglich observieren und ihm die Unterlagen abnehmen, sobald er sie gefunden hat.«
»Wonach genau soll ich Ausschau halten? USB-Sticks, Akten oder Fotos? Eine Vorstellung sollte ich schon davon haben.«
Köster räusperte sich. »Akten. Eine Art Dossier.«
»Gut. Ich melde mich.«
Der PC war noch an. Mit dem Browser Veiled ging Manolis ins Darknet und schrieb Rebecca eine Nachricht.
Können wir uns gleich auf den Inseln treffen?
Die Antwort kam beinahe sofort.
Gib mir fünf Minuten.
Scilly Islands. So nannte Rebecca den Ort im Hinterzimmer des Internets, den sie für ihre Treffen eingerichtet hatte. Die Kommunikation lief mehrfach verschlüsselt über ein Tor-Netzwerk und war nicht nachzuverfolgen.
Die Scillys waren eine nahezu unbewohnte Inselgruppe im Atlantik. Manolis hatte sie gegoogelt, und es passte zu Rebecca, dass sie diesen Namen gewählt hatte.
Sie war eine gute Freundin und neben Köster seine einzige Vertraute. Er kannte sie, seit sie vor sieben Jahren bei ihm einen Range Rover gekauft hatte. Damals war sie Anfang dreißig gewesen und eine mit allen Wassern gewaschene IT-Spezialistin auf dem Weg nach ganz oben. In dem Telekommunikationsunternehmen, in dem sie arbeitete, hatte man ihr den roten Teppich ausgerollt und ihr als nächsten Karriereschritt einen Vorstandsposten in Aussicht gestellt.
Manolis unternahm mit ihr erst eine Probefahrt mit dem neuen Discovery und ein paar Tage später im Freelander. Rebecca war eine attraktive Frau, vor allem aber eine starke, und für starke Frauen hatte er eine Schwäche. Irgendwann hatten sie ein Date. Zwischen ihnen begann es zu knistern, und es bahnte sich etwas an, als eines Nachts der Anruf aus dem Krankenhaus kam. Zwei Jugendliche hatten Rebecca auf dem Nachhauseweg von einem Vortrag überfallen und mit einem Holzpfosten zusammengeschlagen. Zusammengeprügelt traf es besser. Manolis hatte schon viel gesehen, doch ihr Anblick hatte ihm Tränen in die Augen getrieben.
Schädelfraktur, etliche gebrochene Rippen, Milzriss, ein Cut in der linken Augenbraue und Hämatome überall. Sie verbrachte Wochen im Krankenhaus. Da sie keine Familie hatte, kümmerte er sich um alles. Er verhandelte mit den Versicherungen, hielt Kontakt zur Polizei, suchte eine gute Rehaklinik für sie, und die Gefühle, die sie füreinander hegten, veränderten sich. Sie wurden kein Liebespaar, dafür aber beste Freunde.
Nach der Reha fand Rebecca nicht in ihr altes Leben zurück. Panikattacken überfielen sie, sobald sie sich in die Öffentlichkeit begab. Ihr Sicherheitsgefühl war verloren gegangen, ebenso das Vertrauen in die Menschen. Manolis empfahl ihr eine Therapie, als sich abzuzeichnen begann, dass sie ihre Wohnung bald gar nicht mehr verlassen würde. Nur dort fühlte sie sich sicher. Doch die Therapie half nicht. Die Panikanfälle wurden schlimmer. Irgendwann waren Geduld und Verständnis ihres Arbeitgebers aufgebraucht. Nachdem Rebecca für mehr als ein halbes Jahr ausgefallen war, rollte man den roten Teppich wieder ein und kündigte ihr, woraufhin sie sich noch weiter einigelte. Sie kaufte ein Penthouse mit Dachterrasse und freiem Blick auf die Alpen. Von dort oben betrachtet, waren die Menschen klein wie Ameisen und nicht mehr bedrohlich. Außerdem gewöhnte sie sich an, soweit möglich, alles online zu erledigen, und ihm gelang es immer seltener, sie vor die Tür zu locken.
Den Prozess stand sie nur durch, weil sie die beiden Siebzehnjährigen hinter Gittern sehen wollte. Obwohl sie ein Beruhigungsmittel genommen hatte, brach sie während ihrer Zeugenaussage zusammen, und dann verurteilte der Richter diese missratene Brut gerade mal zu fünf Monaten Jugendstrafe auf Bewährung. Ein unfassbarer Schlag für Rebecca. Infolge des Urteils zog sie sich noch mehr zurück. Sie hatte nicht nur ihr Sicherheitsgefühl verloren, sondern auch das Vertrauen in den Staat. Sie war ihm nichts mehr schuldig. Sie war quitt mit ihm.
Gezwungenermaßen machte sie sich beruflich als IT-Beraterin selbstständig. Für besondere Kunden hackte sie sich in beinahe jedes Netzwerk, jeden Server und natürlich auch in Smartphones, diese tragbaren Überwachungsgeräte. Als Manolis einmal ihre Hilfe brauchte, weihte er sie in sein Geheimnis ein. Seither war er nicht nur ihr Freund, sondern auch einer ihrer besonderen Kunden.
Ein leiser Signalton erklang. Rebecca war online, und Manolis klickte Scilly Islands an. Die Seite war nicht sehr umfangreich, eher ein Forum, das lediglich zwei User hatte.
Hallo, Manolis,
wie war’s auf dem Friedhof? Alles gut bei dir?
Vielleicht gelingt es mir irgendwann, Babás nicht mehr böse zu sein. Jedenfalls war es schön, Christina zu treffen. Also: eigentlich alles gut bei mir. Und bei dir?
Die nächsten Monate sehe ich nur Blau. Die Hausverwaltung lässt eine Wärmedämmung anbringen. Sie haben ein Gerüst aufgebaut und es mit blauen Planen verhängt. Vielleicht installiere ich ein paar Webcams und hole mir meine Aussicht zurück. Und: wieso ›eigentlich‹ alles gut? Was stimmt denn nicht?
Vergiss das ›eigentlich‹. Wie wär’s mal wieder mit einem Spaziergang?
Lass uns das Thema wechseln. Du wolltest mich sprechen. Was gibt’s? Hoffentlich keinen Stress wegen Huth?
Keine Sorge. Das ist reibungslos gelaufen. Ich muss jemanden überwachen und gebe dir seine Handynummer. Es wär schön, wenn ich mithören könnte. Und wenn du ihn trackst, kann ich ihn an die lange Leine nehmen.
Sollte kein Problem sein. Bis später. Und über ›eigentlich‹ reden wir noch mal.
Über blaue Planen und Spaziergänge dann aber auch.
Ein Handy so zu manipulieren, dass sie es kontrollieren konnte, war für Rebecca eine Kleinigkeit. Der Nutzer bemerkte nichts. Weder dass es eingeschaltet blieb, wenn er dachte, er hätte es ausgemacht, noch dass die Freisprecheinrichtung aktiviert war und so zur Raumüberwachung diente und den GPS-Tracker schon gar nicht, den Rebecca ins System einschleuste.
Manolis mailte ihr die Daten und wollte den Rest Tee trinken, aber der war kalt geworden. Auf dem Weg in die Küche kam er im Flur an der Wand mit den Familienfotos vorbei. Eine Art Muster, wie eine Tapete, die er nur noch selten bewusst wahrnahm. Doch heute war ein merkwürdiger Tag, daher fielen sie ihm auf, und er blieb stehen.
Es waren nur wenige Bilder, darunter auch das Hochzeitsfoto seiner Eltern. Babás so ernst im Anzug mit Schlaghose, das dunkle Haar schulterlang und eine John-Lennon-Brille auf der Nase. Mama sehr selbstbewusst in ihrem Bohemien-Look. Sie trug einen schwarzen Rippenpulli zu Hotpants und sandfarbenen Wildlederstiefeln, die bis zu den Knien reichten, und darüber einen Gehrock aus auberginefarbenem Samt. Ein breiter Hüftgürtel und reichlich Modeschmuck rundeten ihr Hochzeitsoutfit ab. Mamas Eltern wären entsetzt gewesen, wenn sie das gesehen hätten. Doch sie hatten nicht einmal gewusst, dass ihre Tochter heiratete. Einen Ausländer. Einen Gastarbeiter.
Unter dem Hochzeitsfoto hing ein Schnappschuss vom Urlaub an der Nordsee. Manolis nahm das Bild ab. Das musste 1976 gewesen sein, kurz vor seiner Einschulung. Babás und er bauten eine Burg am Strand und waren ganz mit Sand paniert. Nicht einmal die Farbe der Badehosen war noch zu erkennen. Mama stand mit Christina auf dem Arm im türkisfarbenen Bikini und mit einem Tuch im langen Haar daneben.
Was für ein Abenteuer dieser Urlaub gewesen war. Sie hatten im VW-Bus geschlafen und wild gecampt, weil Mama nicht einsah, Geld für Campingplätze auszugeben. Gekocht hatten sie auf Gaskartuschen und am Lagerfeuer. Verkohlte Würstchen, die innen fast noch roh waren. Und dann das endlose Meer, die Wellen, der Sturm, der die Gischt von der Brandung riss. Aber auch Babás und die Wortflut. An der Nordsee zum ersten Mal.
Mama hatte ihn gebeten, Babás zu suchen, das Essen war fertig. Manolis entdeckte ihn am Strand, wo er auf einem Stein saß. Zwei leere Bierflaschen lagen im Sand, eine volle stand daneben. Er hatte die rechte Ferse aufs Knie gelegt und starrte darauf. Als Manolis näher kam, erkannte er, weshalb sein Vater so dasaß. Blut tropfte aus einer Wunde direkt auf eine Muschelscherbe im Sand.
»Hast du dir wehgetan?« Manolis kämpfte gegen das flaue Gefühl im Magen an, denn er konnte kein Blut sehen. »Du musst ein Pflaster drauftun.«
Babás sah nicht auf. »Ist nicht schlimm«, sagte er so leise, als spräche er mit dem Wind. »Das nicht.«
Was war dann schlimm? Sein Vater schien gar nicht richtig da zu sein. So wie Mama, wenn sie einen Joint geraucht hatte. Aber Babás hatte nicht gekifft. Das tat er nie, weil ihn sonst Geister besuchten. Das hatte er einmal gesagt. Deshalb beunruhigte Manolis das Verhalten seines Vaters.
Vielleicht stammte die Wunde ja gar nicht von der Muschelscherbe, sondern von einem Petermännchen. Die hatten giftige Stacheln, weshalb Mama ihnen verboten hatte, barfuß am Saum des Wassers entlangzulaufen. Denn dort vergruben sie sich im Sand und stachen zu, wenn man auf sie trat.
»Soll ich Mama holen?«
»Nein. Das ist nichts.« Wieder sprach sein Vater so leise, dass er ihn kaum verstehen konnte, griff nach der Bierflasche und trank einen Schluck.
»Das Essen ist fertig. Du sollst kommen.«
»Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich einen Bruder hatte?«
Manolis schüttelte den Kopf.
»Und drei Schwestern. Christina, Elena und Athina.«