
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Kids Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Oliver lebt zusammen mit seinem Vater, seinem Bruder Marco und etwa 2.000 weiteren Bewohnern in einem unterirdischen Schutzraum. Denn die Erdoberfläche ist seit dem großen Zusammenbruch im Jahr 2075, als innerhalb kürzester Zeit 99 % der Menschheit an einem Subcholera-Virus starben, nicht mehr bewohnbar. Als Olivers Vater plötzlich unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt und sein Bruder an die Erdoberfläche verbannt wird, beschließt Oliver, den sicheren Schutzraum zu verlassen. Überrascht stellt er fest, dass die Erdoberfläche gar nicht unbewohnt ist. Das Virus ist schon lange verschwunden und es gibt Ökosiedlungen, in denen ein Pflanzensystem Wasser speichert und Schatten spendet. Doch sogenannte Schutzraum-Jäger suchen systematisch nach den Verstecken der Überlebenden, um sie zu plündern. Oliver und das Mädchen Tsché machen sich auf die Suche nach Olivers Bruder. Doch dieser befindet sich bereits in den Fängen des schlimmsten Schutzraum-Jägers! Tsché und Oliver müssen ihr eigenes Leben riskieren, um Marco zu befreien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
RC2722
Gefährliche Freiheit
eISBN 978-3-96129-231-8
Edel Kids Books
Ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
Copyright © Edel Germany GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Die französische Originalausgabe erschien
bei Didier Jeunesse unter dem Titel »RC2722«
© Didier Jeunesse, 2020
Text: David Moitet
Übersetzung: Maren Illinger
Covergestaltung: zero-media.net, München unter Verwendung des Originalcovers von © Didier Jeunesse
Lektorat: Anna Madouche
ePub-Konvertierung: Datagrafix GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
1DER BUNKER
1
Schreie. Wieder und wieder. Eine Menschenmenge strömt durch die Straßen und versucht, den nahenden Soldaten zu entkommen. Wer nicht schnell genug ist, kriegt ihre Gummiknüppel oder elektrischen Schlagstöcke zu spüren und wird kurzerhand in einen Laster geworfen. Die anderen rennen umso schneller und werfen ängstliche, manchmal auch wütende Blicke zurück auf die olivgrüne Welle, die unaufhaltsam näher rollt. Wer ihr nicht ausweicht, steht nicht wieder auf.
Tränengas brennt in den Augen und vermischt sich mit dem Nebel. Es ist wie ein Vorgeschmack auf den Weltuntergang.
Inmitten dieses Chaos klammert sich ein kleiner Junge mit aller Kraft an eine starke Hand wie ein Schiffbrüchiger an sein Floß. Um ihn herum ist ein ganzer Wald aus Beinen, die ihn jeden Moment zu zertrampeln drohen. Er stolpert mehrmals, doch er fällt nicht hin. Ermutigende Rufe helfen ihm, seine Angst zu überwinden. Von Zeit zu Zeit teilt sich die Menge. Der Kleine sieht die Soldaten in ihren Schutzanzügen. Er hält sie für Astronauten.
Die Hand zieht ihn vorwärts. Er hastet weiter. Sein Herz klopft heftig. Er hat das Gefühl, schon ewig auf der Flucht zu sein. Sein Atem geht schnell, aber er ist stolz darauf, dass er nicht langsamer wird. Das Echo der Gummiknüppel entfernt sich. Rechts von ihnen liegt eine ruhigere Straße. Vielleicht können sie sich dort etwas ausruhen. Sie verfallen vom Lauf- in den Marschschritt. Er atmet tief ein. Ein stechender Geruch steigt ihm in die Nase. Unförmige Haufen liegen vor ihm auf der Straße und auf dem Bürgersteig. Die meisten sind mit Tüchern bedeckt. Der Kleine betrachtet die Haufen. Erneute Schreie und Explosionen lassen ihn zusammenzucken. Er blickt zu der Straße zurück, aus der sie gekommen sind. Menschen eilen in ihre Richtung. Ein Mann rennt ihn um, verheddert sich mit dem Fuß in einem Laken, flucht, rennt weiter. Das Laken rutscht zur Seite und enthüllt eine Hand, gekrümmt in einem letzten Versuch, sich ans Leben zu klammern. Schließlich ist der ganze leblose Körper entblößt. Der Junge kann den Blick nicht von dem blutleeren, entstellten Gesicht des Leichnams lösen.
Er ist wie erstarrt. Kein Laut dringt aus seiner Kehle. Die Hand legt sich auf seine Schulter. Sie müssen weiter, weiter. Der Schrecken weicht der Verzweiflung, durchzuckt ihn noch einmal, als eine Ratte aus den Kleidern des Toten huscht. Der Junge stolpert und stürzt in den Unrat vor dem Bürgersteig. Er schlägt sich das Knie auf. Der Schmerz lässt ihn das Gesicht verziehen, und er kann einen Schrei nicht unterdrücken.
»Aahhhhhhh! Au!«
»Verdammt! Wer schreit denn da so?«
Oliver fährt in seinem Bett auf. Er stößt sich den Kopf und reibt sich die Stirn, auf der sich schon eine ordentliche Beule bildet.
»Albtraum?«, murmelt jemand dicht neben ihm.
Die Stimme gehört Sam, seinem besten Freund, seinem einzigen Freund, der auf der Pritsche gegenüber liegt.
»Mhm. Der gleiche wie immer«, stöhnt Oliver. »Ich bin mitten in einer Menschenmenge, ganz vorne, mit meinem Vater, und wir kommen in eine Straße voller Leichen.«
»Wie nett.«
»Den Traum bin ich gewohnt. Aber ich bin’s nicht gewohnt, mir den Kopf am Bett über mir anzuschlagen. Bis vor einem Monat hatte ich ein ganzes Zimmer für mich.«
»Ich erinnere dich daran, dass du auf eigenen Wunsch hier bist. Im Gegensatz zu allen anderen, also sag das lieber nicht zu laut.«
»Ich weiß, du hast recht. Andererseits … Kopfschmerzen habe ich so oder so.«
Sam unterdrückt ein Lachen. »Hast du schon mal mit deinem Alten über den Traum geredet?
»Ja. Vor langer Zeit. Er hat total abgeblockt. Weißt du, was er gesagt hat? ›Wie sollte jemand von meinem Rang in so eine Meute geraten?‹ Ich bin stinkwütend geworden. Wir haben nie wieder darüber gesprochen.«
»Scheint ja nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen bei euch zu sein. Hast du dich deshalb unserem Wartungstrupp angeschlossen?«
»Mein Vater ist echt autoritär«, murmelt Oliver. »Er gibt nie nach. Ich hab dir doch schon erzählt, dass ich meine ganze Kindheit über lernen musste. Wenn wir aus dem Unterricht kamen, fing noch mal ein ganzer Schultag an. Ich habe unglaublich viel Zeit damit verschwendet, Dinge zu lernen, die ich niemals brauchen werde. In den letzten Wochen haben wir es nicht mal mehr geschafft, normal miteinander zu reden. Wir haben uns nur noch angebrüllt.«
»Und dein Bruder?«
»Du meinst Mister Perfect? Wir waren noch nie auf einer Wellenlänge. Marco ist der krasseste Typ der Welt. Er ist gut in Mathe, Sport und Quantenphysik. Er ist so ziemlich in allem gut. Sogar in Fremdsprachen! Als würden wir irgendwann noch mal Beziehungen zu anderen Ländern aufnehmen … Guter Witz. Und jetzt wurde er auch noch bei den Wasserkriegern aufgenommen.«
»Also, wenn ich einen Bruder hätte, der Wasserkrieger ist, dann würde ich …«
»Schon gut, Sam, genug von meiner Familie.« Oliver seufzt. »Ich glaube, ich brauchte einfach mal ein bisschen Luft, ein bisschen Abstand, das ist alles.«
»Und da hast du dir gedacht, wäre doch eine super Idee, in den Belüftungsschächten und Kanalrohren rumzukriechen und die Lunge mit gutem, frischen Sauerstoff zu füllen.«
»Ha, ha, sehr witzig. Und was die Luft angeht, glaube ich, dass wir alle hier den gleichen Muff atmen.«
»Könnt ihr zwei mal endlich still sein? Manche hier würden gerne schlafen!«, donnert Wildschweins laute Stimme.
Oliver und Sam wechseln einen Blick über den schmalen Gang, der ihre Pritschen voneinander trennt, und rollen sich auf die andere Seite. Wildschwein ist nicht durch Zurückhaltung und Sanftmut zu seinem Spitznamen gekommen. Mit ihm legt man sich lieber nicht an.
Oliver schließt die Augen und versucht erfolglos, seine Nacht um ein paar Minuten zu verlängern, aber der Albtraum will nicht verschwinden. Das alles kommt ihm so real vor … Natürlich hat er schon als Kind wie alle im Bunker Videos von der Welt vorher gesehen und sich in Endlosschleife ihren brutalen Niedergang infolge der Wasserkriege und der Transcholera-Epidemie angeschaut. Der Große Kollaps … Auch Bilder von Aufständen gibt es mehr als genug im Datenarchiv. Ob ihn die Millionen Toten doch stärker beeindruckt haben, als er zugeben will? Vielleicht sollte er wirklich mal zum Therapeuten gehen, wie sein Bruderherz ihm nahegelegt hat. Es träumt wohl niemand bei gesundem Verstand jede Nacht von Leichenbergen, Nahtoderfahrungen und einer völlig verrückt gewordenen Welt.
Oliver seufzt und wälzt sich in seinem winzigen Bett herum, wobei er sich Mühe gibt, seine Zimmergenossen nicht noch einmal zu stören. Zehn Schlafpritschen auf fünf Etagen in einem Zimmer, das etwa zwei mal zwei Meter zwanzig groß ist. Der Inbegriff der Beengtheit. Er hatte gehofft, in der Wartungsabteilung eine zweite Familie zu finden. »Ein Privilegierter, der auf seine Privilegien verzichtet, verdient Bewunderung«, hatte er gedacht. Aber die Realität sieht anders aus. Niemand hier kann begreifen, warum ein junger Mann mit einer aussichtsreichen Zukunft in der Führungsebene des Bunkers alles aufgibt. Einige argwöhnen, dass er als Spion im Auftrag der Machthaber da ist, um jegliche Rebellion der Arbeiter im Keim zu ersticken. Die anderen können schlicht nicht verstehen, wie man Komfort und großzügige Lebensmittelrationen gegen ein hartes Leben voller Zwang und Verzicht tauschen kann.
Zum Glück gibt es Sam. Vom ersten Tag an hat er ihn unter seine Fittiche genommen und den Spott und die Sticheleien der anderen ausgebremst. Alle mögen Sam, und die Tatsache, dass er sich mit Oliver angefreundet hat, genügt, damit die Truppe ihn akzeptiert. Zum Glück.
2
Oliver lässt ein paar Tropfen Wasser auf einen kleinen Lappen laufen und wäscht sich das Gesicht. Er legt eine Zahnputztablette auf seine Zahnbürste und schrubbt energisch. Dann nimmt er sich einige Sekunden Zeit, um sein Spiegelbild zu betrachten. Er streicht sich die strubbeligen braunen Haare zurück und zieht die Augenbrauen zusammen. Wie nach jeder albtraumgeplagten Nacht hat er Ringe unter den blaugrünen Augen.
»Du solltest mehr schlafen, Alter«, sagt er laut zu sich selbst.
Dann verlässt er das Gemeinschaftsbad und gesellt sich zu den anderen Arbeitern. Die ganze Mannschaft hat sich im Aufenthaltsraum versammelt, wo die heutigen Aufgaben verteilt werden. Das übernimmt Wildschwein, obwohl sich offiziell sein Vorgesetzter darum kümmern sollte. Die Instandhaltungsabteilung muss vor allem die Funktion der Maschinen überwachen, die dafür sorgen, dass zweitausend Menschen im Bunker 17, etwa fünfhundert Meter unter der Erde, überleben können. In dieser Tiefe kann schon die kleinste Panne im Belüftungssystem tödlich sein. Das Gleiche gilt für die Wasserversorgung. Jeder Bewohner erhält täglich zwei Liter Wasser, nicht mehr und nicht weniger. Oliver lauscht Wildschweins Anweisungen und schlürft dabei einen Teil seiner Ration, die Hände um die heiße Tasse gelegt. Heute Morgen hat er sogar einen Löffel Honig zugeteilt bekommen, die nahezu einzige Zuckerquelle in ihrer Ernährung. Wenn man den Biologen zu Beginn des Jahrhunderts gesagt hätte, dass Bienen einen halben Kilometer unter der Erde besser gedeihen als an der Oberfläche, hätten sie wohl nur laut gelacht.
»Wasserfilter reinigen in Sektor C, Marc und Aurélien.«
»Geht klar, Chef.«
»Salzversorgungsanlage leeren und reinigen, Lyse und Romain. Der Rest der Mannschaft säubert die Wasserrohre mit Unterwasserdrohnen. Noch Fragen? Dann los!«
»Einen Moment noch …« Wildschweins Vorgesetzter meldet sich zu Wort. Als Ranghöchster im Raum ist es sein gutes Recht, aber es ist erst das zweite Mal, dass Oliver ihn sprechen hört. Wildschwein mustert den Funktionär missmutig, doch dann scheint er sich an die hierarchische Beziehung zu erinnern, die ihn dem kleinen Mann in der weißen Uniform unterstellt.
»Ich habe neulich schon einmal das Problem in Sektor Y erwähnt«, sagt der Funktionär.
Sektor Y.
Bei dem Wort geht ein Raunen durch die Gruppe. Die einzelnen Bereiche des Bunkers sind in alphabetischer Reihenfolge gegliedert. A ist das Innere des Bunkers. Je weiter man Richtung Z kommt, desto tiefer gelangt man in ein Labyrinth aus Gängen und Schächten, deren Instandhaltung immer mühsamer wird. Einige Sektoren haben schon seit Jahren keinen Techniker mehr gesehen, und ihr Zustand verschlechtert sich stetig. Kurz gesagt, niemand hat Lust, sich weiter als bis Sektor H vorzuwagen.
»Soll das ein Witz sein?«, schnaubt Wildschwein. »Kommt nicht infrage. Die Drecksarbeit kannst du einer anderen Mannschaft übertragen. Ich schicke meine Jungs doch nicht ins Verderben!«
»Na ja, es ist so … der Chefingenieur besteht darauf. Und er will unbedingt, dass euer Team das übernimmt. Er vertraut nur euch. Der Sensor einer externen Luftschleuse hat mehrmals eine Öffnung registriert. Es besteht Infektionsgefahr durch das Virus. Wenn es dazu kommt, verlieren wir eine Ebene im Schutzmechanismus.«
»Gibt es ein Leck?«, fragt Wildschwein mit finsterer Miene.
»Bis jetzt konnte das Virus nicht nachgewiesen werden. Aber ein kleineres Leck ist durchaus möglich.«
»Das heißt also volle Schutzmontur. Ich fasse zusammen: Ich muss meine Jungs mehrere Kilometer durch Gänge schicken, durch die man nur auf allen vieren kommt, mit Sauerstoffflaschen und gut fünfzehn Kilo Material auf dem Rücken.«
»Korrekt«, sagt der Funktionär. »Wir würden bei der Gelegenheit auch gleich die Primärfilter austauschen. Sie sind zehn Jahre alt, das ist die maximale Lauf-zeit.«
Wildschwein lacht verächtlich. »Hattest du schon mal einen an?«
»Äh … wie bitte?«, stammelt der Funktionär.
»Einen Schutzanzug. Warum landen die Knochenjobs eigentlich immer bei uns?«
»Ich habe die Anweisung, jedem Mitglied des Teams eine Prämie von zehn Kreditpunkten zu gewähren. Für die beiden, die sich freiwillig melden, das Doppelte. Und für die Mission so viel Wasser, wie sie wollen.«
»Sehr umsichtig«, spottet Wildschwein. »Bei den Litern, die sie schwitzen werden.«
»Zwanzig Kreditpunkte? Ohne mich«, sagt Javier. »Ich hab sechzig gespart, mehr brauche ich nicht.«
»Der Chefingenieur hat schon mit eurem … Zögern gerechnet«, sagt der Funktionär. »Ich soll euch daran erinnern, dass wir alle ein Team sind … eine große Familie. Wir müssen einander helfen, um zu überleben.«
Wildschwein schenkt ihm sein schönstes Lächeln. »Und warum ist der Herr Chefingenieur nicht zu uns runtergekommen, um uns die Nachricht persönlich zu überbringen? Und warum lässt der Herr Chefingenieur nicht seine tollen Wasserkrieger durch die Rohre kriechen? Die sind doch so gut trainiert, oder etwa nicht? Und wohlgenährt, habe ich gehört.«
Der Funktionär schluckt mühsam. Seine Stimme ist nur noch ein Murmeln. »Der Chefingenieur hat mir aufgetragen, euch im Fall einer Weigerung zu bestrafen. Zwei Wochen lang kein Sold.«
»Potzblitz! Der war gut. Habt ihr gehört, Jungs?«, knurrt Wildschwein. »Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich oben in Sektor A war, aber so ein Erpressungsversuch erfordert eigentlich einen Besuch, meint ihr nicht auch?«
Oliver tritt vor. »Ich melde mich als Freiwilliger.«
»Was?«, fragt Wildschwein.
»Ich habe gesagt: Ich melde mich als Freiwilliger.«
»Ich gehe mit«, ergänzt Sam.
Wildschwein starrt die beiden an, hin- und hergerissen zwischen Wut und Entsetzen.
»Ich habe absolut keine Lust, da runterzugehen«, schaltet sich Javier ein, »und ich zwinge niemanden, es für mich zu tun. Aber wenn es ihnen Spaß macht, werde ich mich über die zehn Kreditpunkte nicht beschweren.«
»Abgemacht«, sagt der Funktionär erleichtert und wischt sich eine Schweißperle von der Stirn. »Ich werde dem Chefingenieur unverzüglich mitteilen, dass euer Team die Mission akzeptiert hat.«
3
Seit fast drei Stunden arbeiten sich Sam und Oliver durch das Netz aus Tunneln voran, eine Art Krake mit vielen Tentakeln, die durch Erde und Gestein gehen und in einer Vielzahl natürlicher Grotten münden. Um sie herum verlaufen Rohre und elektrische Kabelbündel unterschiedlicher Größen, die das Belüftungssystem des Bunkers versorgen. Das Ziel der Architekten war, eine konstante Frischluftversorgung aus verschiedenen Quellen zu gewährleisten, ohne dabei an der Oberfläche Hinweise darauf zu geben, dass sich an dieser Stelle ein Bunker befindet. Als die Regierung Frankreichs verstanden hatte, dass die Erderwärmung außer Kontrolle geraten war, wurde die Konstruktion von insgesamt einhundert unterirdischen Schutzräumen im ganzen Land geplant und durchgeführt. Das Projekt unterlag der strengsten Geheimhaltung. Die Notwendigkeit, es vor der breiten Bevölkerung verborgen zu halten, erklärte sich von selbst. Nur einige wenige Privilegierte waren über die Existenz dieser Schutzräume informiert worden und hatten sich retten können, als der Kipppunkt erreicht war.
Bei jeder Abzweigung studiert Oliver die Karte, die sie zum Sektor Y führen soll. Sie sollten sich besser nicht verlaufen.
»Ich wusste nicht, dass diese Tunnel so lang sind«, stöhnt er.
»Manche über zehn Kilometer«, erwidert Sam. »Die Höhlen sind zum Teil ziemlich weit vom Bunker entfernt.«
»Ich hoffe, wir haben uns nicht verirrt. Die Ingenieure hätten ruhig mal ein paar Leuchtdioden einbauen können, die den richtigen Weg weisen.«
Sam gluckst. »Das wäre cool. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie ein Handy mit GPS hatte, bevor sie in den Bunker gekommen ist, mit dem sie überall auf dem Planeten ihren Standort bestimmen konnte.«
»Mhm. Das habe ich in der Schule gelernt. Mein Vater meint, dass das eigentlich immer noch klappen müsste, solange die Satelliten funktionieren, die um die Erde kreisen. Aber ewig wird das nicht gehen, weil sie nicht mehr gewartet werden.«
»Glaubst du, die Wasserkrieger benutzen so einen Schnickschnack, wenn sie nach draußen gehen?«
»Keine Ahnung. Muss ich meinen Bruder fragen.«
Noch eine Abzweigung. Sie müssen sich bücken, weil der Gang so niedrig ist.
Sam wirft einen Blick auf die Karte. »Rechts, würde ich sagen.«
»Ich auch«, stimmt Oliver zu.
»Dann nehmen wir doch rechts. Wir brauchen kein GPS!«
»Hier unten würde es sowieso nicht funktionieren«, sagt Oliver und wagt sich in den dunklen Gang.
»Mist«, flucht Sam. Dieser Gang ist nicht nur eng, hier gibt es auch keine Beleuchtung mehr.
Die beiden wagen sich weiter in die Dunkelheit des unterirdischen Labyrinths, Sektor um Sektor, nur mit dem Licht ihrer Stirnlampen. Wie Wildschwein vorhergesagt hat, ist der Weg kräftezehrend. Sie keuchen und schwitzen, und ihre Rücken schmerzen durch die dauernde gebückte Haltung.
»Machen wir eine Pause?«, fragt Sam nach einer ganzen Weile.
»Da sage ich nicht Nein. Möchtest du einen Schluck Wasser?«
Sam nickt, greift nach seiner Flasche und trinkt mit geschlossenen Augen. »Tut das gut. Warum hast du das gemacht?«, fragt er plötzlich.
»Was?«
»Dich als Freiwilliger gemeldet.«
Oliver zuckt mit den Schultern. »Weiß ich selbst nicht. Vielleicht aus Abenteuerlust. Ich ersticke in diesem verdammten Bunker. Klar, wir kriegen was zu essen, wir haben Arbeit, Missionen, Bücher, Filme, Fitnessräume … Aber mir ist sterbenslangweilig! Findest du es nicht komisch zu wissen, dass wir nie wieder einen neuen Film sehen werden? Jedes Mal, wenn ich einen auf meinem Tablet schaue, habe ich das Gefühl, dass ein Stück Freiheit davonfliegt. Dieser Film wird nie wieder neu sein und mich nie wieder überraschen. Was mache ich, wenn ich alles gesehen habe?«
»Oh Mann, ich möchte ja nicht in deinem Kopf stecken«, sagt Sam und grinst. »Solche Fragen stelle ich mir nie.«
»Warum nicht? Macht dir das nichts aus?«
»Ich glaube, ich habe eine Art Motto. Da oben sind 99 Prozent aller Menschen tot. Es herrscht ein unsägliches Chaos. Es gibt kein Wasser und kein Essen, nur schreckliche Krankheiten und Müll, so weit das Auge reicht.« Sam seufzt. »Das Leben im Bunker ist kein Vergnügungspark, aber ich habe nie etwas anderes gekannt. Also vermeide ich es, darüber nachzudenken. Denken hält der Traurigkeit die Tür auf. Da spiele ich lieber Karten, trinke ein paar Gläser Kartoffelschnaps mit meinen Freunden und lebe einfach …«
Oliver denkt nach. »Das würde ich auch gerne können.«
»Und warum hast du nicht versucht, bei den Wasserkriegern aufgenommen zu werden, wenn du so scharf auf Abenteuer bist?«
Oliver holt tief Luft und atmet geräuschvoll wieder aus. »Ich bin nicht besonders gut darin, mich an Regeln zu halten. Soldat zu werden, war also keine Option für mich. Zur Enttäuschung meines Vaters, übrigens.«
»Man ist, wer man ist«, bemerkt Sam.
»Ja, das stimmt wohl. Ich habe auch eine Frage: Warum hast du dich gemeldet, um mich auf der Mission zu begleiten?«
Sam lächelt. »Ich kann doch nicht zulassen, dass der kleine Frischling sich tief unter der Erde verirrt. Du wärst in irgendeinem Stollen krepiert, und dann hätte der ganze Komplex ein halbes Jahr lang nach deiner Leiche gestunken. Ich habe eine empfindliche Nase.«
»Pff … Blödmann!«
»Na komm, gehen wir weiter.«
Nach etwa einer weiteren Stunde mühsamen Kriechens versperrt ihnen ein Luftfilter den Weg.
»Das ist das Ende von Sektor R«, erklärt Sam. »Wir kommen jetzt in die letzte Quarantäneebene. Wenn irgendwo ein Leck ist, kann es sein, dass dieser Bereich schon verseucht ist.«
»Ich weiß. Ich habe das Handbuch gelesen. Das heißt, wir ziehen jetzt die Schutzanzüge an?«
»Jep.«
»Ich hab sowieso keine Lust mehr, 15 Kilo auf dem Rücken zu schleppen.«
»Tja, wenn du das Ding erst anhast, wird es dir noch weniger gefallen. Da drin ist es gut zehn Grad wärmer.«
Die Jungen ziehen die Schutzanzüge über, wobei sie darauf achten, alle Dichtungen sicher zu verschließen, dann begutachten sie sich gegenseitig. Mit einem Virus, das nur einen von hundert Menschen verschont hat, ist nicht zu spaßen. Umgeben von der dicken Plastikschicht, versteht Oliver, was Sam gemeint hat. Sein Atem lässt die Maske beschlagen, und er hat das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen.
»Du musst möglichst langsam atmen«, rät Sam. »Sonst hyperventilierst du und kippst um.«
Oliver nickt, und es gelingt ihm, seinen Atem zu regulieren. Die beiden durchqueren die Luftschleuse und wagen sich weiter in die Windungen der Tunnel hinein. Oliver fragt sich, ob sie überhaupt jemals ankommen werden. Wie konnte er nur so blöd sein, sich freiwillig zu melden?
»Da wären wir«, sagt Sam nach einer gefühlten Ewigkeit.
Nur noch wenige Hundert Meter. Oliver ist völlig k. o. Er hätte nie gedacht, dass es so anstrengend werden würde.
»Wurde aber auch Zeit«, keucht er.
Am Ende des Gangs befindet sich die letzte Luftschleuse. Dahinter liegt die Außenwelt. Oliver spürt sein Herz heftig hämmern. Das ist bescheuert. In seinem Anzug hat er nichts zu befürchten. Außerdem müssen sie ja gar nicht rausgehen, nur überprüfen, ob der Sensor der Luftschleuse richtig funktioniert, und die Filter austauschen. Sam, der viel mehr Erfahrung hat als er, holt mehrere kleine elektronische Geräte hervor und kontrolliert einen Sensor nach dem anderen.
»Und?«, fragt Oliver.
»Keine Auffälligkeiten. Alles läuft perfekt.«
»Ist ja komisch.«
»Hm, ehrlich gesagt, ist mir das ziemlich egal. Wir wechseln die Filter und gehen zurück«, sagt Sam schulterzuckend. »Es geht ganz leicht. Ich nehme die alten Filter raus und setze die neuen ein. Dabei kann kontaminierte Luft hereinkommen. Dein Job ist es, auf den Virusdetektor zu schauen. Wenn der auslöst, drückst du auf den roten Knopf neben der Schleuse.«
»Okay. Und was passiert dann?«
»Dann sitzen wir hier fest, bis eine Dekontaminierungsmannschaft kommt und uns rettet.«
»Hierher? Machst du Witze?«
Sam stößt ein kleines Lachen aus, das im Schutzhelm widerhallt.
»Was denkst du, warum Wildschwein nicht scharf drauf war, zwei seiner Jungs hierherzuschicken?«
»Na schön, los geht’s. Wollen wir vorher noch beten?«
»Bist du gläubig?«, fragt Sam.
»Kein bisschen.«
»Hätte mich auch gewundert.« Sam holt das nötige Werkzeug aus seinem Rucksack und wirft Oliver einen Blick zu. »Bereit?«
»Jep.«
Mit flinken Bewegungen macht sich Sam daran, den Filter zu wechseln, während Oliver auf den Detektor starrt. Adrenalin rauscht durch seine Adern. So etwas Gefährliches hat er noch nie gemacht. Glücklicherweise bleibt der Detektor während der ganzen Operation still.
»Jippie!«, ruft Sam. »Mission erfolgreich. Rückzug. Schlag ein, mein Freund«, sagt er und hebt die Hand.
Oliver will einschlagen, doch im letzten Moment zieht Sam lachend die Hand weg, und Oliver fällt der Detektor aus der Hand. Mit einem Klirren landet er auf dem Boden.
»Mist«, sagt Sam. »Arbeit für die Elektroniker. Ist er kaputt?«
Etwas verärgert geht Oliver in die Knie und richtet seine Stirnlampe auf den Detektor.
»Verdammt, was ist das denn?«, fragt er plötzlich.
»Ach, keine Sorge«, sagt Sam. »Die lieben es, den Kram zu reparieren. Beschäftigungstherapie.«
»Nein, das meinte ich nicht.«
Sam nähert sich, so gut es in dem engen Gang geht.
»Sieh dir das an«, sagt Oliver.
Neben dem Detektor zeichnen sich mehrere Fußabdrücke aus roter Erde auf dem grauen Beton ab. Sie scheinen von der Luftschleuse zu kommen.
»Verflixtes Kanalrohr!«, ruft Sam. »Wie ist das möglich?«
»Wenn du mich fragst, hat jemand die Luftschleuse benutzt, um nach draußen zu gehen.«
»Spinnst du? Wer sollte das tun?«
»Das würde auf jeden Fall erklären, warum die Öffnungsdetektoren mehrmals ausgelöst wurden. Wie du gesagt hast, funktionieren sie perfekt.«
Oliver geht dicht an die Schleuse heran und versucht, in den dahinterliegenden Raum zu leuchten. Wie erwartet ist der Boden der Höhle von rötlicher Erde bedeckt.
»Bingo«, murmelt er.
»Sektor Z, Alter. Das heißt draußen. Man muss total durchgeknallt sein, um da rauszugehen«, sagt Sam.
»Warum regst du dich so auf?«, fragt Oliver. »Vielleicht hat ein Wasserkrieger den Durchgang genutzt, und das war’s.«
»Klar, und meine Mutter liegt am Pool und sonnt sich«, blafft Sam. »Wenn der Chefingenieur verlangt, dass wir die Luftschleuse kontrollieren, dann weil er nicht weiß, warum die Sensoren ausgelöst haben. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber die Sache ist ernst. Wir werden einen Haufen Probleme kriegen, das sage ich dir.«
»Wir können es ja auch für uns behalten.«
»Ich weiß nicht, Oliver. Die Sache ist ernst«, wiederholt Sam.
»Der Detektor hat nicht angeschlagen. Also ist das Virus nicht in der Höhle. Es besteht keine unmittelbare Gefahr.«
»Stimmt. Aber wie weit ist er wohl gegangen, der Typ, der die Spuren hinterlassen hat?«
»Das sehen wir später. Los, komm, wir drehen jetzt um.«
Sam will vorgehen, stolpert aber über die gebrauchten Luftfilter, die er noch nicht in seinem Rucksack verstaut hat, und taumelt nach hinten. Reflexartig hält er sich an Oliver fest und reißt dabei versehentlich seinen Sauerstoffschlauch ab, bevor er unsanft auf dem Hintern landet.
»Mist, entschuldige. Schnell, wir müssen ihn wieder anschließen!«
Oliver versucht es, aber der Anschluss an das Ventil scheint kaputt zu sein. Die Luft wird knapp. Endlich schafft er es atemlos, den Helm abzuziehen.
»Oh, verdammt«, sagt Sam. »Prozedur B 28.«
»Häh?«, fragt Oliver.
»Direkter Luftkontakt auf der ersten Quarantäne-Ebene. Du musst drei Tage in Isolation, das ist die Inkubationszeit des Virus.«
»Drei Tage? Das ist nicht dein Ernst.«
»Leider doch.«
»Das behalten wir auch für uns.«
»Kommt nicht infrage.« Sam schüttelt den Kopf. »Damit würden wir Hunderte Menschen in Gefahr bringen. Außerdem hat dein Anzug den Druckverlust aufgezeichnet. Der Ingenieur weiß schon Bescheid.«
»Was für ein Scheiß.«
»Das kann man wohl sagen.«
4
Quarantäne. Tag 2.
Oliver starrt das Kabel an, das sein Datenimplantat im Nacken mit dem Bildschirm vor ihm verbindet. Lesen, Filmschauen, Lesen, Filmschauen, Lesen … Die Tage sind lang, wenn man nichts zu tun hat. Mittlerweile ist er schon seit 48 Stunden in einem winzigen sterilen Raum, mit einem Haufen Sensoren am Körper, die die Ärzte fortwährend über seinen Gesundheitszustand informieren: Herzschlag, Atemfrequenz, Körpertemperatur, Blutzuckerspiegel, nichts entgeht ihnen. Oliver fragt sich, ob sie auch seine Gedanken lesen können. Mehrmals ertappt er sich dabei, wie er in Gedanken die Ärzte beschimpft und auf ihre Reaktion wartet. Doch trotz des Aufgebots an schrecklichen Beleidigungen bleiben die Mediziner neutral wie ein Teller Schwarzknollensuppe, eine der wenigen Gemüsesorten, die ohne künstliches Licht gedeiht. Sein Gedankengestöber scheint also nicht bei ihnen anzukommen. Umso besser. Schön wäre es sicher nicht anzusehen. Wie Sam sagt, er macht sich zu viele Sorgen.
Normalerweise vertreibt er sie, indem er den ganzen Tag aktiv ist, aber die Quarantäne öffnet vielen Grübeleien die Tür, die er seit Wochen wegzuschieben versucht. Da kann er – dank der Inhalte in seinem Datenimplantat – noch so viele seiner Lieblingsfilme schauen oder sich in Ellana vertiefen, den Roman von Pierre Bottero, der ihn in den letzten Jahren begleitet hat: Seine Gedanken schleichen sich doch unweigerlich in die Geschichte und nehmen den ganzen Raum ein. Was zur Hölle stimmt nicht mit ihm? Warum kann er sich nicht damit begnügen, die Regeln zu befolgen und die Vorteile zu genießen, die der Dienstgrad seines Vaters mit sich bringt? Einfach erwachsen werden und die Hierarchiestufen des Bunkers erklimmen, um selbst irgendwann einen verantwortungsvollen Posten zu übernehmen? Die Worte seines Vaters am Tag, als Oliver, verkündete, dass er sich der Instandhaltungsabteilung anschließen wolle, hallen immer noch in seinem Kopf nach. »Willst du mich in den Wahnsinn treiben, ja?«, hatte sein Vater gebrüllt. »Was erwartest du von mir, Oliver? Ich verstehe deine Sehnsucht nach Freiheit, aber es gibt hier nun einmal gewisse Konstanten, denen sich niemand entziehen kann!«
Konstanten, denen sich niemand entziehen kann. Das war so ein typischer Ausdruck seines Vaters. Ein Experte der Kernphysik kann natürlich nicht reden wie alle anderen Sterblichen. Oliver hatte nicht gewusst, was er darauf erwidern sollte. Manchmal lässt sich eine Entscheidung, die einen fast zerreißt, nicht so leicht in Worte fassen. Es ist schwer, seinem Vater zu sagen, dass man seine Zukunft nicht in einem sterilen Raum sieht, wo jedes Gerät immer an seinem Platz bleiben muss, bis eine neue Regel festlegt, dass es zwanzig Zentimeter nach links gerückt werden darf, nur um einige Monate später wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückzukehren. Wenn Oliver die Augen schließt, sieht er wilde Weiten vor sich, über die der Wind weht. Er hört das Rauschen von Gras. Beinahe riecht er den Duft der Frühlingsblumen.
Im Bunker muss er sich mit der schalen Luft begnügen, die der riesige Ventilator hereintreibt. Der Ventilator, von dem in jeder Sekunde ihr Leben abhängt und der, natürlich, nur dank des bunkereigenen Kernreaktors funktioniert. Anders gesagt, dank der Arbeit seines Vaters, der dafür verantwortlich ist, dass die kostbare Maschine niemals ausfällt.
Drei kurze Schläge reißen Oliver aus seinen Gedanken. Es ist Sam. Er schneidet hinter der Fensterscheibe Grimassen.
»Na, lebst du noch?«
»Ha, ha, sehr witzig«, knurrt Oliver.
»Man muss im Leben über alles lachen können …«
»Sagt wer? Konfuzius?«
»Was? Nee, lass mich ausreden: Man muss im Leben über alles lachen können, sonst wird man zum Arschloch.«
»Klingt wirklich nicht nach Konfuzius.« Oliver grinst.
»Das sagt mein Vater immer. Okay, ein Poet ist er nicht gerade …« Sam lacht kurz auf. »Wie geht’s dir?«
»Wie einer Maus im Käfig.«
»Kein Fieber?«
»Nö.«
»Dann erkläre ich dich nach der Statistik offiziell als gerettet!«
»Vielen Dank.« Oliver seufzt. »Schade, dass du kein Arzt bist, sonst könntest du mich hier rauslassen. Ist Wildschwein sauer, dass ich den Detektor kaputt gemacht habe?«
»Quatsch. Wir hatten einfach Pech, und unsere Arbeit haben wir trotzdem erledigt«
»Gibt’s was Neues wegen der Spuren? Ich bin dreimal von den Wasserkriegern verhört worden.«
»Ich auch. Diese Idioten stellen jedes Mal dieselben Fragen.«
»Trotzdem sind sie ganz schön furchteinflößend …«
Sam nickt finster. »Was hast du gesagt?«
»Was wohl?«, brummt Oliver. »Die Wahrheit. Dass ich keine Ahnung habe, wer da rausgegangen ist. Aber eins weiß ich sicher, sie selbst haben auch keinen Schimmer, und das gefällt ihnen gar nicht.«
»Ja, gelinde gesagt. Aber ich wüsste wirklich auch gerne, wer so verrückt ist, den Bunker zu verlassen.«
Oliver überlegt, bevor er antwortet. Ich könnte so verrückt sein …, denkt er. Kurz fragt er sich, ob er laut gedacht hat. Er sieht Sam an, doch der zuckt nicht mit der Wimper.
»Und dein Bruderherz, hat der dich besucht?«, will Sam wissen.
Oliver schüttelt den Kopf.
»Dein Vater?«
»Auch nicht.«
»Ihr seid echt eine komische Familie.«
Diese Feststellung trifft Oliver wie ein Faustschlag. Kann man überhaupt von Familie sprechen, wenn man nicht mal in der Lage ist, richtig miteinander zu reden?
»Ich muss wieder los«, sagt Sam. »Die Arbeit ruft.«
»Alles klar. Cool, dass du da warst.«
»Ist doch selbstverständlich. Wir Überlebende aus dem Sektor Y halten zusammen.«
»Schon. Trotzdem danke.«
Oliver schweigt, während er Sam nachblickt.
»Meine Familie …«, murmelt er dann, »… bist du.«
Aber da ist Sam schon weg.
5
Jetzt ist Oliver wieder allein. Die Ärzte beruhigen ihn, sein Gesundheitszustand sähe gut aus. Und aus irgendeinem Grund ist er nicht vor Angst gelähmt, dass das Virus ihn kontaminiert haben könnte. Dabei hat man ihnen immer wieder eingebläut, wie ansteckend es ist, dass man sich schützen muss, dass man auf keinen Fall nach draußen gehen darf und immer in der Tiefe der Erde bleiben muss. Ein dummer Gedanke treibt Oliver ein Grinsen ins Gesicht: Was ist besser – innerhalb weniger Tage an einer schrecklichen Viruserkrankung zu sterben oder langsam an diesem trostlosen Leben kaputtzugehen, das man ihnen hier bietet? Ein Leben ohne Perspektive, ohne Geschmack, ohne Farbe? Es ist Zeit, diesen Käfig zu verlassen, denkt er bitter, als ihm klar wird, wie düster seine Gedanken sind.
Eine Silhouette nähert sich hinter der Glasscheibe. Sein Bruder Marco. Er ist groß, sein braunes Haar glatt gekämmt, sein muskulöser Oberkörper wird von der Uniform der Wasserkrieger betont. Die menschgewordene Perfektion. Ihr Vater ist so stolz auf ihn. Oliver will einen bissigen Kommentar machen, doch Marcos zitternde Lippen halten ihn davon ab. Es kommt selten vor, dass sein großer Bruder die Fassung verliert, und sein verzerrter Mund weckt in Oliver eine schlechte Vorahnung.
»Das ist kein Anstandsbesuch, hm?«, fragt er beunruhigt.
Marco schüttelt den Kopf. Er kann nicht spre-chen.
»Was? Was ist los?«, fragt Oliver. »Haben sie dich geschickt, um mir irgendeine Strafe zu verkün-den?«
»Ich habe eine schlechte Nachricht.«
»Dann raus damit.«
»Unser Vater …«
»Was ist mit unserem Vater?«
»Er … Er ist tot«, stammelt Marco. »Er ist heute Morgen gestorben, ganz früh.«
Oliver hat das Gefühl, dass die Zeit stehen bleibt. »Aber das kann doch nicht sein! Er … war total fit. Was ist passiert? Ein Unfall?«
»Ein Herzinfarkt. Er hat nicht gelitten.«
»Wann?«
»Gegen sieben.«
Oliver schaut auf die Uhr. Es ist elf. »Vor vier Stunden? Und du kommst erst jetzt?«
»Ich … ich hatte einen Zusammenbruch, Oliver. Ich wusste nicht, wie ich es dir sagen sollte. Und wie du reagieren würdest, in deiner Situation …«
Oliver spürt eine schreckliche Wut in sich aufsteigen. Sein Vater? Tot? Das ist etwas, was er sich einfach nicht vorstellen kann. Zorn, Trauer und ein heftiges Gefühl der Ungerechtigkeit kämpfen in ihm. Ihm wird bewusst, dass ihre letzten Gespräche aus nichts als Beschimpfungen, Vorwürfen und fruchtlosen Äußerungen bestanden haben. Alles kommt hoch, was er seinem Vater gerne gesagt hätte. Was sein Vater ihm hätte sagen sollen. Eine regelrechte Sturmflut. Mit dem Handrücken wischt er sich die Tränen aus den Augenwinkeln. Er wird nicht weinen. Nicht jetzt. Nicht hier, vor seinem Bruder.
»Ich will ihn sehen.« Olivers Worte hängen in der Luft. »Jetzt.«
»Du weißt, dass das nicht geht. Du stehst unter Quarantäne.«
»Du bist doch ein Wasserkrieger, oder nicht? Befiehl ihnen, mich rauszulassen.«
»Aber die Regeln …«
»Zum Teufel mit den Regeln! Es ist unser Vater, verdammt noch mal!«
Marco schüttelt langsam den Kopf. »Du änderst dich nie«, sagt er.
Ohne den Blick von ihm zu lösen, reißt Oliver sich die Sensoren von Brust und Armen.
»Was … was machen Sie da?«, schaltet sich der Arzt ein.
Oliver ist so voller Schmerz und Wut, dass er ihn gar nicht hört. Er steht auf und rüttelt an der Türklinke.
»Aufmachen!«, schreit er.
Der Arzt wirft ihm einen strengen Blick zu. »Mit der Quarantäne ist nicht zu spaßen«, sagt er.
»Machen Sie auf, oder ich schlage die verdammte Scheibe mit dem Stuhl ein«, droht Oliver.
Der Arzt wendet sich fassungslos an Marco. Als Wasserkrieger ist sein Rang höher als der des Arztes. Im Bunker ist alles eine Frage der Hierarchie.
Marco seufzt tief. »Wie hoch ist die Kontaminierungswahrscheinlichkeit?«, fragt er schließlich.
Der Arzt tut so, als würde er nicht verstehen.
»Ich habe Sie gefragt, wie hoch die Kontaminierungswahrscheinlichkeit ist!«, wiederholt Marco laut.
»Äh … nun ja, ich würde sagen, unter einem Prozent, aber …«
»Machen Sie die Tür auf«, sagt Marco kühl.
Der Arzt tut es widerstrebend.
Oliver verlässt das Isolationszimmer und bleibt vor seinem Bruder stehen.
»Danke«, sagt er nur. »Wo ist Papa?«
»Er wurde gerade ins Krematorium gebracht.«
»Du hättest ihn ohne mich verbrennen lassen?«
»Die Regeln schreiben vor, das ein Verstorbener …«
»Stopp. Es reicht. Ich hab genug gehört. Ich will ihn sehen.«
»Soll ich mitkommen?«
»Nicht nötig.«
6
Oliver eilt entschlossen durch die Gänge des Bunkers. Mehrere Bekannte grüßen ihn, doch er reagiert nicht. Er steuert geradewegs auf die Einäscherungskammer zu, überwältigt von Gefühlen, die er kaum beherrschen kann. Es tut ihm leid, dass er so hart zu seinem Bruder gewesen ist. In so einem Moment sollte er wohl vergessen, was sie trennt. Aber dazu fühlt er sich gerade nicht in der Lage. »Lass dir etwas Zeit und sprich mit Marco, wenn du ruhiger bist«, hätte sein Vater ihm geraten, der sich irgendwann mit Olivers impulsivem Wesen abgefunden hat. Aber sein Vater wird nie wieder da sein, um ihm zu helfen, die überschäumende Energie zu bändigen, die ihn immer daran hindert, sich an die strengen Vorschriften des Bunkers anzupassen. Er wird nie wieder da sein, um ihm Ratschläge zu geben, die er sich nur schwer anhören konnte. Ratschläge, die ihn aber doch oft auf den richtigen Weg zurückgebracht oder dafür gesorgt haben, dass er sich gewisse Probleme gar nicht erst eingehandelt hat. Im Bunker mit seinen militärischen Regeln werden Entgleisungen hart bestraft.
Oliver bleibt vor der Tür der Einäscherungskammer stehen. Er holt tief Luft und betritt zum ersten Mal den Raum, den er und seine Klassenkameraden früher immer »den Grill« genannt haben. Heute kommen ihm diese Zeiten weit weg vor. Er denkt, dass Sams Vater sein Sprichwort ergänzen sollte: Man muss im Leben über alles lachen können, aber bitte im richtigen Moment.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragt der Empfangsbeamte.
»Ich möchte den Leichnam meines Vaters sehen. Nikolaï Sokolov.«
»Oh … mein aufrichtiges Beileid.«
Oliver nickt. Der Mann kommt ihm vage bekannt vor. Er muss ihn schon einige Male gesehen haben. Ist ja auch kein Wunder, da nur zweitausend Menschen im Bunker leben. Eine Art Kleinstadt, nur eben unterirdisch.
»Wenn Sie mir bitte folgen würden.«
Als Oliver den Leichnam seines Vaters sieht, werden seine Knie weich, und er verliert beinahe das Gleichgewicht.
»Alles in Ordnung?«
»Ja«, stammelt Oliver. »Danke.«
»Soll ich Sie einen Moment allein lassen?«
»Ja. Bitte.«
»Ich bin nebenan, wenn Sie mich brauchen.«
Als er mit seinem Vater allein ist, tritt Oliver näher und legt ihm eine Hand an die Wange. Dann schließt er die Augen.
»Es tut mir leid«, murmelt er. »Es tut mir leid, Papa. Warum bist du einfach so gestorben? Ich hätte dir gerne noch ein paar Dinge gesagt. Dinge, die man einer Leiche nicht sagen kann.«
Oliver beugt sich vor und legt die Stirn an die seines Vaters. Die Berührung ist seltsam, aber tröstlich. Wie kann es sein, dass dieser starke Mann, den scheinbar nichts aus der Fassung bringen konnte, ohne das kleinste Vorzeichen gestorben ist? Oliver richtet sich wieder auf und bemerkt eine klebrige rote Flüssigkeit an seinen Fingern. Blut. Er untersucht das Genick seines Vaters. Sein Datenimplantat wurde entfernt. Die Elektroden, die das Gerät mit den Synapsen seines Vaters verbunden haben, wurden nicht einmal herausgezogen. Oliver kennt Ethan, den jungen Mann, der mit dieser Aufgabe betraut ist, und er wundert sich über seine Nachlässigkeit. Er dreht sich um und wischt sich die Hände an einem Recyclingpapier ab, dann wirft er es in den Schacht, der es der Wiederverwertung zuführt. Das Papier wird durch das Unterdrucksystem angesaugt.
Oliver setzt sich auf eine Bank, zu Füßen seines Vaters. Er weiß nicht, was er tun oder sagen soll, deshalb wartet er, starrt ins Leere, lässt seine Gedanken wandern. Wirre Bilder der letzten Tage mischen sich mit älteren Erinnerungen, auch mit seinen Albträumen, die ihn nachts verfolgen. So sitzt er eine ganze Weile, bis sein Blick an den Schuhsohlen seines Vaters hängen bleibt. Feiner roter Staub sitzt in den Rillen ihres Profils. Oliver vergewissert sich, dass er nicht träumt, beugt sich vor und schaut näher hin.
Abgesehen von den Fußspuren in Sektor Y hat er Erde dieser Farbe noch nie gesehen.
7
Oliver hält kurz inne, bevor er die Tür zum Labor öffnet. Dann drückt er energisch die Klinke und tritt über die Schwelle. Ihm gegenüber ist ein Tresen. Ein kleiner Mann hebt fragend den Blick.
»Hallo, ich heiße Oliver. Ich bin ein Freund von Ethan. Können Sie ihm sagen, dass ich da bin?«
Trotz seines inneren Aufruhrs ringt Oliver sich ein Lächeln ab. Der Mann hinter dem Tresen zuckt mit den Schultern.
»Das interne Kommunikationssystem ist gerade ausgefallen«, sagt er nur. »Ich warte auf die Techniker.«
»Und was heißt das?«
»Dass ich Ethan nicht informieren kann.«
»Okay. Geht es vielleicht auch direkt? Sein Büro ist doch gleich am Ende des Gangs, oder?«
»Sie wollen, dass ich meinen Posten verlasse, um ihm zu sagen, dass sie da sind?«
Oliver nickt.
Der kleine Mann rührt sich nicht. »Ausgeschlossen«, sagt er schließlich.
»Können Sie mir sagen, warum?«, fragt Oliver, der langsam die Geduld verliert.
»Es verstößt gegen die Vorschrift.«
»Das verstehe ich. Aber die Vorschrift beinhaltet doch bestimmt gewisse Ausnahmen, zum Beispiel, wenn das Kommunikationssystem ausgefallen ist.«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Na schön, ich will Ihnen keine Probleme machen«, lenkt Oliver ein. »Kann ich selbst zu ihm gehen? Dann müssen Sie Ihren Posten nicht verlassen.«
»Auch das verstößt gegen die Vorschrift. Kein außenstehendes Individuum darf das Labor ohne Vorlage von Formular B 26 mit Unterschrift des Laborleiters oder eines hohen Verantwortlichen des Bunkers betreten.«
Oliver seufzt. Am liebsten würde er den kleinen Mann von seinem Stuhl zerren und über den Gang schleifen, aber er beherrscht sich. Da kommt ihm ein Gedanke.
»Und wenn ich Ihnen versprechen würde, dass dreißig Kreditpunkte ganz diskret auf Ihren Kollektor übertragen werden könnten, bestünde dann die Chance, dass Sie irgendeine Möglichkeit finden, Ethan zu holen?«
»Das wäre gegen die …«
»… Vorschrift. Ich weiß, das haben Sie schon gesagt.«
»Für sechzig Kreditpunkte wäre es vielleicht möglich …«
»Fünfzig.«
»Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Oliver«, sagt der Mann und streckt den Arm aus.
Oliver hält seinen Unterarm an den des Mannes und gibt seinem Implantat gedanklich den Auftrag, fünfzig Kreditpunkte zu überweisen. Als die Transaktion beendet ist, zeigt der kleine Mann ein großes Lächeln und entriegelt die Tür, die zu den Laborräumen führt.
»Hinterste Tür rechts«, sagt er.
Oliver verschwindet in den Gang, ohne den Mann eines weiteren Blickes zu würdigen. Er steuert auf die Tür des Büros zu und tritt ein. Und richtig, da sitzt Ethan, ein Stirnband mit diversen Geräten um den Kopf, darunter eine Lupe und eine starke LED-Lampe. Dieses praktische Accessoire erleichtert seinem Freund die Arbeit, verleiht ihm aber auch einen ziemlich speziellen Look. Als er den Kopf hebt, die Lupe vor dem linken Auge, erinnert er eher an einen verrückten Wissenschaftler als an den Jungen, mit dem Oliver früher stundenlang im Pausenraum Cageball gespielt hat.
»Hey Oliver, schön dich zu sehen! Ist ja schon ewig her …« Sein Gesicht verdunkelt sich. »Ich hätte dich lieber unter anderen Umständen wiedergesehen«, fügt er schnell hinzu. »Mein herzliches Beileid.«
Oliver lächelt schwach. »Danke. Es ist ein trauriger Tag.«
»Ich habe gehört, dass du in Quarantäne musstest. Geht es dir gut?«
»Ja, in der Hinsicht ist alles in Ordnung. Wenigstens etwas.«
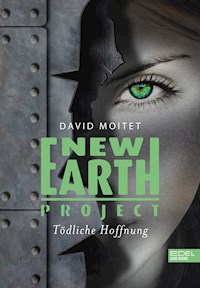













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














