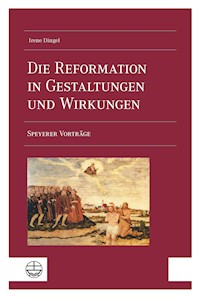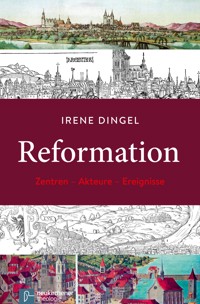
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Reformation, ein historischer Prozess, der auf eine umfassende kirchlich-theologische Erneuerung zielte und zugleich tiefgreifende Wirkungen in Kultur, Gesellschaft und Politik hervorbrachte, war für Europa ein einschneidendes Ereignis. Als ausschlaggebendes Datum gilt das Jahr 1517, in dem mit der Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers nicht nur das Nachdenken über zentrale theologische Fragen, sondern auch der Ruf nach Erneuerung von Kirche und Gesellschaft neue, kraftvolle Impulse erhielt. Dem standen gesellschaftliche und politische Entwicklungen sowie weitere reformatorische Ansätze in Europa zur Seite, die mit der 1517 von Wittenberg ausgehenden Bewegung in Interaktion traten. Für die Reformatoren war die konsequente Orientierung an den Ausschließlichkeit beanspruchenden Grundsätzen "sola scriptura", "solus Christus", "sola gratia" und "sola fide" leitend, was sich in Glauben und Lehre, Frömmigkeit und Ritus niederschlug und zugleich das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft tiefgreifend veränderte. Das Buch versucht, die Prozesse der Etablierung und Entfaltung der Reformation im Spannungsfeld der politischen Entwicklungen in Europa nachzuzeichnen. Ein kurzer Blick auf die spätmittelalterlichen Strukturen in Politik, Gesellschaft und kirchlichem Leben dient dazu, das Substrat zu skizzieren, auf dem sich die Reformation entfaltete und von dem sie sich abgrenzte. Nicht nur Wittenberg und die von dort ausgehende Reformation kommt zu Sprache, sondern auch weitere reformatorische Zentren und ihre herausragenden Akteure, deren Ausstrahlung nicht nur den Westen, sondern auch den Osten Europas erreichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Irene Dingel
Reformation
Zentren – Akteure – Ereignisse
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-7887-3035-2
Weitere Angaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
© 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstr. 13, D-37073 Göttingen/
Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.
www.v-r.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der
vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlaggestaltung: Grafikbüro Sonnhüter, www.sonnhueter.com unter Verwendung folgender Bilder:
Wittenberg 1536, gemeinfrei;
Panoràmica de la ciutat i el riu Limmat durant el segle XV, gemeinfrei;
Ansicht von Straßburg im Jahre 1493, gemeinfrei;
Carte Geneve, gemeinfrei
Satz: Dorothee Schönau, Wülfrath
EPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Inhalt
Vorwort
Einleitung
HINTERGRÜNDE
Politische, gesellschaftliche und rechtliche Strukturen um 1500
I.
Ständeordnung und Verfassungsstrukturen
II.
Das Heilige Römische Reich deutscher Nation
Religiöses Leben im Spätmittelalter und an der Schwelle zur Frühen Neuzeit
I.
Die Kirche in ihren institutionellen Erscheinungsformen und Strukturen
1.Kirche und Papsttum
2.Der konziliare Gedanke
3.Klerus
II.
Frömmigkeit
1.Mystik und Devotio moderna
2.Volksfrömmigkeit
III.
Erneuerungsbewegungen
1.Kirchenkritik und Reformansätze vor der Reformation
2.Renaissance und Humanismus
DIE REFORMATION
Zentren – Akteure – Ereignisse
Die Reformation in Wittenberg
I.
Martin Luthers Entwicklung zum Reformator
1.Theologische Grundlegung: Disputationen und reformatorische Hauptschriften
2.Evangelische Verkündigung: Bibelübersetzung – Predigt – Unterweisung
II.
Philipp Melanchthon als Wittenberger Professor und theologischer Lehrer
1.Der Universalgelehrte und sein wissenschaftliches Werk
2.Der Theologe und Reformator
Die Ausbreitung der Reformation – Wege und Medien
I.
Die Predigt
II.
Das Lied
III.
Aktivitäten der Humanistenzirkel
IV.
Der Buchdruck
Die Reformation in Zürich
I.
Huldrych Zwinglis Weg zur Reformation
II.
Der Beginn der Reformation in Zürich
1.Zwinglis reformatorische Predigt
2.Der Bruch mit der römischen Kirche
III.
Die Zürcher Disputationen
1.Die erste Zürcher Disputation und ihre Wirkung
2.Die zweite Zürcher Disputation
IV.
Theologische Grundlegung und praktische Gestaltung der Reformation
Kontroversen und Abgrenzung
I.
Die Wittenberger Bewegung (1521/1522)
II.
Der Streit mit Erasmus über den freien Willen (1524/1525)
III.
Die Abendmahlskontroverse mit Zwingli (1525–1529)
IV.
Die Antinomistischen Streitigkeiten (1527 und 1537/1538)
Reformatorischer Dissent
I.
Das Täufertum
1.Das frühe Täufertum in Zürich – Konrad Grebel und Felix Mantz
2.Vielfalt des Täufertums – Balthasar Hubmaier, Hans Denck, Hans Hut
3.Konsolidierung und Abgrenzung
4.Das Täuferreich in Münster
5.Mennoniten und Hutterer
II.
Ausprägungen des Spiritualismus
1.Thomas Müntzer: Kämpferische Leidensnachfolge
2.Caspar Schwenckfeld von Ossig: die Botschaft vom inneren Christus
3.Sebastian Franck: Konsequenter Individualismus
III.
Antitrinitarische Strömungen
1.Die Anfänge
2.Verbreitung
Die Reformation in Straßburg
I.
Martin Bucers Weg nach Straßburg
II.
Einführung und Etablierung der Reformation in Straßburg
III.
Abgrenzung und Konsolidierung
IV.
Bucers Wirken außerhalb
Reformation und Bildung
I.
Grundzüge des Bildungswesens im Spätmittelalter
II.
Reformatorische Begründungen der Bildungsreform
III.
Praktische Umsetzungen – Wittenberger und Straßburger Typ
Reformation und Reichspolitik
I.
Der Römische Prozess gegen Luther und die Lage im Reich
II.
Die Bedeutung der Reichstage für die Reformation
1.Der Wormser Reichstag von 1521 und die Ächtung Luthers
2.Der Reichstag von Speyer 1526, die Entstehung des landesherrlichen Kirchenregiments und die Ordnung der Kirche
3.Der Reichstag von Speyer 1529 und das Ringen um ein Minderheitenrecht in Glaubensfragen
4.Der Augsburger Reichstag von 1530 und die reformatorische Bekenntnisbildung
5.Der Schmalkaldische Bund, das Ringen der Mächte und erste Religionsfriedensschlüsse
Ringen um Konsens
I.
Die Wittenberger Konkordie (1536)
II.
Kaiserliche Konzilspolitik und Schmalkaldische Artikel (1537)
III.
Das Religionsgespräch von Hagenau, Worms und Regensburg (1540/1541)
Krieg und Frieden
I.
Der Bauernkrieg (1524–1526) und die Reaktion Martin Luthers
II.
Der Schmalkaldische Krieg (1546/1547) und das Augsburger Interim (1548)
III.
Fürstenkrieg und Passauer Vertrag (1552)
IV.
Der Augsburger Religionsfrieden (1555)
V.
Die französischen Religionskriege und das Edikt von Nantes (1598)
Die Reformation in Genf
I.
Calvins Weg zur Reformation und sein frühes reformatorisches Wirken
II.
Calvins Wirken in Genf (1536–1538) und sein Straßburger Exil (1538–1541)
III.
Calvins Rückkehr nach Genf und weiteres Wirken (1541–1564)
1.Neuordnung der Kirche – Struktur, Praxis, Kirchenzucht
2.Konsolidierung der Lehre – Theologische Kontroversen
IV.
Der Bruch mit dem entstehenden Luthertum – Der Zweite Abendmahlsstreit (1552–1557)
1.Der Consensus Tigurinus
2.Westphal gegen Calvin
3.Wirkungen auf Lehre und Leben der Reformierten
AUSSTRAHLUNG
Die Ausstrahlung der Reformation – Europäische Dimensionen
I.
Die Niederlande
II.
Nordeuropa/Skandinavien
III.
Preußen und das Baltikum
IV.
Ungarn und Siebenbürgen
V.
Böhmen und Mähren
VI.
Frankreich
VII.
England
VIII.
Schottland
IX.
Spanien und Italien
Quellen und Literatur
I.
Quellen
II.
Literatur
Register
I.
Personen
II.
Orte
III.
Bibelstellen
Vorwort
Einen kleinen Überblick über ein so großes Thema wie die Reformation zu schreiben, ist keine geringe Herausforderung, zumal der Markt angesichts des anstehenden Reformationsjubiläums boomt. Darstellungen zum Reformationsjahrhundert und vor allem zum Wirken Martin Luthers haben Hochkonjunktur. Dennoch lohnt es sich, sich aufs Neue dieser Epoche zu widmen, die sich durch eine vielschichtige Interaktion theologischer, politischer, gesellschaftlicher und kultureller Faktoren auszeichnet und dadurch entscheidende Transformationen auf all diesen Ebenen in Gang setzte. Dies umfassend und auf europäischer Ebene zu behandeln, würde Hunderte von Seiten füllen. Diese Studie beschränkt sich daher auf die großen Zentren der Reformation in Zentraleuropa, auf die entscheidenden Akteure und die ausschlaggebenden Ereignisse, die die Reformation förderten oder behinderten, sie veränderten und prägten. All dies kommt aus den jeweiligen historischen Kontexten und Konstellationen heraus in den Blick und soll sich in der Vielfalt der Perspektiven zu einem differenzierten Gesamtbild zusammenfügen.
Eigentlich hätte ein nur halb so langes »Lese-Buch« entstehen sollen – zugänglich für alle Interessierten, keineswegs nur für ein akademisches Publikum, angelegt für eine schnelle Orientierung. Aber die Darstellung ist dann letzten Endes doch nicht so kurz und knapp ausgefallen wie ursprünglich geplant. Der Charakter eines »Lese-Buchs« im Sinne einer gut lesbaren, sich leicht erschließenden Darstellung ist jedoch – wie ich hoffe – gewahrt geblieben. Die Anmerkungen beschränken sich daher auf das strikt Notwendige, d.h. auf wichtige Literaturnachweise und zum Verständnis unerlässliche Zusatzinformationen. Für die Reformation relevante Personen wurden bei ihrer ersten Nennung mit Lebensdaten bzw. Regierungsdaten versehen, um ihre Einordnung zu erleichtern. Frühneuzeitliche Zitate sind heutigem Sprachgebrauch angeglichen worden.*
Dass das Buch in dieser Fassung erscheinen kann, ist dem Neukirchener Verlag und seinem Lektor Ekkehard Starke zu danken, der es ungekürzt akzeptiert hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Der Dialog mit der internationalen und interdisziplinären »community« der Forschenden am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz (IEG), die auch immer wieder renommierte Reformationshistoriker aus aller Welt zu den Ihren zählen kann, hat insgesamt stimulierend und in jeder Hinsicht bereichernd gewirkt. Und nicht zuletzt haben die Angehörigen der Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte des IEG alle auf ihre Weise – durch manche Entlastungen, durch kollegiale und freundschaftliche Gesprächsbereitschaft, durch den gut etablierten wissenschaftlichen Austausch in der Verwirklichung gemeinsamer Forschungsinteressen – dazu beigetragen, dass dieses Buch entstehen konnte. Besonders zu danken habe ich Herrn Benjamin Pfannes für seinen Einsatz in der bibliographischen Recherche und Frau Dr. Andrea Hofmann für ihre Hilfe bei der Registererstellung.
Mainz, im Juli 2016
Irene Dingel
____________
* Die Abkürzungen folgen dem Abkürzungsverzeichnis von Siegfried Schwertner, Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete, Berlin/Boston 2014 (IATG3).
Einleitung
Die Reformation war ein historischer Prozess, der auf eine umfassende kirchlich-theologische Erneuerung zielte und zugleich tiefgreifende Wirkungen in Kultur, Gesellschaft und Politik hervorbrachte.1 Für die europäische Geschichte war die Reformation ein einschneidendes Ereignis. Auch wenn sie Elemente persönlicher Frömmigkeit und kirchlicher Erneuerungsbewegungen des Spätmittelalters aufgriff und weiterführte, wurden doch zugleich grundlegende Neuansätze geschaffen. Denn die Reformation transformierte christliche Theologie und Spiritualität sowie gesellschaftlich-politische Strukturen in Europa grundlegend; ethische Auffassungen wurden auf ein neues Fundament gestellt und rechtliche Normen neu definiert. Zwar entfaltete sich die Reformation in den verschiedenen europäischen Räumen und politischen Gemeinwesen auf der Basis der jeweiligen politischen, gesellschaftlichen und frömmigkeitsgeschichtlichen Bedingungen unterschiedlich. Gemeinsam aber war allen reformatorischen Entwicklungen, dass sie ausgelöst und befördert wurden durch die von den Reformatoren propagierte neue Bibelhermeneutik, durch ihre Kritik an herrschenden Autoritätsstrukturen, durch die massenhafte Verbreitung reformatorischer Ideen mit Hilfe neuer Medien und eine wirkmächtige Rezeption in allen gesellschaftlichen Schichten. Dies löste tiefgreifende Veränderungen aus, durch die gesellschaftliches Leben und politisches Handeln, kirchliche Strukturen und individuelle Frömmigkeit eine neue Ausrichtung erhielten.2 Zu Recht hat man der Reformation deshalb eine »epochale« Bedeutung zugesprochen und hier die Überwindung des Spätmittelalters und den Beginn der Frühen Neuzeit gesehen. Als ausschlaggebendes Datum gilt das Jahr 1517, die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers, die nicht nur das Nachdenken über zentrale Fragen der Theologie in Gang setzten, sondern auch den Ruf nach Erneuerung von Kirche und Gesellschaft entscheidend verstärkten und weite Verbreitung erfuhren. Dem standen weitere und andere reformatorische Ansätze in Europa zur Seite, die mit dem, was sich um 1517 von Wittenberg ausgehend entwickelte, in Interaktion traten.
Es ist viel diskutiert worden, ob es sich bei der Reformation um eine kontinuierliche Entwicklung vom Spätmittelalter in die Frühe Neuzeit hinein handelte, oder ob die Reformation einen Umbruch darstellt, der Altes kappt und Neues initiiert und daher in Diskontinuität zur vorangegangenen Epoche steht.3 Beide Perspektiven können gute Argumente für sich geltend machen, sollten aber nicht gegeneinander ausgespielt werden. Denn sowohl was Theologie und Frömmigkeit der Reformation, als auch die durch sie geprägten rechtlichen, gesellschaftlichen und politischen Strukturen angeht, ist einerseits zu beobachten, dass ein vorhandenes kulturelles Erbe die sich etablierenden neuen Ideen mit prägten, dass dieses Erbe andererseits aber auch dezidiert verworfen werden konnte, um Neuansätze geltend zu machen. Ausschlaggebend für diesen Selektionsprozess bzw. die Distanzierung von der überkommenen Tradition war die konsequente Orientierung der Reformatoren an den Ausschließlichkeitskriterien »sola scriptura«, »solus Christus«, »sola gratia« und »sola fide«, die sie – auch wenn sie es nicht explizit formulierten – ihrer Lehre und ihrer Position im politischen und gesellschaftlichen Miteinander normativ zugrunde legten. Dies veränderte nicht nur die kirchliche Verkündigung und die Frömmigkeit des Einzelnen, sondern auch die Strukturen der Gesellschaft. Besonders deutlich wird dies z.B. an der Abschaffung der Unterscheidung zwischen Klerus und Laien und der damit Hand in Hand gehenden Aufwertung des weltlichen Lebens, das man durch die Verantwortungsbereiche der »politia« (Politik und Gesellschaft), der »ecclesia« (Kirche) und der »oikonomia« (Haus und Familie) strukturiert sah. Zugleich ging mit der Reformation die vermeintliche religiöse Einheit Europas4 in der einen christlichen Kirche endgültig verloren. Langfristig entstanden die bis heute existierenden großen christlichen Konfessionen, deren Herausbildung und Etablierung oft mit Staatsbildungsprozessen sowie gesellschaftlicher und kultureller Transformation verbunden waren.5
Diese Darstellung versucht die Prozesse der Etablierung und Entfaltung der Reformation im Spannungsfeld der politischen Entwicklungen in Europa nachzuzeichnen. Ein kurzer Blick auf die spätmittelalterlichen Strukturen in Politik, Gesellschaft und kirchlichem Leben dient dazu, das Substrat zu skizzieren, auf dem sich die Reformation entfaltete und von dem sie sich abgrenzte. Nicht nur Wittenberg und die von dort ausgehende Reformation kommen zu Sprache, sondern mit Zürich, Straßburg und Genf weitere reformatorische Zentren in Zentraleuropa und ihre herausragenden Akteure, deren Ausstrahlung den Westen ebenso wie den Osten Europas erreichte. Die Perspektive ist eine theologie- und ideengeschichtliche, die Kontroversen, reformatorischen Dissent, Bildungserneuerung, Reichspolitik, Ringen um Konsens, Krieg und Frieden von den Fragen her betrachtet, welche Impulse von der reformatorischen Lehre ausgingen, welche Wirkungen und Rückwirkungen sich im Kontext von Politik und Gesellschaft ergaben bzw. welche Transformationen reformatorische Positionen in Gang setzten bzw. selbst erfuhren. Die Abfolge der Kapitel orientiert sich weitestgehend an chronologischen Faktoren und ermöglicht zugleich einen auf Schwerpunkte konzentrierten Durchgang durch die Reformationsgeschichte. Für den Zusammenhang des Alten Reichs endet er mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555, der den »Augsburger Konfessionsverwandten« reichsrechtliche Duldung garantierte, ohne hier eine strikte Grenze ziehen zu wollen. Für den übrigen europäischen Raum, in den hinein die Reformation ausstrahlte und in dem sie zum Teil erst Jahrzehnte später als in Wittenberg und anderen reformatorischen Zentren einsetzte, wird diese Endmarke bewusst überschritten. Denn die Frage nach dem Übergang der Reformation in das Zeitalter der Konfessionen lässt sich nur situationsgebunden und unter Berücksichtigung der verschiedenen europäischen Kontexte beantworten, deren abschließende Skizze die Vielfalt der Reformation vor Augen führt.
____________
1 Zu den unterschiedlichen semantischen Füllungen des Reformationsbegriffs vom 15./16. Jahrhundert bis in die Gegenwart, vgl. Wohlfeil, Einführung, 44–79.
2 Vgl. Dingel/Jürgens, Historische Einführung, in: dies. (Hg.), Meilensteine, 11.
3 Vgl. Moeller, Frühe Reformation, 1998; vgl. auch Müller, Luther’s Transformation of Medieval Thought: Discontinuity and Continuity, 105–114 sowie Leppin, Luther’s Transformation of Medieval Thought: Continuity and Discontinuity, 115–124.
4 Schon Walther von Loewenich hatte auf die religiöse Pluralität der mittelalterlichen Kirche und die bereits zu Zeiten Karls des Großen einsetzenden Säkularisierungsprozesse hingewiesen und dies dem Mythos von einem religiös homogenen Abendland entgegengesetzt. Vgl. von Loewenich, Europa oder christliches Abendland?, 15–32.
5 Vgl. dazu den Überblick von Wolgast, Einführung der Reformation, 1–27.
HINTERGRÜNDE
Politische, gesellschaftliche und rechtliche Strukturen um 1500
I. Ständeordnung und Verfassungsstrukturen
Dass die Reformation Fuß fassen, in Europa eine rasante Ausbreitung erfahren und nachhaltig wirken konnte, lag u.a. an den politischen und gesellschaftlichen Strukturen, in denen sie sich entfaltete. Diese waren seit dem Mittelalter in einem Wandlungsprozess begriffen, der in den einzelnen Ländern und Regionen Europas unterschiedlich weit fortgeschritten war, aber ähnliche Faktoren aufwies.
Herrschaft im europäischen Mittelalter war geprägt durch Lehenswesen und Vasallitätsverhältnisse. Sie bezog sich weniger auf ein bestimmtes, durch Grenzen definiertes Gebiet, sondern ergab sich durch ein komplexes Gefüge persönlicher Bindungen, dessen Grundlage das wechselseitige Treueverhältnis zwischen Lehensherr und Vasall war. Reste dieses Lehenswesens hielten sich bis in die Frühe Neuzeit hinein. Aber bereits im Spätmittelalter begannen die ursprünglich lehensrechtlich an einen Kaiser gebundenen Grafschaften und Fürstentümer ihre politische Struktur zu verändern. Dieser Transformationsprozess betraf auch die ehemals genossenschaftlich-kommunal organisierten Gebilde, wie sie mit der alten Eidgenossenschaft, in den italienischen Stadtstaaten oder den deutschen Reichsstädten vorhanden waren. Gleichzeitig trat das Ideal einer Universalmonarchie bzw. eines Universalkaisertums mittelalterlicher Prägung immer mehr in den Hintergrund. Kaiser Karl V. (reg. 1519–1556) war der letzte Kaiser, der dieses Ideal zu verwirklichen strebte. Aber bereits um das Jahr 1300 hatte die Entwicklung hin zu souveränen Einzelstaaten eingesetzt. So hatte z.B. der französische König Philipp der Schöne nicht nur den Anspruch des Papstes Bonifatius VIII. auf die sich auch auf zeitliche Dinge beziehende »plenitudo potestatis« zurückgewiesen, sondern auch sonst abgelehnt, in irdischen Angelegenheiten einen weltlichen Oberherrn anzuerkennen. Dieses Autonomiestreben des Herrschers, der sich keinem anderen zu Gehorsam verpflichtet sieht, findet sich am klarsten in Frankreich. In Italien dagegen wollte man noch im 14. Jahrhundert nicht auf den Kaiser als obersten Richter verzichten. Denn in den inneren Auseinandersetzungen zwischen patrizischen Familien und Parteiungen konnte eine solche Autorität stabilisierend wirken.
Die Abgrenzung von auswärtigen Ansprüchen konnte mit dem Bestreben Hand in Hand gehen, auch im Innern des jeweiligen Gemeinwesens unabhängige Herrschaftsstrukturen zu schaffen. Bis in die Frühe Neuzeit hinein war das politische Gemeinwesen nämlich ein fürstlich-ständisches Gebilde, das in Interaktion des jeweiligen politischen Oberhaupts mit seinen Ständen funktionierte. Zu den Ständen gehörte der Adel, z.B. auf Reichsebene die Kurfürsten und Fürsten, sodann die hohe Geistlichkeit, wie z.B. die Prälaten und Bischöfe, und schließlich, wiederum auf Reichsebene, die Reichsstädte. Auf der Ebene des Territoriums war der ständische Aufbau ähnlich und bestand im Allgemeinen aus der Ritterschaft, der hohen Geistlichkeit und den Städten des jeweiligen Territoriums. Meist lag das Hauptgewicht auf der Seite des Fürsten, der aber auf Rat und Hilfe seiner Stände angewiesen blieb. Dabei konnte es durchaus zu Spannungen zwischen ihm und den Ständen kommen. Grund dafür war weniger das Streben der Stände nach Herrschaftspartizipation als vielmehr das Bedürfnis, die fürstliche Regierung zu kontrollieren und zu begrenzen. Man wollte verhindern, dass sich der Fürst Privilegien anmaßte, die womöglich die Rechte der unter ihm existierenden Gewalten und Korporationen beeinträchtigten. Oft war das Verhältnis zwischen Fürst und Ständen deshalb vertraglich festgelegt. Aber selbst wenn das nicht der Fall war, so existierte doch der Gedanke eines Rechts der Stände, d.h. der unteren Gewalten – nicht jedoch des einzelnen Untertanen – auf Widerstand, falls der Herrscher den geschriebenen oder ungeschriebenen Vertrag mit den Ständen verletzte. Diese Strukturen führten zu einem kontinuierlichen Ringen zwischen der obrigkeitlichen, nach souveräner Herrschaft strebenden Gewalt und den territorialen Ständen, zwischen dem Kaiser und den Reichsständen. Dieses Ringen bestimmte die Politik des gesamten 16. Jahrhunderts. Erst seit dem 17. Jahrhundert verloren die Stände kontinuierlich an Bedeutung, so dass es dem Träger der Krone oder vergleichbaren Machthabern gelingen konnte, die ständischen Gewalten immer mehr zu neutralisieren.
Dieser Transformationsprozess wurde flankiert durch die allmähliche, ebenfalls vereinzelt schon im 14. und 15. Jahrhundert beginnende Zentralisierung von Verwaltungsstrukturen. Erste Ansätze zeigten sich darin, dass Immunitäten und Privilegien der großen Grundherren, besonders deren gerichtliche Kompetenzen, durch fürstliche Lokalverwaltungen angetastet wurden. Auch hier kam Frankreich eine Vorreiterrolle zu. Denn seit dem 14. Jahrhundert gab es Tendenzen, Befugnisse von lokal begrenzten Verwaltungen zugunsten einer zentralen Steuerung aufzulösen. Dem stellten sich die regionalen Stände mit aller Kraft entgegen, so dass selbst in der am stärksten zentralistisch organisierten Monarchie Frankreich noch lange weite Gebiete von diesen Tendenzen unberührt blieben. Zur Stärkung dieser Opposition konnte man sogar die Reformation in Dienst nehmen.
Langfristig gesehen beförderten all diese Tendenzen die Entwicklung zum modernen Nationalstaat, der im eigentlichen Sinne allerdings erst im 19. Jahrhundert entstand. Wenn in der Frühen Neuzeit dennoch immer wieder von »Nation« bzw. »Nationen« oder von der »deutschen Nation« die Rede war, so ist das weit von dem entfernt, was man seit dem 19. Jahrhundert – staatsbezogen – unter Nation verstand. In der Frühen Neuzeit und damit auch im Zeitalter der Reformation ist unter »Nation« – analog zu dem Lateinischen »natio« und im Unterschied zu dem modernen Nationsverständnis – eine Gruppe von Menschen zu verstehen, die durch Herkunft, Sprache und Kultur ein Kollektiv bilden.
II. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation
Das »Heilige Römische Reich deutscher Nation« gilt zu Recht als Kernland der Reformation, auch wenn sich weitere Zentren der Reformation in anderen Räumen Europas ebenfalls einflussreich entwickelten. Dass die von Wittenberg ausgehenden Impulse aber – anders als vergleichbare Anstöße in anderen Regionen Europas – eine so schnelle und nachhaltige Wirkung entfalten konnten, wurde durch die spezifische politische und gesellschaftliche Struktur des Alten Reichs begünstigt.6
Die Bezeichnung »Heiliges Römisches Reich deutscher Nation« begegnet zum ersten Mal im Jahre 1486 in der Landfriedensordnung des Reichstags von Frankfurt/M. Der Name ist Programm. Denn in ihm spiegelt sich, dass sich das Reich von dem römischen Imperium der Antike ableitete bzw. in dessen Nachfolge sah. Zugleich schwingt in der Bezeichnung als »Heiliges Römisches Reich« der Universalitätsgedanke der alten Reichsidee noch mit. An der Spitze dieses Reichs stand seit jeher ein durch den Papst, den Stellvertreter Christi auf Erden, zum Kaiser gekröntes Oberhaupt, das sich als »advocatus ecclesiae« in eine besondere Verantwortung für die Kirche hineingestellt sah. Der Kaiser dieses Reichs stand – so der durch die »Translatio Imperii« legitimierte Anspruch – in einer Linie mit den ersten christlichen Kaisern der Antike und den späteren großen mittelalterlichen Herrschern, auch wenn das frühneuzeitliche Reich faktisch nur noch einen Teil des ehemaligen Reichsgebiets umfasste. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts trat deshalb in der Bezeichnung die »nationale« Komponente als eingrenzender Faktor hinzu, ohne dass schon von einem Nationalstaat die Rede sein könnte. Der Name dieses politischen Gebildes sagte lediglich aus, dass sich dieses Reich, das sich nach wie vor als universal verstand und dessen Kaiser einen Universalitätsanspruch erhob, signifikant von den »nicht-deutschen« Ländern unterschied, auch wenn es keineswegs in fest gezogenen geographischen Grenzen existierte.
Bezeichnend dafür war, dass in fast allen Grenzgebieten die rechtlichen Zugehörigkeiten unbestimmt waren. Der Deutschordensstaat z.B. im Nordosten des Reichs war im Jahre 1466 mit dem Frieden von Thorn dem polnischen König lehenspflichtig geworden. Kaiser und Papst aber hatten diesen Vertrag nicht anerkannt. Hinzu kam, dass die Ordensritter zweimal nacheinander – 1498 und 1510 – Angehörige des Reichsfürstenstands zu ihren Hochmeistern gewählt hatten. Der erste war ein wettinischer Prinz, der zweite ein Mitglied des Hauses Hohenzollern gewesen, nämlich der Markgraf Albrecht von Brandenburg aus der Linie Brandenburg-Ansbach. Beiden hatte der Kaiser untersagt, dem König von Polen in Krakau den Lehenseid zu leisten. Der Deutschordensstaat gehörte also nicht zum Reich, stand aber durch seine Hochmeister dennoch in enger Verbindung zum Reich, was rechtliche Unklarheiten schuf. Im Jahre 1525 wurde der Deutschordensstaat von dem Hochmeister Albrecht von Brandenburg, der das Land der Reformation zuführte, in ein weltliches Herzogtum verwandelt. Es blieb aber unter polnischer Lehenshoheit.
Im Nordwesten und Westen verhielten sich die Dinge ähnlich. Hier waren die niederländischen und burgundischen (Freigrafschaft Burgund) Gebiete an Habsburg gefallen, zum Teil durch die Heirat Maximilians I. und Marias von Burgund (1477), zum Teil durch Erbfall nach dem Tod Karls I., des Kühnen (Charles le Téméraire, 1477). Daher galten sie als Bestandteile des Reichs. Aber sowohl in den Niederlanden als auch in Burgund gab es Adlige, die Vasallen des französischen Königs und des Kaisers zugleich waren. Diese habsburgischen Besitzungen fügten sich deshalb nur schwer in das Reich ein und bildeten einen Herd ständiger Unruhe.
Ebenso wenig fest war die südliche Grenze des Reichs. Hier hatte sich im Jahre 1499 im Friedensschluss von Basel endgültig das Ausscheiden der Eidgenossenschaft aus dem Reichsverband ergeben. Voraufgegangen war ein blutiger Reichskrieg mit den Eidgenossen, der sogenannte Schweizer- oder Schwabenkrieg, in dem die Aufgebote des Reichs und des Schwäbischen Bundes den Bauernhaufen der Eidgenossenschaft gegenübergestanden hatten. Die viel beweglicheren Bauernhaufen waren den schlecht geführten Aufgeboten des Reichs überlegen gewesen. All dies beschleunigte den Ausscheidungsprozess der Eidgenossenschaft, der schon im 13. Jahrhundert begonnen hatte. Die Eidgenossenschaft ihrerseits war ein lockerer Bund von Landgebieten und Städten, die zu gemeinsamen Beratungen, den sog. Tagsatzungen, zusammentraten, gemeinsam Vogteien verwalteten und einander ähnliche genossenschaftliche Verfassungsformen hatten. Sie waren daher bestrebt, sich der Steuer an das Reich, die sie als Zumutung empfanden, und vor allem dessen Gerichtshoheit zu entziehen. Sie nannten sich daher in der Folgezeit auch gern die »des heiligen römischen Reichs besonders gefreite Stände«. Dieser genossenschaftliche Bund übte eine nicht geringe Anziehungskraft auch auf die Städte jenseits des Rheins aus, wie z.B. auf Basel, Schaffhausen und Mühlhausen, die sich ihm anschlossen, sowie auf Konstanz und Straßburg, die aber letzten Endes dem Reichsverband verhaftet blieben.
Alle Bemühungen des habsburgischen Kaisers Maximilian I. (reg. 1493–1519) um Festigung der Reichsgrenzen verliefen angesichts dieser Lage nicht sehr erfolgreich. Seine Regierungszeit war zudem von einer aktiven Italienpolitik bestimmt, denn er wollte die uralten Reichslehen in Italien, vor allem das wohlhabende Mailand, wiedergewinnen. Dies führte zu einem lang andauernden habsburgisch-französischen Gegensatz, zumal auch der französische König durch Verwandtschaft mit Valentina Visconti Ansprüche auf Mailand erhob. Ludwig XII. war es sogar gelungen, 1499 Mailand zu erobern, und er führte den dortigen Herzog Ludovico Sforza, der durch die zweite Ehe Maximilians mit Blanca Sforza dem Reich verbunden war, im Jahre 1500 in französische Gefangenschaft. All dies stand am Beginn einer auch in der Folgezeit weiter schwelenden, immer wieder kriegerisch ausgetragenen Feindschaft. Angesichts des insgesamt schwachen Reichsverbandes waren diese und andere politische Herausforderungen nur schwer zu bewältigen. Der Gedanke einer grundlegenden Reform war daher allgegenwärtig.7
Dieser Gedanke war nicht neu. Ende des 15. Jahrhundert wurde die lange geforderte Reform der Reichsverfassung endlich umgesetzt8. Sie sollte der inneren Struktur des Reichs feste Konturen geben und zielte darauf, das Funktionieren des Reichsverbands sicherzustellen. Die wichtigsten Entscheidungen wurden auf dem Reichstag zu Worms 1495 und dem Reichstag zu Augsburg im Jahre 1500 getroffen. Die Reform bezog sich auf die Institutionen des Reichs, die man neu organisierte und zum Teil auch neu einrichtete: den Reichstag und das Reichskammergericht. Außerdem wurden eine Friedensordnung, eine Reichssteuer und die Einrichtung eines Reichsregiments beschlossen. Der Weg dorthin war bestimmt durch den seit Jahrhunderten bestehenden und fortdauernden Gegensatz zwischen Kaiser und Reichsständen. Den Reichsständen lag daran, ihr Gewicht geltend zu machen und die Macht des Kaisers zu beschränken. Sie trugen daher Mit-Verantwortung dafür, dass die außenpolitischen Pläne Maximilians scheiterten und er Niederlagen hinzunehmen hatte, was dieser den Fürsten auch anlastete. Aber die Reichsreform schrieb diese Grundkonstellation der beiden konkurrierenden Gewichte von Kaiser und Ständen fest.
Sie betraf zunächst die Funktionen des Reichstags als maßgebliches Organ des Reichs. Einberufen wurde er vom Kaiser, der ihn möglichst jedes Jahr zusammentreten lassen sollte, was anfangs, allerdings nicht dauerhaft, in die Tat umgesetzt werden konnte. Der Kaiser legte mit einer »Proposition« die Tagesordnung fest, war dann aber von den eigentlichen Verhandlungen nahezu ausgeschlossen. Dies lag an der Struktur des Reichstags und dem Ablauf der Beratungen. Im Reichstag vertreten waren die regionalen Träger der Macht, d.h. die Reichsstände. Sie bildeten die drei »Kurien« des Reichstags: den Kurfürstenrat, den Fürstenrat und das Reichsstädtekollegium. Deren Beratungen fanden in getrennten Sitzungen statt, bevor man in einem komplizierten Verfahren zu einer übergreifenden Beschlussfindung kam. Das Votum der Reichsstädte hatte dabei nur konsultatives Gewicht. Verkündet wurden die Beschlüsse, denen er zuvor zugestimmt hatte, vom Kaiser in den »Reichs-Abschieden« (1497 eingeführt). In diesen Reichsabschieden wurde so allmählich eine Reichsgesetzgebung niedergelegt. Der Reichstag selbst entwickelte sich zum politischen Machtzentrum des Reichs.
Neben dem Reichstag galt das Reichskammergericht als zweites Organ des Reichs. Die Reform hatte es neu eingerichtet. Auslöser für die Schaffung dieser Institution war die Ausweitung des Fehdewesens im 15. Jahrhundert. Denn immer noch beanspruchten einzelne Stände oder Personen das Recht auf Selbsthilfe. Versuche, die Fehde über Landfriedensordnungen einzudämmen, waren erfolglos verlaufen. Im Jahre 1495 verabschiedete der Wormser Reichstag einen »ewigen Landfrieden«, den das Reichskammergericht garantieren und für dessen Einhaltung es sorgen sollte. Dennoch hielt sich das Fehdewesen weiterhin zäh am Leben. Trotz all dieser Maßnahmen gab es also nach wie vor keine Rechtssicherheit. Während zuvor die oberste Gerichtsbarkeit am Hof des Kaisers ausgeübt worden war, übertrug man sie nun dem Reichskammergericht, was einerseits eine Einschränkung der kaiserlichen Machtvollkommenheit bedeutete, zumal die Reichsstände Einfluss auf die Berufung der Richter hatten, andererseits aber auch fürstliche Hoheitsrechte beschränkte, da das Reichskammergericht dem Gerichtswesen der einzelnen Territorien und Städte übergeordnet war. Es sollte ständig tagen und sesshaft sein. Als Sitz wurde die Stadt Frankfurt am Main bestimmt. Ab 1527 tagte das Reichskammergericht jedoch in Speyer. Die Richter waren in der Mehrzahl studierte Juristen, die auf der Grundlage des römischen Rechts ihr Amt ausübten.
Um das Reichskammergericht zu unterhalten waren finanzielle Mittel notwendig. So wurde ebenfalls 1495 der »Gemeine Pfennig« beschlossen, eine ständige Reichssteuer. Aber deren Erträge waren unzulänglich, was zum einen daran lag, dass kein wirksames Mittel zur Eintreibung dieser Steuer zur Verfügung stand, zum anderen daran, dass die Stände dem entgegenarbeiteten. Dies hatte zur Folge dass das Reichskammergericht aufgrund des finanziellen Mangels jahrelang arbeitsunfähig war.
Die letzte Komponente der Reichsreform betraf das Reichsregiment, dessen Aufgabe es sein sollte, die Regierung des Reichs zu gewährleisten. Im Jahre 1500 wurde zu diesem Zweck eine Regimentsordnung erlassen, die vorsah, dass ein Gremium von 20 Personen die Macht im Reich ausüben sollte. Den Vorsitz sollte der Kaiser führen und zwei Vertreter bestimmen können. Außerdem waren Repräsentanten der Städte und die Kurfürsten darin vertreten. Die generelle Mehrheit in diesem Gremium lag bei den Kurfürsten. In allen wichtigen Entscheidungen sollte der Kaiser an das Reichsregiment gebunden sein. Es kontrollierte seine Außenpolitik und regulierte das Kriegswesen. Sitz des Reichsregiments sollte Nürnberg sein. Aber es war nur von kurzem Bestand. Kaiser Maximilian hatte versucht, die Einrichtung dieser Institution zu hintertreiben. Zudem fehlte es an finanziellen Mitteln und Personal und damit an den Grundvoraussetzungen für ein Funktionieren. Faktisch war das Reichsregiment bereits 1502 handlungsunfähig. Erst im Jahre 1521 wurde es noch einmal in Worms eingerichtet.
Der Dualismus von Kaiser und Ständen blieb also bestehen und war charakteristisch für das gesamte Reformationszeitalter. Niemand besaß die universale Macht im Reich. Anders sah es im Vergleich dazu in England oder in Frankreich aus. Hier war der König bereits in der Lage, über ein stehendes Heer zu verfügen. Er konnte auf feste Einkünfte aus seinem Reich rechnen und ein Staatsbudget veranschlagen. Von Maximilian I. dagegen ist bekannt, dass er in Extremsituationen sein eigenes Tafelsilber versetzen oder gar seine Gemahlin und deren Hofstaat – z.B. den Wirten von Worms – monatelang als Pfand ausliefern musste, bis ausstehende Rechnungen bezahlt waren. Man kolportierte, dass er in den Gewölben seiner Burg in Wien nach mysteriösen Schätzen graben ließ. All dies macht deutlich, wie wenig die damaligen Strukturen eine tragfähige Wirtschaft, Politik und Verwaltung sicherstellen konnten. Dennoch etablierte die Reichsreform Verfassungsstrukturen von einer gewissen Festigkeit und Orientierungskraft. Denn immerhin gab es jetzt Institutionen und Regelungen, die für den Zusammenhalt dieses komplexen Reichsgebildes sorgen konnten. Nichtsdestoweniger blieb das Ringen zwischen Kaiser und Ständen um die politische Durchsetzungskraft und die Verwirklichung von Eigeninteressen bestehen, was – anders als in monarchisch zentralisierten Ländern – erhebliche Spielräume für die Etablierung der Reformation eröffnete.9
Dies lag auch an der territorialen Struktur des Heiligen Römischen Reichs, das, neben dem Königreich Polen, das ausgedehnteste Herrschaftsgebiet Europas darstellte. Von seiner territorial-politischen Zusammensetzung her aber war es vollkommen uneinheitlich. Besonders im Südwesten, Westen und im Zentrum war das Reichsgebiet territorial zerklüftet. Die Grenzen der Territorien lagen oft eng beieinander, konnten aber zugleich durch kollidierende Herrschaftsrechte überspannt werden. Im Osten des Reichs existierten dagegen weiträumigere Gebiete mit einheitlicheren Strukturen. Dies lag zum Teil an rechtlichen Bedingungen. Es gab Länder, die von Adelsfamilien regiert wurden, in denen bei jedem Erbfall die Grenzen entsprechend der Zahl der erbberechtigten Söhne neu gezogen wurden, oder in denen diese Grenzen durch Heiraten wieder aufgehoben werden konnten. Daneben existierten die territorial unteilbaren Kurfürstentümer, deren Regierung jeweils an den ältesten Sohn der herrschenden Dynastie überging. Außerdem gab es zahlreiche geistliche Territorien, die ebenfalls – als kirchlicher Besitz – unteilbar waren. Mitten in diesem territorialen Flickenteppich lagen die freien Reichsstädte, die durch einen gewählten Magistrat bzw. Rat regiert wurden, und die ihrerseits wieder Landbesitz im Umland haben konnten. Um in Auseinandersetzungen zu bestehen und Übergriffen zu wehren, um sich gegenseitig abzusichern und zu unterstützen, wurden Bünde und Einungen geschlossen.
Die gesellschaftliche Struktur des Reichs war ebenso uneinheitlich wie die territoriale. In allen Territorien existierten die sogenannten Landstände, die das Land und seine Bevölkerung gegenüber dem Landesherrn vertraten. Unter diese Landstände zählten die Grundbesitzer (u.U. auch die freien Bauern), der Adel, die hohe Geistlichkeit und die Städte. Sie fanden sich zu Beratungen in Landtagen zusammen, was um 1500 in allen größeren Territorien üblich geworden war. Meist bestanden hier, wie auf den Reichstagen, drei »Kurien«, in denen die Prälaten, der Adel bzw. die Ritterschaft und die Städte vertreten waren. Aber auch andere Zusammensetzungen waren anzutreffen. So existierten z.B. Landtage, in denen mehrere Adelskurien vertreten waren, oder auch solche, in denen der Adel überhaupt keinen Sitz und Stimme hatte. Gelegentlich gab es eine »Herrenbank«, sehr selten eine Vertretung der Bauern. Möglich war auch, dass von den drei ersten Kurien bzw. Bänken eine oder sogar zwei fehlten. Die Territorialfürsten, die mit dem Kaiser zusammen regierten und ihn kontrollierten, waren also ihrerseits an ihre Landstände zurückgebunden, von denen sie kontrolliert wurden. Wollte ein Landesherr z.B. Steuern erheben, mussten sie durch die Inhaber des Grundbesitzes – d.h. den Adel – genehmigt werden. Zugleich konnten die Landstände Mittel einsetzen, um die Landesherrschaft zu behindern. Sie beanspruchten beispielsweise Privilegien, die sich auf Steuerfreiheit erstrecken oder Landesteilungen entgegenstehen konnten. Vor diesem Hintergrund tendierte die Politik der Landesherren nicht selten dahin, die Macht der Stände zu begrenzen. Ein Fürst konnte aber auch durchaus Interesse daran haben, die Stände an der Verantwortung und Gesetzgebung für sein Territorium zu beteiligen. Denn dies konnte durch die Identifikation mit den Belangen des Territoriums dazu beitragen, die Landesherrschaft zu stabilisieren.
Die territoriale Struktur des Reichs wurde durch die Städte aufgesprengt. Denn unter den Städten innerhalb eines Territoriums, gab es solche, die eine Landstandschaft besaßen oder Sonderrechte im Blick auf Steuer, Kriegsfolge oder Gerichtsbarkeit genossen und so der unmittelbaren Regierungsgewalt des jeweiligen Landesherrn entzogen waren. Wieder andere Städte besaßen als freie Reichsstädte Reichsunmittelbarkeit und hatten mit ihrem Rat eine eigene politische Obrigkeit. Ihr politischer Sonderstatus sprengte die Einheitlichkeit eines Territoriums. Daher tendierten die Landesherren dazu, sie ihrer Rechte zu berauben und möglichst in ihr Gebiet einzugliedern. Auf diese Weise hatten Ende des 15. Jahrhunderts Städte wie Mainz und Erfurt ihre Freiheiten verloren. Im 16. Jahrhundert gab es ca. 80 Städte, die als freie Reichsstädte dem Reichstag angehörten, wie z.B. Nürnberg, Augsburg, Straßburg, Köln, Frankfurt/M. Ihr politischer Einfluss jedoch war relativ gering. Aber die Städte verfügten durch ihre florierenden Handelsbeziehungen meist über erhebliche Finanzkraft, was sich – angesichts der permanenten Geldnot der Fürsten – günstig auf die Sicherung ihrer Eigenständigkeit auswirkte. Eine Stadt wie Nürnberg z.B. konnte noch kurz nach 1500 ihr Territorium abrunden. Dass auch Städte, wie z.B. Schwäbisch-Hall und Hamburg, über Territorialbesitz verfügten, war durchaus üblich. Anfang des 16. Jahrhunderts existierten im Reich ungefähr 3.000 Städte mit Stadtrecht. Die meisten waren Kleinstädte mit nicht mehr als 2.000–3.000 Einwohnern. Nur ca. 5% überschritten diese Grenzen. Eine Einwohnerzahl von 20.000 oder mehr war selten. Keine Stadt des Reichs gehörte zu den Großstädten Europas. Augsburg und Köln zählten mit ihren ca. 40.000 Einwohnern zu den größten Städten des Reichs und rangierten damit weit hinter den Städten Frankreichs und Italiens. Dennoch waren sie aufgrund des in ihnen ansässigen Gewerbes, des Handels, der hier gepflegten Kunst und Bildung kulturelle Zentren.
Während die Städte die territoriale Geschlossenheit der fürstlichen Landesherrschaft durchlöcherten, legte die Kirche ein dichtes, grenzüberspannendes Netz über die Territorialherrschaften. Sie überschritt in ihren Organisationsformen die Landesgrenzen und durchdrang zugleich alle individuellen Lebensbezüge. Sie verfügte über großen Reichtum und weiten Grundbesitz. Im Herzogtum Bayern z.B. waren ca. 50% des Bodens kirchlicher Grundbesitz. Die Landesherren strebten daher danach, sich in die bischöfliche Verwaltung innerhalb ihrer Territorien einzuschalten. Sie versuchten z.B., Einfluss auf die Besetzung der Domkapitel zu nehmen oder auf die Nominierung von Bischöfen, um so Kontrolle über benachbarte Bistümer zu erlangen. Manchmal gelang es ihnen, durch gezielte Einflussnahme auf Stellenbesetzungen, Klöster und deren Besitz mitzuverwalten. Auch in die kirchliche Gerichtsbarkeit griff die weltliche Herrschaft ein und versuchte sie zu beschränken. Solche Interessen konnten sich mit der Reformation bzw. reformatorischen Anliegen verbinden und sie instrumentalisieren. All dies oder ähnliche Aktionen bedeuteten aber keineswegs eine Absage an die Frömmigkeit. Dieselben Obrigkeiten, die die Kirche aus ihren angestammten politischen Rechten zu verdrängen suchten, praktizierten eine durchaus aufrichtige Frömmigkeit und lebten in tiefer Devotion. Ihre Eingriffe in kirchliche Strukturen und Belange waren durch Herrschaftskonkurrenz motiviert, zielten aber nicht auf das kirchliche Monopol in der Heilsvermittlung.
Religiöses Leben im Spätmittelalter und an der Schwelle zur Frühen Neuzeit
I. Die Kirche in ihren institutionellen Erscheinungsformen und Strukturen
1. Kirche und Papsttum
Die Kirche hatte sich vor allem im Hoch- und Spätmittelalter zu einer einflussreichen Institution entwickelt, die sowohl für das Leben in Politik und Gesellschaft als auch für das Leben des Einzelnen von tragender Bedeutung war.10 Sie galt als Hüterin der wahren Lehre und Hort der Bildung. Ihr Einfluss ragte weit in den Alltag hinein, indem sie Tages- und Jahreszeiten, ja den gesamten Lebenslauf mit Sakralhandlungen begleitete. Sie war die sachverständige Helferin in Notsituationen und Grenzfällen des Lebens, die Trost und Hilfe bot. Die gesamte gesellschaftliche Ordnung in Ehe und Familie, Stand und Beruf war von kirchlich vermittelten Grundsätzen geprägt, ebenso wie Politik und Wirtschaft. Zudem verfügte die Kirche über beträchtliche materielle Güter. Sie hatte Grundbesitz, richterliche Kompetenzen und konnte obrigkeitliche Funktionen ausüben.
Gleichzeitig war es dem Papsttum gelungen, seinen Primat zu festigen, was erhebliche Auswirkungen auf die Kompetenzen von Synoden und Bischöfen mit sich brachte. Vor allem aber sah sich das Papsttum als Träger nicht nur des geistlichen, sondern auch des weltlichen Schwerts (Zwei-Schwerter-Lehre), welches es – symbolisch vollzogen in Salbungen und Krönungen – an die Inhaber weltlicher Macht übertrug. Die theoretische Grundlage dafür findet sich in der Lehre von der päpstlichen »plenitudo potestatis«. Nach der von Papst Bonifatius VIII. promulgierten Bulle »Unam Sanctam« von 1302 bedeutete dies nicht nur die Herrschaft über die Kirche, sondern auch über den weltlich-politischen Bereich. Demnach war es der Papst, der den weltlichen Herrscher damit beauftragte, das weltliche Schwert – zum Schutze der Christenheit – zu führen. Auch nach der Zeit Bonifatius’ VIII. traten päpstliche Kurialisten weiter für diese Prinzipien ein.
Diese auf das römische Papsttum hin orientierte Kirche hatte auch politisch immer mehr an Bedeutung gewonnen. Politische Aufgaben und eine ausgebaute, zentralisierte Verwaltung erforderten immer größere finanzielle Mittel. Bereits im 13. Jahrhundert hatten deshalb die Päpste damit begonnen Steuern zu erheben. Die hauptsächlichen Einnahmen bestanden aus den Erträgen des Kirchenstaats, aus den Zinsen, die der Papst von lehenspflichtigen Königreichen erhielt (z.B. von Neapel und England), aus dem Peterspfennig (Polen und Ungarn) und den Kreuzzugssteuern, die ihrem eigentlichen Zweck auch entfremdet werden konnten. Hinzu kamen weitere Einnahmequellen, die sich die seit Clemens V. in Avignon residierende Kirche (1309–1377) nach und nach erschloss. Dazu gehörte z.B. dass sich die Päpste durch Reservationen die Besetzung kirchlicher Ämter (Pfründen, Benefizien) vorbehielten. Während in der Regel bei der Neubesetzung einer Pfründe die Hälfte der Einnahmen des ersten Jahres an den zuständigen Bischof ging, flossen im Falle einer päpstlichen Reservation diese sogenannten »Annaten« direkt an die »camera apostolica«, die zentrale Finanzbehörde der Kurie. Prälaten hatten für ihre Bestätigung durch den Papst die »Servitien«, d.h. ein Drittel ihrer Jahreseinnahmen zu entrichten. Außerdem wurden Amtsgeschäfte der päpstlichen Behörden mit Gebühren belegt.
Daneben spielte das Recht eine große Rolle. Die Kirche verfügte über eine eigene Gesetzgebung und eine eigene Gerichtsbarkeit. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts wurde das kanonische Recht als Disziplin an den jungen Universitäten gelehrt. Die Päpste jener Zeit waren sämtlich gelehrte Kanonisten, die sich darum bemühten, die geltenden Rechtssätze zu sammeln und zugänglich zu machen. Damit rückte der Papst zugleich immer mehr in die Rolle des höchsten Gesetzgebers, wodurch sich die Befugnis der Konzilien zunehmend darauf beschränkte, die päpstlichen Dekretalen nachträglich zu billigen. Das kanonische Recht erlangte eine derartige Bedeutung, dass man auch sakramentale Vollzüge in einen rechtlichen Verständnishorizont einbettete. Die Buße z.B. verstand man als Abtragen einer Schuld, die man sich durch Sünde aufgeladen hatte. Die Schuld war dann abgegolten, wenn ein ihrer Schwere entsprechendes göttlich bzw. kirchlich auferlegtes Strafmaß vollzogen war.
2. Der konziliare Gedanke
Angesichts dieser Entwicklungen wurde seit dem 13. Jahrhundert der Ruf nach einer Reform der Kirche immer lauter. Dem kurialen Zentralismus und dem päpstlichen Anspruch auf die »plenitudo potestatis« stellte man den konziliaren Gedanken gegenüber (Konziliarismus). So propagierte im 14. Jahrhundert der an der Pariser Universität lehrende Marsilius von Padua (ca. 1290–1342/1343) mit seiner Schrift »Defensor pacis«11 eine Konzeption von Kirche, nach der die »universitas fidelium« durch das allgemeine Konzil vertreten werde. Dem Konzil, das aus Geistlichen und Laien bestehen solle, komme die höchste kirchliche Autorität zu.12 Mit dieser Konzeption hatte Marsilius unterschwellig eine deutliche Kritik an der bestehenden Kirche formuliert, die sich seiner Ansicht nach zu einer Klerikerkirche ohne Laienbeteiligung entwickelt hatte. Auch am Primatsanspruch des Papsttums, dessen biblische Begründung er hinterfragte und historisch erklärte, übte er Kritik. Dagegen gestand er dem Papst lediglich einen Ehrenvorrang unter den übrigen Amtsträgern der Kirche zu, die ihrer geistlichen Gewalt nach alle gleich seien. Weiterhin forderte er, dass sich die Kirche auf ihre religiösen Aufgaben beschränken und Besitzlosigkeit üben solle. Mit dieser Schrift hatte Marsilius von Padua einen kühnen Angriff auf die Kirche und ihre hierarchische Struktur formuliert. Es war deshalb nur folgerichtig, dass ihn Papst Johannes XXII. exkommunizierte und die anstößigen Sätze des »Defenso pacis« als häretisch brandmarkte. Zwei Jahrhunderte später, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, erlangten sie noch einmal unmittelbare kirchenpolitische Bedeutung, als König Heinrich VIII. von England (reg. 1509–1547) die Schrift neu herausgeben ließ. Das fiel in jene Zeit, in der sich die englische Kirche von Rom zu lösen begann.13 Das Gedankengut des Marsilius, auf das sich seine eigenen Zeitgenossen wegen seiner Verurteilung nicht berufen konnten, erlangte auf diese Weise nachträgliche Wirkung.
In die Reihe derer, die Kritik an den herrschenden institutionellen Strukturen der Kirche äußerten, gehört auch der englische Franziskaner Wilhelm von Ockham (1290–1349). Er war von Marsilius von Padua, den er auch persönlich kennengelernt hatte, beeinflusst. In seinen Streitschriften wandte sich Ockham besonders gegen den Gedanken der »plenitudo potestatis« und die Zwei-Schwerter-Lehre. Gegen die herrschende päpstliche Ansicht vertrat er die Meinung, dass auch die höchste weltliche Gewalt unmittelbar von Gott, nicht etwa vom Papst, in ihr Amt eingesetzt sei. Außerdem sprach er dem Konzil die höchste kirchliche Autorität zu. Zugleich übte er Kritik an der Entwicklung der Kirche zu einer Rechtsanstalt und Herrschaftsorganisation und mahnte zur Rückkehr zu der Idee der apostolischen Armut.
Sowohl Marsilius von Padua als auch Wilhelm von Ockham äußerten den Gedanken eines übergeordneten Generalkonzils, der allerdings erst mit dem Großen Schisma von 1378 effektive Bedeutung gewann. Denn das Schisma zwischen Papst Urban VI. in Rom und dem von den Franzosen gewählte Gegenpapst Clemens VII. in Avignon hatte die Christenheit in zwei Oboedienzen gespalten. Einziges Mittel zur Behebung der Spaltung und zur Reform der Kirche war ein allgemeines Konzil, das man immer dringlicher forderte.
Das lang ersehnte Konzil fand – nach einem gescheiterten Versuch in Pisa 1409 – schließlich in den Jahren 1414–1418 in Konstanz statt. Es beendete das Große Schisma und stellte die Einheit der westlichen Christenheit wieder her. Der Konziliarismus wurde zwar sanktioniert und das Dekret »Frequens« sah auch die regelmäßige Einberufung allgemeiner Konzilien vor, aber dies blieb reine Theorie. Dagegen ging das Basler Konzil von 1431–1449 die Reformfragen intensiver an. Die verabschiedeten Dekrete stärkten den Gedanken von der obersten Autorität des Konzils und enthielten u.a. Bestimmungen zur regelmäßigen Abhaltung von Diözesan- und Provinzialsynoden, Verfügungen gegen das Konkubinat der Kleriker, gegen Missstände im Gottesdienst und gegen die leichtfertige Verhängung des Interdikts. Papst Eugen IV. verlegte das Konzil schließlich nach Ferrara und dann nach Florenz, wo ein Teil der Konzilsväter weiter tagte, während das Basler Konzil immer mehr zerfiel. Die Wirkung der Reformansätze hielt sich in engen Grenzen, so dass das Papsttum in der nachkonziliaren Zeit wieder zu seiner alten Politik zurückkehrte und in der Renaissance eine neue Blüte erfuhr. In Frankreich dagegen sorgte die Pragmatische Sanktion von Bourges (1438) dafür, dass die Reformdekrete von Basel rezipiert wurden. Sie stärkte zugleich die Macht der Krone, die nun auf Kapitelwahlen Einfluss nehmen und die Zuständigkeit der päpstlichen Jurisdiktion eingrenzen konnte. So war es z.B. möglich, bei Missbrauch kirchlicher Amtsgewalt oder Verstößen gegen die Bestimmungen der Pragmatischen Sanktion an die zuständigen weltlichen Parlamente zu appellieren und den Fall der geistlichen Gerichtsbarkeit zu entziehen. Auch wenn die Pragmatische Sanktion durch das Konkordat von Bologna zwischen König Franz I. (reg. 1515–1547) und Papst Leo X. 1516 wieder aufgehoben wurde, hielten die Parlamente doch hartnäckig an deren Bestimmungen fest. Durch das Konkordat aber hatte der französische König nun das Nominationsrecht für alle vakanten Bischofssitze und Abteien erhalten. Dies machte ihn zum Herrn der Kirche seines Landes.14
In der Kirche war der Konziliarismus, der das Selbstverständnis des Papsttums und sein Agieren in Kirche und Welt in Frage gestellt hatte, schnell wieder zurückgedrängt. Papst Pius II., der als Kardinal Enea Silvio Piccolomini noch ein eifriger Konziliarist gewesen war, verbot in seiner Bulle »Execrabilis« im Jahre 1460 aufs schärfste die Möglichkeit, vom Papst an ein allgemeines Konzil zu appellieren, zumal dies bedeutet hätte, dass dem Konzil eine über dem Papst stehende Autorität zukäme. Leo X. ließ dieses Verbot auf der V. Lateransynode (1512–1517) wiederholen. Dies lässt vermuten, dass der konziliare Gedanke noch nicht ganz verschwunden war, und so hatten die Päpste guten Grund, in den Anfängen der Reformation ein Wiederaufleben konziliarer Tendenzen zu vermuten und zu befürchten.
3. Klerus
Die Tatsache, dass sich in der Kirche trotz vielversprechender Ansätze nichts änderte, mag u.a. damit zusammenhängen, dass die bestehenden Verhältnisse und Strukturen in mancherlei Hinsicht Vorteile boten. Die Kirche war nämlich zu einer Versorgungsanstalt für die nachgeborenen Söhne und Töchter aus adligen Familien geworden. Aus ihnen kam die soziale Oberschicht des Klerus: Fürstbischöfe, Bischöfe, Äbte und Äbtissinnen. Gelegentlich fanden auch Söhne reicher Bürger Zugang zu ähnlich gehobenen kirchlichen Positionen. Auch in einem geistlichen Amt oder im Kloster behielt man den adlig wohlhabenden Lebensstil im Sinne standesgemäßer Repräsentation bei. Das Hauptinteresse der Stellen- oder Pfründeninhaber richtete sich daher eher auf die mit dem Amt verbundenen Erträge, weniger auf die geistlichen Aufgaben. Wenn von dem Bischof von Straßburg, einem wittelsbachischen Prinzen, der im Jahre 1500 dort als Bischof amtierte, berichtet wurde, dass er während seiner insgesamt 28-jährigen Amtsführung nicht ein einziges Mal gebeichtet oder gepredigt habe, war dies durchaus nicht ungewöhnlich. Die Reformation thematisierte später immer wieder das Versagen der Bischöfe, gerade im Blick auf notwendige Reformen. Das Beispiel aber zeigt, dass die Gründe für ein solches Versagen nicht unbedingt in einem moralischen Defizit lagen, sondern durch die herrschenden Strukturen bedingt wurden. Hinzu kam, dass das Kirchenrecht die Möglichkeit bot, kirchliche Ämter und die damit zusammenhängenden Einkünfte zu kumulieren, d.h. in einer Hand anzusammeln. Dies konnte für die Aufrechterhaltung einer standesgemäßen Repräsentation wichtig sein. Die Kehrseite der damit verbundenen Steigerung des Einkommens aber war die Abwesenheit des Amtsinhabers von seinen zusätzlichen Pfründen. Dies wiederum bedeutete Vernachlässigung des geistlichen Amtes in Predigt, Sakramentsverwaltung und Seelsorge an jenen Stellen.
Demgegenüber lebte der einfache Weltklerus unter eher dürftigen Bedingungen. Er war es, der die eigentliche Arbeitslast trug, denn die Inhaber mehrerer Benefizien stellten für die mit einer solchen Pfründe verbundenen kirchlichen und seelsorgerlichen Pflichten Vikare ein. Deren unzulängliche Besoldung begünstigte das Entstehen eines regelrechten Klerikerproletariats. Die damit aufkommende Unzufriedenheit äußerte sich zunächst nur latent, zumal der soziale Aufbau des geistlichen Standes weitgehend dem der damaligen Gesellschaft entsprach. Während Bischöfe und Kapitelherren dem Adel entstammten, kamen die anderen Geistlichen aus den übrigen Bevölkerungsgruppen. Bauernsöhne waren jedoch fast nie unter ihnen. Aufstiegsmöglichkeiten waren selten und nur in Ausnahmefällen gegeben. Die ohnehin schon hohe Zahl der Pfarrkleriker stieg durch die zahlreichen Mess- und Altarstiftungen kontinuierlich an. In einigen Städten des Reichs gehörten – nimmt man die Zahl der Mönche und Nonnen hinzu – ca. 10% der Bevölkerung dem geistlichen Stand an. Entsprechend niedrig waren die Einkünfte. Ein Kaplan verdiente etwa ein Viertel dessen, was damals ein Maurergeselle bekam. Es lag also nahe, auch auf den unteren Ebenen Pfründen zu kumulieren, um überhaupt das Existenzminimum zu erreichen.
Die Frage nach der beruflichen Qualität eines Geistlichen wurde bei der Vergabe von Pfründen kaum gestellt. Zwar ist es schwierig, ein Gesamtbild über den Bildungsstand des damaligen Klerus zu erstellen, Tatsache aber war ein deutliches Bildungsdefizit. Es genügte im Allgemeinen, wenn die Geistlichen ihre Pflichten vom Ablauf her beherrschten. Allenfalls war die Fähigkeit gefordert, einen lateinischen Messtext übersetzen zu können. Akademische Studien waren nicht sehr verbreitet. Theologie hatten die wenigsten studiert. Aber nicht nur die theologische Qualität der Geistlichen war fraglich, auch die Moralität ihrer Lebensführung. Schon damals stellte der geforderte Zölibat für viele eine schwere Belastung dar. Häufig arrangierte man sich, indem man einen Dispens einholte, d.h. beim zuständigen Bischof eine Ablösegebühr entrichtete. Diese Gebühr konnte sich sowohl auf eine jährliche Abgabe belaufen als auch auf eine Abgabe bei der Geburt eines Kindes. Das Kind wiederum konnte sich ebenfalls von dem Makel und den gesellschaftlich-rechtlichen Behinderungen einer solchen illegitimen Geburt durch einen Dispens befreien lassen. Prominentes Beispiel für diese Praxis ist Erasmus von Rotterdam, der als unehelicher Sohn eines Priesters einen Dispens einholte, um Augustiner-Chorherr werden und auch die Priesterweihe empfangen zu können. Diese Art der Aufrechnung kirchlicher Vollzüge war weit fortgeschritten. Vieles, was die Kurie leistete, bekam Geldwert: nicht nur die Verleihung von Pfründen und Würden, nicht nur die Entscheidung in Rechtsfragen und die Ablösung von der Überschreitung des kanonischen Rechts, sondern – wie sich zu Beginn des Reformationszeitalters im Ablasswesen zeigte – schließlich auch die Vermittlung von Gnade und Heil.15
II. Frömmigkeit
1. Mystik und Devotio moderna
Während alle Ansätze zu einer strukturellen Reform der Kirche im Wesentlichen gescheitert waren, kamen von der Frömmigkeit her neue Impulse, vor allem von Seiten der Mystik. Die Mystik, deren Ziel die unmittelbare, persönliche Vereinigung des einzelnen mit Gott bzw. mit Christus ist, stellte die Innerlichkeit und die Abkehr von allen irdischen Dingen und Äußerlichkeiten in den Vordergrund. Dazu gehörte in den Augen der Mystiker auch die von äußerlicher Erstarrung geprägte, institutionalisierte Kirche mit ihren Amtsinhabern als Vermittler des Heils.
Die hervorragendsten Vertreter der Mystik im 14. Jahrhundert waren Angehörige des Dominikanerordens im deutschsprachigen Bereich. Man bezeichnet dieser Richtung daher auch als »Deutsche Mystik«. Sie griff auf Gedankengut zurück, das die romanische Mystik mit Bernhard von Clairvaux (1091–1153), Bonaventura (1221–1274) und Hugo von St. Victor (1097–1141) bereits vorgeprägt hatte. Einflussreich wurde die Deutsche Mystik vor allem durch ihre Predigt in der Volkssprache. Zwei Hauptrichtungen lassen sich unterscheiden: eine extreme Linie, die nur einzelne kleine Kreise hervorbrachte, z.B. vertreten durch die »Brüder und Schwestern vom freien Geist«. Diese Gruppe sah den Menschen als von Natur aus göttlich und daher unfähig zur Sünde an. Sein »instinctus interior« sei bestimmend für sein religiöses Leben. Sakramente und die priesterlich-sakramentale Heilsvermittlung waren für diese Gruppe daher überflüssig. Daneben existierte eine demgegenüber gemäßigte Linie, vertreten von Meister Eckhart (ca. 1260–1327) und seinen Schülern. Meister Eckhart gilt als der bekannteste und einflussreichste Vertreter der deutschen Mystik. Seine Schüler waren Johannes Tauler (ca. 1300–1361) und Heinrich Seuse (ca. 1298–1366). Tauler wirkte vor allem in Straßburg und war wohl in seinen Schriften und Predigten noch eingängiger als Meister Eckhart. Bei Seuse zeigt sich eine starke Empfindsamkeit und poetische Kraft. Die von der Mystik erfassten Kreise nannten sich »Gottesfreunde« (Namensgebung nach Joh 15,14f). Die besonders am Oberrhein verbreiteten Gruppen wirkten in Klöstern und Beginenhäusern, unter Bürgern und Handwerkern. In diesen geistigen Zusammenhang gehört auch eine Schrift, die unter dem Titel »Vom vollkommenen Leben« verbreitet wurde. Der Verfasser blieb anonym, war aber wohl um 1400 in Frankfurt beheimatet. Auch Martin Luther hat diese Schrift gelesen und außerordentlich geschätzt. Er brachte sie unter dem Titel »Theologia deutsch« neu heraus.
Zu Anfang wurde die Mystik vornehmlich in Klöstern der Bettelorden gepflegt. Später ergriff sie auch immer mehr die Laien. Sie traf in eine Art Frömmigkeitsvakuum und füllte einen Bereich aus, der von der institutionalisierten Kirche nicht bedient worden war. Sie war ein in ganz Europa verbreitetes Phänomen. Auch in Frankreich und in England gab es parallele Strömungen. In England waren Walter Hilton (ca. 1340) und Juliana von Norwich (ca. 1340 – nach 1416) herausragende Gestalten; in Frankreich Pierre d'Ailly (1350–1420) und Johannes Gerson (1363–1429). Beide waren Professoren an der Pariser Universität, Gerson war sogar ihr Rektor. Eine besondere Bedeutung aber kam der niederländischen Mystik des 14. und 15. Jahrhunderts zu. Hier wirkte, besonders im Süden, der Flame Jan van Ruysbroek (1293–1381). Er stand in Verbindung zu Schülern Meister Eckharts und zu den oberrheinischen Gottesfreunden. Im Bistum Utrecht hielt seit 1379 der Holländer Geert Groote (1340–1384) Bußpredigten. Da er allerdings nur eine Diakonenweihe besaß, wurde er bald mit einem Predigtverbot belegt, blieb aber in persönlichen Kontakten weiterhin seelsorgerlich tätig.16
Aus den Aktivitäten der Mystiker und mystisch geprägter Gruppen erwuchs eine Erweckungsbewegung: die »Devotio moderna«. Sie zielte auf Vertiefung und Verinnerlichung des religiösen Lebens. Anders als der Mystik fehlte der Devotio moderna die spekulative und ekstatische Seite. Sie trug eher praktischen und erbaulichen Charakter. Die Bewegung ruhte hauptsächlich auf zwei Trägergruppen: zum einen auf den »Brüdern und Schwestern vom gemeinsamen Leben« und zum zweiten auf den Augustiner-Chorherren der Windesheimer Kongregation.
Die Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben gingen auf das Wirken Grootes zurück. Er hatte in seinen letzten Lebensjahren sein Haus in Deventer armen Frauen zur Verfügung gestellt, die in dem von ihm gepredigten Sinne Gott dienen wollten. So entstanden noch vor 1400 allenthalben Hausgemeinschaften (z.B. in Zwolle). Nicht nur Frauen fanden sich in solchen Gemeinschaften zusammen, sondern auch Männer, nicht nur Geistliche sondern auch Laien. Allmählich bildeten sie unter der Leitung von Rektoren eine festere Organisation heraus. Der Unterhalt wurde – anders als bei den Beginen und Begarden – aus einer gemeinsamen Kasse bestritten, und man pflegte die »vita communis«. Gelübde wurden nicht abgelegt, und jedem stand frei, jederzeit wieder aus dem Haus auszutreten. Das allerdings war selten, ebenso wie der Fall, dass eine Gemeinschaft später eine Ordensregel annahm. Dennoch ähnelte das Leben durchaus demjenigen im Kloster. Neben der Frömmigkeitsübung stand die alltägliche Arbeit. Geistliche betätigten sich meist als Abschreiber von Handschriften, Laien als Handwerker, z.B. als Spinner oder Weber. Außerdem sorgten die Brüder für den Unterhalt von Bursen, in denen die Schüler der städtischen Lateinschulen beherbergt und verpflegt wurden. Die Seelsorge – auch bei den Schwestern – übernahmen die geistlichen Brüder. Sie konnten außerdem als Prediger in den Stadtkirchen wirken. All dies zeigt, dass der Geist der Devotio moderna nicht etwa auf die Hausgemeinschaften beschränkt blieb, sondern nach außen wirkte. Dies lag nicht zuletzt daran, dass der Anteil der Geistlichen, die solche in die Breite und nach außen wirkenden Funktionen übernehmen konnten, überwog. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts erteilten die Brüder der Devotio moderna auch Unterricht, zumeist als Repetitoren in den Bursen. Dies war der Anfang von Fratresschulen, die gelegentlich in Konkurrenz zu den bestehenden Stadtschulen traten. Aber auch an Stadtschulen wirkten vereinzelt Brüder als Lehrer. Bei weitem stärker als dieser bildungsgeschichtliche Impuls war der religiöse Einfluss der Bewegung, der auch auf Nikolaus von Kues (1401–1464) und Erasmus von Rotterdam (1466–1536) während ihrer Schulzeit in Deventer wirkte. Nach 1400 griff die Bewegung der Devotio moderna auch auf benachbarte Gebiete über, nämlich ins Rheinland und nach Westfalen. Sie erreichte Hildesheim, Magdeburg und Marburg. Im oberhessischen Butzbach entstand ein Brüderhaus. Von dort aus gelangte die Devotio moderna durch Gabriel Biel (ca. 1410–1495), den späteren Tübinger Theologieprofessor, nach Württemberg.
Die zweite Trägergruppe der Devotio moderna, die Windesheimer Kongregation, erhielt ihren Namen von dem Stift Windesheim, das im Jahre 1387 von Schülern Grootes bei Zwolle gegründet worden war. Dort nahm man in der Folgezeit die Augustinerregel an. Windesheim wurde zum Ausgangspunkt einer weitreichenden Kongregation von Augustiner-Chorherren. Ihr Ziel war eine strengere Disziplinierung und bessere Bildung der Kanoniker. Ende des 15. Jahrhunderts hatte die Kongregation bereits über 100 Niederlassungen in den Niederlanden und im Reichsgebiet. Bis nach Dänemark und Frankreich reichte ihre Ausstrahlung. Diese reformorientierte Kongregation war kein Solitär. Auch in anderen Orden entstanden vergleichbare Reform- und Frömmigkeitsbestrebungen. Im Reich wirkte die Bursfelder Kongregation, eine Vereinigung reformierter Benediktinerklöster, in ähnlicher Weise. Bei den Franziskaner-Observanten oder in der toskanischen Kongregation der Dominikaner, bekannt geworden durch Girolamo Savonarola (1452–1498), oder in der deutschen Kongregation der regulierten Augustiner-Eremiten mit Johannes von Staupitz (1460–1524) gab es vergleichbare Ansätze. Auch wenn die Ausstrahlung jener Reformkongregationen durchaus unterschiedlich und nicht gleichermaßen intensiv war, so war der auf die Frömmigkeit zielende, erneuernde Impuls doch beachtlich.
Dazu trug die in den Kreisen der Devotio moderna entstandene Literatur in hohem Maße bei. Als wichtigstes Werk gilt die »Imitatio Christi«, abgefasst in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Sie war fast so verbreitet wie die Bibel. Autor der Schrift war, zumindest teilweise, Thomas von Kempen (Thomas a Kempis, ca. 1380–1471), ein ehemaliger Fratresschüler in Deventer und späterer Augustinerchorherr in St. Agnetenberg bei Zwolle. Dem Titel der Schrift gemäß geht es um eine Nachfolge Christi, die sich darin verwirklichen soll, dass der Mensch in Geduld und Demut sein Kreuz auf sich nimmt. Die eindringlich ausgesprochene Mahnung zu Demut bezieht sich auch auf die intellektuelle Ebene. Denn die Schrift betont immer wieder, dass es auf Irrwege führe, wenn man zu viel wissen wolle. »Nicht soll die Wissenschaft …, sofern sie an sich recht und von Gott geordnet ist, herabgesetzt werden«, so führte der Autor aus, »aber vorzuziehen bleibt immer ein gutes Gewissen und ein tugendhaftes Leben«.17 Gelehrte Theologie bietet die »Imitatio Christi« also nicht, aber auch keine Ansatzpunkte, an denen die institutionalisierte Kirche hätte Anstoß nehmen können. Die »Imitatio Christi« war weder kirchenkritisch noch kirchenfern. Sie bot damit Potenzial dafür, in der im 16. Jahrhundert ebenfalls einsetzenden Erneuerung innerhalb der römischen Kirche wieder an Aktualität zu gewinnen. Ignatius von Loyola (1491–1556) z.B. benutzte die »Imitatio Christi«, deren wesentliche Züge in seinen Exerzitien eine Weiterentwicklung fanden.18
Insgesamt gesehen blieb die Mystik des 15. Jahrhunderts überwiegend der kirchlichen Sphäre verhaftet. Sie stand auf dem Boden der kirchlichen Lehre, deren Grenzen sie nicht überschritt. Dennoch konnten die Inhalte ihrer Predigt und ihre Frömmigkeit für reformatorische Inhalte fruchtbar gemacht werden.
2. Volksfrömmigkeit
Die Devotio moderna war eine Bewegung, die im Grunde auf eine Minderheit beschränkt blieb. Sie erfasste nicht die Massen. Denn diejenigen, die ihr angehörten, hatten eine überdurchschnittliche, religiöse Erziehung. Die Frömmigkeit des einfachen Volks sah anders aus. Sie setzte sich aus den verschiedensten Elementen zusammen und bildete ein Gemisch aus christlichem Gedankengut, Aberglauben, und nicht-christlichen Vorstellungen und Praktiken. Hexenwahn und Magie, Astrologie und Alchemie gingen mit christlichen Vorstellungen eine enge Verbindung ein. Der Hexenwahn stellt dabei nur einen kleinen Ausschnitt dessen dar, was die spätmittelalterliche Frömmigkeit kennzeichnete. Was das Leben aller grundlegend bestimmte, war der Gedanke an den zeitlichen Tod und das Weltende. Auch das Hexenwesen wurde im Grunde als eine Begleiterscheinung des herannahenden, befürchteten und furchterregenden Endes der Welt verstanden. Denn dazu gehörte das Eindringen des Bösen in alle Lebensbereiche. Diese Grundstimmung, nämlich der Gedanke an den stets nahen Tod und das heranrückende Weltende, spiegelt sich ausdrucksvoll in der Kunst des Spätmittelalters. Das Thema der Apokalypse und des Jüngsten Gerichts tauchte immer wieder in Kunstwerken jener Zeit auf. Es begegnete in Stein gehauen über den Kirchenportalen, auf Wandteppichen, auf Gemälden und Holzschnitten und erinnerte den Betrachter eindringlich an das große Rechenschaft-Ablegen vor dem Weltenrichter. Seit dem 13. Jahrhundert war das Thema des Totentanzes hinzugekommen, das gerade in den großen Pestzeiten von unmittelbarer Aktualität war. Die Figur des Todes selbst war in bildlichen und literarischen Darstellungen in mehr als einer Gestalt bekannt. Es gab den Tod als apokalyptischen Reiter, der über eine Schar am Boden liegender Menschen hinwegsprengt, den Tod als Megäre mit Fledermausflügeln, als Skelett mit Sense oder mit Pfeil und Bogen. Der Totentanz, der sowohl gespielt als auch bildnerisch dargestellt wurde, fügte dem eine Aussage hinzu, die niemanden aussparte: Der Tod fordert grinsend, mit den Schritten eines alten steifen Tanzmeisters, den Papst, den Kaiser, den Edelmann, den Tagelöhner, den Mönch, das kleine Kind, den Narren und auch alle anderen Stände und Berufe zum Tanze auf. Alle müssen dieser Aufforderung folgen. Totentänze führten mahnend die Vergänglichkeit und Nichtigkeit des Irdischen vor Augen, vermischt mit der Aussage, dass im Tod alle gesellschaftlichen Unterschiede fallen und alle gleich sind.
Dieses Bewusstsein der Begrenztheit und Unberechenbarkeit des Lebens wurde durch die alltäglichen Erfahrungen, wie etwa die ständige Bedrohung durch Epidemien oder die politische Bedrohung durch die vor den Grenzen stehenden Osmanen als Feinde der Christenheit (1453 Fall Konstantinopels), gestärkt und bestätigt. Dies wiederum führte zu einer bemerkenswerten Steigerung der Frömmigkeit. Angesichts dessen, dass der Tod unmittelbar und unberechenbar in das Leben einbrechen konnte, war es wichtig, sich rechtzeitig durch Buße und fromme Handlungen auf ein gutes Ende vorzubereiten. Denn dann galt es, vor Gottes Gericht Rechenschaft ablegen zu müssen. Auch Christus begegnete den Menschen in diesem Szenario in erster Linie als Richter. Zu den charakteristischen Frömmigkeitsübungen jener Zeit gehörte z.B. die Kreuzwegandacht, die Marienverehrung und das Rosenkranzgebet. Man suchte Gnade und Erbarmen über die Fürsprache der Gottesmutter Maria, die den Menschen mit ihrem Sohn, dem gerechten Richter, versöhnen sollte. Maria, der man mehr Verständnis, Mitleid und Erbarmen zutraute als ihrem Sohn, rückte immer mehr in den Vordergrund. Kapellen, Altäre, Messen, Feste, Gebete, Lieder und Bruderschaften wurden zu Ehren der Gottesmutter eingerichtet. All dies zielte auf Sicherung des Seelenheils. Bruderschaften z.B. galten als besonders wertvolle Heilsgaranten. Denn ihre Aktivitäten zielten darauf, den einzelnen in ein besonderes Verhältnis zu dem jeweiligen Heiligen, dem sie sich assoziiert hatten, zu setzen. Sie verschafften ihren Mitgliedern Anteil an den guten Werken jenes Heiligen, der anderen Brüder oder einer mönchischen Gemeinschaft, der sich eine solche Bruderschaft anschließen konnte. Außerdem wurden durch die Bruderschaften gute Werke organisiert, denen dadurch Heilsrelevanz zukam. Darüber hinaus entstanden neue Heiligenkulte, denn auch die Heiligen sollten – wie Maria – fürbittend und mit ihren Verdiensten für den sündigen Menschen vor Gott eintreten und so die Brücke zwischen dem Sünder und dem gerecht richtenden Gott schlagen. Dabei ordnete man den Heiligen bestimmte Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche leiblicher oder geistlicher Art zu. Außerdem wuchs die Verehrung von Reliquien, denn über die sterblichen Überreste von Heiligen oder durch geheiligten Gegenstände ragte das Transzendente heilbringend in das Diesseits hinein. Wer es sich leisten konnte, sammelte selbst Reliquien, wie z.B. der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise, Luthers Landesherr, der eine der größten Reliquiensammlungen seiner Zeit besaß. Hinter der Reliquienverehrung