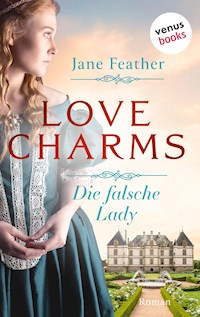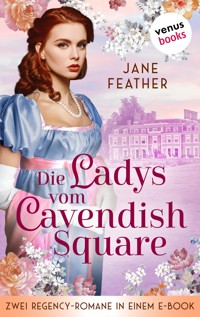4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency Angels
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Zwischen Anstand und Leidenschaft: Der historische Liebesroman »Regency Angels – Die verlockende Betrügerin« von Jane Feather jetzt als eBook bei dotbooks. England im 18. Jahrhundert: Gerade noch war die junge Juliana eine frisch verheiratete Braut – nun wird sie nach dem tragischen Tod ihres Mannes zu Unrecht als Mörderin gesucht! Zuflucht findet sie bei dem mysteriösen Duke of Redmayne, der ihr ein skandalöses Angebot macht: Sie soll ihm helfen, seinen vermögenden, aber herzlosen Cousin um sein beträchtliches Erbe zu erleichtern. Doch ist Juliana für den gutaussehenden Duke wirklich nur Mittel zum Zweck? … Seine dunklen, glühenden Blicke scheinen eine ganz andere Sprache zu sprechen … »Jane Feather ist eine begnadete Schriftstellerin – einzigartig und wunderbar.« Daily News Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der prickelnde Liebesroman »Regency Angels – Die verlockende Betrügerin« von New-York-Times-Bestsellerautorin Jane Feather ist Band 3 ihrer romantischen Trilogie »Regency Angels«, deren Bände unabhängig voneinander gelesen werden können – ein Vergnügen für alle Fans von Julia Quinns »Bridgerton«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 756
Ähnliche
Über dieses Buch:
England im 18. Jahrhundert: Gerade noch war die junge Juliana eine frisch verheiratete Braut – nun wird sie nach dem tragischen Tod ihres Mannes zu Unrecht als Mörderin gesucht! Zuflucht findet sie bei dem mysteriösen Duke of Redmayne, der ihr ein skandalöses Angebot macht: Sie soll ihm helfen, seinen vermögenden, aber herzlosen Cousin um sein beträchtliches Erbe zu erleichtern. Doch ist Juliana für den gutaussehenden Duke wirklich nur Mittel zum Zweck? … Seine dunklen, glühenden Blicke scheinen eine ganz andere Sprache zu sprechen …
»Jane Feather ist eine begnadete Schriftstellerin – einzigartig und wunderbar.« Daily News
Über die Autorin:
Jane Feather ist in Kairo geboren, wuchs in Südengland auf und lebt derzeit mit ihrer Familie in Washington D.C. Sie studierte angewandte Sozialkunde und war als Psychologin tätig, bevor sie ihrer Leidenschaft für Bücher nachgab und zu schreiben begann. Ihre Bestseller verkaufen sich weltweit in Millionenhöhe.
Bei dotbooks erscheinen als weitere Bände der Reihe »Regency Angels«:
»Die unwiderstehliche Spionin – Band 1«
»Die verführerische Diebin – Band 2«
Außerdem ihre Reihe »Love Charms« mit den Bänden:
»Die gestohlene Braut – Band 1«
»Die geliebte Feindin – Band 2«
»Die falsche Lady – Band 3«
In der Reihe »Regency Nobles« erschienen:
»Das Geheimnis des Earls – Band 1«
»Das Begehren des Lords – Band 2«
»Der Kuss des Lords – Band 3«
Außerdem erscheinen in der Reihe »Die Ladys vom Cavendish Square«:
»Das Verlangen des Viscounts – Band 1«
»Die Leidenschaft des Prinzen – Band 2«
»Das Begehren des Spions – Band 3«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Vice« bei Bantam Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Wilde Chrysanteme« im Goldmann Verlag.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1996 by Jane Feather
Published by Arrangement with Shelagh Jane Feather
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-302-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Regency Angels 3« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jane Feather
Regency Angels –Die verlockende Betrügerin
Roman
Aus dem Amerikanischen von Elke Bartels
dotbooks.
Endlich ein Buch für Jim! Immer meine Inspiration.
Immer – nun ja, fast ... – ein Muster an Geduld.
Immer ein Quell der Unterstützung und des Trosts.
Immer meine große Liebe.
Prolog
London, im Jahre 1750
»Ich bedaure sehr, Euer Gnaden, aber ich habe im Moment kein solches Mädchen.«
»Das hatte ich auch nicht erwartet, Madam. Aber ich darf wohl annehmen, daß Sie eines beschaffen können.« Tarquin, Dritter Herzog von Redmayne, beugte sich in seinem Sessel vor, um genüßlich den Duft einer Rose in einer tiefen Schale auf dem Tischchen neben ihm einzuatmen.
»Es dürfte etwas schwierig werden, einen solch speziellen Wunsch zu erfüllen«, erwiderte Mrs. Dennison sinnierend, während sie sich mit ihrem bemalten Fächer Kühlung verschaffte.
Ein Lächeln huschte über das schmale Antlitz des Herzogs. »Sie und Mr. Dennison werden feststellen, daß das Honorar Ihre Anstrengungen mehr als aufwiegen wird, Elizabeth.«
Seine Gastgeberin blickte ihn über den Rand ihres Fächers hinweg an, und ihre Augen blitzten. »Nicht doch, Herzog. Sie wissen, wie sehr ich es hasse, über Geschäftliches zu diskutieren ... es ist so vulgär.
»Sehr vulgär, in der Tat«, stimmte er liebenswürdig zu. »Übrigens bestehe ich darauf, daß es sich um ein Original handelt, Madam. Ich habe kein Interesse an vorgetäuschter Jungfräulichkeit, ganz gleich, wie frisch und unschuldig die Person auf den ersten Blick auch erscheinen mag.«
Elizabeth Dennisons Miene verriet, wie gekränkt sie war. »Wie können Sie auch nur im entferntesten annehmen, daß ich solche Praktiken pflege, Mylord?«
Das Lächeln des Herzogs wurde noch breiter, doch er schüttelte leicht den Kopf und entnahm der tiefen Tasche seines Samtüberrocks eine Schnupftabakdose aus Lapislazuli. Für einen Moment herrschte Schweigen in dem sonnigen Salon, während er gemächlich eine Prise Tabak schnupfte, die Dose zuklappte und sie dann wieder an ihren Platz schob, bevor er sich die Nase mit einem spitzengesäumten Tüchlein putzte.
»Darf ich fragen, ob das Mädchen für Ihre eigenen Zwecke bestimmt ist, Euer Gnaden?« erkundigte sich Mrs. Dennison eine Spur zögernd. Bei dem Herzog von Redmayne konnte man nie ganz sicher sein, wo er die Grenze zwischen zulässigen Erkundigungen und Unverschämtheit zog.
»Gehen Sie davon aus, daß sie ausschließlich mir persönlich entsprechen soll, wenn Sie sich auf die Suche machen.« Der Herzog erhob sich von seinem Sessel. »Auf diese Weise gewinnen wir die Gewißheit, daß sie den anspruchsvollsten Maßstäben gerecht wird.«
»Ohne Zweifel werden Sie feststellen, daß alle unsere jungen Damen den höchsten Ansprüchen genügen, Sir.« In ihrer Stimme schwang eine Andeutung von Tadel mit, als sich Mistress Dennison mit einem Rascheln von Seide zu ihrem eindrucksvollen Umfang erhob. »Mein Mann und ich können mit Fug und Recht stolz auf das Niveau unseres Hauses sein.« Sie zog an der Klingelschnur.
»Hätte ich etwas anderes geglaubt, Elizabeth, hätte ich mich wohl kaum an Sie um Hilfe gewandt«, erwiderte der Herzog beschwichtigend, während er seine Handschuhe und den Spazierstock von dem Konsolentischchen nahm.
Mistress Dennisons Miene glättete sich wieder. »Ich werde unverzüglich damit beginnen, Erkundigungen einzuziehen, Euer Gnaden.«
»Halten Sie mich bitte über Ihre Fortschritte auf dem laufenden. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, Madam.« Ihr Besucher verbeugte sich galant, doch in seinen grauen Augen unter den schweren Lidern war ein Glitzern, das seiner Gastgeberin, die in einen tiefen Knicks vor ihm versank, leichtes Unbehagen verursachte. Andererseits war dieses Unbehagen ein durchaus vertrautes Gefühl, wenn man mit dem Herzog von Redmayne direkt zu tun hatte, und sie war nicht die einzige, die so empfand.
In einem energischen Versuch, Selbstsicherheit vorzutäuschen, wandte sie sich zu dem Lakaien um, der auf ihr Klingeln hin erschienen war, und erklärte mit betont fester Stimme: »Seine Gnaden möchte gehen.«
»Meine Empfehlung an Ihren Gatten, Madam ...«, murmelte der Herzog unter einer erneuten Verbeugung. Er folgte dem Diener aus dem Salon in die Halle. In dem von hellem Morgensonnenschein durchfluteten Haus herrschte eine eigenartige Stille, während die Dienstmädchen ihre täglichen Pflichten verrichteten, als wären sie ängstlich darauf bedacht, nicht die Schlafenden im oberen Stockwerk zu wecken – jene, die bei Nacht ihrer Arbeit nachgingen und bei Tageslicht ihre wohlverdiente Ruhe genossen.
Das verbindliche Lächeln entschwand abrupt aus Mistress Dennisons Gesicht, nachdem sich die Tür hinter ihrem Besucher geschlossen hatte. Den Auftrag des Herzogs zu seiner Zufriedenheit auszuführen, würde mit einigen Komplikationen verbunden sein. Ein Frauenzimmer zu finden, das noch im Besitz ihrer Jungfräulichkeit war und sich dazu zwingen ließe, dem Diktat des Herzogs zu gehorchen, dürfte nicht einfach sein.
Jungfrauen waren leicht zu finden, das bedeutete keine Schwierigkeit ... unschuldige Mädchen vom Lande, die ohne Freunde oder Verwandte in die Großstadt kamen, gab es zu Hunderten. Aber eine, die einen triftigen Grund haben würde, den Bedingungen des Herzogs zuzustimmen ...
Und es handelte sich nicht etwa um Forderungen, wie sie bei dieser Art von Vertrag üblich waren, wie der Herzog mehrfach ausdrücklich betont hatte. Er wollte keine gewöhnliche Hure, denn er hatte eine höchst ungewöhnliche Verwendung für sie. Worin dieses Vorhaben bestand, darüber ließ er jedoch kein Sterbenswörtchen fallen.
Elizabeth Dennison zuckte ihre molligen, elfenbeinweißen Schultern. Sie würde Richard die Sachlage schildern, denn bei ihrem Ehemann und Geschäftspartner konnte man sich darauf verlassen, daß er sich schon einen Aktionsplan ausdenken würde. Es war nicht ratsam, einem so wohlhabenden und einflußreichen Kunden wie Tarquin, Herzog von Redmayne, eine Bitte abzuschlagen.
Kapitel 1
Juliana war kurz davor zu ersticken. Ihr Ehemann unternahm jedoch keinen Versuch, um sie vor der enormen Last seines Gewichts zu schützen, als er sich – krebsrot im Gesicht und mit glasigen Augen von dem reichlichen Alkoholgenuß während der Hochzeitsfeierlichkeiten – schnaufend und keuchend auf ihr bewegte. Sie hatte sich durchaus damit abgefunden, diesen Vollzug der Ehe über sich ergehen zu lassen; tatsächlich war sie Sir John trotz seines fortgeschrittenen Alters und seiner Leibesfülle sogar aufrichtig zugetan – aber allmählich dämmerte ihr, daß sie, wenn sie ihn nicht irgendwie auf ihre Zwangslage aufmerksam machte, in Kürze ihren Geist unter ihm aufgeben würde.
Ihre Nase wurde gegen seine massige Brust gequetscht, und ihre Kehle schnürte sich mehr und mehr zu. In ihrer Benommenheit konnte sie nicht mehr klar genug denken, um herauszufinden, was mit dem Rest ihres Körpers geschah; doch nach Johns Flüchen und hilflosen Anstrengungen zu urteilen, kam die Sache offenbar nicht so recht voran. Schwarze Flecken begannen vor ihren Augen zu tanzen, das Zimmer drehte sich schwindelerregend um sie, und ihre Brust hob sich in einem verzweifelten Versuch, Luft zum Atmen zu ergattern.
Von plötzlicher Panik erfaßt, schlug Juliana wild mit den Armen zu beiden Seiten ihres eingeklemmten Körpers um sich, und dabei berührte ihre linke Hand zufällig den glatten Messinggriff des Bettwärmers.
In instinktiver Selbstverteidigung packte sie den Gegenstand, schwang ihn hoch und schlug ihrem Ehemann damit auf die Schulter. Es war bei weitem kein harter Schlag, und er diente auch lediglich dem Zweck, Sir John wieder zur Vernunft zu bringen, doch bedauerlicherweise schien er genau den gegenteiligen Effekt zu erzielen.
Sir Johns glasige Augen weiteten sich erschrocken, als er sekundenlang auf die Wand hinter Julianas Kopf starrte, sein Kiefer sank schlaff herab, dann kam ein seltsamer kleiner Seufzer über seine Lippen, der dem Entweichen von Luft aus einem geplatzten Ballon ähnelte, und im nächsten Moment brach er reglos über ihr zusammen.
Wenn er ihr vorher schon unerträglich schwer vorgekommen war, so lastete das Gewicht seines Körpers jetzt wie ein Felsbrocken auf ihr und preßte sie tief in die Matratze hinunter. Juliana schob und zerrte und stieß mit aller Kraft, während sie wiederholt seinen Namen rief in dem vergeblichen Versuch, ihn aufzuwecken.
Die beginnende Panik, die sie wenige Minuten zuvor empfunden hatte, war nichts im Vergleich zu der ohnmächtigen Angst, die jetzt in ihr emporstieg. Ihre Hilferufe wurden von Johns Körper gedämpft und verloren sich endgültig an den dicken, reich bestickten Bettvorhängen aus Brokat. Es war ausgeschlossen, daß jemand sie hinter der fest verriegelten, massiven Eichentür hören konnte. Der Haushalt schlief bereits, und George war nach seiner dritten Flasche Portwein sinnlos betrunken auf der Couch in der Bibliothek zusammengebrochen. Nicht, daß sie es hätte ertragen können, in dieser höchst peinlichen Situation von ihrem verabscheuungswürdigen Stiefsohn aufgefunden zu werden.
Juliana, deren ganzer Körper vor Anstrengung in Schweiß gebadet war, wand sich wie ein Aal hin und her, bis es ihr gelang, die Knie anzuziehen und genügend Spielraum zu gewinnen, um ihre Beine zu befreien. Dann grub sie ihre Fersen in die Matratze, während sie sich gleichzeitig mit Armen und Schultern gegen den schlaffen Körper stemmte, der sie blockierte, und schließlich gelang es ihr, John gerade weit genug zur Seite zu rollen, daß sie sich unter ihm hervorwinden konnte, bevor er wieder zurückplumpste.
Langsam kämpfte sich Juliana in eine sitzende Position und blickte auf ihn hinunter, eine Hand auf den Mund gepreßt, ihre Augen riesengroß vor Bestürzung. Sie beugte sich über ihn.
»John?« Zögernd berührte sie seine Schulter und schüttelte ihn leicht. »John?«
Er gab keinen Laut von sich, und sein Gesicht war in den Kissen vergraben. Sie drehte vorsichtig seinen Kopf herum. Seine starren Augen blickten leblos zu ihr auf.
»Allmächtiger Gott, hab Erbarmen!« flüsterte Juliana entsetzt, als sie langsam vor dem Toten zurückwich. Sie hatte ihren Ehemann umgebracht!
Benommen und ungläubig stand sie neben dem Bett, während sie auf die nächtlichen Geräusche des Hauses horchte: das Ticken der großen Standuhr, das gelegentliche Ächzen und Knarren der Dielenbretter, das Rauschen des Windes, der an offenen Fensterflügeln rüttelte. Von menschlichem Treiben war nichts zu hören.
Großer Gott, das hatte sie nur wieder mal ihrer namenlosen Unbedachtsamkeit zu verdanken! Warum mißlang ihr bloß immer alles, was sie anfing? Warum nur?
Ihr blieb gar nichts anderes übrig, als jemanden im Haus zu wecken. Aber was würden sie bei Johns Anblick sagen? Der runde Abdruck des Bettwärmers zeichnete sich deutlich auf dem Rücken des Toten ab. Sie mußte ihn wesentlich härter getroffen haben, als es ihre Absicht gewesen war. Aber das paßte wieder einmal zu ihrem impulsiven, schusseligen Naturell – sie war und blieb eben ein Pechvogel!
Zitternd vor Entsetzen, berührte sie den Bettwärmer und bemerkte, daß er noch immer sehr heiß war. Sie hatte ihren Ehemann mit einem glühenden Gegenstand getroffen und ihn getötet!
George würde keine Zeit verschwenden, wenn er davon erfuhr. Sie könnte sich jegliche noch so logische Erklärung sparen. Er würde sie öffentlich der Habgier beschuldigen, so wie er es bereits an jenem Morgen bei ihrem Gespräch unter vier Augen getan hatte; seine Behauptung lautete, sie hätte einen Mann, der alt genug war, ihr Großvater zu sein, nur seines Geldes wegen geheiratet. Sicherlich klagte er sie an, die Zuneigung und blinde Vernarrtheit seines Vaters schamlos ausgenutzt und dann kaltblütig seinen Tod arrangiert zu haben, um frei über das beträchtliche Erbe verfügen zu können, das ihr laut den Klauseln des Ehevertrages nach dem Ableben ihres Mannes zustand – eine Erbschaft, die Georges Ansicht nach ausschließlich ihm zustand.
Eine Frau, die ihren Ehemann ermordet hatte, galt als üble, heimtückische Verräterin. Genauso wie ein Bediensteter, der seinen Herrn umbrachte. Wenn sie des Mordes für schuldig befunden wurde, landete sie zur Strafe auf dem Scheiterhaufen.
Juliana wich noch einen Schritt weiter vom Bett zurück, schob hastig die schweren Bettvorhänge zur Seite und eilte ans Fenster, wo sie eine Weile stand und in tiefen Zügen die warme Nachtluft einatmete, in die sich eine erfrischende Brise Seeluft vom Soient mischte. Sie werden mich als Verbrecherin verbrennen.
Einmal war sie Zeugin dieses grauenhaften Spektakels gewesen, draußen auf dem Platz vor dem Gefängnis von Winchester. Mistress Goadsby war des Mordes an ihrem Ehemann für schuldig befunden worden, als er einen Treppensturz nicht überlebte. Vor Gericht hatte sie erklärt, er sei betrunken gewesen und habe sie geschlagen, und dabei sei er gestolpert und auf die Stufen geprallt. Die Blutergüsse und Schwellungen waren noch deutlich auf ihrem Gesicht erkennbar gewesen, als sie auf der Anklagebank gesessen hatte. Dennoch hatten sie sie an den Pfahl gebunden, sie gehenkt und ihre Leiche dann in Brand gesteckt.
Juliana war damals kaum mehr als ein Kind gewesen, aber die schreckliche Szene hatte sie noch jahrelang verfolgt ... zusammen mit dem Geruch brennenden Fleisches. Übelkeit befiel sie jetzt bei der Erinnerung, und sie rannte zum Bett zurück, zog den Nachttopf hervor und erbrach sich heftig darein.
Vielleicht würden die Richter glauben, daß John eines natürlichen Todes gestorben war, hervorgerufen durch die starke körperliche Anstrengung ... andererseits war da dieser unverkennbare Abdruck auf seinem Rücken. Ein Abdruck, den er sich unmöglich selbst beigebracht haben konnte.
Und George würde ihn sehen. Eine Stiefmutter, die wegen Mordes an ihrem Ehemann verurteilt wurde, ging all ihrer Rechte verlustig. Der Ehevertrag würde annulliert werden, und Sir Johns Sohn könnte endlich triumphieren.
Juliana hätte nicht sagen können, wie lange sie dort über den Nachttopf gebeugt auf dem Fußboden saß, doch nach und nach trocknete der Schweiß auf ihrer Stirn, und sie war wieder fähig, einen klaren Gedanken zu fassen.
Sie mußte fort von hier. Es gab niemanden, der für ihre Unschuld eintreten würde ... niemanden, der trotz der offenkundigen Fakten ein gutes Wort für sie einlegte. Ihr Vormund hatte den Ehevertrag ausgehandelt, wobei er natürlich in erster Linie den eigenen Profit im Auge behielt. Danach hatte er nichts mehr zu tun haben wollen mit der Nichte, die lediglich eine lästige Bürde für ihn gewesen war seit jenem Augenblick, als man die junge Waise in seine Obhut gegeben hatte. Es gab keinen Menschen auf der Welt, der auch nur ein entferntes Interesse an ihr hegte.
Juliana erhob sich vom Fußboden, schob den Nachttopf mit dem Fuß wieder unter das Bett zurück und zog Bilanz. Die Postkutsche nach London hielt um vier Uhr früh vor dem »Rose and Crown« in Winchester. Ihr blieb also noch genug Zeit, um die zehn Meilen bis Winchester zu Fuß über die Felder zu laufen und rechtzeitig an der Postkutschenstation einzutreffen. Bis der Haushalt aufwachte oder George seinen Rausch ausgeschlafen hatte, würde sie längst auf und davon sein.
Sie würden sie ganz sicher verfolgen, aber in London könnte sie mühelos untertauchen. Sie mußte nur darauf achten, sich im »Rose and Crown« möglichst unauffällig zu verhalten und keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Schaudernd wandte Juliana die Augen vom Bett ab, als sie zu dem Kleiderschrank ging, in dem ihre brandneue Aussteuer hing. Sie hatte jedoch auch ein Paar Reithosen aus grobgewirkter Baumwolle und eine Leinenbluse unter den Kleidungsstücken verborgen. In diesem Kostüm war sie Forsett Towers bei den häufigen Gelegenheiten entflohen, wenn ihr Leben unter der Fuchtel der Ehefrau ihres Vormunds noch unerfreulicher als gewöhnlich geworden war. Keiner hatte die Verkleidung jemals entdeckt oder die diversen Orte, wo sie Unterschlupf suchte. Natürlich hatte sie bei ihrer Rückkehr jedesmal für ihre heimlichen Ausflüge büßen müssen, aber Lady Forsetts Haselnußrute war ihr immer als ein geringer Preis für jene kostbaren Stunden der Freiheit erschienen.
Juliana kleidete sich in aller Eile an, zog Strümpfe und Stiefel an und drehte dann ihr üppiges, flammendrotes Haar zu einem Knoten auf dem Kopf zusammen, wobei sie einige verräterische Strähnen unter eine wollene Mütze schob, die sie tief über die Ohren streifte.
Als nächstes brauchte sie Geld. Zumindest genug, damit es für den Fahrpreis der Postkutsche und für ein paar Übernachtungen in einem billigen Gasthof reichte, bis sie Arbeit fände. Aber sie würde kein Geld nehmen, das jemand vermissen würde ..., was sie nicht nur als Mörderin, sondern auch noch als Diebin brandmarkte!
Warum sie sich um ein solch haarspalterisches Problem Sorgen machen sollte, überstieg die eine Hälfte von Julianas Verstand; aber die andere Hälfte schien ganz von allein zu arbeiten, während sie mit der Leistungsfähigkeit eines Automaten Möglichkeiten prüfte, wieder verwarf und eigene Entscheidungen traf.
Sie nahm vier Sovereigns aus dem Versteck in der Schublade der Frisierkommode. Zufällig hatte sie beobachtet, wie John vor dem Zubettgehen seine Taschen leerte ... vor vielen Stunden, wie es jetzt schien ... nachdem die Hochzeitsgäste endlich von der Schlafzimmertür gewichen waren und unter jovialobszönen Bemerkungen das Haus verlassen hatten, um dem frischvermählten Paar die wohlverdiente Ruhe zu gönnen.
John war so betrunken gewesen, daß er kaum noch hatte aufrecht stehen können. In Gedanken sah sie ihn jetzt wieder vor sich, wie er schwankte, während er den Inhalt seiner Tasche in die Schublade leerte – seine blutunterlaufenen blauen Augen hatten vor Erregung geglänzt, und sein normalerweise schon leicht gerötetes Gesicht war nach den vielen Toasts auf das Wohl des Brautpaares hochrot verfärbt gewesen.
Tränen schnürten plötzlich Julianas Kehle zu, als sie den noch immer ungewohnten Ehering von ihrem Finger streifte. John hatte sie stets mit Freundlichkeit behandelt, wenn auch auf eine eher onkelhafte Art. Sie war mehr als bereit gewesen, seinen Heiratsantrag anzunehmen; erschien ihr doch die Ehe als einzige Möglichkeit, dem Haus ihres Vormunds zu entfliehen. Mehr als bereit – bis ihr klargeworden war, daß sie mit George würde fertigwerden müssen ... dem bösartigen, eifersüchtigen, lüsternen George. Aber da war es schon zu spät gewesen, um noch einen Rückzieher zu machen. Sie ließ den Ring in die Schublade zu den verbleibenden Sovereigns fallen. Der Goldreif schien ihr zuzublinzeln, und sein Glanz wurde stumpf hinter dem Tränenschleier vor ihren Augen.
Energisch schob Juliana die Schublade zu und wandte sich wieder dem Standspiegel zu, um ihren Anblick zu prüfen. Ihre Verkleidung hatte niemals den Zweck gehabt, die Leute in unmittelbarer Nähe zu täuschen, und als sie sich jetzt im Spiegel musterte, erkannte sie, daß die Leinenbluse nur wenig tat, um die volle Rundung ihrer Brüste zu kaschieren; auch den verführerischen Schwung ihrer Hüften betonten die enganliegenden Reithosen nur noch.
Schließlich nahm sie einen schweren Winterumhang aus dem Schrank und hüllte sich darin ein. Der Umhang verbarg zwar ihre überaus weibliche Figur, doch der Gesamteindruck stellte sie keineswegs zufrieden. Allerdings würde das Licht um diese frühe Morgenstunde ziemlich schlecht sein, und mit ein bißchen Glück fänden sich noch andere Fahrgäste an der Postkutschenstation ein, so daß sie kein unnötiges Aufsehen erregen würde.
Als sie sich auf Zehenspitzen zur Schlafzimmertür bewegte, warf sie einen letzten Blick auf die geschlossenen Bettvorhänge. Sie hatte das Gefühl, dem Toten einen gewissen Respekt schuldig zu sein. Es erschien ihr unrecht, so Hals über Kopf vom letzten Lager ihres Ehemannes wegzulaufen. Und dennoch blieb ihr keine andere Wahl. Einen Moment lang hielt sie inne, während sie intensiv an den Mann dachte, den sie kaum länger als drei Monate gekannt hatte. Sie erinnerte sich an seine Freundlichkeit und Güte. Und dann verdrängte sie energisch jede Gemütsbewegung. John Ridge war fünfundsechzig Jahre alt gewesen. Er hatte drei Ehefrauen im Laufe seines Lebens gehabt. Und er war schnell und schmerzlos gestorben ... ein Tod, den leider sie verschuldet hatte.
Juliana schlüpfte aus dem Schlafzimmer und schlich verstohlen den stockfinsteren Korridor entlang, wobei sie sich mit den Händen an der Wand entlangtastete. Am obersten Treppenabsatz blieb sie zögernd stehen. Die Halle unter ihr war dunkel, aber nicht so schwarz wie der zurückliegende Korridor. Schwaches Mondlicht schimmerte durch die vielen kleinen Glasscheiben der Sprossenfenster.
Ihr Blick schweifte ängstlich zur Tür der Bibliothek. Sie war fest verschlossen. Juliana flog die Treppe hinunter, schlich auf leisen Sohlen zu der bewußten Tür und preßte ihr Ohr gegen das Holz. Ihr Herz hämmerte in ihrer Brust, und sie fragte sich, warum sie noch Zeit damit verschwendete, auf die unregelmäßigen, dröhnenden Schnarchlaute im Inneren des Raums zu horchen. Aber sie zu hören, vermittelte ihr ganz einfach ein Gefühl der Sicherheit.
Hastig wandte sie sich zum Gehen, und dabei blieb ihr Fuß in den Fransen des abgetretenen elisabethanischen Teppichs hängen. Sie stolperte prompt, klammerte sich im Fallen haltsuchend an ein Tischbein und stürzte auf die Knie – mit dem Ergebnis, daß ein kupferner Krug voller Malven gefährlich ins Kippen kam, als sich der Tisch bewegte, und gleich darauf laut auf dem Fliesenfußboden zerschellte.
Juliana lag auf den Knien, vor Schreck wie erstarrt, während sie mit angehaltenem Atem das Echo von der hohen Balkendecke widerhallen hörte, das dann langsam in der Nacht verklang. Es war ein Krach gewesen, der selbst Tote zum Leben hätte erwecken können.
Aber nichts geschah. Keine aufgeregten Rufe ertönten, keine herbeieilenden Schritte ... und das Wundersamste von allem: keine Veränderung oder Unterbrechung im Rhythmus des schnaubenden Röchelns aus der Bibliothek.
Leise vor sich hin fluchend, rappelte Juliana sich wieder auf. Wieder mal ihre ungeschickten Füße! Sie waren der Fluch ihres Lebens, viel zu groß und ohne Zweifel mit einem eigenen Willen ausgestattet.
Auf Zehenspitzen schlich Juliana nun in den rückwärtigen Teil des Hauses und schlüpfte zur Küchentür hinaus. Draußen war alles ruhig. Das Haus hinter ihr lag in tiefem Schlaf. Das Haus, das ihr Heim hätte werden sollen – ihre Zuflucht vor den unberechenbaren Mißgeschicken und Windungen eines Lebens, das ihr bisher nur wenig Glück beschert hatte.
Juliana zuckte die Achseln. Wie eine streunende Katze, die vor langer Zeit gelernt hat, sich allein durchzuschlagen, blickte sie ihrer unbestimmten Zukunft mit klagloser Resignation entgegen. Als sie mit eiligen Schritten den Hinterhof durchquerte und sich einen Weg zu dem Obstgarten und den Feldern dahinter bahnte, schlug die Kirchenuhr gerade Mitternacht.
Ihr siebzehnter Geburtstag war vorbei. Der Tag, den sie als Braut begonnen und als Witwe und Mörderin beendet hatte.
»Einen schönen guten Morgen, Cousin«, nuschelte eine Stimme aus den Tiefen eines Lehnsessels, als der Herzog von Redmayne die Bibliothek seines Hauses in der Albermarle Street betrat.
»Und was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches, Lucien?« erkundigte sich der Herzog in nüchternem Tonfall, obwohl eine Andeutung von Empörung in seinen Augen aufflackerte. »Willst du auf diese Weise deinen Gläubigern entwischen? Oder stattest du mir einen ergreifenden Höflichkeitsbesuch ab?«
»Ich bitte dich, Cousin. Spar dir deinen Sarkasmus.« Lucien Courtney rappelte sich auf die Füße und musterte mit spöttischer Gelassenheit seinen Vetter sowie den Mann, der unmittelbar hinter ihm den Raum betreten hatte. »Nanu, wenn das nicht unser lieber Reverend Courtney ist! Was für eine überwältigende Ansammlung von Verwandten. Wie geht’s dir denn so, alter Knabe?«
»Recht gut, danke«, erwiderte der andere Mann verbindlich. Er war in schlichtes Grau gekleidet, mit einem einfachen weißen Halstuch – seine Kleidung bildete einen krassen Gegensatz zu dem pfauenblauen seidenen Gehrock des Herzogs mit den vergoldeten Knöpfen und den reichbestickten Ärmelaufschlägen. Aber seine physische Ähnlichkeit mit Redmayne war verblüffend: Die gleiche gerade, vornehme Nase und tiefliegende graue Augen, der gleiche schmale, gutgeschnittene Mund, das gleiche energische, in der Mitte gespaltene Kinn. Damit endeten die Gemeinsamkeiten der beiden Männer jedoch. Während Quentin Courtney die Welt und ihre verrückten Launen mit dem wohlwollenden und aufrichtigen Verständnis eines frommen Geistlichen betrachtete, sah sein Halbbruder Tarquin, Herzog von Redmayne, seine Mitmenschen mit den scharfen, desillusionierten Augen eines Zynikers.
»Also, was führt dich zu den heimatlichen Fleischtöpfen zurück?« höhnte Lucien ein wenig. »Ich dachte, du wärst inzwischen ein wichtiger Kirchenmann in der Diözese irgendeines Landesbischofs geworden.«
»Kanonikus der Melchester Kathedrale, um genau zu sein«, erklärte Quentin kühl. »Ich bin im Auftrag meines Bischofs hier, um kirchliche Angelegenheiten mit dem Erzbischof von Canterbury zu besprechen.«
»Oh, was sind wir doch schnell, weit und heilig aufgestiegen«, rief Lucien mit spöttisch gekräuselten Lippen aus. Quentin ignorierte die Bemerkung.
»Darf ich dir eine Erfrischung anbieten, Lucien?« Tarquin ging zu den Karaffen auf der Anrichte. »Ah, wie ich sehe, hast du dich schon selbst bedient«, fügte er hinzu, als er den Cognacschwenker in der Hand des Jüngeren bemerkte. »Meinst du nicht, daß es noch ein bißchen früh am Morgen für Cognac ist?«
»Mein lieber Junge, ich bin überhaupt noch nicht im Bett gewesen«, äußerte Lucien mit einem Gähnen. »Für meine werte Person ist dies ein Schlaftrunk.« Er stellte sein Glas auf einem Tischchen ab und schlenderte mit etwas unsicheren Schritten zur Tür. »Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mich für ein paar Nächte bei dir einquartiere, oder?«
»Wie sollte ich?« gab Tarquin mit einer hochgezogenen Braue zurück.
»Tatsache ist, daß bei mir zu Hause praktisch Belagerungszustand herrscht«, erklärte Lucien, während er sich an die Tür lehnte und in seinen Taschen nach der Schnupftabakdose suchte. »Zu jeder Tages- und Nachtzeit hämmern die verdammten Gläubiger und Gerichtsvollzieher an meine Tür. Man kommt einfach nicht mehr dazu, sich richtig auszuschlafen, weil einem diese Halunken keine Ruhe lassen.«
»Und was wirst du diesmal verkaufen, um diese Halunken zu befriedigen?« wollte der Herzog wissen, während er für sich und seinen Bruder ein Glas Madeira einschenkte.
»Tja, ich werde mich wohl oder übel von Edgecombe trennen müssen«, brummte Lucien und nahm eine Prise Schnupftabak. Er seufzte aus tiefstem Herzen. »Eine schreckliche Sache. Aber ich wüßte wirklich nicht, was ich sonst tun sollte ... es sei denn natürlich, du würdest dich in der Lage sehen, einem Verwandten aus der Klemme zu helfen.«
Seine blaßbraunen Augen, die tief in ihren Höhlen wie die letzten Funken eines verlöschenden Feuers glühten, nahmen plötzlich einen scharfen, gerissenen Ausdruck an, und er musterte seinen Cousin abschätzend. Sein Mund verzog sich zu einem wissenden Lächeln, als er einen Muskel an Tarquins Kiefer verräterisch zucken sah, während dieser darum kämpfte, seinen Ärger in Schach zu halten.
»Nun«, sagte Lucien sorglos, »wir werden später darüber sprechen ... wenn ich etwas ausgeschlafener bin. Vielleicht beim Dinner?«
»Mach, daß du rauskommst«, knurrte Tarquin und kehrte ihm brüsk den Rücken.
Luciens glucksendes Lachen hing noch in der Luft, als sich die Tür hinter ihm schloß.
»Es wird wohl kaum noch etwas von Edgecombe übrigbleiben, was der arme Godfrey einmal erben könnte«, bemerkte Quentin, als er an seinem Wein nippte. »Seit Lucien vor knapp sechs Monaten volljährig geworden ist, hat er bereits ein Vermögen durchgebracht, von dem die meisten Männer bis ans Ende ihrer Tage im Luxus leben könnten.«
»Ich werde nicht tatenlos danebenstehen und zusehen, wie er Edgecombe verkauft«, ließ Tarquin sich deutlich vernehmen. »Und ich werde auch nicht danebenstehen und zusehen, wie das wenige, was noch davon übrigbleibt, in den Besitz von Luciens bedauernswertem Anhang übergeht.«
»Mir ist bloß schleierhaft, wie du das verhindern willst«, sagte Quentin überrascht. »Ich weiß, der arme Godfrey besitzt nicht mehr Verstand als ein Truthahn, aber er ist trotzdem Luciens rechtmäßiger Erbe.«
»Er würde es sein, falls Lucien keine eigenen Nachkommen hinterläßt«, erwiderte der Herzog, während er beiläufig in der Gazette blätterte.
»Nun, wir alle wissen, daß da keine Aussicht besteht«, erklärte Quentin. Es war etwas, was er immer als eine unveränderliche Tatsache betrachtet hatte. »Außerdem ist Lucien jetzt volljährig und braucht dir keine Rechenschaft mehr abzulegen; du hast keine Handhabe mehr, ihn zu kontrollieren.«
»Richtig, und er hört auch nie auf, mir das unter die Nase zu reiben«, gab Tarquin zurück. »Aber eher wird die Hölle zufrieren, als daß ich mich von Lucien Courtney unterkriegen lasse, mein Freund.« Er schaute auf und begegnete dem Blick seines Halbbruders.
Quentin fühlte, wie ihm ein kleiner Schauder das Rückgrat hinunterrieselte bei dieser geflüsterten Verkündigung. Er kannte Tarquin wie kein anderer, auch die sanftere Seite dieser scheinbar so unbeugsamen Natur, kannte die Schwächen und Verwundbarkeiten seines Halbbruders; er wußte, daß der harte Zynismus, den Tarquin der Welt präsentierte, eine Schutzmaßnahme war, die er sich in frühester Jugend angeeignet hatte, eine Abwehrmaßnahme gegen jene, die die Freundschaft eines zukünftigen Herzogs für ihre eigenen Ambitionen zu mißbrauchen suchten.
Quentin war sich jedoch auch bewußt, daß man die Rücksichtslosigkeit des Herzogs von Redmayne nicht unterschätzen durfte, wenn es um seine persönlichen Interessen ging. »Und was hast du vor?« fragte er schlicht.
Tarquin trank sein Glas aus. Er lächelte, aber ohne Humor. »Es ist an der Zeit, daß sich unser kleiner Cousin eine Ehefrau zulegt und eine Familie zu gründen beginnt«, erklärte er. »Damit sollte das Problem eines Erben von Edgecombe gelöst sein.«
Quentin starrte ihn an, als hätte er den Verstand verloren. »Keine Frau wird Lucien jemals heiraten, selbst wenn er zu heiraten bereit wäre. Er ist von der Syphilis zerfressen, und die einzigen Frauen, die in sein Vergnügungsprogramm passen, sind Huren aus der Gosse, die in Männerkleidung den Burschen für ihn spielen.«
»Das stimmt. Aber was glaubst du, wie lange er noch zu leben hat?« fragte Tarquin fast beiläufig. »Man braucht ihn sich doch bloß anzusehen. Er ist völlig ausgebrannt von seinen zügellosen Ausschweifungen und dem Tripper. Ich würde ihm vielleicht noch sechs Monate geben ... längstens ein Jahr.«
Quentin sagte nichts, aber sein Blick ruhte weiterhin unverwandt auf dem Gesicht seines Halbbruders.
»Außerdem weiß er um seinen Zustand«, fuhr Tarquin fort. »Jeden Tag schlägt er über die Stränge, als wäre es sein letzter. Er schert sich keinen Deut darum, was mit Edgecombe oder dem Courtney-Vermögen passiert. Warum sollte er auch? Aber ich werde mich darum kümmern, daß Edgecombe unversehrt in kompetente Hände übergeht.«
Quentin sah entsetzt aus. »Um Gottes willen, Tarquin, hab Erbarmen! Du könntest doch unmöglich eine Frau dazu verdammen, das Bett mit ihm zu teilen, selbst wenn er sie zu sich nehmen würde. Es käme einem Todesurteil gleich.«
»Hör gut zu, lieber Bruder. Ich habe da einen Plan.«
Kapitel 2
Zu dem Zeitpunkt, als die Postkutsche in den Hof des Gasthauses »Zur Glocke« in der Wood Street in Cheapside rumpelte, hatte Juliana fast vergessen, daß noch eine andere Welt außerhalb des engen, vollgestopften Inneren der Kutsche und der Gesellschaft ihrer sechs Mitreisenden existierte. Bei einer Fortbewegung von fünf Meilen pro Stunde und einem erzwungenen Zwischenhalt bei Sonnenuntergang, weil weder der Kutscher noch die Passagiere nach Einbruch der Dunkelheit auf den Landstraßen unterwegs sein wollten, hatte es mehr als vierundzwanzig Stunden gedauert, um die siebzig Meilen von Winchester nach London zurückzulegen.
Während der langen Stunden der Nacht hatte Juliana, wie der Rest ihrer Reisegefährten, im Schankraum des Postkutschengasthofs gesessen. Trotz der harten, unbequemen Bänke hatte sie es als eine willkommene Abwechslung von dem zermürbenden Holpern und Rütteln der eisernen Kutschenräder über ungepflasterte Straßen begrüßt.
Kurz vor Morgengrauen waren sie erneut aufgebrochen, und gerade wenige Minuten nach sieben Uhr früh stieg sie zum letzten Mal aus der Kutsche. Jetzt stand sie im Hof der »Glocke« und bog ihren steifen Rücken gegen ihre ins Kreuz gestützten Hände in dem Versuch, ihre verkrampften Muskeln etwas zu lockern. Die Postkutsche aus York trudelte ebenfalls gerade ein und spuckte ihre schläfrig blinzelnden, erschöpften Passagiere aus. Die Juniluft war schon warm um diese frühe Morgenstunde und mit den Gerüchen der Großstadt durchtränkt – Juliana rümpfte angewidert die Nase über den durchdringenden Gestank des faulenden Unrats in den Gossen und der Dunghaufen, die sich in den engen, kopfsteingepflasterten Straßen türmten.
»Hast du ’nen Koffer da oben, Junge?«
Juliana brauchte einen Moment, um zu begreifen, daß die Frage des Kutschers an sie gerichtet war. Sie trug noch immer ihren Umhang und die Wollmütze, die sie während der gesamten Reise nicht abgesetzt hatte, bis weit über die Ohren heruntergezogen. Sie wandte sich dem Mann zu, der auf dem Dach der Kutsche hockte und dabei war, das Gepäck der Fahrgäste loszuschnallen.
»Nein, nichts, danke.«
»Eigentlich eine zu lange Fahrt, um nicht mal mit ’nem Beutel loszuziehen«, bemerkte der Mann neugierig.
Juliana nickte nur schweigend und steuerte dann auf die Tür des Gasthofs zu. Ihr kam es vor, als wäre sie nicht nur endlos unterwegs gewesen, sondern in eine andere Welt gereist ... in ein anderes Leben. Was ihr dieses Leben bringen würde und wie sie damit umgehen sollte, waren die einzigen Fragen, die sie im Moment interessierten.
Sie betrat den dunkel getäfelten Schankraum, wo eine Küchenmagd gerade einen Eimer Wasser auf dem schmierigen Fliesenfußboden auskippte. Juliana hüpfte über einen Strom schmutzigen Wassers, der ihre Stiefel zu durchnässen drohte, blieb mit dem Fuß am Rand des Eimers hängen und klammerte sich haltsuchend an der Theke fest, um nicht auszurutschen. Als sie ihr Gleichgewicht wiedergefunden hatte, nickte sie dem Mädchen gutgelaunt zu.
»Einen schönen guten Morgen!«
Das Mädchen schniefte und zog ein Gesicht, als stellte sie sich einen guten Morgen anders vor. Sie war ein mageres, blasses Geschöpf, das sein Haar fast schmerzhaft straff aus der Stirn zurückgekämmt und zu einem strähnigen, fettigen Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. »Sie woll’n was zu essen?«
»Wenn ich darum bitten darf«, erwiderte Juliana mit ungetrübter Fröhlichkeit. Sie glitt auf einen hohen Hocker an der Theke und blickte sich im Raum um. Der Vergleich mit dem Landgasthof, der ihr von ihrem Heimatort her vertraut war, fiel nicht sonderlich günstig aus. Dort gab es stets frische Blumen und Bündel von getrockneten Kräutern, blankpoliertes Messing und sorgfältig gewachstes Holz; dieser Schankraum dagegen starrte vor Schmutz, und es stank nach schalem Bier und Latrine. Die Anwesenden hatten darüber hinaus eine mißtrauische, fast feindselige Art an sich.
Gleich darauf tauchte der Wirt aus dem dämmrigen Zwielicht hinter der Theke auf. »Was kann ich Ihnen bringen?« Die Frage klang durchaus höflich, aber sein Ton war mürrisch, und er musterte sie abschätzend aus blutunterlaufenen Augen.
»Eier und Toast und Tee, wenn ich bitten darf, Sir. Ich bin gerade mit der Kutsche aus York angekommen.« Juliana versuchte es mit einem freundlichen Lächeln.
Der Mann beäugte sie argwöhnisch in der trüben Atmosphäre, und sie zog ihren Umhang unwillkürlich fester um sich.
»Lassen Sie mal erst Ihr Geld sehen«, knurrte er.
Juliana griff in ihre Tasche und zog einen Shilling hervor. Sie knallte die Münze auf die Theke und funkelte den Mann grimmig an, wobei ihre jadegrünen Augen plötzlich Funken versprühten.
Der Wirt wich überrascht einen Schritt zurück vor ihrem jähen Zorn. Er schnappte sich die Münze, warf Juliana erneut einen forschenden Blick zu und fauchte die immer noch den Fußboden wischende Küchenmagd an: »Ellie, geh in die Küche und bring dem Gentleman seine Eier und seinen Toast.«
Die Magd ließ ihren Mopp derart ungeduldig in den Eimer fallen, daß ein Schwall Wasser über den Rand schwappte, dann schlurfte sie mit einem tiefen Aufseufzen hinter die Theke und verschwand in der Küche.
Die schmalen, blutunterlaufenen Augen des Wirts verengten sich. »Einen Humpen Ale, junger Herr?«
»Nein, nur Tee, bitte.«
Sein schlauer Blick wanderte über die verräterischen Rundungen ihrer Figur. »Tee wird dir nur den Magen verkorksen, Jungchen. Ist ein Getränk, das für Weiber taugt. Hat dir denn keiner beigebracht, Ale zum Frühstück zu trinken?«
Juliana sah ein, daß ihre Verkleidung doch nicht ausreichend überzeugte, aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihrem Zweck durchaus gedient. Sie wiegte sich in dem Glauben, daß keiner im »Rose and Crown« einen zweiten Gedanken an sie verschwendet hatte, und für diesen Wirt hier war sie gerade mit der Postkutsche aus York angekommen – was schließlich am anderen Ende des Landes, also kurz vor der schottischen Grenze lag.
»Ich bin auf der Suche nach Unterkunft und Arbeit«, sagte sie beiläufig und bestätigte damit kampflos seinen Verdacht. »Wissen Sie vielleicht von irgendeiner Stellung hier in der Gegend?«
Der Mann rieb sich nachdenklich übers Kinn. »Tja, mal überlegen, vielleicht fällt mir dazu was ein. Aber zuerst woll’n wir doch sehen, was Sie unter der Mütze da haben.«
Juliana zuckte die Achseln und zog sich die Wollmütze vom Kopf. »Wie Sie meinen. Mir ist allerdings schleierhaft, was mein Haar mit der Frage zu tun hat, ob ich eine Anstellung bekomme oder nicht.«
In dem Moment kehrte Ellie mit dem Frühstück zurück, und ihr blieb der Mund offenstehen, als sich die feurige Masse von Locken, aus der engen Mütze befreit, aus ihren Nadeln löste und über Julianas Schultern und Rücken floß.
»He, wieso läufst du in Jungskleidern ’rum?« Sie setzte den Teller mit einem dumpfen Knall vor Juliana auf der Theke ab.
»Es erleichtert das Reisen«, erwiderte Juliana, als sie ihren Toast in das Eigelb tauchte. »Und könnte ich bitte noch meinen Tee haben?«
»Oh, wir markieren die feine Dame, wie?« gab Ellie frech zurück. »Ich wette, du bist auch keine Heilige.«
»Halt den Mund und hol den Tee, Mädchen«, befahl der Wirt und machte eine drohende Handbewegung in ihre Richtung.
Ellie duckte sich, schniefte verächtlich und rannte in die Küche zurück.
»Also, wie kommt’s dann, daß sich eine junge Frau in Burschenkleidung allein auf Reisen begibt?« erkundigte sich der Wirt wie nebenbei, während er einen stumpfen Zinnkrug an seinem Ärmel polierte.
Juliana wischte hungrig den letzten Rest des Eigelbs mit einem Stück Toast auf und legte dann ihre Gabel nieder. »Ich suche Arbeit, wie ich Ihnen schon sagte.«
»Sie sprechen wie ’ne Lady«, beharrte er. »Ladies laufen nich’ so in der Gegend rum und suchen Arbeit.«
»Ladies, die eine Pechsträhne haben, könnten unter Umständen dazu gezwungen sein.« Sie schenkte sich Tee aus der Kanne ein, die Ellie unwirsch neben ihrem Ellenbogen abgestellt hatte, setzte die Kanne wieder ab und verfing sich prompt mit einer Falte ihres Umhangs in der Tülle, als sie den Arm bewegte. Die Kanne wackelte und kippte auf der Theke um, doch Juliana gelang es, ihr Kleidungsstück zu befreien, ohne allzuviel von der heißen Flüssigkeit zu verschütten.
»Tja, ich schätze, das mag wohl sein«, stimmte der Wirt zu, während er ihren Kampf mit der Teekanne beobachtete.
»Also, wissen Sie zufällig von irgendeiner Erwerbstätigkeit?«
»Könnte sein. Warten Sie hier einfach ’ne Weile, und ich will sehen, was ich tun kann.«
»Danke.« Sie lächelte strahlend, und er zwinkerte mit seinen Schweinsäuglein, bevor er in den hinteren Regionen verschwand und Juliana mit ihrem Tee zurückließ.
In der Küche winkte er einen Küchenjungen herbei, der soeben fettige Töpfe und Pfannen in einem hölzernen Bottich neben der Tür reinigte. »He, du Lümmel! Beweg dich in die Russell Street in Covent Garden. Zu Mr. Dennisons Haus. Sag Mistress Dennison, daß Josh Bute aus der Glocke möglicherweise was Interessantes für sie hat. Hast du verstanden?«
»Ja, Sir, Mr. Bute«, sagte der Junge eilfertig. »Wird sofort erledigt, Sir.« Er hastete davon, und Mr. Bute stand einen Moment in der Küche, während er sich lächelnd die Hände rieb. Die Dennisons zahlten eine ordentliche Prämie für die Vermittlung einer hübschen jungen Person, und die da gerade in seinem Schankraum saß, hatte so etwas Gewisses an sich; der Wirt witterte ein erstklassiges Geschäft mit dem Etablissement jenes anspruchsvollen Paares.
Er nickte befriedigt vor sich hin, als er in den Schankraum zurückkehrte. »Ich schätze, ich kann was für Sie tun, Miss«, erklärte er mit einem Lächeln, das er für jovial hielt, das Juliana jedoch an einen zahnlosen, tollwütigen Hund erinnerte.
»Um welche Art von Arbeit handelt es sich denn?« erkundigte sie sich.
»Oh, gute, saubere Arbeit, Miss«, versicherte er ihr hastig. »Solange Sie Mistress Dennison zufriedenstellen, wird’s Ihnen prächtig gehen.«
»Ist es eine Arbeit mit Unterkunft im Hause?«
»Oh, ja, Miss, das ist es«, erwiderte er, während er einen Krug Ale für sich selbst zapfte. »Angenehme Arbeit mit Unterkunft. Genau das Richtige für eine junge, alleinstehende Lady. Mistress Dennison kümmert sich aufrichtig um ihre Mädchen.« Er wischte sich mit dem Handrücken den Schaum vom Mund und grinste sein zahnloses, schlitzohriges Lächeln.
Juliana runzelte nachdenklich die Stirn. Es schien alles bemerkenswert schnell und reibungslos zu gehen. Fast schon allzu glatt. Dann zuckte sie die Achseln. Sie hatte nichts zu verlieren und sollte getrost diese Mistress Dennison erst einmal kennenlernen; falls sie tatsächlich ein Stubenmädchen oder auch eine Dienstmagd brauchte, würde es ihr zumindest zu einem Anfang verhelfen.
»Soll ich sie aufsuchen?«
»Du meine Güte, nein. Mistress Dennison wird hierherkommen«, bremste der Wirt ihren Eifer, als er einen weiteren Humpen Ale zapfte.
»Dann setze ich mich solange in die Nische dort drüben am Kamin.« Juliana gähnte unterdrückt. »Ich könnte ein Nickerchen machen, während ich warte.«
»Tun Sie das«, sagte Mr. Bute betont gleichmütig, aber sein Blick ruhte weiterhin starr auf ihr, bis sie sich auf der Holzbank in der tiefen Nische zusammengerollt und ihre Wange auf ihre Hand gebettet hatte. Sie war so erschöpft, daß ihr die Augen augenblicklich zufielen.
Mr. Bute saugte mit einem zufriedenen Schnalzen an seinem zahnlosen Gaumen. Die Kleine würde keine Schwierigkeiten machen, bis Mistress Dennison eintraf. Dennoch blieb er vorsichtshalber im Schankraum und behielt ein wachsames Auge auf die schlafende Gestalt, bis er zwei Stunden später das Rattern von Rädern im Stallhof hörte und gleich darauf das Geräusch schneller Schritte auf dem Vorplatz.
Eilig kam er hinter seiner Theke hervor und rannte hinaus, um seine Besucherin mit einer tiefen Verbeugung zu begrüßen.
»Also, was haben Sie für mich, Bute?« verlangte die Dame zu wissen, während sie ungeduldig mit einem hochhackigen Pumps aus rosa, mit Silberspitze verzierter Seide auf den Boden klopfte. »Es ist teuflisch früh am Morgen für Besuch, deshalb will ich doch sehr hoffen, daß ich nicht vergeblich hergekommen bin.«
»Das glaube ich nicht, Madam«, erwiderte der Wirt mit einer weiteren tiefen Verbeugung, wobei seine Nase fast seine Knie streifte. »Das Mädchen sagt, sie wär’ gerade mit der Kutsche aus York angekommen.«
»Na schön, und wo ist sie?« Elizabeth setzte ihren Fächer in Bewegung und rümpfte leicht die Nase über die muffige, widerwärtige Luft im Raum, in die sich jetzt noch der Geruch kochenden Kohls mischte.
»Im Schankraum, Madam.« Der Wirt hielt die Tür auf, und die Dame rauschte an ihm vorbei, wobei sie geschickt den Reifen ihres weiten grünen Seidenrocks durch den Türrahmen manövrierte.
»Da drüben, in der Nische am Kamin«, erklärte Mr. Bute leise und zeigte auf die Holzbank.
Mistress Dennison durchquerte den Raum. Ihr Schritt war leichtfüßig, in ihren Augen schimmerte ein gieriger Glanz. Sie blieb vor der Bank stehen und blickte auf die schlafende, in einen Umhang gewickelte Gestalt hinunter. Ihr abschätzender Blick ruhte einen Moment auf der wirren Fülle flammendroter Haare, dann musterte sie die cremige Blässe der Haut, die schwungvolle Form der vollen, leicht geöffneten Lippen, die Ansammlung von Sommersprossen auf dem Rücken der geraden, kräftigen Nase.
Nicht direkt hübsch, entschied Mistress Dennison mit Kennerblick. Für wahre Schönheit waren ihre Züge zu stark ausgeprägt. Aber ihr Haar konnte man als prachtvoll bezeichnen. Und es gab viele Gentlemen, die eine Erscheinung bevorzugten, die ein wenig aus dem Rahmen fiel. Aber was um alles in der Welt hatte sie dazu bewogen, Männerkleidung anzuziehen? Stimmte etwas nicht? Sie mußte etwas zu verbergen haben, daran bestand kein Zweifel. Wenn sie sich indessen auch noch als Jungfrau entpuppen sollte ...
Elizabeths schöne Augen verengten sich abrupt zu Schlitzen. Eine Jungfrau, die etwas zu verbergen hatte ...
Sie beugte sich über Juliana und rüttelte sie leicht an der Schulter. »Meine Liebe, es ist Zeit aufzuwachen.«
Juliana tauchte langsam aus den Tiefen eines traumlosen Schlafes empor. Sie öffnete die Augen und blickte blinzelnd in das Gesicht, das sich über sie beugte. Ein hübsches Gesicht: lächelnde rote Lippen, freundliche blaue Augen. Es war jedoch kein Gesicht, das sie kannte, und einen Moment lang fühlte sie sich völlig verwirrt und orientierungslos.
Die Frau berührte sie erneut an der Schulter. »Ich bin Mistress Dennison, meine Liebe.«
Die Erinnerung kehrte mit einem Schlag zurück. Juliana setzte sich auf und schwang ihre Beine über den Rand der Bank. Neben diesem strahlenden Geschöpf in raschelnder Seide, auf dessen dunkelbraunen Locken eine zierliche Spitzenkappe thronte, kam sie sich furchtbar linkisch vor, nichts als schmutzige Ellenbogen und Knie. Sie zog ihre Füße unter die Bank in der Hoffnung, daß sie dort keinen Schaden anrichten könnten, und machte sich hastig daran, ihr Haar zu bändigen und mit Nadeln festzustecken.
»Der Wirt hier schien der Annahme, daß Sie möglicherweise ein Stubenmädchen suchen, Ma’am«, begann sie.
»Meine Liebe, verzeihen Sie mir, aber Sie sprechen nicht wie jemand, der Dienstbotenarbeit gewöhnt ist«, erklärte Mistress Dennison ohne lange Umstände, als sie neben Juliana Platz nahm. »Ich habe gehört, Sie sind mit der Postkutsche aus York angereist.«
Juliana nickte zustimmend, doch Elizabeths Blick wurde noch eine Spur schärfer. Sie besaß zuviel Menschenkenntnis und Lebenserfahrung, um sich von einer unerfahrenen Lügnerin täuschen zu lassen. Außerdem schwang in der Sprechweise des Mädchens keinerlei Yorkshire-Dialekt mit.
»Wo sind Sie zu Hause?« wollte sie wissen.
Juliana schob die letzte Nadel in ihr Haar zurück. »Müssen Sie das unbedingt wissen, Ma’am?«
Elizabeth beugte sich vor und legte ihre behandschuhte Hand sanft auf Julianas. »Nicht, wenn Sie es mir nicht sagen möchten, Kind. Aber vielleicht verraten Sie mir Ihren Namen und Ihr Alter?«
»Juliana Ri ... Beresford«, korrigierte sie sich hastig. George und seine Häscher würden Juliana Ridge suchen. »Ich bin gerade siebzehn geworden, Ma’am.«
Die Dame nickte. Der kleine Versprecher war ihr nicht entgangen. »Nun, wie wär’s, wenn Sie gleich mit mir kommen, meine Liebe? Sie brauchen Ruhe und Stärkung und neue Kleider.« Ihre Röcke raschelten und sie lächelte einladend.
»Aber... aber welche Art von Arbeit müßte ich denn tun, Madam?« Juliana fühlte sich zunehmend verwirrt. Es ging alles so schrecklich schnell.
»Darüber werden wir uns unterhalten, wenn Sie sich ein wenig erfrischt haben, Kind.« Mistress Dennison richtete sich auf und strich über ihr schimmerndes Gewand. »Kommen Sie. Meine Kutsche wartet draußen, und es ist nur eine kurze Fahrt bis zu meinem Haus.«
Julianas bescheidener Geldvorrat war bis auf einen einzigen Sovereign zusammengeschrumpft. Die Summe würde vielleicht gerade noch reichen, um Unterkunft und Verpflegung für einen oder höchstens zwei Tage bezahlen zu können. Aber sie war hoffnungslos unerfahren in dieser erschreckenden Großstadt, und daher wollte sie nicht den Schutz und die Gastfreundschaft dieser charmanten Frau mit den freundlichen Augen ablehnen. So lächelte sie zustimmend und folgte ihrer Wohltäterin aus dem Gasthof hinaus und in das Innere einer leichten Stadtkutsche, die von zwei kräftigen Apfelschimmeln gezogen wurde.
»Nun, meine Liebe«, hub Mistress Dennison vertraulich an, »warum erzählen Sie mir nicht einfach alles? Ich kann Ihnen versichern, daß ich schon jede erdenkliche Geschichte gehört habe, und es gibt weniges auf der Welt, was mich noch überraschen oder schockieren könnte.«
Juliana lehnte den Kopf an die blaßblauen Samtpolster, und vor ihren müden Augen verschwamm einen Moment lang alles, als sie das freundlich lächelnde Gesicht ihres Gegenübers musterte. Ihr schoß der Gedanke durch den Kopf, daß der einzige Mensch bisher, der sie jemals mit derart freundlichem Interesse angelächelt hatte, Sir John Ridge gewesen war. Tränen stiegen in ihren Augen auf, und sie blinzelte sie hastig fort.
»Armes Kind, was ist Ihnen zugestoßen?« fragte Elizabeth mitfühlend, während sie sich vorbeugte und Julianas Hände in ihre nahm. »Bitte glauben Sie mir, Sie sind bei mir gut aufgehoben.«
Warum sollte ich einem wildfremden Menschen vertrauen? dachte Juliana. Aber es war nur ein vager, flüchtiger Gedanke im hintersten Winkel ihres Bewußtseins. Die Versuchung, jemandem die schrecklichen Ereignisse mitzuteilen, jemandem, der Lebenserfahrung besaß und den Lauf der Dinge kannte, war überwältigend. Wenn sie ihre Identität nicht preisgab und nicht verlauten ließ, woher sie kam, könnte sie die wichtigsten Punkte ihres Geheimnisses trotzdem hüten. Sich trotzdem vor dem langen Arm des Gesetzes schützen.
»Es ist eine seltsame Geschichte, Madam«, begann sie.
Wenn Mylord mir die unschätzbare Ehre erweisen würde, mich heute abend in der Russell Street aufzusuchen, könnte ich Ihnen etwas zeigen, das möglicherweise für Sie von Interesse wäre.
Ihre sehr ergebene
Elizabeth Dennison
Der Herzog von Redmayne überflog die Nachricht mit ausdrucksloser Miene. Dann blickte er zu dem Lakaien auf. »Ist der Bote noch da?«
»Ja, Euer Gnaden. Er hat Anweisung, auf eine Antwort zu warten.«
Tarquin nickte und schlenderte zu seinem Sekretär, wo er ein Blatt Pergament bereitlegte, eine Feder in das Tintenfaß tauchte und rasch zwei Zeilen zu Papier brachte. Er streute Sand über das Geschriebene und faltete den Bogen zusammen.
»Geben Sie dies dem Boten, Roberts!« Tarquin ließ das Schreiben auf das silberne Tablett in den Händen des Dieners fallen, worauf dieser unter einer Verbeugung den Raum verließ.
»Worum ging es denn?« erkundigte sich Quentin, als er von seinem Buch aufblickte.
»Ich bezweifle, daß du das wirklich wissen willst«, erwiderte der Herzog mit einem angedeuteten Lächeln. »Es betrifft eine Angelegenheit, die nicht deine Zustimmung fände, mein Freund.«
»Oh!« Quentins gewöhnlich so gütige Miene wurde ernst. »Doch nicht etwa jene Sache mit Lucien und einer Ehefrau?«
»Richtig, mein Bester, genau die. Sherry?« Tarquin hielt die Karaffe hoch, eine Braue fragend gelüftet.
»Danke.« Quentin legte sein Buch beiseite und erhob sich aus dem Sessel. »Du bist tatsächlich entschlossen, diesen diabolischen Plan in die Tat umzusetzen?«
»Felsenfest.« Der Herzog reichte seinem Bruder das gefüllte Glas. »Aber warum nennst du meinen Plan diabolisch, Quentin?« In seinen Augen glomm leichter Spott auf, und um seine Mundwinkel lag ein amüsierter Zug.
»Weil er diabolisch ist, deshalb«, gab Quentin knapp zurück. »Wie willst du das Mädchen vor Lucien schützen? Angenommen, er beschließt, seine ehelichen Rechte einzufordern?«
»Oh, das Problem kannst du getrost mir überlassen«, meinte Tarquin leichthin.
»Mir gefällt das Ganze nicht!« Quentin starrte stirnrunzelnd in sein Glas.
»Das hast du bereits mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht.« Tarquin klopfte seinem Bruder lächelnd auf die nüchtern gewandete Schulter. »Aber du hältst ja auch sonst nicht viel von meinen Plänen.«
»Nein, und zum Teufel, ich wünschte, ich wüßte, warum ich trotzdem soviel von dir halte«, erwiderte der andere fast unwillig. »Du bist ein gottloser Mann, Tarquin, und spielst zu gerne mit dem Feuer.«
Tarquin setzte sich und kreuzte seine elegant beschuhten Füße. Seine Stirn war in nachdenkliche Falten gelegt, als er die mit glitzernden Diamanten besetzten Schuhschnallen betrachtete. »Ich frage mich, ob juwelenbesetztes Schuhwerk nicht doch eine Spur überspannt wirkt. Mir ist aufgefallen, daß Stanhope bei dem Morgenempfang neulich sehr ansprechende Schnallen aus schlichtem Silber trug ... andererseits bezweifle ich, ob dich dieses Thema interessiert, Quentin.«
»Nein, ich kann wirklich nicht sagen, daß ich dem etwas abgewinnen kann.« Quentin warf einen flüchtigen Blick auf seine eigenen robusten schwarzen Lederschuhe mit den einfachen Metallschnallen. »Und weiche mir jetzt nicht aus, Tarquin.«
»Ich bitte um Verzeihung. Meiner Ansicht nach hatten wir das Thema doch in aller Liebenswürdigkeit ausdiskutiert.« Tarquin nippte an seinem Sherry.
»Wirst du deinen wahnwitzigen Plan aufgeben?«
»Nein, teurer Bruder.«
»Dann gibt es nichts weiter hinzuzufügen.«
»Genau. Wie ich schon sagte, wir haben einen freundschaftlichen Schlußstrich unter die Diskussion gezogen.« Der Herzog erhob sich mit einer geschmeidigen Bewegung und stellte sein Glas ab, bevor er zur Tür ging. »Nun beruhige dich, Quentin. Du wirst nur Falten bekommen, wenn du so viel grübelst.«
»Und spiel du mir nicht den Gecken vor«, erklärte Quentin mit mehr Leidenschaft, als er gewöhnlich zeigte. »Ich falle nicht auf deine Tricks herein, Tarquin.«
Sein Bruder hielt kurz am Ausgang inne, ein leichtes Lächeln auf den Lippen. »Nein, Gott sei Dank, das tust du nicht. Laß dich niemals von mir täuschen, wenn du mich liebst, Bruder.«
Die Tür schloß sich hinter ihm, und Quentin trank sein Glas aus. Er kannte seinen Halbbruder seit nunmehr dreißig Jahren. Lebhaft erinnerte er sich daran, wie zornig und desillusioniert Tarquin als Fünfzehnjähriger gewesen war, wie verraten er sich gefühlt hatte, weil er nicht an die Freundschaft seiner Altersgenossen hatte glauben können. Er erinnerte sich an die Verzweiflung, als der junge Mann wenige Jahre später entdecken mußte, daß die Frau, die er mit solcher Inbrunst liebte, nur an den Vorteilen interessiert war, die sich aus einer Liebesbeziehung mit dem Herzog von Redmayne ergäben.
Quentin wußte, wieviel dem Dritten Herzog von Redmayne das Familienerbe bedeutete. Tarquin war als der älteste Sohn und Erbe eines alten Titels und riesiger Ländereien erzogen worden, und er würde den Stolz und die Ehre seiner Familie bis zu seinem Todestag wahren.
Lucien hingegen gefährdete jene Ehre. Solange er Tarquins Mündel gewesen war, hatte der Herzog genügend Einfluß auf ihn gehabt, um die Zügel in der Hand zu behalten; jetzt hatte er jedoch keinerlei Einspruchsrecht mehr, was den Lebensstil ihres Cousins betraf oder dessen Umgang mit seinem Vermögen und den Landgütern. Quentin verstand Tarquins Besorgnis durchaus, dennoch konnte er den teuflischen Plan seines Halbbruders zur Rettung von Edgecomb keinesfalls gutheißen. Tarquin würde natürlich als Sieger aus der Auseinandersetzung hervorgehen, koste es, was es wolle.
Aber es mußte doch noch irgendeine andere Möglichkeit geben. Quentin griff erneut nach seinem Buch und suchte Trost in Plutarchs Werk »Vitae parallelae«. Er hoffte nur, der Erzbischof würde sich Zeit lassen mit der Angelegenheit, die ihn, Quentin, nach London gebracht hatte. Jemand mußte unbedingt ein wachsames Auge auf die Ereignisse in der Albermarle Street behalten. Manchmal pflegte Tarquin auf Quentin zu hören und ließ sich dazu überreden, seine weitreichenden Vorhaben noch einmal zu überdenken und abzuändern. Quentin liebte seinen Halbbruder von ganzem Herzen. Er hatte ihn während ihrer Kindheit wie einen Helden verehrt. Aber man durfte auch nicht die Augen vor der dunkleren Seite in Tarquins Wesen verschließen.
»Ah, Mylord, Sie sind gekommen.« Elizabeth erhob sich und knickste wiederum, als der Herzog in ihren Privatsalon geführt wurde.
»Aber natürlich, Ma’am. Wie hätte ich bei einem solchen Anreiz wohl fernbleiben können?« Tarquin zog eine emaillierte Schnupftabakdose aus seiner Tasche und nahm eine Prise. Mistress Dennison bemerkte selbstverständlich sofort, daß die feinen Gold- und Elfenbeineinlegearbeiten auf dem Deckel der Dose farblich exakt zu dem seidenen Mantel, dem Gehrock und den Kniehosen des Herzogs paßten.
»Möchten Sie die junge Dame jetzt sehen, Euer Gnaden?«
»Ich brenne darauf, Ma’am.«
»Dann kommen Sie bitte hier entlang, Sir.« Elizabeth führte ihren Gast hinaus. Es war Abend, und das Haus erwachte inzwischen zum Leben. Zwei junge Frauen in Spitzennégligés schlenderten gelassen den Korridor hinunter. Sie grüßten die Hausherrin respektvoll, die sie mit einem Lächeln bedachte, bevor sie weitereilte.
Ein Lakai, der ein Tablett mit Champagner, zwei Gläsern und einer Schale mit Austern trug, klopfte an eine Tür am Ende des Korridors.
»Der Abend fängt früh an«, bemerkte der Herzog.
»Das ist häufig der Fall, Mylord«, klärte Elizabeth ihn geduldig auf. »Wie ich erfahren habe, wird uns Seine Königliche Hoheit später ebenfalls mit seinem Besuch beehren.«
»Leider. Armer Fred«, murmelte der Herzog. Der wichtigtuerische Frederick Louis, Prinz von Wales, dessen Sucht nach Frauen oft Anlaß zu Gespött in der Gesellschaft gab, war praktisch Stammkunde im Etablissement der Dennisons.
Elizabeth führte Tarquin jetzt eine schmale Treppe am Ende des Korridors empor. Es war ein Weg, den der Herzog nicht kannte, und er kniff ein wenig die Augen zusammen, während er dem sanft schaukelnden, karmesinroten Reifrock vor ihm folgte.
»Dies ist mehr oder weniger privat, Mylord«, erklärte Elizabeth, als sie um eine Ecke bogen und einen engen Gang einschlugen. »Sie werden seinen Zweck gleich verstehen.«
Unmittelbar darauf blieb sie vor einer Tür am Ende des Korridors stehen und öffnete sie leise, dann wich sie einen Schritt zur Seite, um den Herzog eintreten zu lassen. Tarquin schob sich an ihr vorbei in eine Kleiderkammer, die nur von den flackernden Lampen des Treppenhauses hinter ihm erleuchtet wurde.
»In der Wand, Euer Gnaden«, flüsterte Elizabeth.
Er ließ seinen Blick über die Wand schweifen und entdeckte sie auf der Stelle: zwei runde Gucklöcher in Mannshöhe, mit genügend großem Abstand für ein Augenpaar.
Tarquin fragte sich, ob wohl sämtliche Räume von Mistress Dennison Möglichkeiten für Voyeure boten, als er an die Gucklöcher herantrat und in eine von Kerzenlicht erhellte Schlafkammer blickte. Er konnte ein mit Barchentvorhängen ausgestattetes Himmelbett sehen, passende Vorhänge, die sich an einem offenen Fenster im Luftzug bauschten, einen Waschtisch mit einem Wasserkrug und einer Waschschüssel aus geblümtem Porzellan. Es war ein Schlafzimmer wie viele in diesem Haus.
Aber in dem kleinen Raum hielt sich ein Mädchen auf. Es stand am offenen Fenster, damit beschäftigt, sein langes Haar zu bürsten. Das Kerzenlicht brachte den intensiven Rotton der seidigen, schimmernden Haarsträhnen zum Leuchten, als es mit kräftigen, rhythmischen Strichen die Bürste hindurchzog. Es trug einen lose fallenden Hausmantel, dessen Vorderteil einen Spaltbreit aufklaffte, als es sich vom Fenster abwandte.
Tarquin erhaschte einen flüchtigen Blick auf feste, volle Brüste, einen flachen weißen Bauch, eine Andeutung von krausem rötlichem Haar zwischen den Schenkeln. Dann entschwand sie aus seinem Blickfeld. Er wartete reglos, den Blick konzentriert auf den Teil des Raums gerichtet, der sichtbar war. Gleich darauf erschien sie erneut vor seinen Augen. Mit einer gelassenen Bewegung schlüpfte sie aus dem Hausmantel und warf ihn auf eine Ottomane am Fußende des Bettes.
Der Herzog rührte sich weder, noch gab er das leiseste Geräusch von sich. Hinter ihm wartete Elizabeth nervös, während sie inständig hoffte, er sähe etwas, was zu sehen sich lohnte.
Tarquin fuhr fort, die schlanke, hochgewachsene Gestalt prüfend zu betrachten; er bemerkte den großzügigen Schwung der Hüften, die straffe Fülle der Brüste, die die Schlankheit ihres Oberkörpers betonte, die schmale Taille. Bemerkte die elfenbeinfarbene Blässe ihrer Haut im Kontrast zu dem faszinierenden Flammendrot ihres Haars. Sie bewegte sich auf das Bett zu, und er musterte die schwungvolle Kurve ihrer Hüften, die glatte Rundung ihres Gesäßes, die langen, festen Schenkel.
Nun hob sie ein Knie und stützte es auf das Bett, schaute dann plötzlich über ihre Schulter zurück. Einen Moment lang schien sie ihn direkt anzusehen, während sich ihre Blicke trafen. Jene Augen waren jadegrün, leuchtend und weit auseinanderstehend unter der kompromißlos geraden Linie ihrer dunklen Brauen. Ihre Wimpern, so dunkel und dicht wie ihre Augenbrauen, flatterten auf und nieder, als sie müde blinzelte. Dann gähnte sie, wobei sie den Mund hinter dem Handrücken verbarg, und kletterte ins Bett.
Sie beugte sich zur Seite und blies die Kerze aus.
Der Herzog von Redmayne schlüpfte lautlos aus der Kleiderkammer und zurück in das Licht des Korridors. Er wandte sich einer erwartungsvollen Mistress Dennison zu.
»Ist sie noch Jungfrau?«
»Davon bin ich überzeugt, Euer Gnaden.«
»Ist sie käuflich?«
»Das nehme ich an.«
»Dann lassen Sie uns über die Bedingungen sprechen, Elizabeth.«