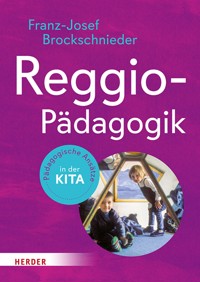
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Was in der italienischen Stadt Reggio Emilia als frühpädagogisches Projekt begann, setzt sich auch in Deutschland immer mehr als Konzept durch: die Reggio-Pädagogik. Dieses Buch vermittelt die grundlegenden pädagogischen Ideen und die Praxis dieses Ansatzes. Es verweist auch auf die politische Dimension der Reggio-Pädagogik, die sich in neuen Formen der Elternarbeit, den kollektiven Leitungsstrukturen und der Gemeinwesenorientierung niederschlägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das schönste Erlebnis ist die Begegnung mit dem Geheimnisvollen. Sie ist der Ursprung jeder wahren Kunst und Wissenschaft. Wer nie diese Erfahrung gemacht hat, wer keiner Begeisterung fähig ist und nicht starr vor Staunen dastehen kann, ist so gut wie tot: Seine Augen sind geschlossen. (Albert Einstein)
Aus Umweltschutzgründen wurde dieses Buch ohne Folie produziert.
Überarbeitete Neuausgabe 2025
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2001
Hermann-Herder-Str.4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagfoto: Hartmut W. Schmidt, Freiburg
Fotos im Innenteil: Einleitung © Rainer Lesniewski – shutterstock; Kapitel 1: Loris Malaguzzi © Preschools and Infanttoddler Centers – Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia (Italy), from the Catalogue of the Exhibition „The hundred languages of children“, Reggio Emilia, Reggio Children, 1996; Kapitel 2: © SolStock – iStock – GettyImages; Kapitel 4: © thomas-bethge – GettyImages; Kapitel 5: © lostinbids – GettyImages
Satz und Gestaltung: Arnold & Domnick, Leipzig
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN (Print) 978-3-451-03560-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83588-9
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83589-6
Inhalt
Einleitung
1 Wie alles begann – Eine kurze Geschichte der Reggio-Pädagogik
2 Die theoretischen Grundlagen der Reggio-Pädagogik
2.1 Die Reggio-Pädagogik als Erziehungsphilosophie – Zum Selbstverständnis der Reggio-Pädagogik
2.2 Das Erziehungsverständnis der Reggio-Pädagogik
2.2.1 Erziehung als gesellschaftliche Aufgabe
2.2.2 Erziehung als kooperatives, kommunikatives und personenorientiertes Handeln
2.2.3 Erziehung basiert auf der Akzeptanz von Rechten
2.2.4 Erziehung als experimentelles Handeln
2.2.5 Das Verhältnis von Theorie und Praxis in der Erziehung
2.3 Das institutionelle Selbstverständnis: Kindertagesstätten als Bildungseinrichtungen und Lebensgemeinschaften
2.4 Die pädagogischen Grundannahmen
2.4.1 Das Bild vom Kind
2.4.2 Erziehungsziele
2.4.3 Bildungs- und Lerntheorie
2.4.4 Pädagogik des Zuhörens
2.4.5 Erzieher:innenrolle
2.4.6 Räume und Materialien als dritte:r Erzieher:in
3 Die Praxis der Reggio-Pädagogik
3.1 Gruppenzusammensetzung
3.2 Räume und Materialien
3.3 Tagesablauf
3.4 Lernprozesse gestalten: Spiel, thematische Arbeit und Projekte
3.5 Beobachtung und Dokumentation
3.6 Team, Leitung und Fachberatung
3.7 Elternarbeit
4 Reggio ist kein Modell – Auf dem Weg zum reggioorientierten Kindergarten
5 Persönliches Schlusswort: Warum Reggio-Pädagogik so bedeutsam ist
Anhang
Literaturverzeichnis
Weiterführende Literatur
Weitere Fachartikel
Videos
Filme im Internet
Podcast
Kontaktadressen
Einleitung
„Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
Reggio-Pädagogik ist der Name eines elementarpädagogischen Ansatzes, der in der norditalienischen Stadt Reggio1 Emilia für die Krippen und Kindergärten in kommunaler Trägerschaft entwickelt wurde. Auf dieser konzeptionellen Basis arbeiten ca. 30 Krippen und Kindergärten dieser Stadt. Unter dem gemeinsamen Dach eines Pädagogischen Zentrums entwickeln sie seit über 70 Jahren kontinuierlich eine eigenständige Elementarpädagogik, die nicht nur in Deutschland, sondern weltweit auf großes Interesse stößt.
Seit den 1980er-Jahren verbreitete sich die Reggio-Pädagogik weltweit. Wanderausstellungen, welche die pädagogische Arbeit dokumentieren, trugen entscheidend dazu bei, den Ansatz über Italien hinaus bekannt zu machen. Die erste Wanderausstellung mit dem Titel „Wenn das Auge über die Mauer springt“ wurde seit 1981 in vielen Städten gezeigt (Reggio Children 2012, S. 144f.). Ein Überblick über die weltweite Verbreitung der Reggio-Pädagogik findet sich auf der Homepage von Reggio Children.
In Deutschland sind zurzeit ca. 70 Einrichtungen als reggio-orientiert von Dialog Reggio, einem gemeinnützigen Verein zur Förderung der Reggio-Pädagogik, zertifiziert. Darüber hinaus haben viele Einrichtungen Elemente der Reggio-Pädagogik übernommen und arbeiten reggio-orientiert, ohne jedoch zertifiziert zu sein. Die Reggio-Pädagogik hat sich also als ein weiterer elementarpädagogischer Ansatz neben der Montessori-, Waldorf-, Fröbel- und Freinet-Pädagogik, dem Situationsansatz, dem offenen Kindergarten, dem Infans-Konzept, dem Early-Excellence-Konzept etc. etabliert.
Es gibt sicherlich viele Gründe, warum sich die Reggio-Pädagogik trotz der bereits vorhandenen elementarpädagogischen Ansätze weltweit Anerkennung verschaffen konnte. In der Regel beziehen sich die Begründungen auf besonders hervorstechende, sichtbare Elemente wie die Produkte der Kinder, das Atelier, die Atelerista, die Projektarbeit oder die Dokumentation. Diese Elemente sind jedoch nur der sichtbare Teil der Reggio-Pädagogik.
Reggio-orientiert pädagogisch zu arbeiten, bedeutet nicht, diesen sichtbaren Teil unreflektiert zu kopieren. Im Gegenteil: Die sichtbaren Elemente nur zu kopieren, zeigt nach Auffassung der Reggianer, dass ihr pädagogischer Ansatz nicht richtig verstanden worden ist. Vielmehr ist auf der Basis der theoretischen Grundlagen und der eigenen praktischen Erfahrungen die eigene pädagogische Praxis selbstständig zu entwickeln und kontinuierlich zu reflektieren. Die in diesem Buch beschriebene Praxis stellt also nur eine Möglichkeit dar, Erziehung und Bildung reggio-orientiert zu gestalten. Viele weitere Varianten sind denkbar.
Das Buch gliedert sich in zwei zentrale Teile: Die Darstellung der theoretischen Grundlagen und wesentlicher Elemente der pädagogischen Praxis. Das Gelingen einer reggio-orientierten Praxis setzt das Verstehen der theoretischen Grundlagen und insbesondere des Selbstverständnisses der Reggio-Pädagogik als eine Erziehungsphilosophie voraus. Daher reicht es nicht aus, nur den praktischen Teil zu lesen. Besonders hilfreich für das Verständnis der Reggio-Pädagogik ist es, immer wieder zu versuchen, Bezüge zwischen den einzelnen theoretischen Elementen sowie den theoretischen und praktischen Elementen herzustellen. Welche Bezüge ergeben sich z. B. zwischen dem Bild vom Kind und der Projektarbeit oder dem reggianischen Bildungsverständnis und der Einrichtung von Ateliers?
Ausführungen zur Geschichte und Übertragbarkeit der Reggio-Pädagogik ergänzen diese beiden Hauptaspekte und sollen zu einem vertieften Verständnis beitragen. Im Schlusswort reflektiere ich meine Auseinandersetzung mit der Reggio-Pädagogik und stelle dar, worin für mich die besondere Bedeutsamkeit der Reggio-Pädagogik liegt. Der abschließende Materialteil mit Hinweisen auf Literatur, Medien und Kontaktadressen soll die Möglichkeit eröffnen, sich vertiefend und detailliert mit der Reggio-Pädagogik auseinanderzusetzen.
Ich hoffe, die Gestaltung und der Inhalt des Buches motivieren Erzieher:innen, sich trotz des anstrengenden beruflichen Alltags und der Vielfalt elementarpädagogischer Ansätze mit der Reggio-Pädagogik zu beschäftigen. Lohn dieser Anstrengungen werden vielfältige Anregungen für die praktische Arbeit und neue pädagogische Impulse sein. Vor allem im Hinblick auf das Bild vom Kind, die Gestaltung der frühkindlichen Bildung, die Bedeutung der Beobachtung und Dokumentation sowie die Rolle der Erzieher:innen hat die Reggio-Pädagogik Positionen, die eine kritische Reflexion der aktuellen Praxis der frühkindlichen Erziehung und Bildung ermöglichen, entwickelt.
Der entscheidende und überzeugendste Grund, sich mit der Reggio-Pädagogik zu beschäftigen, ist letztlich in den Kindern selbst zu suchen. Die Reggianer haben nach meiner Auffassung einen pädagogischen Ansatz entwickelt, der den Kindern guttut und viele Möglichkeiten bietet, ihre Entwicklung konstruktiv zu fördern.
1 Im weiteren Verlauf des Textes bezieht sich der Begriff „Reggio“ auf die Stadt Reggio.
1Wie alles begann –
Eine kurze Geschichte der Reggio-Pädagogik
Loris Malaguzzi
Die Kenntnis der Entstehungsbedingungen eines pädagogischen Ansatzes führt oft zu einem tieferen Verständnis insgesamt und auch zur Klärung der inhaltlichen Bedeutung einzelner Elemente. Gleichzeitig eröffnen sich dadurch kritische Perspektiven. Die folgenden geschichtlichen Ausführungen verdeutlichen, warum sich Reggio-Pädagogik als experimentelle, sich ständig entwickelnde Pädagogik versteht.
Anfang des 20. Jahrhunderts gewannen Bürger:innen und Politiker:innen der Provinz Emilia-Romagna die Überzeugung, dass frühkindliche Erziehung und Bildung eine entscheidende Voraussetzung für eine humane Entwicklung der Gesellschaft ist. Bereits in den 1920er-Jahren forderten sie die Unterstützung der Familie durch die kostenlose Bereitstellung kommunaler Krippen und Kindergärten. Eine uns heute selbstverständliche, damals jedoch provozierende Forderung, da die katholische Kirche ausschließlicher Träger von Kindertageseinrichtungen war und ihre religiösen sowie gesellschaftspolitischen Zielsetzungen den gesamten Bereich der Kleinkinderziehung bestimmten. Es gab aber schon zu diesem Zeitpunkt in der Stadt Reggio Emilia vier nichtkonfessionelle Kindertageseinrichtungen. Sie waren die frühen Vorläufer der heutigen Reggio-Pädagogik.
Die Geschichte der Reggio-Pädagogik im engeren Sinne beginnt im April 1945 nach Kriegsende in Villa Cella, einem kleinen Dorf in der Nähe von Reggio Emilia, heute ein Vorort der Stadt. Bei der Beseitigung der Kriegstrümmer finden Männer und Frauen des Dorfes einen Panzer, den sie mehr oder weniger fachgerecht zerlegen, um die Einzelteile auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Über die Verwendung des Erlöses entscheidet ein Komitee, in dem sich in einer Abstimmung die Frauen durchsetzen. Ihre Idee: der Bau eines Kindergartens. Erziehung zu Humanität und Gewaltfreiheit ist ihrer Meinung nach die beste Antwort auf den gerade überstandenen Krieg. Der erste Volkskindergarten („asilo del popolo“), von Anfang an ein Zentrum für Kinder und Erwachsene, entsteht. Er wird kollektiv geleitet von den Männern und Frauen des Dorfes. Zwei Erzieherinnen arbeiten zunächst unentgeltlich. Alle Dorfbewohner:innen tragen durch die Abgabe von Naturalien zur Ernährung der Kinder bei. Intensiv wird die Frage diskutiert, wie eine Erziehung aussehen könnte, die zu einer friedlichen Zukunft beiträgt.
Ein Konzept, an dem man sich hätte orientieren können, gibt es nicht, nur die Bereitschaft der Eltern, in der Erziehung neue Wege zu gehen und sich mit pädagogischen Fragen auf der Basis unterschiedlicher Theorien intensiv auseinanderzusetzen. Ausgebildete Fachkräfte fehlen ebenfalls. Aus der Not entsteht eines der Prinzipien, das bis heute leitend für die Pädagogik der kommunalen Kindertagesstätten in Reggio ist: Einbeziehung aller für die Erziehung der Kinder relevanten Personen in die konzeptionelle Diskussion, Planung und Realisierung der alltäglichen Arbeit und der Projekte.
In der nahe gelegenen Stadt Reggio erfährt ein junger Lehrer von der Initiative der Frauen. Mit dem Fahrrad macht er sich auf den Weg. Begeistert von dem Engagement bietet er seine Mitarbeit an. Sein Name: Loris Malaguzzi. Von 1970 bis 1985 wird er Koordinator der kommunalen Krippen und Kindergärten in Reggio sein. Bis zu seinem Tod im Jahre 1994 hat er wesentlichen Anteil an der theoretischen Fundierung und weltweiten Verbreitung der Reggio-Pädagogik. Im Rückblick schreibt er:
„Die Frauen in Villa Cella wurden zu den eigentlichen Protagonisten einer neuen Erziehung für Kinder, die bisher nicht in den hohen Schriften der Pädagogik verzeichnet war, weil sie vor allem den Dialog und die Kommunikation in den Mittelpunkt stellte und zusammenfügen wollte, was sonst in den Kindergärten getrennt war, das Kind, seine Familie und seine Umgebung.“ (Malaguzzi zit. nach Dreier 2015, S. 19)
Malaguzzi arbeitete nach seiner Lehrerausbildung in den 1940er-Jahren zunächst an einer Grundschule und wechselte dann an eine Mittelschule, deren Leiter er später wurde. 1951 verlässt er den Schuldienst, weil er das Gefühl hat, seine Ideen von Unterricht und Bildung nicht angemessen verwirklichen zu können, und geht in die Erwachsenenbildung. Nach Schließung der Einrichtung und der Absolvierung eines Psychologiekurses an der Universität Rom gründet er in Reggio ein Zentrum für behinderte Kinder, das dritte in Italien. 1963 nimmt er beratend an der Konzeptentwicklung und Einrichtung der ersten kommunalen Kindertageseinrichtung Robinson Crusoe teil.
Im Jahr darauf wird eine zweite kommunale Tagesstätte eingerichtet, obwohl die gesetzliche Grundlage dafür immer noch fehlt. Erst vier Jahre später, im Jahre 1968, erlässt die Regierung das Gesetz Nummer 444, das die kommunale Trägerschaft von Tageseinrichtungen für Kinder rechtlich absichert. Im gleichen Jahr findet, angeregt und organisiert von Malaguzzi, der erste Kongress nichtreligiöser Kindertageseinrichtungen in Bologna statt.
Das Jahr 1970 ist für die Entwicklung des Reggio-Konzepts von besonderer Bedeutung. Die Kommune richtet eine Koordinations- und Beratungsstelle für Kindertageseinrichtungen ein, deren Leiter Malaguzzi wird. Er initiiert die Einstellung von Künstler:innen sowie eines hauptamtlichen Puppenspielers. Die Koordinierungsstelle mit hauptamtlichen Pädagog:innen und Psycholog:innen wird zum Motor der konzeptionellen Entwicklung der Reggio-Pädagogik.
Mit der Verabschiedung des Gesetzes Nummer 1044 ermöglicht der italienische Staat ab 1971 auch die Einrichtung kommunaler Kinderkrippen. Die Stadt Reggio ist eine der ersten, die von dieser Möglichkeit Gebrauch macht. Von nun an richtet sich die Entwicklungsarbeit auf den gesamten Bereich der öffentlichen vorschulischen Kleinkinderziehung. Ebenfalls im Jahre 1971 findet in Reggio der erste Kongress statt, auf dem der bis dahin erreichte Stand der Theorie- und Praxisentwicklung zur Diskussion gestellt wird. 1972 folgt ein zweiter, an dem sich die Kommune finanziell nicht beteiligt, sondern lediglich einen Saal für die erwarteten 250 Teilnehmer:innen zur Verfügung stellt. Als mehr als 900 Interessierte anreisen, muss man in das Stadttheater umziehen.
In den folgenden Jahren nutzen die Reggianer immer wieder selbst organisierte Fachtagungen und Ausstellungen, um ihr Konzept einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen und sich mit Wissenschaftler:innen und Erzieher:innen weltweit darüber auszutauschen. Aufgrund dieser Bemühungen stößt die Reggio-Pädagogik im Ausland zunehmend auf große Anerkennung. In Italien selbst ist die Resonanz eher verhalten. Nicht selten müssen sich die Reggianer gegen Angriffe aus konservativen Kreisen verteidigen. 1976 strahlt der Rundfunk eine sechsteilige Vortragsreihe aus, in der das Konzept massiv kritisiert wird.
1985 übernimmt Carla Rinaldi die Leitung des Pädagogischen Zentrums, nachdem Malaguzzi in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist. Der Ausbau des Reggio-Konzepts wird systematisch vorangetrieben. 1991 erfolgt dann eine erste, für alle sichtbare internationale Würdigung der Entwicklungsarbeit. Die amerikanische Zeitschrift „Newsweek“, vergleichbar dem deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, zeichnet die Kindertagesstätten der Stadt Reggio als weltbeste Einrichtungen aus. 1996 reagiert die italienische Regierung auf das inzwischen weltweite Ansehen des Konzepts. Das Erziehungsministerium beschließt, ein nationales Forschungs- und Dokumentationszentrum zur Reggio-Pädagogik aufzubauen. 2006 wird das Loris Malaguzzi International Centre in Reggio eröffnet. In diesem Zentrum finden jährlich viele Tagungen statt und werden aktuelle Projekte der Kindertagesstätten präsentiert. Zudem ist dort die Dauerausstellung „One city, many children“, in der die Geschichte der Reggio-Pädagogik präsentiert wird, zu sehen.
Was 1945 als Initiative einer kleinen Dorfgemeinschaft begonnen hat, ist zu einem elementarpädagogischen Ansatz, der national und international hohes Ansehen genießt, herangereift.
Zeittafel zur Reggio-Pädagogik
1945
Gründung selbstverwalteter Kindertagesstätten in der Stadt Reggio
1962
Einige selbstverwaltete Kindertagesstätten stellen einen Antrag auf Kommunalisierung
1963
Die erste kommunale Kindertagesstätte wird eröffnet
(Robinson Crusoe)
1964
Die zweite kommunale Kindertagesstätte wird eröffnet
(Anna Frank)
1966
Internationale Konferenz zur Reggio-Pädagogik
1967
Übernahme der Trägerschaft der selbstverwalteten Kindertagesstätten durch die Stadt Reggio
1968
Verabschiedung des Gesetzes 444 (Absicherung staatlicher und kommunaler Trägerschaft vorschulischer Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren)
1970
Gründung der kommunalen Koordinations- und Beratungsstelle
1970
Loris Malaguzzi wird offizieller Koordinator der kommunalen Kindertagesstätten
1970
Kunsterzieher:innen werden in den Kindertagesstätten eingestellt
1970
Puppenspieler:innen führen Workshops mit den Erzieher:innen durch
1971
Verabschiedung des Gesetzes 1044 (Errichtung und Finanzierung kommunaler Krippen)
1971
Die erste kommunale Krippe wird eröffnet
1971
Erster Kongress zur Reggio-Pädagogik in Reggio
1972
Gianni Rodari führt Workshops zur Fantasieförderung durch
1972
Zweiter Kongress zur Reggio-Pädagogik in Reggio
1976
Die Reggio-Pädagogik wird in einer 6-tägigen Rundfunkvortragsreihe scharf kritisiert
Ab 1979
Die Reggio-Pädagogik wird international zunehmend beachtet
1981
Konzeption der Wanderausstellung „Hundert Sprachen hat das Kind“
1985





























