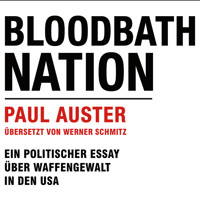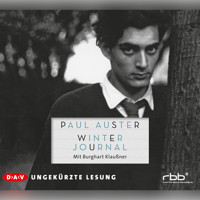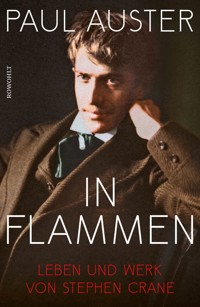7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem verschlossenen, abgedunkelten Zimmer sitzt ein alter Mann: vergesslich, gebrechlich, inkontinent. Er weiß weder, wer er ist, noch wo er ist. Eine Kamera und Mikrophone beobachten ihn. Auf seinem Nachttisch stehen Fotos von Menschen, die ihm bekannt vorkommen. Je verzweifelter er sich zu besinnen versucht, desto tiefer gerät er in ein Labyrinth erdachter Welten, bis er sich schließlich in den Zeilen eines Manuskripts selbst begegnet. «Eine Geschichte […] von metaphysischer Kargheit, zu der ihn zweifellos sein Vorbild Samuel Beckett inspiriert hat.» Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Paul Auster
Reisen im Skriptorium
Roman
Über dieses Buch
Paul Auster wurde 1947 in Newark, New Jersey, geboren. Er studierte Anglistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University New York und verbrachte einige Jahre in Paris. Heute lebt Auster in Brooklyn. Er ist mit der Schriftstellerin Siri Hustvedt verheiratet und hat zwei Kinder. Austers Romane, Essays, Gedichte und Drehbücher liegen sämtlich in der Reihe der rororo-Taschenbücher vor.
Weitere Veröffentlichungen:
Mein New York
Von der Hand in den Mund
Nacht des Orakels
Mr. Vertigo
Im Land der letzten Dinge
Die Brooklyn-Revue
Die Musik des Zufalls
Mond über Manhattan
Das Buch der Illusionen
Auggie Wrens Weihnachtsgeschichte
Timbuktu
Das rote Notizbuch
Die Erfindung der Einsamkeit
Die New-York-Trilogie
Leviathan
Mann im Dunkel
Vita
In einem verschlossenen, abgedunkelten Zimmer sitzt ein alter Mann: vergesslich, gebrechlich, inkontinent. Er weiß weder, wer er ist, noch wo er ist. Eine Kamera und Mikrophone beobachten ihn. Auf seinem Nachttisch stehen Fotos von Menschen, die ihm bekannt vorkommen. Je verzweifelter er sich zu besinnen versucht, desto tiefer gerät er in ein Labyrinth erdachter Welten, bis er sich schließlich in den Zeilen eines Manuskripts selbst begegnet.
«Reisen im Skriptorium» ist ein raffiniertes Vexierspiel, finten- und voltenreich, brillant und kunstvoll. Paul Auster lädt ein auf eine Reise in die Phantasie.
«Auster ist jemand, der sich nicht davon abbringen lässt, dem Dunkeln und Abgründigen nachzuspüren, das sich in Schönheit und Harmonie versteckt.» (Die Welt)
«Eine Geschichte […] von metaphysischer Kargheit, zu der ihn zweifellos sein Vorbild Samuel Beckett inspiriert hat.» (Süddeutsche Zeitung)
«Geschichten erfinden, verwerfen, zuspitzen, Geschichten erzählen, das kann Paul Auster.» (Neue Zürcher Zeitung)
Für Lloyd Hustvedt
(zum Gedenken)
Der alte Mann sitzt auf der Kante des schmalen Betts, die Hände gespreizt auf den Knien, den Kopf gesenkt, und starrt den Fußboden an. Er hat keine Ahnung, dass unmittelbar über ihm in der Decke eine Kamera eingebaut ist. Der Verschluss klickt lautlos einmal pro Sekunde, sodass mit jeder Umdrehung der Erde sechsundachtzigtausendvierhundert Fotos gemacht werden. Wüsste er, dass er beobachtet wird, würde das auch nichts ändern. Seine Gedanken sind woanders, gestrandet bei den Chimären in seinem Kopf, während er eine Antwort auf die Frage sucht, die ihn nicht mehr loslässt.
Wer ist er? Was tut er hier? Wann ist er angekommen, und wie lange wird er bleiben? Mit etwas Glück wird die Zeit es uns allen weisen. Fürs Erste haben wir nur die Aufgabe, die Bilder möglichst aufmerksam zu betrachten und uns jedweder voreiligen Schlussfolgerung zu enthalten.
In dem Raum befindet sich eine Reihe von Gegenständen, und an jedem ist ein Stück weißes Klebeband befestigt, auf das in Blockbuchstaben ein einzelnes Wort geschrieben ist. Am Nachttisch steht zum Beispiel das Wort TISCH. An der Lampe das Wort LAMPE. Sogar an der Wand, die strenggenommen kein Gegenstand ist, klebt ein Streifen mit der Aufschrift WAND. Der alte Mann blickt kurz auf, sieht den Klebstreifen an der Wand und spricht mit leiser Stimme das Wort Wand. Zu diesem Zeitpunkt kann man nicht wissen, ob er das Wort von dem Klebstreifen abliest oder einfach die Wand selbst meint. Es könnte sein, dass er das Lesen verlernt hat, aber Dinge noch als das erkennt, was sie sind, und sie bei ihrem Namen nennen kann, oder aber umgekehrt, dass er die Fähigkeit verloren hat, Dinge als das zu erkennen, was sie sind, aber noch lesen kann.
Er trägt einen blau-gelb gestreiften Baumwollpyjama, seine Füße stecken in schwarzen Lederpantoffeln. Ihm ist nicht ganz klar, wo er sich befindet. In dem Raum, ja, aber in welchem Gebäude liegt der Raum? In einem Haus? In einer Klinik? In einem Gefängnis? Er kann sich nicht erinnern, seit wann er hier ist und was für Umstände seine Verlegung an diesen Ort herbeigeführt haben. Vielleicht war er schon immer hier; vielleicht lebt er hier schon seit dem Tag seiner Geburt. Er weiß nur, sein Herz ist von einem unerbittlichen Schuldgefühl erfüllt. Zugleich kann er sich des Eindrucks nicht erwehren, Opfer einer furchtbaren Ungerechtigkeit zu sein.
Der Raum hat ein Fenster, aber die Jalousie ist zugezogen, und soweit er sich erinnern kann, hat er noch nicht hinausgesehen. Das Gleiche gilt für die Tür und ihren weißen Porzellanknauf. Ist er eingeschlossen, oder kann er kommen und gehen, wie er will? Diese Frage muss er erst noch untersuchen – denn wie oben im ersten Absatz festgestellt, sind seine Gedanken woanders, treiben in der Vergangenheit, wandern unter den Phantomen umher, die sich in seinem Kopf drängen, immer auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, die ihn nicht loslässt.
Die Bilder lügen nicht, erzählen aber auch nicht die ganze Geschichte. Sie protokollieren lediglich das Vergehen der Zeit, bilden nur das Äußere ab. Das Alter des Mannes zum Beispiel lässt sich anhand der leicht unscharfen Schwarzweißbilder kaum bestimmen. Die einzige einigermaßen sichere Aussage ist die, dass er nicht jung ist, aber das Wort alt ist ein dehnbarer Begriff und kann für jeden zwischen sechzig und hundert gelten. Wir wollen daher nicht mehr von einem alten Mann sprechen und die Person in dem Raum künftig als Mr. Blank bezeichnen. Ein Vorname wird fürs Erste nicht nötig sein.
Schließlich steht Mr. Blank von dem Bett auf, hält kurz inne, um sein Gleichgewicht zu finden, und schlurft dann zu dem Schreibtisch am anderen Ende des Raums. Er ist müde, als sei er gerade aus zu kurzem, unruhigem Schlaf erwacht, und als die Sohlen seiner Pantoffeln über den nackten Holzboden schaben, erinnert ihn dieses Geräusch an Schmirgelpapier. Aus weiter Ferne, von jenseits des Raums, von jenseits des Gebäudes, in dem der Raum sich befindet, hört er den undeutlichen Schrei eines Vogels – einer Krähe vielleicht, einer Möwe vielleicht, er kann es nicht sagen.
Mr. Blank lässt sich auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch nieder. Es ist ein außerordentlich bequemer Stuhl, befindet er; weiches braunes Leder und breite Armlehnen, die reichlich Platz für seine Ellbogen und Unterarme bieten, ganz zu schweigen von einem unsichtbaren Federmechanismus, der ihm erlaubt, nach Belieben vor und zurück zu schaukeln, und genau damit fängt er an, sobald er sich hingesetzt hat. Das Schaukeln wirkt beruhigend auf ihn, und während Mr. Blank sich dem angenehmen Schwingen hingibt, kommen ihm Erinnerungen an das Schaukelpferd in seinem Zimmer, als er ein kleiner Junge war, und von neuem durchlebt er einige der Phantasiereisen, die er auf diesem Pferd zu unternehmen pflegte, dessen Name Whitey war und das für den jungen Mr. Blank kein weiß angemaltes Stück Holz, sondern ein Lebewesen, ein echtes Pferd gewesen war.
Nach diesem kurzen Ausflug in seine frühe Kindheit steigt ihm wieder die Angst in die Kehle. Mit matter Stimme spricht er vor sich hin: Ich darf das nicht geschehen lassen. Dann beugt er sich vor, um die Papiere und Fotografien zu untersuchen, die in ordentlichen Stapeln auf der Mahagoniplatte des Schreibtischs liegen. Als Erstes nimmt er die Bilder, drei Dutzend zwanzig mal fünfundzwanzig Zentimeter große Schwarzweißporträts von Männern und Frauen verschiedener Hautfarben und Lebensalter. Das oberste Foto zeigt eine junge Frau Anfang zwanzig. Ihr dunkles Haar ist kurzgeschoren, und in ihren Augen, die starr in die Kamera blicken, liegt ein gespannter, gequälter Ausdruck. Sie steht auf der Straße, in irgendeiner Stadt, vielleicht in Italien oder Frankreich, denn hinter ihr sieht man eine mittelalterliche Kirche, und da die Frau mit Schal und Wollmantel bekleidet ist, darf man annehmen, dass das Bild im Winter aufgenommen wurde. Mr. Blank sieht der jungen Frau angestrengt in die Augen und versucht sich zu erinnern, wer sie ist. Nach etwa zwanzig Sekunden hört er sich ein einziges Wort flüstern: Anna. Eine Aufwallung überwältigender Liebe durchflutet ihn. Er fragt sich, ob er nicht einst mit Anna verheiratet war oder ob er nicht vielleicht ein Bildnis seiner Tochter betrachtet. Kaum hat er das gedacht, attackiert ihn eine erneute Woge von Schuldgefühlen, und er weiß, Anna ist tot. Schlimmer noch, er vermutet, dass er für ihren Tod verantwortlich ist. Es könnte sogar sein, sagt er sich, dass er sie umgebracht hat.
Mr. Blank stöhnt gepeinigt auf. Der Anblick der Bilder ist zu viel für ihn, also schiebt er sie beiseite und wendet sich den Papieren zu. Es sind insgesamt vier Stapel, jeder etwa fünfzehn Zentimeter hoch. Ohne dass er sich eines besonderen Grundes dafür bewusst wäre, greift er nach dem obersten Blatt des am weitesten links von ihm liegenden Stapels. Der mit der Hand, in Blockbuchstaben ähnlich denen auf den weißen Klebstreifen, geschriebene Text lautet:
Aus den fernsten Weiten des Weltraums betrachtet, ist die Erde nicht größer als ein Staubkorn. Bedenke das, wenn du das nächste Mal das Wort «Menschheit» schreibst.
Aus dem angewiderten Ausdruck, der ihm beim Überfliegen dieser Sätze ins Gesicht tritt, können wir mit einiger Sicherheit schließen, dass Mr. Blank die Fähigkeit zu lesen nicht verloren hat. Wer jedoch der Autor dieser Sätze sein könnte, muss vorläufig offenbleiben.
Mr. Blank greift nach dem nächsten Blatt auf dem Stapel und erkennt, dass es sich um ein getipptes Manuskript handelt. Der erste Absatz lautet:
Sobald ich anfing, meine Geschichte zu erzählen, schlugen sie mich nieder und traten mir an den Kopf. Als ich aufgestanden war und aufs Neue zu sprechen anhob, schlug mir einer von ihnen auf den Mund, und ein anderer verpasste mir einen Hieb in den Magen. Ich brach zusammen. Wieder gelang es mir aufzustehen, aber gerade als ich zum dritten Mal mit der Geschichte anfangen wollte, schleuderte mich der Colonel an die Wand, und ich verlor das Bewusstsein.
Auf dem Blatt folgen noch zwei weitere Absätze, doch ehe Mr. Blank den zweiten lesen kann, läutet das Telefon. Es ist ein schwarzes Modell mit Wählscheibe aus den späten vierziger oder frühen fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, und da es auf dem Nachttisch steht, ist Mr. Blank gezwungen, sich von dem weichen Lederstuhl zu erheben und durch den ganzen Raum zu schlurfen. Beim vierten Klingeln nimmt er den Hörer ab.
Hallo, sagt Mr. Blank.
Mr. Blank?, fragt die Stimme am anderen Ende.
Wenn Sie das sagen.
Wissen Sie das genau? Ich kann nichts riskieren.
Ich weiß überhaupt nichts genau. Wenn Sie mich Mr. Blank nennen wollen, will ich gern auf diesen Namen hören. Mit wem spreche ich?
James.
Ich kenne keinen James.
James P. Flood.
Helfen Sie meinem Gedächtnis auf die Sprünge.
Ich war gestern bei Ihnen zu Besuch. Wir haben zwei Stunden miteinander verbracht.
Ah. Der Polizist.
Expolizist.
Richtig. Der Expolizist. Was kann ich für Sie tun?
Ich möchte Sie wiedersehen.
Hat das eine Gespräch nicht gereicht?
Nicht ganz. Ich weiß, ich spiele in dieser Angelegenheit nur eine Nebenrolle, aber man hat mir gesagt, ich dürfe Sie zweimal sehen.
Das heißt, ich habe gar keine Wahl.
So sieht es aus, leider. Aber wir brauchen nicht in dem Raum zu reden, wenn Sie nicht wollen. Wir können nach draußen gehen und uns in den Park setzen, wenn Ihnen das lieber ist.
Ich habe nichts anzuziehen. Ich stehe hier in Schlafanzug und Pantoffeln.
Schauen Sie in den Schrank. Da sind alle Kleider, die Sie brauchen.
Ah. Der Schrank. Danke.
Haben Sie schon gefrühstückt, Mr. Blank?
Ich glaube nicht. Darf ich denn essen?
Drei Mahlzeiten am Tag. Es ist noch ein wenig früh, aber Anna müsste bald kommen.
Anna? Haben Sie Anna gesagt?
Das ist die Person, die sich um Sie kümmert.
Ich dachte, sie sei tot.
Wohl kaum.
Vielleicht meine ich eine andere Anna.
Das bezweifle ich. Von allen, die an dieser Geschichte beteiligt sind, ist sie die Einzige, die ganz auf Ihrer Seite ist.
Und die anderen?
Sagen wir so: Es herrscht große Verärgerung, und dabei wollen wir es belassen.
Es sollte bemerkt werden, dass zusätzlich zu der Kamera in eine der Wände ein Mikrophon eingebaut ist; jeder Ton, den Mr. Blank von sich gibt, wird von einem hochempfindlichen Digitalrecorder aufgezeichnet. Das leiseste Stöhnen oder Schniefen, jedes Hüsteln, jeder noch so flüchtige Furz, alle diese Geräusche sind daher ebenfalls wesentliche Bestandteile unseres Berichts. Selbstverständlich gehören zu diesen akustischen Daten auch die von Mr. Blank verschiedentlich gemurmelten, gesprochenen oder geschrienen Worte, wie zum Beispiel das oben wiedergegebene Telefonat mit James P. Flood. Das Gespräch endet damit, dass Mr. Blank widerstrebend der Forderung des Expolizisten nachgibt, ihm im Lauf des Vormittags einen Besuch abstatten zu dürfen. Nachdem Mr. Blank den Hörer aufgelegt hat, setzt er sich auf die Kante des schmalen Betts und nimmt eine mit der im ersten Satz dieses Berichts beschriebenen identische Haltung ein: die Hände gespreizt auf den Knien, den Kopf gesenkt, starrt er den Fußboden an. Er überlegt, ob er wieder aufstehen und nach dem Schrank suchen soll, auf den Flood hingewiesen hat, und ob er, falls dieser Schrank existiert, den Schlafanzug aus- und etwas anderes anziehen soll, vorausgesetzt, es befinden sich tatsächlich Kleider in dem Schrank – falls dieser Schrank überhaupt existiert. Aber Mr. Blank hat es nicht eilig, sich mit solch profanen Dingen zu befassen. Er möchte zu dem Typoskript zurück, das er zu lesen angefangen hat, bevor er vom Telefon unterbrochen wurde. Also steht er vom Bett auf, doch als er zögernd einen ersten Schritt in Richtung Schreibtisch setzt, befällt ihn ein jäher Schwindel. Er spürt, dass er zu Boden stürzen wird, wenn er noch länger stehen bleibt, aber statt zum Bett zurückzukehren und sich hinzusetzen, bis der Anfall vorüber ist, legt er die rechte Hand an die Wand, stützt sich mit seinem ganzen Gewicht daran ab und lässt sich langsam auf die Knie sinken. Von dort wirft Mr. Blank sich nach vorn und landet auf den Handflächen. Ob ihm schwindlig ist oder nicht, er ist so fest entschlossen, den Schreibtisch zu erreichen, dass er auf allen vieren dort hinkriecht.
Als es ihm gelungen ist, auf den Ledersessel zu klettern, schaukelt er erst einmal ein wenig, um seine Nerven zu beruhigen. Trotz seiner körperlichen Anstrengungen begreift er, dass er Angst hat, das Typoskript weiterzulesen. Warum ihn diese Angst ergriffen hat, kann er sich nicht erklären. Es sind doch nur Worte, sagt er sich, und seit wann haben Worte die Macht, einen Mann halb zu Tode zu ängstigen? Es geht nicht, murmelt er kaum hörbar. Dann, um sich aufzumuntern, wiederholt er diesen Satz, schreit ihn aus Leibeskräften: ES GEHT NICHT!
Unerklärlicherweise gibt ihm dieser plötzliche Ausbruch den Mut weiterzumachen. Er holt tief Luft, richtet seine Augen auf die Worte vor ihm und liest die folgenden zwei Absätze:
Man hielt mich von Anfang an in diesem Raum gefangen. Soweit ich das erkennen kann, ist es keine typische Zelle und scheint weder zu dem abgezäunten Militärbereich noch zu der territorialen Strafanstalt zu gehören. Es ist ein kleines, karges Gemach von etwa dreieinhalb mal viereinhalb Metern, und aus der Schlichtheit seiner Konstruktion (Lehmboden, dicke gemauerte Wände) schließe ich, dass es früher als Lagerraum für Lebensmittelvorräte gedient hat, vielleicht für Mehl- und Getreidesäcke. Oben an der nach Westen gelegenen Wand gibt es ein einzelnes vergittertes Fenster, aber es ist so weit vom Boden entfernt, dass ich nicht mit den Händen heranreichen kann. Ich schlafe auf einer Strohmatte in einer Ecke, und täglich werden mir zwei Mahlzeiten gebracht: morgens kalter Haferbrei, abends lauwarme Suppe und hartes Brot. Nach meinen Berechnungen bin ich seit siebenundvierzig Nächten hier. Diese Zählung könnte jedoch falsch sein. An den ersten Tagen in der Zelle wurde ich viele Male geschlagen, und da ich mich nicht erinnern kann, wie oft ich das Bewusstsein verloren habe – und wie lange diese Ohnmachten anhielten –, kann es sein, dass ich mich verzählt und nicht genau mitbekommen habe, wann die eine Sonne auf- oder die andere untergegangen ist.
Die Wüste beginnt unmittelbar vor meinem Fenster. Immer wenn der Wind aus Westen weht, rieche ich Salbei und Wacholder, die Minima dieser dürren Weiten. Ich habe da draußen ganz allein fast vier Monate lang gelebt, die Gegend von einem Ort zum anderen durchstreift, bei jedem Wetter im Freien geschlafen, und es ist mir nicht leichtgefallen, aus der Offenheit jenes Landes in die engen Grenzen dieses Raumes zurückzukehren. Erzwungene Einsamkeit und den Mangel an Unterhaltung und menschlichem Kontakt kann ich ertragen, aber ich verzehre mich danach, wieder Luft und Licht um mich zu haben, und hege tagein, tagaus nur den Wunsch, etwas anderes sehen zu können als diese schartigen Mauern. Ab und zu gehen unter meinem Fenster Soldaten vorbei. Ich höre das Knirschen ihrer Stiefel auf dem Boden, das unregelmäßige Lautwerden ihrer Stimmen, den Lärm von Karren und Pferden in der Hitze des unerreichbaren Tags. Das hier ist die Garnison bei Ultima: äußerster Westzipfel der Konföderation, am Rand der bekannten Welt. Wir befinden uns hier mehr als dreitausend Kilometer von der Hauptstadt entfernt, vor uns die unvermessenen Horizonte des Fremden Territoriums. Nach dem Gesetz darf niemand dort hinausgehen. Ich habe es getan, weil ich den Befehl dazu hatte, und jetzt bin ich zurück, um meinen Bericht abzuliefern. Man wird mich anhören oder auch nicht, und dann wird man mich nach draußen bringen und erschießen. Dessen bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Es ist wichtig, dass ich mir nichts vormache und der Versuchung widerstehe, Hoffnung aufkeimen zu lassen. Wenn sie mich an die Wand stellen und ihre Gewehre auf meinen Körper richten, werde ich sie nur darum bitten, mir die Augenbinde abzunehmen. Nicht dass ich ein Interesse daran hätte, die Männer zu sehen, die mich töten werden, aber ich möchte noch einmal den Himmel sehen können. Das ist jetzt mein einziger Wunsch. Im Freien zu stehen und in den unermesslichen blauen Himmel über mir zu blicken, ein letztes Mal in die brüllende Unendlichkeit zu schauen.
Mr. Blank hört auf zu lesen. An die Stelle seiner Angst ist Verwirrung getreten, und obwohl er jedes Wort des Textes versteht, hat er keine Ahnung, was er daraus machen soll. Ist das ein Tatsachenbericht, fragt er sich, und was genau ist die Konföderation mit ihrer Garnison bei Ultima und den rätselhaften Fremden Territorien, und warum klingt diese Prosa, als stamme sie aus dem neunzehnten Jahrhundert? Mr. Blank ist sich durchaus bewusst, dass sein Kopf nicht arbeitet wie gewohnt, dass er über seinen Aufenthaltsort und den Grund seines Hierseins völlig im Dunkeln tappt, hält es aber für einigermaßen ausgemacht, dass der gegenwärtige Augenblick irgendwo am Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts liegt und dass er selbst in einem Land lebt, das Vereinigte Staaten von Amerika heißt. Dieser letzte Gedanke erinnert ihn an das Fenster oder, genauer gesagt, an die Jalousie davor, an der ein weißer Klebstreifen mit dem Wort JALOUSIE befestigt ist. Die Fußsohlen auf den Boden und die Arme auf die Lehnen des Ledersessels gepresst, schwenkt er um neunzig bis hundert Grad nach rechts, um einen Blick auf besagte Jalousie zu werfen – denn der Stuhl bietet nicht nur die Möglichkeit, auf ihm zu schaukeln, sondern lässt sich auch um seine senkrechte Achse drehen. Diese Entdeckung erfreut Mr. Blank so sehr, dass er vorübergehend vergisst, warum er sich die Jalousie ansehen wollte, und stattdessen in dieser bisher unbekannten Eigenschaft des Sessels schwelgt. Er dreht sich einmal im Kreis, zweimal, dreimal, und erinnert sich dabei daran, wie er als Junge beim Friseur auf dem Stuhl gesessen hat und wie Rocco, der Friseur, ihn vor und nach dem Haareschneiden auf ähnliche Weise im Kreis herumgedreht hat. Als Mr. Blank wieder zur Ruhe kommt, befindet sich der Stuhl mehr oder weniger in der gleichen Position wie zu Beginn seines Kreisens, das heißt also, er blickt wieder in Richtung der Jalousie vor dem Fenster, und wieder fragt er sich, nach diesem angenehmen Zwischenspiel, ob er nicht zum Fenster gehen, die Jalousie hochziehen und einen Blick nach draußen werfen sollte, um zu sehen, wo er sich befindet. Vielleicht ist er gar nicht mehr in Amerika, sagt er sich, sondern in einem anderen Land, in finsterer Nacht von Geheimagenten entführt, die für irgendeine ausländische Macht arbeiten.
Nach den drei Umdrehungen auf dem Stuhl ist ihm jedoch ein wenig schwindlig, und da er eine Wiederholung der Episode fürchtet, die ihn vor wenigen Minuten gezwungen hat, auf allen vieren durch den Raum zu kriechen, traut er sich nicht so recht von der Stelle. Mr. Blank ist sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass der Stuhl nicht nur vor- und zurückgeschaukelt und im Kreis gedreht werden kann, sondern auch noch mit vier Rollen ausgestattet ist, die es ihm ermöglichen würden, zu der Jalousie zu gelangen, ohne aufstehen zu müssen. Da er also nicht ahnt, dass ihm außer seinen Beinen noch andere Fortbewegungsmittel zur Verfügung stehen, bleibt Mr. Blank, wo er ist: bleibt auf dem Stuhl mit dem Rücken zum Schreibtisch, betrachtet die einst weiße, jetzt aber vergilbte Jalousie und versucht sich an sein Gespräch mit dem Expolizisten James P. Flood vom vorigen Nachmittag zu erinnern. Er tastet in seinem Gedächtnis nach einem Bild, nach irgendeinem Hinweis darauf, wie dieser Mann aussieht, doch statt irgendwelche deutlichen Bilder heraufzubeschwören, wird er wieder einmal von einer lähmenden Woge von Schuldgefühlen überwältigt. Bevor sich diese erneute Attacke von Qualen und Schrecken jedoch zu einer ausgewachsenen Panik ausweiten kann, vernimmt Mr. Blank ein Klopfen an der Tür und dann das Geräusch eines Schlüssels, der ins Schloss eingeführt wird. Bedeutet das, dass Mr. Blank in diesem Raum gefangen gehalten wird und, wenn er gehen will, auf die Gnade und das Wohlwollen anderer angewiesen ist? Nicht unbedingt. Es könnte sein, dass Mr. Blank die Tür von innen abgeschlossen hat und dass die Person, die jetzt den Raum zu betreten versucht, das Schloss aufmachen muss, um über die Schwelle zu kommen, und damit Mr. Blank die Mühe erspart, aufzustehen und die Tür selbst zu öffnen.
Wie auch immer, die Tür geht auf, und eine kleine Frau undefinierbaren Alters tritt ein – fünfundvierzig bis sechzig Jahre alt, denkt Mr. Blank, aber auch diese grobe Schätzung könnte falsch sein. Ihr graues Haar ist kurzgeschnitten, sie trägt eine dunkelblaue Hose und eine hellblaue Baumwollbluse, und sobald sie den Raum betreten hat, wirft sie Mr. Blank ein Lächeln zu. Dieses Lächeln, das Sanftheit und Freundlichkeit zu vereinen scheint, bannt seine Ängste und versetzt ihn in einen Zustand gefasster Ruhe. Er hat keine Ahnung, wer sie ist, ist aber dennoch froh, sie zu sehen.
Haben Sie gut geschlafen?, fragt die Frau.
Ich bin mir nicht sicher, antwortet Mr. Blank. Um ganz ehrlich zu sein, ich kann mich nicht erinnern, ob ich geschlafen habe oder nicht.
Das ist gut. Das heißt, die Behandlung wirkt.
Statt diese rätselhafte Äußerung zu kommentieren, sieht Mr. Blank die Frau schweigend an und fragt schließlich: Verzeihen Sie meine Dummheit, aber Sie heißen nicht zufällig Anna?
Wieder lächelt die Frau ihn sanft und freundlich an. Es freut mich, dass Sie meinen Namen behalten haben. Gestern ist er ihnen ständig entfallen.