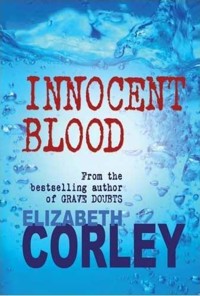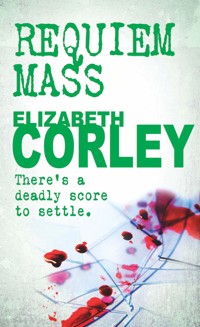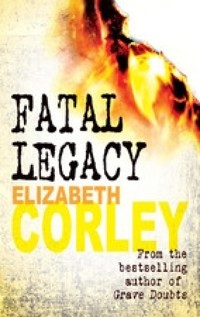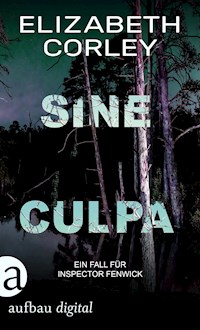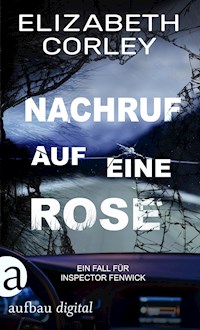12,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspector Fenwick Doppelband
- Sprache: Deutsch
Zwei Fälle für Inspector Fenwick.
Requiem für eine Sängerin.
Deborah Fearnside ist verschwunden. Dass ihr etwas zugestoßen sein könnte, vermutet nicht nur ihr Ehemann, sondern auch Chief Inspector Andrew Fenwick. Sein Verdacht steigt, als auch noch die Lehrerin Kate Johnstone brutal ermordet und die zweifache Mutter Leslie Smith bei einem Autounfall mit Fahrerflucht lebensgefährlich verletzt wird. Denn Deborah, Kate und Leslie waren einst Klassenkameradinnen und gehörten in ihrer Schulzeit zu einer berühmt-berüchtigten Mädchen-Clique. Eine von ihnen, die Sängerin Carol, starb bereits mit 17 Jahren unter mysteriösen Umständen. Jetzt ist von den Schulfreundinnen nur noch Octavia Anderson übrig, inzwischen eine berühmte Sopranistin. Fenwick ist sich sicher: Sie weiß, wer der gnadenlose Killer ist und warum er sich ausgerechnet Octavia für das Finale seiner Mordserie aufgehoben hat. Doch so sehr Fenwick auch nachfragt, Octavia verrät nichts. Aber welches Geheimnis ist so grausam, dass man selbst Jahrzehnte später nicht darüber sprechen kann?
Nachruf auf eine Rose.
Hat sich der einflussreiche Firmenboss Alan Wainwright wirklich selbst umgebracht? Sein Sohn Graham zweifelt daran, nachdem er plötzlich nur noch die Hälfte des Vermögens erben soll. Er wendet sich an die Polizei und wieder einmal steht Inspektor Fenwick vor einer großen Herausforderung. Die neue Haupterbin Sally Wainwrigth benimmt sich äußerst merkwürdig - aber das alleine beweist noch nicht ihre Schuld. Fenwick ermittelt - und stößt auf unvorstellbare Abgründe ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1287
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Informationen zum Buch
Zwei Fälle für Inspector Fenwick!
Requiem für eine Sängerin.
Deborah Fearnside ist verschwunden. Dass ihr etwas zugestoßen sein könnte, vermutet nicht nur ihr Ehemann, sondern auch Chief Inspector Andrew Fenwick. Sein Verdacht steigt, als auch noch die Lehrerin Kate Johnstone brutal ermordet und die zweifache Mutter Leslie Smith bei einem Autounfall mit Fahrerflucht lebensgefährlich verletzt wird. Denn Deborah, Kate und Leslie waren einst Klassenkameradinnen und gehörten in ihrer Schulzeit zu einer berühmt-berüchtigten Mädchen-Clique. Eine von ihnen, die Sängerin Carol, starb bereits mit 17 Jahren unter mysteriösen Umständen. Jetzt ist von den Schulfreundinnen nur noch Octavia Anderson übrig, inzwischen eine berühmte Sopranistin.
Fenwick ist sich sicher: Sie weiß, wer der gnadenlose Killer ist und warum er sich ausgerechnet Octavia für das Finale seiner Mordserie aufgehoben hat. Doch so sehr Fenwick auch nachfragt, Octavia verrät nichts. Aber welches Geheimnis ist so grausam, dass man selbst Jahrzehnte später nicht darüber sprechen kann?
Nachruf auf eine Rose.
Hat sich der einflussreiche Firmenboss Alan Wainwright wirklich selbst umgebracht? Sein Sohn Graham zweifelt daran, nachdem er plötzlich nur noch die Hälfte des Vermögens erben soll. Er wendet sich an die Polizei und wieder einmal steht Inspektor Fenwick vor einer großen Herausforderung. Die neue Haupterbin Sally Wainwrigth benimmt sich äußerst merkwürdig - aber das alleine beweist noch nicht ihre Schuld. Fenwick ermittelt - und stößt auf unvorstellbare Abgründe ...
Über Elizabeth Corley
Elizabeth Corley, wuchs in West Sussex, England, auf. Sie lebt in London und München und leitet das Europageschäft eines internationalen Finanzdienstleistungs-Unternehmens. Ihre Inspector-Fenwick-Thriller sind Kultbestseller.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Elizabeth Corley
Requiem für eine Sängerin&Nachruf auf eine Rose
Zwei Fälle für Inspector Fenwick!
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Newsletter
Requiem für eine Sängerin
ERSTER TEIL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
ZWEITER TEIL
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
DRITTER TEIL
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
VIERTER TEIL
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
FÜNFTER TEIL
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
SECHSTER TEIL
48. Kapitel
Nachruf auf eine Rose
PROLOG
ERSTER TEIL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
ZWEITER TEIL
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
DRITTER TEIL
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
VIERTER TEIL
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
Impressum
Elizabeth Corley
Requiem für eineSängerin
Roman
Aus dem Englischenvon Joachim Körber
Requiem
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Der alte Mann starb. Er lag in einem blendend weißen Bett in einem Privatzimmer, weitab vom Lärm des Krankenhaustrubels. Über sein Bett hatte sich eine Stille hernieder gesenkt, als wäre er bereits durch eine unsichtbare Glocke von der Welt abgeschirmt.
Grelles australisches Sonnenlicht funkelte an den Rändern der dicht geschlossenen Jalousien und machte den Mangel an Farbe in dem Raum überdeutlich – weiße Wände, weißer Boden, weiße Jalousien, weiße Laken, weiße Haut, weißes Haar, weiße Lippen, blasse weiße Finger. Nur die Schatten verliehen den Zügen des Mannes Kontur. Er schwebte in einem traumähnlichen Zustand: Eben noch ein junger Mann, war er im nächsten Augenblick tot und blickte mit einer Mischung aus Mitleid und Verachtung auf den altersschwachen, vom Krebs zerfressenen Körper hinab, unfähig, in den bis auf die Knochen abgemagerten Gliedmaßen und dem aufgedunsenen Leib den Mann zu entdecken, der er einmal gewesen war.
Seit Tagen war er dem Tode nahe, verweigerte jedoch die lindernde Betäubung einer starken Dosis Morphium. Die Arzte und Schwestern hatten ihm Tag für Tag mehr geben wollen – aber er besaß das Geld und die Willenskraft, sich ihren Verordnungen zu widersetzen, und schien Qualen den Vorzug vor der Betäubung zu geben. Sie verstanden das nicht. Er war erst zweiundsechzig, sah aber aus wie neunzig. Ein Einwanderer fern seiner Heimat, allein, keine Familie, seine Frau längst tot. Die Ärzte und Schwestern wussten nicht, was ihn am Leben hielt; jedenfalls klammerte er sich an sein Delirium und widerstand der Versuchung, in einen letzten, ruhigen Schlaf hinüberzugleiten.
Im Geiste war der Mann in einer fast zwanzig Jahre zurückliegenden Vergangenheit gefangen. In einem nicht enden wollenden Albtraum durchlebte er wieder und wieder dieselbe Woche seines Lebens. Jedes Mal war er stummer Zeuge der Ereignisse, gelähmt und taub, nicht imstande einzugreifen. Jedes Mal musste er mit ansehen, wie seine Tochter auf einem malerischen Klippenweg in den Tod ging.
Sie drehte sich um, winkte – nicht ihm, sondern ihren Freundinnen – und ging weiter bergab, bis sie nicht mehr zu sehen war. Dann veränderte sich seine Perspektive: Er schwebte wie eine Möwe über ihr und versuchte, sie wegzutreiben von dem, was wenige Meter weiter auf sie wartete, doch seine krächzenden Schreie blieben ungehört.
In seinem drogenumnebelten Zustand wurde der Krebsschmerz zu der Pein, die sich in seinen Arm-Flügeln ausbreitete, während er immer wieder über ihrem Kopf herabstieß. Die Trockenheit in seiner Kehle wurde zu dem heiseren Krächzen, das er von sich gab. Stunde um Stunde folgte er ihr im Halbschlaf denselben Weg hinab; seine Versuche, sie zu warnen, gerieten mit jedem Mal schwächer, das kalte Grauen aber, das ihre letzten Augenblicke begleitete, wurde mit jeder Wiederholung unbarmherziger.
Den Hang hinunter, um die Kurve, und dort wartete jemand auf sie, verfolgte schweigend, wie zuerst ihr goldener Schöpf und dann ihre ganze zierliche Erscheinung über der Anhöhe auftauchte. Das Gesicht der wartenden Gestalt konnte er aus der Vogelperspektive nicht sehen. Dunkel, schlank, athletisch – mehr war nicht zu erkennen –, aber seine Tochter wusste, wer das war. Lachend und mit ausgebreiteten Armen lief sie den steilen Weg hinunter in eine kräftige Umarmung. Zärtlich und vertrauensvoll blickte sie in das Gesicht, das er nicht sehen konnte.
Er stieß panische Möwenschreie aus und schlug wild mit den Flügeln in dem Bemühen, sie zu warnen. Sie aber schloss die Augen und reckte das Gesicht einem Kuss entgegen. Sie wurde von der fremden Gestalt in einer geschmeidigen Bewegung hochgehoben und herumgewirbelt wie einst als kleines Mädchen von ihrem Vater – doch dann wurde sie losgelassen und flog über den Rand der Kalksteinklippe. Endlose Sekunden lang blieben ihre Augen geschlossen, ihr Lächeln lediglich verwirrt. Im letzten Moment schlug sie die Augen auf und schaute sich erschrocken um. Sie ruderte mit den Armen, das Gesicht von Todesangst verzerrt. Schließlich stürzte sie in den Abgrund, prallte auf Simsen des unnachgiebigen Kalksteins ab, brach sich auf einem zerklüfteten Felsvorsprung den Rücken, wurde durch den Aufprall weiter hinaus geschleudert – gelähmt, aber noch bei Bewusstsein –, fiel sechzig Meter in die Tiefe und blieb auf dem Geröll liegen.
Der Vater stieß als Vogel mit angelegten Schwingen hinab, um seine Tochter festzuhalten, bevor eine Welle sie mit sich reißen konnte. Er schlug die Klauen in ihr mittlerweile scharlachrot gesprenkeltes T-Shirt; mit dem Schnabel berührte er sanft ihre Wange, um den Kopf zu drehen. Mit leeren blauen Augen blickte sie zu ihm auf. Ihr Kopf rollte zurück, hinterließ Blut und graue Masse auf den Felsen und blieb in einem unnatürlichen Winkel liegen. Sie lag reglos, es sei denn, eine Welle der steigenden Flut schlug über ihr zusammen und bewegte wie in einer Imitation des Lebens ihre Gliedmaßen. Sie war tot, immer tot.
Zehn Nächte nachdem der Patient ihrer Obhut anvertraut worden war, wurde Schwester Sarah Evens durch einen Ruf von ihm aufgeschreckt. Bislang hatte er allen getrotzt; nicht gesprochen und Medikamente so hartnäckig verweigert, dass man seine Qualen am besten linderte, indem man ihn einfach in Ruhe ließ. Wäre es mit rechten Dingen zugegangen, hätte er längst tot sein müssen. Stattdessen saß er plötzlich aufrecht im Bett, und nicht das Fieber, sondern Aufregung färbte sein Gesicht rot.
Noch erstaunlicher als seine Munterkeit war jedoch seine Bitte. Er verlangte nach einem Priester – einem katholischen obendrein –, und zwar unverzüglich. Eine Viertelstunde später kam der junge Priester herbeigeeilt, um ihm die Letzte Ölung zu geben, doch als er am Bett des sterbenden Mannes Platz nahm, kamen ihm Zweifel am Grund für den Ruf.
Ja, es gab eine Seele hier, die er erretten musste; ja, der Mann würde seine Sünden beichten, bereuen und sich in Gottes Hände geben, aber doch nur unter einer kleinen Bedingung. Der Priester musste einen Brief schreiben, einen höchst wichtigen Brief, den der Mann ihm diktieren würde. Der Priester musste bei der Bibel schwören, dass der Brief dem Neffen des Mannes in England zugestellt würde. Es schien sich um eine unbedeutende Gefälligkeit zu handeln, doch der stechende Blick des Mannes, als er darauf bestand, dass der Priester die Hand auf das Heilige Buch legte und schwor, seinen Inhalt ebenso streng zu hüten wie eine Beichte, hätte ihm eine Warnung sein sollen.
«Ich werde Ihren Brief schreiben, mein Sohn. Aber warum ist er so wichtig?»
Auf dem Gesicht des alten Mannes erschien ein garstiges Lächeln. Sein Atem roch nach verwesenden Tieren.
«Ich habe das Gesicht gesehen! Ich habe das Gesicht gesehen! Ich weiß, wer es war, und mein Neffe muss es erfahren – unverzüglich. Er wird wissen, was zu tun ist.»
Für den Priester hörte sich das harmlos an, vielleicht ging es um eine Art Offenbarungserlebnis. Arglos legte er seinen Eid ab und begann, die letzten Worte des alten Mannes zu Papier zu bringen.
Das Haus war genau so, wie er es in Erinnerung hatte: Ein Betonweg führte zu einer billigen Tür, die einst butterblumengelb gestrichen gewesen, nun aber verwittert war und an saure Milch denken ließ.
Als er den Schlüssel ins Schloss steckte, überkam ihn ein so heftiger Kummer, dass er warten und den Kopf in die Hand stützen musste, bis der beinahe physische Schmerz nachließ. Fast auf dem Fuß folgte die altbekannte Wut, die ihn anspornte, über die Schwelle zu gehen und die dunkle, verwahrloste Diele zu betreten.
Das Haus war ihm selbst im Halbdunkel vertraut. Ohne Umschweife ging er zur Küche, wo hin und wieder ein Schimmer der Abendsonne durch die Wolkendecke und schmutzige Fensterscheiben hereinfiel und einen Tisch mit Wachstuchdecke sowie einen maroden Stuhl erkennen ließ. Er setzte sich erschöpft, zog eine eselsohrige Schwarzweißfotografie aus der Tasche und strich behutsam über das Bild von vier lachenden Gesichtern. Vergangenheit, glückliches Lachen, hübsche Gesichter, und eines, das hübscheste, war für immer fort. Sie war unschuldig gestorben, ohne zu ahnen, wie sehr er sie geliebt hatte.
Wer war schuld an ihrem Tod? Nicht er! Jahrelang hatte er geglaubt, er trage die Verantwortung. Jahrelang hatte er gearbeitet, gekämpft, getötet und damit vergeblich versucht, sein Gewissen zu beruhigen und die Erinnerung an sie zu tilgen. Jetzt wusste er, dass es nicht seine Schuld war. Der Brief, den er nicht erwartet und nicht gewollt hatte, machte alles klar. Er hätte sie nicht retten können – denn es hatte jemanden gegeben, der wollte, dass sie starb.
Wer das war, dessen konnte er noch nicht sicher sein, aber es waren Andeutungen gemacht worden, und die reichten aus, um ihn wieder auf die Spur zu bringen. Die Liste der Verdächtigen konnte nicht lang sein. Er wusste nicht, wer von ihnen es gewesen war, es konnten auch zwei gewesen sein. Als er an ihre betroffenen Gesichter dachte an dem Tag, als sie die Nachricht von ihrem Tod in dieses Haus brachten, als ihm klar wurde, wie scheinheilig mindestens einer dieser mitleidigen, tränenfeuchten Blicke gewesen war, sprang er, den Tisch umstoßend, mit einem unbeherrschten Schrei auf und suchte blind nach etwas, das er verletzen oder zerstören konnte.
Er stolperte zur Spüle, schlug mit der bloßen Faust das Fenster darüber ein und verspürte eine obszöne Freude, als er das Blut aus den Schnitten auf seinem Handrücken quellen sah. Erst als es auf das Foto zu tropfen drohte, zog er den Arm zurück und verband die Hand mit einem alten Küchentuch, das an der Tür gehangen hatte. Die blinde Wut ließ langsam nach, und er blieb wie immer schwach und leer, aber für eine Weile beschwichtigt zurück. Er hob das Foto auf, strich zärtlich darüber und ging zurück zu dem Stuhl. Ein Gedanke ging ihm wieder und wieder durch den Kopf – es war nicht meine Schuld. Und dieser Gedanke erfüllte ihn mit eisklarer Zielstrebigkeit.
Jemand hatte gewollt, dass sie starb, hatte sie in den Tod gestürzt. Wenn er seiner Sache sicher war, würde er das Wenige, das er für sie und ihr Andenken noch tun konnte, tun. Einst wäre er für sie gestorben. Nun genoss er das Wissen, dass er wenigstens etwas für sie vollbringen konnte: sie rächen, für sie töten – einmal, zweimal, dreimal –, sooft es nötig war, damit sie endlich in Frieden ruhen konnte.
Noch einmal brach die Sonne durch die Wolken, ehe sie hinter den fernen Hügeln unterging. Ihr Licht fiel sanft auf das lächelnde Gesicht eines Mannes, der sein Schicksal kannte und seinen Frieden gefunden hatte.
ERSTER TEIL
Dies irae
Dies irae, dies illa
Tag des Zornes, Tag der Zähren
1
«Gott sei Dank!»
Deborah Fearnside machte die Tür zu, lehnte sich erleichtert dagegen und schloss die perfekt geschminkten Lider über ihren blauen Augen. Es war Montag, und die Kinder waren endlich aus dem Haus; die stets zuvorkommende Mavis Dean hatte sie mitgenommen. Nun musste sie sich nur noch selbst fertig machen.
Sie schlug die Augen auf und sah nervös auf die Uhr. Jetzt, so kurz davor, hatte sie Schmetterlinge im Bauch. Auf gar keinen Fall wollte sie in letzter Minute alles vermasseln. Im Grunde war sie bereit, und das schon seit Viertel vor sieben. Sie musste nur noch ihren Mantel und die Schlüssel holen, abschließen und gehen. Ihre angeborene gute Laune kehrte zurück, während sie durch das Haus eilte.
Deborah Fearnside hatte Montage schon immer gemocht. Sie wusste, das unterschied sie von nahezu allen anderen Menschen, aber ihr gefiel der Gedanke, dass sie wenigstens in einer Hinsicht anders war. Montags ging Derek wieder ins Büro, pünktlich um 6.55 Uhr rollte er mit seinem neuen silbermetallic lackierten Audi aus der Einfahrt, damit er den Zug um 7.12 Uhr nach Victoria Station erwischte. Und die Kinder gingen Viertel vor acht zum Kindergarten. Noreen, die Putzfrau, kam um 8.15 Uhr, um das Frühstücksgeschirr abzuräumen und die Trümmer des Wochenendes zu beseitigen.
Dieser Frühlingsmorgen aber war etwas Besonderes. Deborah würde nach London fahren und Verträge unterzeichnen, die ihr – was bringen würden? Aufregung, Herausforderung, Ruhm? Einerlei, auf jeden Fall etwas Neues. Sie sehnte sich verzweifelt nach etwas Neuem.
Vier Wochen zuvor hatten sie und ein paar Freundinnen auf eine viertelseitige Anzeige in der Lokalzeitung geantwortet, in der junge Mütter mit Interesse an einem Nebenjob als reife Models für einen neuen Katalog gesucht wurden. Der Anzeige zufolge richtete sich der Katalog an Familien, die bevorzugt «bequem und einfach hochwertige Kleider für ihren erfüllten, aktiven Lebensstil» kauften. Darüber hinaus hätten Analysen gezeigt, dass «der Rücklauf unserer Zielgruppe deutlich besser ist (in manchen Fällen bis zu dreimal so hoch), wenn die Kleidungsstücke von echten Müttern und ihren Kindern vorgeführt werden».
Die Ansprüche an die Models waren hoch, der Auswahlprozess in vier Stufen unterteilt. Zudem gab es enge Grenzen, was die Größe und das Gewicht der Mütter sowie das Alter der Kinder betraf. Das Honorar für erfolgreiche Models war laut Anzeige «ausgezeichnet».
Zunächst waren Deborah und ihre Freundinnen skeptisch gewesen. Mindestens sechs von ihnen entsprachen den Größen- und Gewichtsvorgaben und hatten Kinder in der richtigen Altersgruppe. Drei unter ihnen waren Deborahs Auffassung nach ziemlich attraktiv; sie kam nicht umhin, sich im Stillen zu sagen, dass sie selbst wahrscheinlich die Attraktivste war. Sie hatte immer noch das naturgelockte goldblonde Haar und die hellblauen Augen, die die Jungs in der Schule verrückt gemacht hatten, und trotz der beiden Kinder war sie schlank und gut gebaut. Mit dreiunddreißig waren ein paar Schwangerschaftsstreifen und beginnende Cellulitis wohl unvermeidbar, aber in der Anzeige hatte ausdrücklich gestanden, dass es ausschließlich um Oberbekleidung gehe, für Bademoden und Unterwäsche würden professionelle Models engagiert. Trotz allem war ihnen die Sache riskant vorgekommen, womöglich machten sie sich alle zum Narren – und so waren die Freundinnen übereingekommen, dass das nichts für sie sei.
Dann war zweierlei geschehen, das Deborah veranlasste, mit dem 8.12-Uhr-Zug nach London zu fahren und ihren Termin wahrzunehmen.
Erst Derek. Sie konnte akzeptieren, dass er nicht eben offensiv männlich war, so war er nun einmal erzogen, aber sie hatte wenigstens mit einer gewissen Reaktion gerechnet, als sie am Samstag nach Erscheinen der Anzeige in ihrer Neuerwerbung von der «Naughty Nighty»-Party, die sie Anfang der Woche besucht hatte, aus dem ans Schlafzimmer angrenzenden Badezimmer stolziert kam. Den gewagten Zweiteiler aus türkisfarbenem Chiffon hatte sie unter zahlreichen Witzeleien und neidischen Bemerkungen ihrer Freundinnen ausgesucht. Das hauchzarte Etwas war fast bis zum Nabel ausgeschnitten, und elfenbeinfarbene Spitzenborten zierten Armöffnungen und Saum. Dazu gehörte ein passendes Höschen. Das Ensemble ließ ihre immer noch festen Brüste zur Geltung kommen und kaschierte die Pölsterchen an den Hüften, die sie trotz zweimal Gymnastik pro Woche einfach nicht wegbekam.
Als sie also nach dem Duschen rosig und warm das halbdunkle Schlafzimmer betrat, an den richtigen Stellen von einem Hauch von Dereks Lieblingsparfüm umweht, lauerte sie auf eine Reaktion. Doch ihr Mann schaute nur kurz von seiner Lektüre – The Economist – auf und bat sie, das Licht im Bad auszumachen. Sie hatte es, in der Hoffnung, eine verführerische Silhouette darzubieten, absichtlich angelassen. Deborah ließ sich nicht beirren, glitt auf das Bett und zog ihm die Zeitschrift weg. Doch er riss ihr das Heft aus der Hand, drehte sich um, schüttelte das Kissen auf und schlüpfte energisch unter die Decke, bevor er mit einem frostigen «Um Himmels willen!» das Nachttischlämpchen ausknipste.
Der Streit, den das nach sich zog, war einer ihrer schlimmsten gewesen. Am Ende saß Deborah um zwei Uhr morgens in einen Frotteemorgenmantel eingemummt in der Küche, trank Tee und schwor sich, sie würde Derek beweisen, dass sie noch eine attraktive Frau war. Erst später, als sie die Zeitungen vom Freitag wegräumte, fiel ihr Blick wieder auf die Annonce. Impulsiv riss sie sie heraus und legte sie beiseite.
Selbst danach wäre jedoch fraglich gewesen, ob Deborah etwas unternommen hätte, hätten es sich nicht Jean und Leslie, zwei ihrer engsten Freundinnen, über das Wochenende anders überlegt und beschlossen, doch auf die Anzeige zu antworten. Brian, Leslies Mann, war das wachsende Interesse seiner Frau an der Anzeige nicht entgangen, und so hatte er die angegebene Nummer angerufen. Er hatte bei einer ausgesprochen wortgewandten und höflichen Sekretärin eine Nachricht hinterlassen und war binnen einer Stunde vom Manager des neuen Unternehmens zurückgerufen worden. Der Mann hatte, sehr professionell, alle Fragen beantworten können. Zwei Tage später war den Smiths eine Hochglanzbroschüre über die Agentur nebst einer Bilanz der Muttergesellschaft ins Haus geflattert. Brian, von Beruf Buchhalter, hatte bei der Handelskammer Erkundigungen über die Mutterfirma eingezogen. Die existierte tatsächlich, und es gab auch eine Tochtergesellschaft für den Großhandel mit Modeartikeln. Beruhigt, aber dennoch entschlossen, ganz sicherzugehen, rief Brian einen Freund in der Branche an, der ihm bestätigte, dass die Mutterfirma in der Tat vorhatte, auf dem Versandhandelsmarkt zu expandieren.
Der Zuspruch ihres Mannes beschwichtigte Leslies Zweifel, und sie ermutigte ihre Freundinnen, sich zu bewerben. Brian bot sich sogar an, sie zu den Vorstellungsterminen zu begleiten, sollte es so weit kommen. Das gab für Deborah den Ausschlag, und am Ende beschlossen sechs Mütter der Kindergartengruppe, sich gemeinsam zu bewerben. In der Anzeige hieß es, Interessentinnen sollten Namen, Anschrift, Telefonnummer, Größe und Gewicht angeben, Angaben zu Alter und Geschlecht der Kinder machen und einige Fotos von der Familie und von sich beilegen (die zurückgeschickt würden, sofern ein frankierter Umschlag beigelegt sei).
Von den sechs Freundinnen wurden innerhalb einer Woche vier zu Vorstellungsterminen nach London gebeten. Aufgeregt begaben sie sich zum Hotel Carlton in der Nähe des Trafalgar Square (vier Sterne, wie Deborah Derek stolz wissen ließ). Letztendlich war Leslies Mann doch nicht mitgekommen; vier Frauen zusammen könnten sich hinreichend sicher fühlen.
Die Gespräche führte eine atemberaubend attraktive und elegant gekleidete Dame Anfang dreißig in einem Konferenzraum. Sie gab die nervösen Antworten der Frauen in einen Laptop ein, auf dem, wie sie erläuterte, bereits die Informationen aus ihren Bewerbungen gespeichert waren. Die Fragen zielten auf den Werdegang der Frauen; frühere Erfahrungen beim Modeln oder Schauspielern (Deborah erinnerte sich an einen Auftritt am College, als sie neunzehn war, und etwas Schauspielunterricht); die Kinder – ob es ihnen Spaß machen würde, Kleidungsstücke vorzuführen; und zuletzt, beinahe entschuldigend, die Ehemänner – was die von einem möglichen Engagement halten würden.
Nach zwei Stunden waren alle vier ausführlich befragt und darüber informiert worden, dass sie binnen einer Woche Nachricht erhalten würden. Sie bekamen eine Broschüre mit Einzelheiten über die Agentur und den Katalog. Als die Freundinnen aus dem Fahrstuhl traten und durch die marmorverkleidete Halle gingen, sahen sie zu ihrer Bestürzung zwei äußerst attraktive Frauen an der Rezeption nach dem Konferenzraum der Agentur fragen. Insgeheim war Deborah der Ansicht, dass sie sich bei solcher Konkurrenz glücklich schätzen konnten, wenn sie auch nur die nächste Hürde schafften.
Innerhalb von drei Tagen erhielten Leslie und Deborah telefonisch die Mitteilung, dass sie Erfolg gehabt hatten. Sie wurden für die darauf folgende Woche zu ersten Probeaufnahmen bestellt. Die Termine lagen so, dass sie zusammen fahren konnten. Darüber hinaus wurden sie gebeten, in einem Fotoatelier der Gegend, wo bereits entsprechende Arrangements getroffen worden waren, auf Kosten der Agentur Aufnahmen von ihren Kindern machen zu lassen. So müssten, erklärte die ausgesprochen freundliche Dame am Telefon, die Kinder nicht reisen, solange die endgültigen Vereinbarungen noch nicht getroffen seien. Deborah und Leslie fanden das besonders professionell und einfühlsam.
Die Probeaufnahmen verliefen ausgezeichnet; anschließend wurde ihnen gesagt, dass sie zur Unterzeichnung der Verträge nach London eingeladen würden. Zusammen mit zwei anderen seien sie unter mehr als hundert Bewerberinnen ausgewählt worden. Beim nächsten Mal würden sie nicht selbst zum Studio fahren müssen, sondern würden von einem Wagen mit Chauffeur vom Bahnhof abgeholt.
Und so kam es, dass Deborah Fearnside an einem sonnigen Aprilmorgen in beschwingter Stimmung zum letzten Mal ihre Haustür zumachte und gewissenhaft abschloss. Als sie mit ihrer kleinen Tasche, in der sich die nötigsten Reiseutensilien, ein merkwürdiger Glücksbringer und – für den Fall, dass sie nach den Aufnahmen noch Zeit für einen Besuch im West End finden sollte – ihr Scheckbuch befanden, das Haus verließ, plagte sie kein schlechtes Gewissen.
Deborah wollte Leslie mit zum Bahnhof nehmen und traf pünktlich bei ihrer Freundin ein. Auf den Anblick, der sich ihr dort bot, war sie nicht vorbereitet.
«Deborah. O Gott, es tut mir Leid.» Eine völlig aufgelöste Leslie, die Lockenwickler noch im Haar, machte die Tür auf. «Ich werde es nicht schaffen. Der Morgen war eine einzige Katastrophe. Erstens ist die Katze weg – der Himmel weiß, wo das verdammte Vieh steckt! Sie ist noch nie ausgerissen, und die Kinder laufen seit sieben Uhr weinend durchs Haus. Dann hat Julie angerufen und gesagt, dass ihr Auto nicht anspringt. Also kann sie die Kinder nicht zur Schule bringen. Und um allem die Krone aufzusetzen, hat eben noch der Rektor von Jamies Schule angerufen und gesagt, dass er mich in einer ‹ernsten Angelegenheit› sprechen muss; etwas, das er nicht am Telefon besprechen kann.»
Leslie schien den Tränen nahe. Irgendwo im Haus hörte Deborah weinende Kinder und einen Hund, der unablässig bellte.
«Du Ärmste! Was machst du denn jetzt?» Deborah war voll des Mitleids, aber nichtsdestotrotz musste sie zum Bahnhof, das Auto parken und eine Fahrkarte kaufen. «Weißt du was?», sagte sie, als sie ihre Freundin so ratlos sah. «Ich erkläre denen, dass du aufgehalten worden bist. Sobald ich im Studio bin, rufe ich an, um zu hören, wie es bei dir steht.»
«Oh, danke, Deb, das wäre toll. Eigentlich müsste ich es trotz allem noch schaffen, vorausgesetzt, mit dem Rektor geht alles reibungslos über die Bühne.»
«Da bin ich ganz sicher, keine Bange. Und die von der Agentur wird es nach der ganzen Mühe, die sie auf sich genommen haben, um uns zu finden, nicht stören, wenn du ein klein wenig zu spät kommst. Wir sehen uns dann später.»
Deborah drehte sich um und ging, ohne auf die Antwort ihrer Freundin zu warten. Wenn der Verkehr nicht allzu dicht war, konnte sie den Zug noch erwischen.
Als der 8.12-Uhr-Zug mit fünf Minuten Verspätung abfuhr, ließ sie sich dankbar auf den Sitz sinken. Wäre der Verkehr nicht so günstig gewesen, wäre der Zug pünktlich abgefahren, hätte sie auf Leslie gewartet, dann wäre sie vielleicht, vielleicht am Abend wohlbehalten wieder nach Hause gekommen.
2
Er saß am Steuer des gemieteten 5er BMW und wartete geduldig. Alle Planungen und Vorbereitungen liefen auf diesen Augenblick hinaus. Er war, wie bei früheren Anlässen, vollkommen ruhig und konzentrierte sich ausschließlich auf die Einzelheiten der Darbietung, die er gleich geben würde. Er hatte geplant, Rollen besetzt und geprobt, bis das Stück perfekt war; er war Schöpfer und Künstler in einem.
In diesem Fall hatte er sich einem scheinbar unlösbaren Problem gegenübergesehen: Wie brachte man eine Frau von ihrer tagtäglichen Routine ab, ohne Verdacht zu erregen, und gewann Zeit für ein entspanntes Verhör, ohne sich mit einer Großfahndung der Polizei herumärgern zu müssen?
Das Leichteste war gewesen, sie und die anderen zu finden. Ihre Namen hatte er aus einem alten Schuljahrbuch, der Rest stammte aus einer alten Frauenzeitschrift. Danach hatte er entscheiden müssen, in welcher Reihenfolge er an sie herantreten würde. Er brauchte spezifischere Informationen und konnte nur hoffen, dass es ihm gelang, aus der Ersten von ihnen die ganze Wahrheit herauszuholen.
Für diese hatte er sich entschieden, weil sie leicht zu knacken sein würde. Er bezweifelte, dass sie selbst unter günstigsten Umständen lange durchhalten würde; Eitelkeit und Sorge um ihr hübsches Gesicht würden sie für seine Drohungen umso empfänglicher machen. Er verabscheute Verhöre – sie waren in ihrem Verlauf nicht kalkulierbar und kosteten Zeit. Im Gegensatz zu Zeitgenossen, denen es sexuelle Befriedigung zu verschaffen schien, anderen Schmerzen zuzufügen und mit dem Messer Macht über ein hilfloses Opfer auszuüben, hatte er kein Vergnügen daran.
Die eigentliche Herausforderung war es gewesen, einen Plan auszuarbeiten, der hinreichend Möglichkeiten für eine Entführung bot, die nicht sofort großes Geschrei nach sich zog. Sie einfach aus dem Dorf zu holen wäre ein schlechter Anfang gewesen; er kannte diese Art von Gemeinden nur zu gut. Auch wenn sie weitgehend von Pendlern und ihren Familien bewohnt wurden, wussten doch zumindest die Frauen und Kinder genau übereinander Bescheid. Noch schlimmer: Ihr Alltag spielte sich in solcher Regelmäßigkeit ab, dass jede Abweichung innerhalb weniger Stunden bemerkt worden wäre.
Und sie entsprach auf Mitleid erregende Weise einem bestimmten Typ: Mitglied der Fahrgemeinschaft zur Schule und zum Kindergarten, zweimal die Woche Gymnastik, einmal die Woche Hilfsdienst im Altenheim, und sie ging öfter einkaufen und ihre Freundinnen besuchen, als ihrem Mann lieb war. Es gab keinen Tag in ihrem selbst gestalteten, sinnlosen Leben, an dem sie für seine Zwecke nicht zu schnell vermisst worden wäre. Noch problematischer war, dass es kaum eine Möglichkeit gab, sie zu Hause abzuholen, ohne von jemandem gesehen zu werden, denn sie hatte gleich zwei Nachbarinnen, die gern hinter den Gardinen lauerten.
Der erste Ansatz einer Lösung war ihm während einer Beobachtungsfahrt eingefallen, als er ihr und einigen ihrer Freundinnen zu einem Cafe gefolgt war. Sie hatten sich darüber beklagt, wie sinnlos ihr Leben sei, wie unausgefüllt sie sich fühlten und welch großes Potenzial ungenutzt in ihnen schlummere. Das alles hatte er zur späteren Verwendung gespeichert.
An einem anderen Tag hatten sie die Köpfe über einem Versandhauskatalog zusammengesteckt. Zwischen abfälligen Kommentaren über die Kleidungsstücke waren immer wieder Bemerkungen darüber gefallen, wie unnatürlich die Models aussähen; eine der Frauen hatte gesagt, sie wirkten einfach nicht wie «richtige Menschen».
Während er noch die gesammelten Fakten sondierte, waren die beiden Unterhaltungen in seinem Geiste zu einer Idee verschmolzen. Sie war, wie alle guten Ideen, überraschend einfach: Entführ sie nicht in ihrer vertrauten Umgebung, bring sie in eine deiner Wahl. Sie musste eine der Dutzenden von Menschen werden, die Woche für Woche vermisst wurden. Sie musste in London verschwinden, wo das etwas Alltägliches war, nicht im verschlafenen Sussex. Noch besser, wenn sie sich langweilt: Verhilf ihr zu einem Grund, etwas anderes zu tun, legitimiere es und unterstütze es mit einem Wunsch oder Vorbehalt, den sie ohnehin schon hat. Mit natürlichen Models für einen Versandhauskatalog liefen sämtliche Fäden zusammen.
Die Umsetzung der Idee war natürlich komplizierter – «arbeitsintensiv», wie sein alter befehlshabender Offizier gesagt hätte. Das war seine einzige Schwäche, die Neigung, die Ausführung seiner Pläne zu aufwendig zu gestalten. Grund dafür war seine Liebe zum Detail, fast schon eine Besessenheit, ebenso wie der Wunsch, gerissener zu sein als seine Widersacher. Aber kein Teil seines Plans war unwichtig. Es war leicht gewesen, die Anzeige zu entwerfen: Brief und Scheck an die Lokalzeitung, einschließlich einer Kopie, und da die Anzeige dort gesetzt wurde, brauchte er keine Werbeagentur. Das Konto für den Scheck hatte er per Post von seiner «Geschäftsadresse» aus eröffnet – einem möblierten Büro in einer heruntergekommenen Gegend im Norden Londons, das er bar bezahlte und dessen halbseidener Vermieter keine Fragen stellte.
In aller Hast hatte er die Bekleidungs- und Versandbranche sondiert: Die wichtigen Wirtschaftsmagazine und einige wöchentliche Anlagerundschreiben hatten ihm eine Liste von Konfektionsherstellern und Einzelhändlern in Großbritannien geliefert. Er hatte den passendsten herausgesucht, ein paar Anteile gekauft und war mit Kopien der Geschäftsberichte und vorläufigen Bilanzen belohnt worden. Wie gut, dass er sie gehabt hatte – dank ihrer hatte er Leslie Smiths Mann beruhigen können.
Nach diesen Vorbereitungen hatte er die Anzeige acht Wochen lang alle vierzehn Tage geschaltet und zu diesem Zweck eigens Briefpapier mit Geschäftsadresse drucken lassen. Er hatte befürchtet, die Anzeigenannahme der Zeitung könnte womöglich versuchen, Auskünfte über die Firma einzuholen, aber dazu gab es keinen Grund; sein Scheck wurde kommentarlos akzeptiert.
Er hatte die Anzeige so entworfen, dass sie die Frau direkt ansprechen musste. Er wusste, dass sie diese Zeitung las und die Anzeigen studierte. Sie war von einer gewissen Dünkelhaftigkeit, und er hatte den Anzeigentext darauf zugeschnitten. Offensichtlich hielt sie sich für attraktiv und glaubte, dass sie in jüngeren Jahren tatsächlich hätte Model werden können; er vermutete, dass sie in einem Alter war, da Gelegenheiten, ihre Attraktivität zu beweisen, ihr besonders verführerisch erscheinen mussten. Natürlich hatte er auch gehört, wie sie in die Kritik an den hauptberuflichen Models einstimmte.
Zu guter Letzt hatte die Annonce die Möglichkeit eingeräumt, dass die Frauen als Gruppe antworteten. Das Risiko, dass sie nicht reagierte, hatte natürlich bestanden; er hatte sie vor allem erst einmal testen wollen. Wäre die Sache schief gegangen, hätte er ein wenig Geld verloren – davon hatte er genug – und ein bisschen Zeit vergeudet. Na und? Die Zeit war auf seiner Seite; er wartete schon fast zwanzig Jahre.
Er war einigermaßen überrascht gewesen, als die Frau und ihre Freundinnen gleich nach dem ersten Erscheinen auf die Anzeige antworteten. Es hatte ein simples Auswahlverfahren stattgefunden, das stilvoll und überzeugend und in jeder Phase mit der angemessenen Ermunterung durchgespielt wurde; so als ginge es darum, ein gekennzeichnetes Schaf mit geringstmöglicher Aufregung für die anderen von der Herde zu trennen. Mit leisem Stolz erinnerte er sich an die Anreize, die er eingearbeitet hatte, um sie stets zum Weitermachen zu ermutigen. Das Hotel machte, wie etliche andere in London, tagsüber ebenso viel Geschäft wie nachts; es war so klein, dass seine einzelne Buchung nicht weiter auffiel, aber elegant genug, um auf sein Opfer ansprechend zu wirken.
Eine attraktive Interviewerin zu finden war einfach gewesen. Er hatte eine Zeitarbeitsfirma angerufen und deutlich gemacht, welches Erscheinungsbild und welche Schreibmaschinenkenntnisse er bei der Kraft voraussetzte, die er für drei Wochen einzustellen gedachte. Nach einer Runde von Vorstellungsgesprächen hatte er sich für die Kandidatin entschieden, die das Geld für eine Weltreise verdienen wollte. Er gab ihr eine Einweisung und den Laptop, Einzelheiten über die Kandidatinnen und einen kleinen Vorrat an Broschüren, die er woanders hatte drucken lassen als das Briefpapier. Er hatte im Voraus bezahlt und seine Deckadresse hinterlassen, an die täglich Ausdrucke der Gesprächsnotizen und Kommentare über die Bewerberinnen geschickt werden sollten. Die junge Frau war ganz entzückt gewesen, weil sie bei guter Bezahlung einen interessanten Job in einem eleganten Hotel bekommen hatte. Er hatte ihr einen Erfolgsbonus versprochen, wenn sie schnell geeignete Kandidatinnen fanden. Sie hatte keinerlei Fragen gestellt und schien frei von jeder Neugier.
Er hatte die gesamte Korrespondenz persönlich erledigt, hatte die Zuschriften unter der Adresse im Norden von London abgeholt und die Einladungen zu den Vorstellungsgesprächen getippt. Schließlich hatte er der jungen Frau mehr als ein Dutzend Bewerberinnen geschickt und sie kurz nach dem Kontakt mit der Zielperson und ihren Freundinnen angerufen, um ihr zu sagen, dass die Suche abgeschlossen und ihr Erfolgshonorar unterwegs sei. Auf sein Geheiß hatte sie sämtliche Unterlagen und den Laptop zu der Zeitarbeitsfirma gebracht, wo die Sachen von einem der weniger gut beleumundeten Minicar-Unternehmen abgeholt worden waren. Eine Woche später hatte er den PC, auf dem sämtliche Daten gelöscht waren, in die Schuttmulde eines Bauunternehmens an der Baustelle bei Aldgate geworfen.
Der Laptop wäre streng genommen gar nicht nötig gewesen, aber er hatte bei früheren Gelegenheiten festgestellt, dass es Autorität und Seriosität verströmte, Daten in einen Computer einzugeben. Es war unwahrscheinlich, dass die Polizei den Kauf des Laptops zurückverfolgen konnte – vorausgesetzt, sie stellten überhaupt den Zusammenhang her. Er hatte das Gerät an einem Samstag in einem gut besuchten Computerladen gekauft und bar bezahlt, und es war eines der meistverkauften Modelle gewesen.
Er verzog die Lippen zu einem seltenen Lächeln, als er an die beiden Schönheiten von der Begleitagentur dachte, die, weil er es so vereinbart hatte, zur selben Zeit in dem Hotel aufgekreuzt waren wie sein Opfer. Dabei hatte er eigens darauf bestanden, dass sie viel Wind machen sollten, wenn sie nach der Suite fragten – und erklärt, dass sich in der Halle einige Leute aufhalten würden, die er beeindrucken wollte. Die Damen, daran gewöhnt, Sonderwünsche zu erfüllen, waren pünktlich erschienen. Unglücklicherweise hatten die Gespräche trotz seiner exakten Anweisungen länger gedauert, und er hatte von seinem Beobachtungsposten gleich neben der Rezeption frustriert mit ansehen müssen, dass die beiden Damen mit ihrem Theater schon fertig waren, als die anderen Frauen aus den Lifts kamen. Er war sicher, dass diesen die Vorstellung entgangen war, und das bereitete ihm einen gewissen Verdruss, denn die gut aussehende Konkurrenz hatte die Frauen neidisch und nervös machen sollen. Er wusste, eventuelle Vorbehalte konnte er am besten ausschalten, indem er dafür sorgte, dass sie den Job von ganzem Herzen haben wollten.
Trotz dieses kleinen Rückschlags war der zweite Schritt gut gelaufen. Schritt Nummer drei, die Fotoaufnahmen, die er für den schwierigsten Teil gehalten hatte, waren am leichtesten zu vereinbaren gewesen. Er hatte eine hohlköpfige Drogensüchtige mit einem letzten Rest von angenehmer Sprechstimme gefunden, die am Telefon die Termine verabredete. Sie hatte sich so über das Geld gefreut, dass sie keine Fragen stellte, ihre Rolle spielte und sich dabei auf Mitleid erregende Weise bemühte, ihm zu gefallen. Dann das Studio. Ihm war nicht klar gewesen, wie viele Fotostudios es in London gab. Schließlich hatte er eins in einer guten Gegend nicht weit vom Stadtzentrum gemietet und dem glücklichen Fotografen versichert, es handele sich um ein legitimes Geschäft. Er hatte Honorar und Anweisungen per Kurier zugestellt und im letzten Augenblick erklärt, dass er unterwegs sei und die Aufnahmen leider nicht persönlich überwachen könne. Er wusste, dass die Leute im Studio ihre Aufgabe perfekt gemeistert hatten, hatte er die ganze Sache doch mit gewöhnlichem Überwachungszubehör – einem in einem Doppelsteckdose verborgenen Sender – verfolgt.
Das letzte Stadium erforderte feinfühlige Manöver. Er brauchte sie allein, wie ein Collie, der das markierte Schaf umkreist und von den anderen trennt. Er brauchte sie ohne die anderen Frauen, die dem Unternehmen nur einen Anstrich von Sicherheit hatten geben sollen. Indem er sie bis zuletzt in dem Glauben ließ, dass sie die Sache mit einer Freundin gemeinsam machte, konnte er sie, so dachte er, in Sicherheit wiegen.
Ihm war klar, dass der ganze Plan in dieser Phase immer noch auseinander fallen konnte – der vorgebliche Anruf des Rektors erwies sich möglicherweise als wirkungslos; sie hätte beschließen können, auf ihre Freundin zu warten. Bald würde er es wissen. Gelassen wartete er ab, gefeit gegen mögliche Enttäuschungen, denn er war darauf trainiert, seinen Eifer auf ein Minimum zu begrenzen. Er hatte seine Emotionen vollkommen unter Kontrolle, als er mit dem Mietwagen an der Victoria Station vorfuhr.
3
Der Zug fuhr nahezu pünktlich ein. Deborah riss sich aus einem glücklichen Tagtraum, in dem sie, dank ihrer Einkünfte als Model, mit Derek einen romantischen Urlaub für zwei gemacht hatte. Sie gab dem Mann am Ausgangsschalter den Abriss ihres Fahrscheins und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln, das ihm den Tag versüßte und ihn später zu einem wichtigen Zeugen hätte machen können, wenn es denn zu einer polizeilichen Ermittlung gekommen wäre. Zielstrebig ging sie zu einem der Seitenausgänge, wo ein Wagen mit Chauffeur auf sie warten sollte. Inzwischen spürte sie wieder die Schmetterlinge im Bauch und musste mehrmals tief durchatmen, um sich zu beruhigen.
Sie trat in die Hitze des ungewöhnlich warmen Apriltages hinaus, und Staub und Lärm der viel befahrenen Londoner Straße trugen wenig zu ihrer Beruhigung bei. Blinzelnd sah sie sich nach dem Fahrer um. Am Telefon hatte es sich so einfach angehört, aber hier, im Gedränge von Menschen und Verkehr, wurde ihr klar, dass sie den Wagen auch schlichtweg übersehen konnte.
In ihrer wachsenden Panik zuckte sie heftig zusammen, als ein dunkelhäutiger Mann mit Knoblauchatem zu ihr trat und sie sanft am Ellbogen berührte.
«Haben Sie sich verirrt, Madam?»
«Nein, nein, alles in Ordnung, danke. Die Sonne blendet nur so. Danke, es ist wirklich alles in Ordnung.»
«Entschuldigen Sie meine Direktheit, Verehrteste, aber den Eindruck habe ich ganz und gar nicht – und ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich Sie hilflos hier stehen ließe.»
Seine Aufmerksamkeit hatte etwas Bedrohliches, daher versuchte Deborah verzweifelt, ihn loszuwerden.
«Nein, wirklich, alles in Ordnung. Ich warte auf jemanden. Sie müssten jeden Moment hier sein», entgegnete sie brüsk und schickte ein vages Lächeln hinterher, das ihre Augen jedoch nicht erreichte.
«Aber ich habe ein hübsches Restaurant gleich auf der anderen Straßenseite, wo Sie bequem sitzen und nach den Leuten Ausschau halten könnten, auf die Sie warten.»
Der Mann war hartnäckig, nun hielt er schon ihren Ellbogen mit festem Griff umklammert und zog sie zum Bordstein, als wollte er mit ihr die Straße überqueren.
«Schon gut, die Lady gehört zu mir», sagte plötzlich eine Stimme hinter ihnen.
Deborah und ihr Beschützer drehten sich um. Die Gesichtszüge des Mannes waren kaum zu erkennen, da er die Sonne im Rücken hatte. Er war groß und kräftig. Etwas an seiner Haltung ließ Deborah unwillkürlich an die Polizei denken, aber sie verwarf den Gedanken auf der Stelle und schob das Gefühl auf die Chauffeursmütze, die der Mann trug.
«Mrs. Fearnside? Ich bin Ihr Chauffeur von Happy Families, dem Versandhaus.»
«Ja, ja, das bin ich», antwortete Deborah hastig, da sie es kaum erwarten konnte, den Restaurantbesitzer loszuwerden, und dann, etwas freundlicher: «Wie nett, dass Sie mich abholen.»
«Keineswegs, Madam, das ist mein Job. Aber wir sollten unverzüglich fahren. Ich stehe nämlich im Halteverbot.»
Der Restaurantbesitzer schien nicht willens, sie gehen zu lassen, doch schließlich veranlasste ihn etwas in den Augen des Chauffeurs, den Rückzug anzutreten. Er deutete eine Verbeugung an und machte sich daran, die Straße zu überqueren.
«Au revoir, Madame. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich wieder einmal.»
Deborah beachtete den davoneilenden Mann nicht weiter. «Nochmals danke. Er ging mir schon ziemlich auf die Nerven.»
Der Chauffeur lächelte nur und nahm ihre kleine Reisetasche. Behutsam umfasste er ihren Ellbogen und trug sie fast über die Straße zu dem wartenden Auto, stets darauf bedacht, dem dichten Verkehr auszuweichen. Er verstaute ihre Tasche und Jacke auf der Rückbank und machte ihr die Beifahrertür auf. Deborah zögerte unmerklich.
«Würden Sie lieber hinten sitzen, Madam? Ich dachte, vorn hätten Sie es bequemer; die meisten Fahrgäste ziehen das vor.» Zum ersten Mal sah er ihr in die Augen und lächelte. Mit einem leichten Kribbeln stellte Deborah fest, dass er außerordentlich attraktiv war: älter, als sie zunächst gedacht hatte – aber sehr gut aussehend, mit bernsteinfarbenen Augen und der Physis eines jüngeren Mannes.
«Danke. Ich fahre auch vorn bei Ihnen.»
Sie glitt in das warme Innere, wo es nach Leder roch, während er sich vergewisserte, dass er ihr Kleid nicht in der Tür einklemmte. Er fädelte sich in den Verkehrsstrom ein und schaltete die Klimaanlage ein. Kurz darauf herrschte eine angenehme Temperatur, und es musste keine abgasverpestete Luft von draußen mehr hereingepumpt werden.
«Da wir durch ein, zwei fragwürdige Viertel kommen, Mrs. Fearnside – würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich die Türen verriegele?»
«Nein, überhaupt nicht. Ich mache das immer; man hört so viele schreckliche Geschichten, dass ich mich wirklich nicht mehr sicher fühle, wenn ich allein fahre.»
Er lächelte ihr beruhigend zu, dann wurden alle vier Türen mit einem satten Klacken verriegelt und der Wagen bahnte sich langsam seinen Weg durch die Fahrzeugschlangen um den Buckingham-Palast herum. Der Chauffeur konzentrierte sich, er wollte einen Unfall vermeiden, der Aufsehen hätte erregen können. Aber ein Teil seiner Aufmerksamkeit galt stets der Frau auf dem Beifahrersitz. Die nächste halbe Stunde war der gefährlichste und schwierigste Teil seines Plans. Wenn sie jetzt in irgendeiner Weise Verdacht schöpfte, blieben ihm kaum Möglichkeiten, ohne Anwendung von Gewalt mit ihr fertig zu werden. Er glaubte nicht, dass sie sich in London sonderlich auskannte, daher nahm er an, dass er noch etwa zehn Minuten hatte, bis anhand der Verkehrsschilder deutlich wurde, dass sie in eine andere Richtung fuhren als die, wo die «Studios» lagen.
Inzwischen musste er dafür sorgen, dass ihr Vertrauen in ihn wuchs. Seine Intuition verriet ihm, dass ein zurückhaltender Flirt der einfachste Weg wäre, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen.
«Haben Sie es bequem, Mrs. Fearnside? Ist Ihnen die Temperatur angenehm?» Er warf ihr einen Seitenblick zu, der Gefallen an dem, was er sah, vermitteln sollte, obwohl er in Wahrheit nicht das geringste sexuelle Interesse an ihr hatte. Auf eine rein sachliche Weise war ihm klar, dass man sie als ziemlich attraktiv bezeichnen konnte – ein Faktor, der sich von nun an als Nachteil erweisen würde, da in zunehmendem Maße das Risiko bestand, dass sich potenzielle Zeugen an sie erinnerten.
Wie auch immer, er hatte gelernt, wenn nötig so auf seine Opfer einzugehen, wie sie es von ihm erwarteten. Sie hatten einmal von einem Verhaltenspsychologen erklärt bekommen, dass eine subtile Wiederholung ihres eigenen Verhaltens durch andere beruhigend auf Menschen wirkte. Offenbar war er darin ein Naturtalent. Er empfand nichts für sie – keine Leidenschaft, kein Mitgefühl –, nur ein kühles Interesse an ihren wahrscheinlichen Reaktionen und eine gewisse Empfänglichkeit für ihre Stimmung. Seine Darbietung war perfekt; sie konnte unmöglich etwas ahnen.
«Alles bestens, danke.» Deborah meinte, einen Anflug von Interesse in seinem Blick wahrzunehmen. Wie er sie ansah, hatte etwas unterschwellig Raubtierhaftes, etwas leise Gefährliches. Wärme breitete sich in ihrer Magengegend aus. Sie verspürte nicht den Hauch von Angst. «Und nennen Sie mich bitte Deborah.»
«Einverstanden. Deborah. Das ist ein schöner Name. Meine Schwester hatte mal eine Freundin, die so hieß; ich habe immer heimlich für sie geschwärmt. Wissen Sie, was der Name bedeutet?»
Sie schüttelte den Kopf.
«Er stammt aus der Bibel. Es ist aber auch das hebräische Wort für Biene – was zweierlei Bedeutung haben kann: Fleiß oder Süße. Mit diesem Wissen wollte ich die Deborah von damals beeindrucken, aber genützt hat es mir nicht viel!» Er lachte, das anheimelnde, entspannte Lachen eines Mannes, der einen Witz auf seine Kosten vertragen kann. «Wie auch immer, ich finde, der Name passt zu Ihnen.»
Wieder schenkte er ihr einen solchen Blick. Zu ihrem Ärger stellte Deborah fest, dass sie errötete, doch sie hoffte, er würde es nicht sehen. Angesichts seiner kultivierten Art fragte sie sich, warum er als Chauffeur arbeitete.
Er achtete wieder auf den morgendlichen dichten Verkehr. Sie betrachtete seine Hände am Lenkrad, die langen, kräftigen Finger in den dünnen Autohandschuhen. Ihr Blick wanderte zu seinen schlanken, muskulösen Beinen in der marineblauen Hosen; plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie ihn anstarrte und er ihr beiläufiges Interesse als ernsthaft auffassen könnte, wenn sie nicht vorsichtig war. Da sie von Natur aus romantisch veranlagt und zutiefst frustriert war, erkannte sie die Alarmsignale in ihrem Verhalten.
Nach ein paar Minuten des Schweigens wagte sie eine Bemerkung.
«Sie haben etwas von einer Schwester gesagt, haben Sie Kontakt mit ihr?»
«Nicht so oft, wie mir lieb wäre. Sie arbeitet im Ausland, in Brüssel, daher sehe ich sie nur selten. Was ist mit Ihnen – haben Sie Geschwister?»
«Ich bin ein Einzelkind. Mein Vater ist vor ein paar Jahren gestorben. Meine Mutter wohnt in der Nähe; ich sehe sie ziemlich regelmäßig – allerdings sind es eher Pflichtbesuche, denn wir kommen nicht besonders gut miteinander aus. Ich habe meine eigene Familie, ein Mädchen und einen Jungen.»
Deborah hörte sich unermüdlich weiterplappern und verstummte unvermittelt. Sie wusste selbst nicht, warum sie einem vollkommen Fremden so viel über sich preisgab, und fühlte sich bloßgestellt. Aber er wirkte so vertrauenswürdig, schien sich aufrichtig für sie zu interessieren, obwohl er sie durch ein Tohuwabohu von aggressiven Fahrern in schwarzen Taxis und tollkühnen Fahrradkurieren steuern musste. Unwillkürlich dachte sie an Derek, der schon unter günstigsten Umständen kaum Interesse an dem zeigte, was sie sagte, auf gar keinen Fall aber beim Autofahren.
Er freute sich über ihre Zutraulichkeit. Sie wirkte sichtlich entspannter. Wichtiger aber war, dass sie den Straßen, durch die sie fuhren, kaum Aufmerksamkeit schenkte.
«Ich muss kurz anhalten und ein paar Stoffmuster abholen, die ich ins Büro bringen soll. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus; es dauert nur einen Moment.»
«Kein Problem. Sie scheinen doch trotz des Verkehrs gut voranzukommen, und wir müssen erst um zehn da sein, oder?» Deborah erwiderte sein dankbares Lächeln und machte es sich in dem Ledersitz bequemer.
Langsam fuhr er in eine Nebenstraße der Kensington High Street und gleich danach in eine schmale Gasse, die im rechten Winkel davon abzweigte. Er hatte sich vor einigen Wochen für die Stelle entschieden und sie mehrmals besucht, um sich zu vergewissern. Die meisten Anwohner waren um diese Zeit wohl zur Arbeit gegangen, und die wenigen anderen brachen ganz sicher noch nicht zum Einkaufen auf. Er hielt vor einer Doppelgarage auf der schattigen Straßenseite, wo zwei Lorbeerbäume in Kübeln die Beifahrerseite des Autos abschirmten.
Er öffnete die Fahrertür, womit durch die Zentralverriegelung auch alle anderen Türen und die Kofferhaube aufgingen, ließ seine Tür offen, ging um das Auto herum zum Kofferraum, zog den Reißverschluss des kleinen Necessaires auf, das er dort verstaut hatte, und holte die Spritze heraus. Im Schatten der Kofferhaube, von der Straße wie von der Frau auf dem Beifahrersitz abgeschirmt, überprüfte er sorgfältig die Dosis und verbarg die Spritze anschließend in der ausgestreckten linken Hand.
Gerade laut genug, dass es im Innern des Wagens zu verstehen war, rief er: «Mrs. Fearnside, es tut mir Leid, dass ich Sie noch einmal belästigen muss, aber könnten Sie mir vielleicht kurz helfen?»
Deborah riss sich aus ihrem Tagtraum und löste den Sicherheitsgurt. Sie drehte sich zur offenen Tür um und stellte fest, dass er schon da stand, mit dem Rücken zur hinteren Beifahrertür und die rechte Hand ausgestreckt, um ihr beim Aussteigen zu helfen. Noch sitzend streckte sie ihm ihre Linke entgegen und rechnete mit einem leichten Erschauern bei der Berührung. Sanft drehte er ihre Hand, als wollte er sie küssen. Sie schaute ihm erwartungsvoll in die Augen und registrierte erstaunt seinen stechenden Blick.
Deborah verspürte einen plötzlichen Anflug von Angst, als ihr klar wurde, dass sie nichts über diesen faszinierenden Fremden wusste, der sich da so entschlossen über sie beugte. Sie wollte ihm ihre Hand entziehen, doch sein Griff wurde fester. Seine linke Hand glitt auf sie zu und stach ihr die Nadel in die Ader auf dem Handrücken. Sie hatte gerade noch Zeit, «Nein» zu murmeln, dann lahmte das Betäubungsmittel ihr Nervensystem, und sie sank in einen Zustand am Rande der Bewusstlosigkeit.
Er hatte ihr für ihre Größe und ihr Gewicht, über die sie in der Bewerbung so ausführlich Auskunft gegeben hatte, die maximale Dosis verabreicht. Das Ganze hatte nicht einmal eine Minute gedauert. Behutsam brachte er ihren Körper wieder in Position, stellte den Sitz schräger und legte ihr den Sicherheitsgurt wieder an. Ein kleines Kissen vom Rücksitz platzierte er in ihrem Nacken, sodass ihr Kopf nicht von einer Seite zur anderen rollte. Seine Schirmmütze und die Chauffeursjacke verschwanden im Kofferraum.
Als er aus der Gasse hinausfuhr, sahen sie aus wie ein perfektes Paar, sie war müde und fürsorglich für die Reise gebettet, er saß mit weißem Hemd und dunkler Krawatte aufmerksam am Steuer des stattlichen BMW. Er schätzte, dass ihm sechs bis acht Stunden blieben, bis sie wieder zu sich kam, also genügend Zeit, um sein Ziel zu erreichen. Er fuhr schnittig und selbstbewusst, aber immer am Tempolimit, die Kensington High Street entlang, an Olympia vorbei und weiter nach Hammersmith. Auf der M4 ging es Richtung Westen, und zwei Stunden später war er durch Reading bereits durch. Als er von der Schnellstraße abfuhr, Severn Bridge hinter sich ließ und jenseits von Monmouth einen Feldweg in den Black Hills hinab fuhr, war Deborah immer noch bewusstlos. Nach einigen Meilen kam ein kleines Ferienhaus in Sicht.
Während der Fahrt hatte sich der Himmel zugezogen und eine dunkelgraue Sturmfärbung angenommen. Die ersten dicken Tropfen von dem, was ein gewaltiger Wolkenbruch zu werden drohte, prasselten ihm auf die Glatze, als er die Tür des Ferienhauses aufschloss.
Er kehrte zum Auto zurück, tauschte die Lederhandschuhe gegen weiche aus dünnem, hautengen Latex aus und streifte Deborah ebensolche über. Dann hob er sie hoch, trug sie in ein kleines Schlafzimmer im hinteren Souterrain des Ferienhauses, legte sie auf das Bett und ging noch einmal hinaus, um seine restlichen Vorräte zu holen und den BMW in der angrenzenden Scheune zu verstecken.
Binnen einer Stunde hatte er mit jahrelang trainiertem Geschick alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen. Er hatte das Bett abgezogen und darauf und darunter große, stabile Plastikplanen ausgebreitet. Deborahs leblosen Körper hatte er entkleidet, abgesehen von einer Duschhaube und den Gummihandschuhen. Hand- und Fußgelenke hatte er mit Nylonseilen an dem schweren schmiedeeisernen Bettgestell festgebunden. Die Vorhänge waren zugezogen, nur eine Vierzig-Watt-Glühbirne, die unter einem unpassenden Lampenschirm aus rosa Tüll in der Mitte der niedrigen Decke hing, spendete spärliches Licht.
Auf einer soliden, schmucklosen Kommode hatte er Papiertücher, ein frisches Paar Handschuhe, eine Schürze, einen Knebel – falls erforderlich – und einen großen Krug mit kaltem Wasser angeordnet. Das Zimmer war nicht geheizt; heulend pfiff der Sturmwind durch die Ritzen des Holzfensterrahmens. Zuletzt legte er die Instrumente auf den Nachttisch, wo sie sie beim Aufwachen sehen würde – Skalpelle, ein Tranchiermesser, eine dünne Drahtschleife mit Holzgriffen, Pinzetten.
Als alles bereit war, setzte er sich in die rustikale Küche, trank eine Tasse heißen Kaffee und richtete sich aus seinen Vorräten eine leichte Mahlzeit an. Allmählich musste sie zu sich kommen. Sie war festgebunden, die Tür abgeschlossen, und sie konnte sich die Lunge aus dem Hals schreien, ohne dass sie jemand hören würde. Das Ferienhaus lag abgeschieden. Sicher, auf der Karte hatte er gesehen, dass es selbst in diesem entlegenen Landstrich einen Wanderweg gab, aber an diesem zunehmend stürmischen und grauen Abend würde er zweifellos nicht gestört werden. Er konnte seiner Arbeit nachgehen.
4
Kurz nach siebzehn Uhr, als der Sturm um das Ferienhaus tobte, an den Läden rüttelte und im Kamin heulte, hörte er ein leises Stöhnen. Er wartete geduldig, wohl wissend, dass es bald zu einem Schrei anschwellen würde, der es mit dem fürchterlichsten Heulen des Sturms aufnehmen konnte. Vage war ihm bewusst, dass er die nächsten Stunden unangenehm finden würde, doch er unterdrückte den Gedankengang und zwang sich zur Ruhe. Sie war nur eine Frau, aber Frauen konnten verschlagenere Gegner sein als Männer.
Mit großer Sorgfalt legte er seine Maske an. Nach einigem Nachdenken war er zu dem Ergebnis gekommen, dass sie sich kooperativer verhalten würde, wenn sie eine Chance sah zu überleben. Und sie war schlau genug zu wissen, dass ein Entführer, der sich seinem Opfer unverhüllt zeigte, dieses nie lebend gehen lassen würde. Außerdem tröstete ihn der Gedanke an eine Verkleidung. Das Ganze würde ihm schwer genug fallen, aber preiszugeben, wer er wirklich war, und ihren Hass zu sehen, ihren Abscheu, das würde er nicht ertragen. Es war wichtig, dass sie nicht mehr den Chauffeur in ihm sah.
Die minimale Verkleidung war schnell zurechtgelegt; mit dünnen Polstern unter dem weiten schwarzen Hemd und zwei Paar Jogginghosen sah er mindestens vierzehn Pfund schwerer aus. Farbige Kontaktlinsen – angesichts seiner eigentlichen Augenfarbe war Dunkelbraun nötig – und ein Hauch Make-up veränderten sein Aussehen vollkommen und ließen ihn ausdruckslos und bedrohlich zugleich wirken. Eine schwere Goldkette um den Hals und ein enger Kopfschutz vollendeten die Verwandlung. Die Handschuhe trug er immer noch; er hatte sie kein einziges Mal abgelegt, seit er das Haus betreten hatte.
Ihren ersten wahren Schreckensschrei hörte er, als er die Gesichtsmaske über das Kinn zog. Es folgten weitere kurze, keuchende Schreie, von denen er eine Gänsehaut bekam. Sie erinnerten ihn an die Füchsin, die er einmal auf der Farm eines Freundes in einer Falle gefunden hatte; Qual und Angst hatten das Tier so Mitleid erregend winseln lassen, dass er schnellstens losgerannt war, um Hilfe zu holen. In seiner kindlichen Unschuld hatte er geglaubt, der Vater seines Freundes würde das verstümmelte Tier retten. Er wusste noch, wie er mit dem Mann zu der Stelle gelaufen war – und wie er dann mit dem erstorbenen «Nein!» auf den Lippen daneben stand und zusah, wie der Mann das Gewehr hob und das hilflos am Boden liegende Tier erschoss. Seither hatte er viele schlimmere Tode gesehen, aber keiner hatte ihn so tief erschüttert.
Brüsk stieß er die Tür zu dem kleinen Zimmer auf.
«Maul halten!» Er sprach absichtlich mit rauer Stimme und schlug einen anderen Ton an als den, der ihr zuvor so zugesagt hatte.
Beim Anblick des bedrohlichen dunklen Fremden in der Tür schrie Deborah nur noch lauter.
«Halt endlich dein Scheißmaul, sonst näh ich dir die verdammten Lippen zu.»
Ihre Schreie klangen zu einem jämmerlichen Wimmern ab; die Angst machte es ihr unmöglich, zusammenhängende Worte zu formulieren. Sie hatte an den Fesseln gezerrt. Die Knoten waren so verschlungen, dass sie sich bei Widerstand zusammenzogen, daher gruben sich die Stricke in ihre Handgelenke und scheuerten die Haut so auf, dass bei jeder Bewegung Blut floss.
Er trat an das Bett und sah auf sie hinab. Sie versuchte, sich in die Matratze zu drücken und vor ihm zurückzuweichen, doch es gab kein Entrinnen. Durch seine Nähe noch mehr verängstigt, drehte sie den Kopf von ihm weg. In einem letzten verzweifelten Versuch, ihn zu verdrängen, kniff sie die Augen zu wie ein kleines Kind, das so tut, als wäre das Ungeheuer nicht da, wenn man es nicht sieht.
Seine kalte, gleichgültige Stimme zerstörte ihre Illusion und ließ sie verstummen.
«Hör mir gut zu. Sei still, sei ein braves Mädchen, und dir wird kein Leid geschehen. Ich möchte einem so hübschen Mädchen nicht wehtun, ja?» Mit dem in Latex gehüllten Zeigefinger strich er ihr sanft über Wange, Lider und Brauen. «Ich bin sicher, du kannst ein braves Mädchen sein, wenn du nur willst. Denn wenn nicht…» Schnell wie eine Viper nahm seine Hand ihren Unterkiefer in einen schmerzhaften, unerbittlichen Klammergriff. «Wenn nicht, dann muss ich dich töten, klar. Aber erst, nachdem ich mir meinen Spaß gegönnt habe.»
Er drückte zu, bis er ihren Kieferknochen knirschen hörte und ihr vor Schmerz Tränen über das verzerrte Gesicht liefen. Dann ließ er unvermittelt los.
«Sieh mich an.» Er ließ die Finger an ihrem Hals liegen und wartete, aber ihre Lider blieben fest zusammengekniffen, und sie drehte das Gesicht so weit weg, wie seine Hand es nur zuließ. Ohne Vorwarnung schlug er ihr klatschend auf die Wange. Ihr Kopf wurde von der Wucht des Schlages herumgerissen, und sie stöhnte, während ein dünnes Rinnsal Blut von ihrem Mundwinkel in Richtung Hals floss. Erneut umklammerte er ihren Kiefer und drehte ihren Kopf zu sich herum. Seine Stimme klang ölig und kalt.
«Debbie, Liebste, ich habe gesagt, du sollst mich ansehen. Mach die Augen auf! Los!»
Er drückte zu, bis er die Zähne knirschen hörte. «Los», flüsterte er.
Deborah schlug die Augen auf und blickte in seine. Nun sah er keinen Widerstand mehr, sondern nur noch blankes Entsetzen. Sie befand sich gefährlich dicht an der Grenze zwischen Vernunft und der Flucht in den Irrsinn; er musste sie von dort weglocken, oder er lief Gefahr, zu viel Zeit zu vergeuden, um das Nötige in Erfahrung zu bringen.
«Debbie», gurrte er, «teuerste Debbie. Du musst nicht solche Angst vor mir haben. Ich will dir nicht zu sehr wehtun – eigentlich würde ich liebend gern ganz darauf verzichten.»
Er unterstrich seine Worte mit einem beschwörenden Blick und wurde mit einem Ausdruck der Verblüffung belohnt. «Hör mir genau zu. Du bist nur hier, weil du etwas weißt, das ich wissen muss. Es ist ein Geheimnis, in das du mich einweihen musst, wenn du lebend hier rauskommen willst.»
Wieder lag Verwirrung in ihrem Gesicht, aber auch ein Anflug von Kampfgeist. Er hatte ihr die Hoffnung als ein Tau hingeworfen, an dem sie sich vom Abgrund ihrer wahnsinnigen Angst hochhangeln konnte.
«Was … was wollen Sie von mir?» Ihre Stimme klang eingerostet, trocken und brüchig. «Sagen Sie es mir! Ich weiß nichts Wichtiges; Sie haben die Falsche entführt. Bitte lassen Sie mich gehen. Sie können nicht mich meinen, Sie …» Sie verstummte, als er ihren Kiefer wieder fester umfasste.
«Hab Geduld, Liebste. Ich weiß, dass du es bist, verstehst du, weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe und ganz sicher bin.»
«Aber ich habe Ihnen doch gesagt, ich weiß nichts. Ich bin eine ganz normale Frau. Bitte lassen Sie mich gehen. Ich kann Ihnen nichts sagen, was ich nicht weiß.» Ihr Ton wurde umso nachdrücklicher, je mehr ihre Überzeugung wuchs, dass sie einem schrecklichen Irrtum zum Opfer gefallen war, und mit dieser Überzeugung ging eine trotzige Entrüstung einher. «Sie können mich nicht einfach hier festhalten!» Sie sah, dass es draußen dunkel war. «Meine Kinder kommen von der Schule nach Hause. Sie müssen mich gehen lassen. Ich bin nicht die, die Sie wollen!»
Er schenkte ihren Einwänden keine Beachtung, entließ sie aus seinem Klammergriff und wollte gehen.
«Hören Sie zu!», kreischte sie. «Warum hören Sie mir nicht zu? Verdammt, kommen Sie zurück!» Mit katzenhafter Schnelligkeit war er wieder beim Bett, kniete sich über sie und schlug sie mit der flachen Hand immer wieder auf beide Wangen, so heftig, dass ihr Kopf bei jedem Schlag von einer Seite auf die andere geschleudert wurde.
«Sei still! Ich habe dir gesagt, dass du diejenige bist, die ich wollte. Noch ein Ton, und ich nähe dir wirklich die Lippen zusammen. Ich habe dich gewarnt. Du kannst die Antworten, die ich von dir will, ebenso gut aufschreiben wie aussprechen.»
Sie sah ängstlich, aber stumm zu ihm auf. Die Prügel hatten sie gefügig gemacht. Er glitt vom Bett und verließ ohne ein weiteres Wort das dunkle Zimmer.