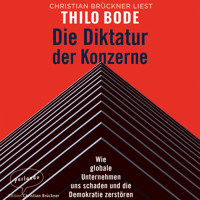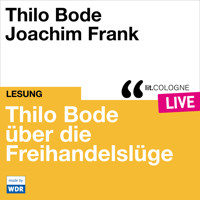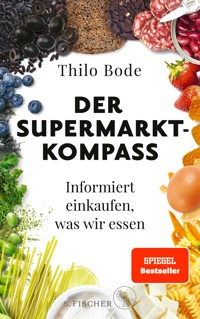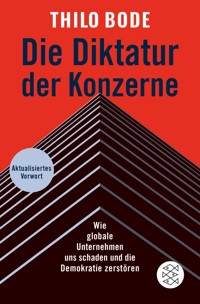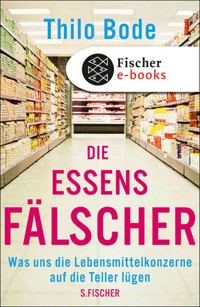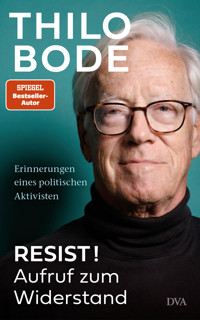
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Bestsellerautor und streitbare Umwelt- und Verbraucherschutzaktivist zieht eine nüchterne Bilanz, aber ist sich sicher: Wir haben eine echte Chance, die Gesellschaft nachhaltig zu verändern
Thilo Bode ist einer der profiliertesten und streitbarsten Umwelt- und Verbraucherschutzaktivisten. Nach mehreren Jahren in der Entwicklungshilfe und einer Zwischenstation in einem Metallkonzern wurde er Direktor von Greenpeace. Er demonstrierte auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking und wurde verhaftet, sprach vor der UNO-Vollversammlung und trug maßgeblich dazu bei, das EU-Freihandelsabkommen TTIP mit den USA zu verhindern. Er attackierte Lebensmittel- und Ölkonzerne und legte sich mit Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann an. Als Chef von Greenpeace und später Foodwatch verantwortete Thilo Bode Kampagnen, die ganze Branchen veränderten. Sein selbstkritischer Blick auf Erfahrungen, unbestreitbare Erfolge und bittere Fehlschläge ist zugleich ein Aufruf zum Widerstand: Die Zivilgesellschaft muss effektiver und kompromissloser werden, um die Gesellschaft nachhaltig zu verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Konzerne übernehmen die Macht, Demokratien weichen zurück, die Umwelt wird ungebremst zerstört – was können wir ausrichten?
Thilo Bode ist einer der bekanntesten und streitbarsten Umwelt- und Verbraucherschutzaktivisten der vergangenen Jahrzehnte. In seinem neuen Buch blickt er zurück auf seine Tätigkeit zunächst in der Entwicklungshilfe, dann über viele Jahre an der Spitze von Greenpeace und foodwatch. Was haben Umwelt- und Verbraucherschützer seit den
1980er-Jahren erreicht und wo sind sie gescheitert? Welche Formen des Protests wirken? Thilo Bodes selbstkritische Bilanz ist ein Aufruf zum Widerstand: Nichtregierungsorganisationen dürfen sich nicht in Gremien mit Konzernen gemein machen und schon gar nicht vom Staat bezahlen lassen. Wir alle müssen Widerstand leisten: gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und die Aushöhlung der Demokratie.
Thilo Bode, geboren 1947, ist einer der einflussreichsten politischen Aktivisten der vergangenen Jahrzehnte. Er studierte Soziologie und Volkswirtschaft, arbeitete danach in der Entwicklungshilfe und in einem Metallkonzern. 1989 wurde er Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, 1995 bis 2001 von Greenpeace International. 2002 gründete er die Verbraucherschutzorganisation foodwatch e. V., die er bis 2017 als Geschäftsführer leitete. Danach war er bis 2021 Direktor von foodwatch International. Er ist Autor mehrerer Bestseller, darunter Die Essensfälscher. Was uns die Lebensmittelkonzerne auf den Teller lügen (2011), Die Freihandelslüge: Warum TTIP nur den Konzernen nützt – und uns allen schadet (2015), Die Diktatur der Konzerne (2018) und Der Supermarkt-Kompass (2023).
Stefan Scheytt, geboren 1962, ist freier Journalist und schreibt seit vielen Jahren regelmäßig für das Hamburger Wirtschaftsmagazin brand eins. Seit 2010 ist dieses Buch das fünfte, bei dem er Thilo Bode als Mitautor begleitet hat. Scheytt lebt mit seiner Familie in Rottenburg am Neckar.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
THILO
BODE
unter Mitarbeit von Stefan Scheytt
RESIST!
Aufruf zum
Widerstand
Erinnerungen
eines politischen
Aktivisten
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Redaktionsschluss: 15. Juni 2025
Copyright © 2025 by Deutsche Verlags-Anstalt, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Lektorat: Ludger Ikas, Berlin
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung: © Peter Rigaud/laif
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33252-5V001
www.dva.de
Für Oskar, Elly und Luca
Inhalt
Vorwort
1 Entwicklungshilfe
Philippinen: Unter Palmen
Somalia: 50 Jahre Entwicklungshilfe und ein »Failed State«
China – der Sprung ins Industriezeitalter
Tunesien – Armut vor unserer Haustür
2 Lehrjahre im Metallkonzern
3 Greenpeace
»Geldmaschine Greenpeace«
Das Plagiat
Für Zeitschriften und Windeln: Kahlschlag im Urwald
Greenpeace und das Recht
Greenfreeze: Die Kühlschrankrevolution
SmILE: Gleiche Leistung, halber Verbrauch
Vor 30 Jahren: Greenpeace fordert Klimageld
Brent Spar: Die Macht der Bilder
Mein Weg »nach oben«
Protest auf dem Platz des Himmlischen Friedens
Greenpeace International
Kampagnen in Diktaturen
Bilanz
4 foodwatch
Scheinlösung Bio
»Abgespeist« und »Goldener Windbeutel«
foodwatch wird international
Die Unvollendete: Nährwertampel
Vom Staat geduldet: Mineralöl im Essen
TTIP und CETA: Freihandel ja, aber nur mit Demokratie
Hände weg vom Acker, Mann!
Geburtstagsparty im Kanzleramt
Bilanz
5 Resist – Widerstand statt Kooperation
Was haben wir falsch gemacht?
Kein Mangel an Lösungen, aber mangelhafte Umsetzung
Die NGOs in der Konsensfalle
Zähmung in der Brüsseler Blase
»Setzt mich unter Druck« – kein Schmusekurs mit Parteien
NGOs in der Wachstumsfalle
Klima- und Umweltpolitik sind Verteilungspolitik
Widerstand – keine Angst vor Beifall von der falschen Seite
Dank
Anmerkungen
Register
Vorwort
Anfang 2017 kletterten sieben Aktivisten von Greenpeace auf einen Baukran in der Nähe des Weißen Hauses in Washington und entrollten in knapp 90 Metern Höhe ein riesiges Transparent, das für ein paar Stunden über dem Haus des mächtigsten Mannes der Welt flatterte. Darauf war ein einziges Wort zu lesen: RESIST.
Das Bild hat mich nicht mehr losgelassen, während ich an diesem Buch schrieb. Denn es rührt an die entscheidende Frage, die mein Leben als politischer Aktivist durchzieht: Wie können wir, die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und damit die Zivilgesellschaft, eine ökologische, soziale, gerechte und friedliche Welt schaffen?
Es sieht nicht gut aus: Trotz massiver Entwicklungshilfe hat sich die Zahl der Armen in den besonders betroffenen Regionen wie den Ländern südlich der Sahara erhöht, leiden Millionen Menschen an Unter- und Mangelernährung. Trotz beeindruckender Erfolge in der Umweltpolitik wie dem Schutz der Ozonschicht, der Ausweisung großer Schutzgebiete in den Weltmeeren oder dem stark wachsenden Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch: Der Ausstoß an Treibhausgasen steigt ständig und heizt das Klima auf, der Raubbau an Wäldern und der Verlust an Biodiversität gehen weiter, die Stärkung von Verbraucher- und Bürgerrechten scheitert an Konzerninteressen.
Und nun auch noch ein US-Präsident, der ein beispielloses Rollback losgetreten hat, dessen Wellen auch die Europäische Union erreichen: Errungenschaften in der Umweltpolitik werden wieder infrage gestellt, etwa die bereits beschlossene Absenkung der CO2-Grenzwerte für Pkw oder die Verpflichtung für Konzerne, in ihren Lieferketten Umwelt- und Menschenrechtsstandards einzuhalten (Lieferkettengesetz). Sogar von der Zivilgesellschaft erkämpfte demokratische Rechte, wie das Informationsfreiheitsgesetz und die Möglichkeit für Verbände, auch Regierungen und Behörden bei Gesetzesverstößen zu verklagen, stehen auf einmal zur Disposition.
Und schließlich: Es hat wieder ein Wettrüsten begonnen, und Krieg wird als Voraussetzung für Frieden beschrieben, wohl wissend, dass nicht nur ein großer Krieg, sondern bereits die Vorbereitungen darauf all unsere Bemühungen für eine ökologische, soziale und in Frieden lebende Gesellschaft zunichtemachen dürften.
Trotz alledem: Meine Zuversicht, dass wir unsere Ziele erreichen können, ist beim Verfassen dieses Buchs gewachsen. Der Grund? Wir haben heute – anders als vor fünfzig Jahren – für alle großen Probleme dieser Welt Lösungen: Wir verfügen über die Erfahrung und das Know-how, die kohlenstoffbasierte Energieversorgung vollständig auf erneuerbare, nachhaltige Energien umzustellen; es ist möglich, durch eine kluge Politik den Verlust an Biodiversität zu stoppen; wir können zehn Milliarden Menschen ökologisch und gesund ernähren; und wir wissen, wie wir unsere Demokratie robuster gegen den Einfluss von Konzerninteressen machen können.
Doch obwohl die Lösungen auf dem Tisch liegen, passiert zu wenig. Das muss uns zu denken geben. Meine Schlussfolgerung ist, dass wir, die NGOs als Teil der Zivilgesellschaft, uns wieder auf unsere eigentlichen Stärken besinnen und einsehen müssen, dass unsere »Macht« in der Konfrontation besteht, nicht in der Kooperation. Anstatt Veränderungen über die Teilhabe an der Macht von Regierungen und Konzernen durchzusetzen, müssen wir öffentlich Widerstand leisten, Druck ausüben, die Mächtigen kontrollieren und nicht mit ihnen in Kommissionen, Konferenzen und an »runden Tischen« kooperieren. Und schon gar nicht dürfen wir NGOs uns vom Staat oder von Konzernen finanzieren lassen.
Wie ich zu diesen Erkenntnissen gekommen bin, will ich in diesem Buch anhand meiner beruflichen Stationen erzählen: als Berater in der Entwicklungszusammenarbeit (1975 – 1986) mit Beispielen aus den Philippinen, Somalia, Tunesien und China, als Vorstandsassistenz in einem mittelständischen Metallkonzern (1986 – 1989), als Geschäftsführer bei Greenpeace Deutschland (1989 – 1995) und Exekutivdirektor bei Greenpeace International (1995 – 2001) sowie schließlich als Gründer und Direktor von foodwatch (2002 – 2021).
1Entwicklungshilfe
Philippinen: Unter Palmen
Liest man die folgende Beschreibung meiner ersten beruflichen Erfahrungen in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre, kann man leicht auf eine falsche Fährte geraten. Ich lebte auf der philippinischen Insel Cebu und bewohnte ein ansehnliches Haus mit Garten in einem Villenviertel der Inselhauptstadt Cebu City. Zwei »Hausmädchen«, wie man das damals nannte, hielten Ordnung in Haus und Garten, sie putzten, wuschen meine Wäsche und kochten, was immer ich mir wünschte, weil sie zuvor andere ausländische Experten zu bekochen gelernt hatten. Am Wochenende stellten sie mir einen Picknickkorb hin für den Ausflug an den Strand, wohin mich mein Fahrer im Jeep chauffierte. Manchmal verbrachten meine Kollegen und ich das Wochenende auch auf der Segeljacht unseres Projektchefs. Mein deutsches Gehalt samt Zulagen kamen zuverlässig und entfalteten auf Cebu Island eine Kaufkraft, die mich anstrengungslos zum Sparer machte. Im Weihnachtsurlaub flog ich zum Skifahren in die Schweiz, um dann wieder zur Arbeit in die Südsee zurückzujetten.
Ich war gerade dreißig und begeistert: mein erster richtiger Job, und dann gleich so einer. Das Einzige, was ich vermisste, waren Regen und Kälte, und manchmal träumte ich davon, wie ich frierend unterm Schirm an einer Straßenbahnhaltestelle in Deutschland warte. Davon abgesehen war es ein Leben und Arbeiten »unter Palmen«. Ich war angekommen, wohin es mich immer gezogen hatte: in der Entwicklungshilfe. Also dort, wo es – im Gegensatz zur humanitären Hilfe in akuten Krisensituationen – um die langfristige Entwicklung ärmerer Länder ging.
Schon während des Studiums der Soziologie und der Volkswirtschaft in den 1960er- und 1970er-Jahren in München und Regensburg war mir klar, dass ich einmal in diesen Bereich gehen wollte. Eine gerechtere, von Armut und Hunger erlöste Welt zu schaffen, das war damals eines jener Themen, über das sich Studierende die Köpfe heiß redeten. Und ich, der ich schon als Abiturient in meinem Heimatdorf Herrsching am Ammersee einen Juso-Ortsverein gegründet hatte, war mittendrin. Meine Diplomarbeit beschäftigte sich folgerichtig mit Entwicklungspolitik, und auch meine Dissertation über Direktinvestitionen in Malaysia hatte Berührungspunkte mit dem Thema. Aber natürlich trieb mich als jungen Mann nicht allein der Edelmut, armen Menschen in armen Ländern zu helfen, sondern auch die Abenteuerlust: Ich wollte raus, die Welt sehen, aufregende Erfahrungen machen.
Die Philippinen waren eines meiner ersten Einsatzländer. Ich arbeitete dort ein gutes Jahr als Angestellter einer großen deutschen Consulting-Firma. Im Auftrag der philippinischen Wasserbehörde und finanziert von der Asiatischen Entwicklungsbank prüften wir, ob ein Staudamm in den Bergen für die Wasserversorgung der Inselhauptstadt Cebu City machbar und wirtschaftlich sinnvoll wäre. In Kooperation mit einem dänischen Consulting-Unternehmen untersuchten wir auch das alternative Konzept, Cebu City aus dem Grundwasser zu versorgen. Nicht, dass wir Staudammberater unsaubere Analysen und Berichte erstellt hätten, aber selbstverständlich war unser Interesse als kommerzielles Beratungsunternehmen, dass möglichst viel Geld bewegt werden würde – was für den Staudamm und gegen die Grundwasser-Lösung sprach. In unserem modern ausgestatteten Büro in der Universität von Cebu City arbeiteten neben zahlreichen einheimischen Ingenieuren und Verwaltungskräften zwanzig bis dreißig ausländische Berater, darunter Deutsche, Dänen, ein Geologe aus dem damaligen Jugoslawien, ein Forstexperte aus Ceylon, unser Projektchef, ein knorriger Neuseeländer und Kriegsveteran, sowie ein US-amerikanischer »report writer«, der darauf spezialisiert war, unsere Berichte in lesbare englische Prosa für die internationalen Finanzierungsinstitutionen zu übersetzen.
Später, in anderen Ländern, bestand meine Aufgabe in der Regel darin, eine Wirtschaftlichkeitsanalyse der jeweiligen Entwicklungshilfeprojekte zu erstellen. Hier aber, auf Cebu Island, sollte ich einen Umsiedlungsplan für die Menschen entwickeln, die im Wassereinzugsbereich des geplanten Staudamms lebten. Zuvorderst musste ein Zensus über die lokale Bevölkerung und deren Struktur durchgeführt werden. Mit einem Team von Soziologie-Studentinnen und -Studenten wanderten wir mehrere Tage auf schmalen Pfaden zu den kleinen verstreuten Gehöften an den Steilhängen des Tals, das den Stausee einmal aufnehmen sollte; die Menschen lebten dort unter einfachsten Verhältnissen als selbstversorgende Wanderfeldbauern, ohne Strom und befestigte Straßen. Für den Umsiedlungsreport erfassten wir, wie viele Menschen es waren, wie alt sie waren, wie viele und welche Tiere sie hielten, was sie anbauten. Sie waren uns gegenüber sehr freundlich und ließen sich nicht anmerken, was sie wirklich dachten. In meiner Gutgläubigkeit ging ich fest davon aus, dass die philippinische Regierung und die Entwicklungsbanken angemessen für diese Menschen sorgen und ihnen neues Land samt Häusern und Tieren zur Verfügung stellen würden. So erzählten wir es den Menschen auch und versicherten ihnen, sie würden auch an ihrem neuen Ort ein gutes Leben führen können.
Zur Umsiedlung dieser rund 5500 Menschen ist es zum Glück nie gekommen. Etwa zwanzig Jahre später nutzte ich eine Dienstreise für Greenpeace nach Ostasien zu einem privaten Abstecher nach Cebu Island und fuhr noch einmal hinauf in das enge Tal. Es stand dort keine Staumauer, ganz offensichtlich hatte man die Wasserversorgung aus dem Grundwasser am Ende doch für sinnvoller befunden. Es lebten dort auch viel weniger Menschen, als wir in unseren Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung vorausgesagt hatten; die meisten waren in die Stadt abgewandert, um im aufblühenden Tourismus der Insel ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Blind für die Realität
Wenn ich heute auf meine ersten Jahre in der Entwicklungshilfe schaue, wundere ich mich über mich selbst. Es erscheint mir im Rückblick abenteuerlich naiv, dass ich damals die Zusicherung der philippinischen Regierung nicht energischer hinterfragt habe, man werde sich um die Zwangsumgesiedelten kümmern – zumal wir seinerzeit bereits Hinweise darauf hatten, dass das versprochene Land längst vergeben war. Ich frage mich, wie ich verdrängen konnte, dass die Zusage der fürsorglichen Behandlung ausgerechnet vom diktatorischen Regime des Marcos-Clans kam, der, gestützt von der feudalen Machtelite, das Land mit eiserner Hand regierte. Wir Berater erlebten damals immer wieder nächtliche Ausgangssperren, die für uns selbst allerdings nur bedingt galten: Wir hatten Ausweise, mit denen wir durch alle Kontrollen kamen, und wenn ein Polizist uns dennoch aufhalten wollte, drückten wir ihm Geld in die Hand, um doch noch in die nächste Bar zu kommen. Unser Gefühl, »unter Palmen« zu arbeiten, hatte unsere Urteilskraft sediert.
Erst viel später dämmerte mir, dass Entwicklungshilfe nicht wirklich zur Überwindung der Armut beitragen kann – Wasserversorgung hin oder her –, solange die gesellschaftlichen Machtverhältnisse des jeweiligen Landes dies nicht zulassen. Auf den Philippinen beherrscht trotz formaler Demokratie tatsächlich auch heute noch eine feudale Landbesitzerkaste das Land, das deshalb ungeachtet seines großen ökonomischen Potenzials in einem Zustand sehr ungleicher Verteilung von Einkommen und Besitz gefangen ist. Dementsprechend ist vor allem die ländliche Armut beschämend hoch. Aktuellen Daten zufolge liegt der Anteil der gesamten Bevölkerung mit einem Einkommen von weniger als 4,20 Dollar pro Tag bei 29 Prozent. Die Armutsquote der ländlichen Bevölkerung dürfte deshalb noch deutlich höher liegen.[1] Jenseits der Wolkenkratzer und Glaspaläste in der Hauptstadt Manila führen die Kleinbauern auf dem Land weiterhin ein ärmliches Leben, und auf den Zuckerrohrplantagen herrschen fast sklavereiähnliche Arbeitsverhältnisse. Dass sich in all den Jahren kaum etwas an diesen Verhältnissen geändert hat, ist der strategischen Bedeutung des Inselreiches geschuldet. Schon während des Vietnamkrieges von 1955 bis 1975 waren die dortigen Luft- und Marinestützpunkte für die USA unverzichtbar. Heute sind sie es angesichts der Großmachtrivalität mit China im Pazifik nicht minder. Der Diktator und Kleptokrat Ferdinand Marcos musste sich deshalb um den Rückhalt durch die USA und den Westen einst ebenso wenig Sorgen machen wie heute sein Sohn, Präsident Ferdinand Marcos junior. Unter solchen Bedingungen kann man von einer Landreform und der Entmachtung der Feudalherren, beides Voraussetzungen für eine faire Entwicklung des Landes, jedenfalls nur träumen.
Damals, als Berater-Greenhorn, glaubte ich noch fest an den Sinn und die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe. Es bedurfte noch einiger weiterer Erfahrungen in anderen Ländern, bis diese Gewissheit erste Risse bekam. Aber selbst dann war ich noch weit davon entfernt, Entwicklungszusammenarbeit grundsätzlich infrage zu stellen. Bei der Arbeit an diesem Buch, in dem ich auf mein berufliches Leben inklusive jener elf Jahre als Helfer und Berater in fremden Ländern zurückblicke, kam ich jedoch nicht umhin, mich mit diesen grundsätzlichen Fragen zu konfrontieren: Hilft Entwicklungshilfe den Empfängerländern wirklich? Sind die knapp elf Milliarden Euro, die das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 2024 bereitstellte, sinnvoll ausgegebenes Geld? Ich stelle diese Fragen in dem Bewusstsein, dafür von einer Seite Beifall zu bekommen, mit der ich nichts teile. Etwa von der AfD, die im Wahlsommer 2024 ein einzelnes Entwicklungshilfeprojekt in Südamerika aufspießte und viel Aufmerksamkeit erhielt für das provokante Plakat »PÜNKTLICHEZÜGEFÜRUNSSTATTRADWEGEFÜRPERU!« Es wäre allerdings grundfalsch, ein politisch so relevantes und brisantes Thema nur deshalb nicht zu bearbeiten. Vielmehr ist es meiner Meinung nach zwingend, darüber zu reflektieren, was Entwicklungshilfe leisten kann und was nicht, und somit auch darüber, was man selbst vor fünfzig Jahren als Akteur in der Entwicklungshilfe gemacht, gedacht und womöglich verdrängt hat.
In den ersten Jahren meiner Tätigkeit war ich nur mittelbar für die Entwicklungshilfe unterwegs, nämlich wie auf Cebu Island für private Beratungsunternehmen, die als Dienstleister aus staatlichen Budgets bezahlt wurden. Ich wollte dann aber auf die Seite der Geber wechseln, zu den »Guten«, wo nicht das eigene Geschäftsinteresse, sondern entwicklungspolitische, allgemeinwohlorientierte Motive im Vordergrund stehen würden. Dort, so meine Hoffnung, würden sich die ersten Zweifel als grundlos erweisen. So kam ich 1978 zur staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit Sitz in Frankfurt am Main, die für die sogenannte »finanzielle Zusammenarbeit« mit Entwicklungsländern zuständig ist. Sie finanziert vor allem große Infrastrukturprojekte, bewegt also die größten Summen des deutschen Entwicklungshilfebudgets. Für die KfW arbeitete ich drei Jahre, die meiste Zeit davon in Afrika. Danach war ich immer wieder als externer Berater für die KfW unterwegs, ebenso für die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), die zweite wichtige sogenannte Durchführungsorganisation, die vorwiegend Berater für die Behörden in den Empfängerländern entsendet sowie kleinere Projekte finanziert und Institutionen berät.
Somalia: 50 Jahre Entwicklungshilfe und ein »Failed State«
Im März 2024 stürmen Kämpfer der islamistischen Al-Shabaab-Miliz das Syl-Hotel in Somalias Hauptstadt Mogadischu: Ein Selbstmordattentäter fährt mit einem Auto vor das Gebäude und zündet mehrere Sprengsätze, im anschließenden Chaos dringen Milizionäre ins Hotel ein. Bei der Aktion und beim anschließenden stundenlangen Schusswechsel zwischen den Angreifern und der Polizei werden Dutzende Menschen verletzt und über dreißig getötet, darunter Hotelmitarbeiter, drei Soldaten und alle fünf Terroristen. Es ist nicht der erste Anschlag von Al-Shabaab auf das Syl-Hotel, sondern schon der dritte in jüngerer Vergangenheit: 2016 reißt eine Lkw-Bombe vor dem Hotel 22 Menschen in den Tod, 2019 liefern sich Islamisten und staatliche Sicherheitskräfte dort ein Gefecht, das mindestens fünf Menschenleben kostet.
Als ich zu Hause Bilder von gepanzerten Fahrzeugen vor dem Hotel sehe, kommen Erinnerungen hoch. Die Geschehnisse wühlen mich auf. Nicht nur, weil ich mich etliche Male an dem Strand aufgehalten habe, wo heute das Hotel steht, sondern auch, weil die Anschläge nur die jüngsten Katastrophen in einem seit Jahrzehnten andauernden Bürgerkrieg sind, der mal aufflammt, mal schwelt. Das war auch schon zu jener Zeit der Fall, als ich im Land war, und dennoch wollte ich ihn damals seltsamerweise nicht wahrhaben. Angesichts solch aktueller Ereignisse steht jedenfalls wieder die unangenehme Frage im Raum, welche Rolle Entwicklungshilfe spielen kann und soll.
Als ich bald nach meiner Anstellung bei der KfW 1978 als sogenannter Ländersachbearbeiter das erste Mal nach Somalia kam, war ich hingerissen von der wilden Schönheit des Landes. Zu der Zeit lebten dort etwa drei Millionen Einwohner, davon etwa eine Million in den wenigen Städten, die anderen verstreut auf einer Fläche, die etwa eineinhalb Mal so groß ist wie Deutschland. Auf dem Land wechselten sich Savanne, Busch und Wald ab, in den Dörfern spielten die Kinder in den Flüssen, ritten auf Wasserbüffeln, während nicht weit entfernt Nilpferde im Wasser dösten. Die Hauptstadt Mogadischu, »die Perle Ostafrikas«: weiß getünchte Häuser, tiefblaues Meer, ausladende Palmen. In dem Hotel, in dem ich meistens abstieg, einem altehrwürdigen Gebäude aus der italienischen Kolonialzeit, aßen die Gäste unter einem atemberaubend schönen Nachthimmel mit dem magischen »Kreuz des Südens« zu Abend. Aber es war anders als »unter Palmen« in den Philippinen – es war tiefes Afrika, Abenteuer.
Meine Arbeit begann ein Jahr nachdem die Lufthansa-Maschine Landshut von einem palästinensischen Terrorkommando mit dem Ziel entführt worden war, inhaftierte Mitglieder der deutschen »Roten Armee Fraktion« (RAF) freizupressen. Nach einer regelrechten Odyssee und der Ermordung des Piloten landete das Flugzeug schließlich in Mogadischu, wo die deutsche Spezialeinheit GSG 9 in einer spektakulären Aktion die Maschine stürmte und alle knapp hundert Geiseln befreien konnte. Die Erlaubnis zum Einsatz einer schwer bewaffneten deutschen Elitetruppe auf fremdem Boden hatte der SPD-Politiker Hans-Jürgen Wischnewski als Sonderbeauftragter von Bundeskanzler Helmut Schmidt in Verhandlungen mit der somalischen Regierung erwirkt. Sein Gegenüber war Präsident Siad Barre, ein Putschist, Despot und Diktator, der zu dem Zeitpunkt Krieg gegen das Nachbarland Äthiopien führte (»Ogadenkrieg«). Lange Zeit war Siad Barre ein Freund und Profiteur der Sowjetunion gewesen, bis er just in jener Zeit auf die Seite der USA wechselte.
Siad Barre ließ sich die Erlaubnis zur Stürmung des entführten Flugzeugs auf dem Flughafen seiner Hauptstadt mit viel Geld bezahlen. Und meine Aufgabe als Ländersachbearbeiter war es schließlich, einen Teil dieses Geldes in Form von Entwicklungshilfe in Somalia auszugeben. Ich erinnere mich an eine »Warenhilfe« in Höhe von drei Millionen D-Mark, die unter anderem für die Anschaffung von Transportfahrzeugen bestimmt waren. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese »Transportfahrzeuge« am Ende keine Traktoren oder Schulbusse waren, sondern militärischen Zwecken dienten. Mein Projektprüfungsbericht war am Ende nur drei Seiten lang, was meine Vorgesetzten bei der KfW in Deutschland sichtlich erfreute. Heute muss ich selbstkritisch anmerken: Auch ich habe mir damals sicher etwas dabei gedacht, nur drei Seiten zu schreiben, obwohl eine genauere Prüfung zweifellos angebracht gewesen wäre. Mit anderen Worten: Man ahnte durchaus etwas und dachte sich seinen Teil, hielt sich letztlich aber raus wie ein unbeteiligter Beobachter, obwohl man doch selbst Akteur war.
Das Gift der Korruption
Ganz ähnlich war es beim Thema Korruption. Natürlich war uns Entwicklungshelfern bewusst, dass Korruption im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben der Somalier eine Rolle spielte, aber welches Ausmaß sie tatsächlich erreichte, wollten wir vermutlich nicht wahrhaben. Ich erlebte sie gleich, als ich zum ersten Mal in Mogadischu landete. In dem Flughafengebäude, das einer Baracke glich, wollte ich, wie es damals üblich war, an der Zollstelle meinen Koffer öffnen. Der Beamte bedeutete mir jedoch energisch, ich solle das nicht tun, und hielt mir die geöffnete Hand hin. Wollte er Geld dafür haben, dass mein Koffer geschlossen bleiben durfte? Ich habe das damals nicht begriffen und darauf bestanden, den Koffer zu öffnen. Es handelte sich offensichtlich um eine Art Korruption 2.0.: Man besticht nicht erst, wenn der Zollbeamte einen beim Schmuggeln erwischt, sondern schon präventiv. Ein ähnliches Erlebnis hatte ich einige Jahre später am Flughafen von Burkina Faso, ehemals Obervolta, dessen neuer Name so viel heißt wie »das Land der Aufrechten«. Am Flughafen der Hauptstadt Ouagadougou kam man zur Leibesvisitation in eine von außen nicht einsehbare Kammer. Der Zollbeamte machte bei mir überhaupt keine Anstalten, nach Verdächtigem zu suchen, sondern auch er hielt einfach die offene Hand hin.
Der Koffer ist mir auch deshalb in Erinnerung geblieben, weil er bei einem späteren Besuch im Büro des somalischen Fischereiministers noch eine Rolle spielte, dem ich ein wichtiges neues Entwicklungshilfeprojekt vorstellen sollte. Dass man als »Sachbearbeiter« in kleineren Ländern so hochrangig empfangen wurde, war nicht unüblich. Unter uns Entwicklungshelfern gab es den Spruch »Im Inland ein Würstchen, im Ausland ein Fürstchen«. Das Projekt, um das es konkret ging, hatte zum Ziel, eine Flotte für die Küstenfischerei aufzubauen. Das war kein schlechter Plan, allerdings beinhaltete er unter anderem die kühne, um nicht zu sagen absurde Idee, auch Nomaden aus dem Inneren des Landes zu Fischern umzuschulen. Ich schlug dem Minister die Gründung einer privatrechtlich organisierten Fischereigesellschaft vor, ein ungewöhnliches Ansinnen im damals noch sozialistisch ausgerichteten Somalia. Für den Minister war das aber kein Problem. Er genehmigte den Vertrag umgehend mit seinem Daumenabdruck und fragte dann – auf meinen Koffer deutend –, ob darin das Geld für das Projekt sei.
Das war es nicht. Trotzdem steht zu vermuten, dass zumindest ein Teil der dann regulär ausbezahlten Projektgelder nicht in das Fischereiflottenprojekt floss, sondern in die Taschen des Präsidenten und seiner Clique. Damals aber redeten wir uns, wie schon angedeutet, das Thema Korruption kollektiv schön. In dem Zusammenhang fällt mir eine Veranstaltung der damaligen Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ ein (die heute Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ, heißt). Als junger Entwicklungshelfer nahm ich an einem Seminar in Deutschland mit dem damaligen Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Rainer Offergeld, teil. Offergeld ließ sich auch zum Thema Korruption ein und machte dabei seinem Namen alle Ehre, denn er wartete mit der steilen These auf, es sei für das Anliegen der deutschen Entwicklungshilfe durchaus vorteilhaft, mit korrupten Eliten zusammenzuarbeiten, denn die seien ja bereits reich und deshalb nicht mehr so anfällig. Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass auch wir deutschen Entwicklungshelfer mit den Geldern, die wir seinerzeit im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland verteilt haben, die Auseinandersetzungen unter den konkurrierenden somalischen Clans angeheizt und zum Bürgerkrieg beigetragen haben. Dreißig Jahre später legte ein UNO-Bericht dar, dass nur etwa die Hälfte der Nahrungsmittelhilfen bei den Zielgruppen ankam, während die andere Hälfte bei den Warlords landete.
Brüchige Grundannahmen
In der Rückschau wird mir klar, dass wir Entwicklungshelfer in unserer eigenen Welt des Nichtwissens und der Klischees lebten. Anders ist vieles nicht zu erklären, zum Beispiel meine Naivität bei einem Erlebnis auf einer Reise von der Hafenstadt Kismaayo im Süden in die Hauptstadt Mogadischu, knapp 500 Kilometer auf einer holprigen Piste im Land Rover. Unterwegs kamen wir an einem Dorf vorbei, in dem sich schwer bewaffnete Männer offen zeigten. Auf meine Frage, warum dies so sei, antwortete man mir, die Ortschaft müsse vor Elefanten geschützt werden, die hier immer wieder einfielen. Auf mich wirkte das glaubhaft, weshalb ich nicht weiter nachfragte. Tatsächlich gibt es solche Fälle, wenn den Tieren ihr Lebensraum genommen wird. Dass aber die kleine in Somalia noch existierende Elefantenpopulation der Grund für eine derart hochgerüstete Dorf-Festung gewesen sein sollte, war Unsinn. In Wahrheit war dieses Dorf einer der vielen Schauplätze im schwelenden Krieg der somalischen Clans, und ich als deutscher Entwicklungshelfer realisierte einfach nicht, dass ich meiner Arbeit in einem Bürgerkriegsland nachging. Wir, die wir schließlich für das Gute in der Welt unterwegs waren, waren derart auf unsere Mission fixiert, dass wir das Drumherum vielfach ausblendeten. Hauptsache, unsere Projekte wurden ordnungsgemäß durchgeführt. Ich jedenfalls war davon überzeugt, in dem Land am Horn von Afrika etwas bewirken und den armen, oft hungernden Menschen helfen zu können.
In dem Zusammenhang fällt mir ein Experte ein, der mir damals für eine gewisse Zeit zur Seite gestellt wurde, um das Projekt der somalischen Fischereiflotte voranzubringen. Es war ein durch und durch seriöser und sympathischer Mann von der Nordseeküste, ein ausgewiesener Fachmann für Fischereiwirtschaft. Unsere erste Begegnung am Flughafen in Deutschland für den gemeinsamen Flug nach Somalia hatte etwas Symbolhaftes für die Realitätsfremdheit der Entwicklungshilfe, wie wir sie betrieben: Sein Schuhwerk passte eher zu Hochwasser an der Küste, seine Windjacke war ganz sicher tauglich für Windstärke sieben, aber ungeeignet für die somalische Savanne. So flogen wir ans Horn von Afrika, fest entschlossen, unser Projekt wie geplant in Angriff zu nehmen.
Selbstverständlich bereiteten wir Entwicklungshelfer uns auf unsere Einsatzorte vor, lasen Weltbank-Berichte, sprachen vorab mit Fachkollegen und Experten. Aber über die tatsächliche politische Situation des jeweiligen Landes hatten wir meist kein profundes Wissen: Wie ist die Gesellschaft aufgebaut? Welche ethnischen Konflikte gibt es? Welche Rolle spielt die Religion, und welche Kräfte wirken von außen rein? Stattdessen basierte unsere Arbeit wesentlich auf der Theorie, dass »Unterentwicklung« in erster Linie eine Frage des mangelnden Kapitals sei. Wir folgten einem simplen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang: Die Entwicklungsländer sind arm, und wenn wir dorthin Geld für vernünftige Projekte geben und durch unsere Begleitung dafür sorgen, dass diese Projekte ordentlich abgewickelt werden, dann wird die Sache schon funktionieren. Im Rückblick ist diese Annahme lächerlich unterkomplex.
Falsch war auch die heute noch vorherrschende Erwartung, dass sich durch die Bereitstellung von Infrastruktur – Straßen, Wasserleitungen, Abwasserkanäle, Stromkabel, Kliniken, Schulen – die ökonomischen Produktivkräfte wie von selbst entfalten und zu einer prosperierenden Wirtschaft führen würden. Ein Blick in die Geschichte der Industrialisierung Europas zeigt jedoch, dass es genau umgekehrt ablief: Es waren Unternehmer, die Kapital, Menschen und Rohstoffe zusammenführten, sodass sich Industrien entwickeln konnten, die dann Druck auf die Politik ausübten, noch mehr und bessere Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen.
Höchst fragwürdig war schließlich auch die Maxime meines Arbeitgebers, der KfW, und letztlich der deutschen Regierung, die politische Stabilität eines Empfängerlandes über alles zu stellen. Keine Frage, ohne eine gewisse Ordnung und Verlässlichkeit ist es sinnlos, Projekte überhaupt anzugehen. Nur hinterfragten wir so meist gar nicht den Preis für diese projektdienliche Stabilität, die oft das Resultat diktatorischer oder quasi-diktatorischer Verhältnisse ist. Der Preis besteht darin, dass das Geld nicht in Form von Wohlstand bei der bedürftigen Bevölkerung landet, sondern zu einem erheblichen Teil für den Militärhaushalt, ja sogar zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung verwendet wird, ganz zu schweigen von den Prachtvillen und Wohnungen, die sich die jeweilige Nomenklatura damit in Paris, London und anderen attraktiven Städten im sicheren Europa kauft. Diese indirekten und negativen Nebenwirkungen, die mögliche positive Effekte der Hilfe mehr als zunichtemachen können, spielen bei der Bewertung und Erfolgsmessung der Projekte keine Rolle.
Die falschen Erwartungen und das Nichthinsehen haben meines Erachtens viel damit zu tun, dass Entwicklungshilfe zu einem guten Teil ein Instrument im geopolitischen Kampf der Blöcke oder Systeme war – und bis heute ist. Gerade in afrikanischen Ländern kämpfte der Westen zu meiner Zeit mit dem sogenannten Ostblock um die Vormachtstellung – auch mit dem Mittel der Entwicklungshilfe, die letztlich maßgeblich durch das Außenministerium vorgegeben war. Wir Entwicklungshelfer bekamen das regelmäßig zu spüren, wenn wir zu Beginn jedes Auslandseinsatzes bei der Deutschen Botschaft in dem jeweiligen Land vorsprechen mussten, wo man uns dann die Einbettung unserer Projekte in die politische Großwetterlage erläuterte.
Zu meiner Zeit schlug sich die außenpolitische Komponente der Entwicklungshilfe sichtbar in der Auflage für die Empfängerländer nieder, die sogenannte Berlin-Klausel zu unterzeichnen: Sie enthielt die Verpflichtung, bevorzugt Waren aus West-Berlin zu beziehen. Dahinter verbargen sich nicht etwa große wirtschaftliche Erwartungen, sondern die politische Absicht, dass die Empfängerländer West-Berlin als Teil der Bundesrepublik Deutschland anerkannten, was der Ostblock damals bekanntlich infrage stellte. Das geopolitische Klima war so angespannt, dass man bei diplomatischen Empfängen in eher dem Ostblock zugeneigten Entwicklungsländern nicht mit den »Kollegen« aus der DDR sprach, die uns oft fremder erschienen als jeder Afrikaner. Ich hätte wahnsinnig gerne mit ihnen diskutiert und vielleicht hätten sie es auch gerne mit mir, aber jeder wusste, dass man das nicht tat.
Dieser Systemwettbewerb sollte schlimme Folgen zeitigen. Zu den schlimmsten Beispielen gehört in meinen Augen die Demokratische Republik Kongo, wo ich in den 1980er-Jahren im Einsatz war, als das Land noch Zaire hieß. Zwischen 1971 und 1997 herrschte dort Präsident Sese Seko Mobutu, einer der korruptesten Staatsführer, die es je gegeben hat. Der Diktator wurde mit westlichem (Entwicklungshilfe-)Geld regelrecht zugeschüttet, weil er angeblich ein »Bollwerk gegen den Kommunismus« war, also auf »unserer« Seite stand. Dafür sah der Westen darüber hinweg, wie Mobutu und seine Clique schwerste Menschenrechtsverletzungen begingen und das rohstoffreiche Land ausplünderten. Es hat sich bis heute nicht nennenswert »entwickelt«, vielmehr herrschen dort Misswirtschaft, Hunger und Kriege.
Dieses Muster scheint heute obsolet zu sein und ist doch virulenter, als man denkt, wenn man sich etwa den Satz von Ex-Außenministerin Annalena Baerbock vor Augen führt, Mali dürfe nicht zum Vasallen Russlands werden – als wäre das afrikanische Land ein Objekt, über das der Westen in irgendeiner Weise verfügen könnte. Ihre Aussage konnte nichts anderes bedeuten, als dass bei der Vergabe von Entwicklungshilfe Bündnistreue mindestens so wichtig ist wie Bedürftigkeit.
Auch Somalia, das Land am Horn von Afrika, gilt heute trotz Hunderter Millionen von Dollar und Euro an Hilfsgeldern und trotz zahlreicher UN-Missionen als failed state, als gescheiterter Staat. Das Leid der Menschen erscheint endlos. Für fast die Hälfte der inzwischen 16 Millionen Somalier ist die tägliche Ernährung nicht gesichert, Hunderttausende von Kindern sind vom Hungertod bedroht, Millionen Menschen hat die seit Jahren anhaltende Dürre aus ihren Dörfern und Städten vertrieben. Verschärft wird die humanitäre Katastrophe durch einen seit Jahren tobenden Clan- und Bürgerkrieg, der die Infrastruktur zerstört hat. Die Menschen haben kaum Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung, sie leiden unter massiven Menschenrechtsverstößen: Auf homosexuelle Handlungen steht die Todesstrafe, Mädchen werden beschnitten, Jugendliche und Kinder tausendfach für Milizen zwangsrekrutiert. Zusätzlich wird das Land seit Jahren von den Anschlägen der militanten islamistischen Organisation Al-Shabaab erschüttert. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International belegt Somalia mit Rang 179 den vorletzten Platz. Bei der Säuglingssterblichkeit rangiert es ebenfalls unter den Letzten, und das Bruttosozialprodukt liegt pro Kopf gerade mal bei knapp 600 US-Dollar (2023) im Jahr. Zum Vergleich: Albanien kommt auf das 14-Fache, Deutschland auf das 90-Fache.
Schaue ich heute zurück, kann ich nur schlussfolgern, dass das Land nach Jahrzehnten ausländischer Einflussnahme – inklusive Entwicklungshilfe – schlechter dasteht als vor fünfzig oder sechzig Jahren kurz nach seiner Unabhängigkeit. Das Bild vom Scherbenhaufen drängt sich auf. Und die bittere Erkenntnis, dass ich als Entwicklungshelfer nicht Teil der Lösung war, als der ich mich damals sah, sondern Teil eines westlichen Entwicklungshilfekonzepts, das ganz offensichtlich nicht in der Lage war, jenseits kurzzeitiger humanitärer Einsätze in Krisenfällen die schwachen Strukturen eines Landes merklich und vor allem langfristig zu stärken.
China – der Sprung ins Industriezeitalter
Jüngere mögen es kaum glauben, aber China galt vor nicht allzu langer Zeit noch als Entwicklungsland, das der Westen nach Kräften unterstützte. Auch Deutschland. Und ich war, nachdem ich 1981 meine Tätigkeit bei der KfW beendet hatte, einer derjenigen, die dabei halfen – diesmal als selbständiger Consultant, beauftragt von der Weltbank. Ausländische Experten wie ich sollten beispielsweise im chinesischen Kohleministerium den Mitarbeitern zeigen, wie man ein Kohlebergwerk plant und den klimaschädlichen Rohstoff möglichst effizient aus der Erde holt (was angesichts meines späteren Einsatzes für den Klimaschutz nicht einer gewissen Ironie entbehrt). China war damals ein Mysterium, ein Land, das für »normale Menschen« 1982 noch nicht zu bereisen war, sich aber zu öffnen begann. Die Chance, es dabei beobachten zu können, elektrisierte mich. Deshalb führte ich ein Tagebuch, in dem ich auch die im Folgenden geschilderten Erlebnisse und Erkenntnisse festgehalten habe.
Sparsamkeit statt Palmen
Als das Flugzeug aus Hongkong im Herbst 1982 auf dem Flughafen in Peking landet, steht ein Team aus dem Ministerium zum Empfang bereit, um mich in einem kleinen Bus ins Hotel zu bringen. Die Fahrt durch die Stadt ist eine Fahrt durch ein Meer von Fahrrädern, nur selten sieht man Taxis vor den wenigen Hotels stehen, noch seltener die großen Autos der Parteikader, Marke »Rote Fahne«. Die Menschen auf den Fahrrädern sind fast alle im Mao-Look gekleidet, wie es im Westen damals hieß, einfarbige Arbeitsanzüge für Männer wie für Frauen. Mein erster Eindruck, der sich in den Wochen und Monaten danach bestätigt, ist, dass die Menschen zwar arm sind und ein einfaches Leben führen, aber kein elendes. Sie haben Arbeit, sie hungern nicht, sie machen keinen unglücklichen Eindruck. Das ganze Land scheint auf dem Sprung zu sein, einen Plan zu haben.
Mein damaliges Hotel, das es noch heute gibt, heißt »Friendship« und ist ein riesiger, von den Russen in den 1950er-Jahren gebauter Kasten für mehr als 2000 Gäste. Das sind zu Beginn der 1980er-Jahre ausländische Experten wie ich und Geschäftsleute, die von der Hauptstadt aus in diesem riesigen Land Fuß fassen wollen. Einer davon ist der Vertreter der Dresdner Bank, der ein paar Türen weiter auf meinem Gang gleich zwei Zimmer gemietet hat.
Was in Peking sofort ins Auge fällt und beeindruckt, ist, wie sparsam das Land damals mit seinen Ressourcen umgeht. Ein Zeichen dafür ist, wie unsere Gastgeber uns unterbringen und behandeln, ganz anders als etwa auf den Philippinen, wo ich, wie berichtet, ein ganzes Haus zur Verfügung gestellt bekam, dazu Bedienstete von der Köchin bis zum Chauffeur. Die Unterbringung im Hotel »Friendship« hingegen ist der wirtschaftlichen Lage des Landes angemessen und zeugt von der realistischen und planvollen Politik der Verantwortlichen zu jener Zeit. Ein weiteres Beispiel ist die Frau an der Kasse des riesigen Hotelrestaurants, die weder eine mechanische Kasse noch einen Taschenrechner hat; stattdessen errechnet sie den jeweils fälligen Betrag auf einem Abakus, einem Gerät mit Holzkugeln, die sie in rasender Geschwindigkeit über die Metallstangen jagt. Ein anderes sprechendes Detail ist der Farbfernseher im Hotelzimmer, ein chinesisches Fabrikat, denn die Hotelmanager wären wohl nie auf die Idee gekommen, für westliche TV-Geräte Devisen dranzugeben.
Obwohl ich schon einige Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit tätig bin, trete ich den zweimonatigen Einsatz in China mit einiger Aufregung und in neugieriger Erwartung an. Denn China nimmt in jener Zeit als Entwicklungsland eine besondere Stellung ein, gerade bei Menschen wie mir, die sich auf der linken Seite des politischen Spektrums verorten und überzeugt sind, dass der Sozialismus besser geeignet ist, die Armut zu überwinden und Wohlstand einigermaßen gerecht zu verteilen, als regelloser Kapitalismus. Was das sozialistische China damals beginnt, wird weltweit als höchst interessantes Experiment verfolgt. Dass andere Entwicklungsländer, zum Beispiel in Afrika, die sich ebenfalls als sozialistisch bezeichneten, es aber nie waren, grandios gescheitert sind, steht auf einem anderen Blatt.
Ich will die Jahrzehnte unter dem Diktator Mao Zedong nicht schönreden. Seine Politik und sein Regime haben Millionen von Menschen auf dem Gewissen. Aber die Veränderungen infolge der von ihm mit Unterstützung der Bauern angeführten siegreichen Revolution im Jahr 1949 schufen letztlich die Grundlage für den späteren atemberaubenden ökonomischen Aufschwung des Landes. Mit der Revolution wurden die Großgrundbesitzer enteignet und den Bauern wurde eigenes Land zugeteilt, das ihnen zwar nicht gehörte, das sie aber eigenständig bewirtschaften konnten. Diese Kleinbauern sind auch heute noch das Rückgrat der chinesischen Landwirtschaft – sie machen etwa 90 Prozent der in der Landwirtschaft Beschäftigten aus. Der Produktivitätsanstieg durch die private Nutzung des Landes erzeugte die Lebensmittel und die Kaufkraft, die für die Entwicklung nötig war. China machte genau das, was andere, heute noch feudal strukturierte Länder versäumt haben: Es schuf eine Schicht von kleinen, aber gut verdienenden Landwirten als Basis für die darauffolgende Industrialisierung.
Nach einer ersten allmählichen Öffnung seit dem Besuch von US-Präsident Richard Nixon im Jahr 1972 und erst recht nach Maos Tod 1976 steht das Land zur Zeit meines Aufenthalts zweifellos an einem neuen Punkt in seiner Geschichte. Und von heute aus gesehen würde ich behaupten, dass es seine Chance optimal genutzt hat, jedenfalls um Längen besser als die meisten anderen Entwicklungsländer. Warum das so ist, erlebe ich damals aus nächster Nähe, sozusagen im Maschinenraum der Transformation, im Kohleministerium der Volksrepublik. Als Volkswirt soll ich dort helfen, die finanzielle Planung zweier Kohlebergwerke voranzutreiben.
Als ich mich an meinem ersten Arbeitstag im Ministerium in meinem Büro in die Akten einlesen will, reißt mich schrille Musik aus Lautsprechern vor dem Gebäude aus der Ruhe. Aus der gegenüberliegenden Fabrik strömen Hunderte von Frauen und Männern in blauen und grauen Kitteln und den typischen Mao-Kappen, stellen sich in langen Reihen auf und beginnen ihre kollektive Morgengymnastik, die von durch Lautsprecher brüllenden Instruktoren synchronisiert wird. Ich erlebe diese alltäglichen Gymnastikaufmärsche vor meinem Büro als Teil einer großen Mobilisierung, die viele Bereiche des täglichen Lebens erfasst. Zu ihr gehört auch die Aktion »Sauberes Peking«: Immer wieder sieht man in der englischsprachigen Zeitung China Daily Bilder von hohen Funktionären der Staats- und Parteiführung, wie sie mit Schaufel und Besen dem Schmutz auf Pekings Straßen zu Leibe rücken. Überhaupt vergeht kaum ein Tag, an dem das Blatt nicht über neue Projekte oder politische Initiativen berichtet, die den Fortschritt in der Hauptstadt und im ganzen Reich antreiben sollen. Derlei Berichte erfüllen selbstverständlich auch einen propagandistischen Zweck, dennoch transportieren sie eine Aufbruchstimmung und eine Energie, wie ich sie in keinem anderen Entwicklungsland zuvor wahrgenommen habe.
Dieser Eindruck stützt sich vor allem auf meine Erfahrungen im Kohleministerium, wo mich der Lerneifer der Mitarbeitenden beeindruckt. Und das umso mehr, als die Ressourcen – wie beschrieben – äußerst knapp sind: Zwar sind die Räume renoviert, mit Teppichen, Sesseln und schweren Schreibtischen ausgestattet, doch bis auf wenige Telefone gibt es so gut wie keine technische Infrastruktur: Statt mit Schreibmaschine und Fotokopierer arbeiten wir – und natürlich auch unsere chinesischen Gegenüber – mit Bleistift und Spitzer. Während wir Entwicklungshilfeberater sonst oft Berichte schreiben, die kaum gelesen in irgendwelchen Schubladen verstauben, sind meine chinesischen Pendants nicht zu bremsen in ihrem Interesse. Man sollte noch hinzufügen, dass unsere Truppe von westlichen Entwicklungsexperten im Wesentlichen aus Ingenieuren des Steinkohlebergbaus im Ruhrpott besteht. Sie sind für die technische Planung der beiden Steinkohlebergwerke zuständig und lassen keinen Zweifel daran, dass das chinesische Bergbauwesen am deutschen Know-how genesen werde. Zwei Ökonomen, einer davon ich, kümmern sich um die wirtschaftlichen Aspekte des Projekts. Gefördert werden die Bergwerke, die viele Hundert Kilometer von Peking entfernt liegen sollen, von der Weltbank in Washington. Unsere Aufgabe vor Ort ist es, gemeinsam mit den Chinesen alle geforderten Informationen zu liefern und eine detaillierte Planung vorzulegen, die internationalen Standards genügt, damit die Kredite auch wirklich fließen können.
Leicht ist das nicht, aber lehrreich, auch für mich, der ja der Lehrende sein soll. Ich lerne in diesen zwei Monaten im Ministerium, wie groß die Auffassungsgabe der dort tätigen Menschen ist, wie ernsthaft sie sich bemühen und vor allem: wie groß ihre Veränderungsbereitschaft ist. Am Anfang wundere ich mich allerdings doch erst mal, um es milde auszudrücken: Meinen chinesischen Kolleginnen und Kollegen sind so gut wie alle Begriffe der Finanzwelt und der Ökonomie, wie sie in unserem System verwendet werden, fremd. Ich muss ihnen den Unterschied zwischen Liquidität und Ertrag erklären und ganz generell, warum man überhaupt eine Bilanz braucht oder warum man jene Kosten ansetzen darf und jene nicht, wenn man herausfinden will, ob ein Projekt rentabel ist oder nicht. Und natürlich gilt es auch ideologisch begründetes Misstrauen abzubauen und davon zu überzeugen, dass diese Instrumente zur Finanzplanung durchaus systemunabhängig anwendbar sind.
Betriebswirtschaft und die Viererbande
Aufschlussreich ist eine Diskussion mit den Ministerialen über Abschreibungen. Ich erkläre ihnen, dass wir bei der Berechnung der Rentabilität der zwei Bergwerke unbedingt Abschreibungen ansetzen müssen, um den unvermeidbaren Verschleiß der Anlagen einzupreisen. Meine Gegenüber erwidern, Abschreibungen hätten sie eigentlich nicht so gerne, sie würden aber noch einmal darüber diskutieren – unter sich. Am nächsten Tag berichten sie mir dann, die »Viererbande« habe während der Kulturrevolution Abschreibungen abgeschafft. Zur Erinnerung: Die »Viererbande« waren mächtige Hardliner vor und nach Mao, die das Land führten, darunter seine Frau. Das Argument der vier gegen Abschreibungen können mir die chinesischen Kollegen nicht nahebringen, müssen sie aber auch gar nicht, denn sie bedeuten mir freundlich lächelnd, dass es jetzt an der Zeit sei, Abschreibungen wieder einzuführen.
Die Fortschritte in der Arbeitsgruppe geschehen in einem Tempo, das ich in keinem anderen Land so erlebt habe, und läuft in der Regel so ab: Die Chinesen, bestehend aus sieben Fachleuten und einer Dolmetscherin, bekommen von uns täglich Informationen, wie bei der Finanzanalyse vorzugehen sei; damit erarbeiten sie selbständig Kapitel für Kapitel des Berichts für die Weltbank, und anschließend ist es unsere Aufgabe, eventuelle Fehler zu finden. Dabei gibt es keine Pausen: Kommt die chinesische Gruppe nach ihrer internen Arbeit in mein Büro, wird straff diskutiert und danach weitergearbeitet. Das mag damit zusammenhängen, dass dem chinesischen Team der Kohleminister höchstpersönlich angehört – was wir Berater aber zunächst gar nicht wissen. Nach den ersten Wochen frage ich die Dolmetscherin, eine perfekt Englisch sprechende Ökonomin, wer denn der dynamische Herr im Team sei, der nicht den klassischen Mao-Look trage, sondern eine Fliegerjacke? Als wäre es die größte Selbstverständlichkeit der Welt, antwortet sie mir, das sei der Minister.
Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb? – ist das chinesische Team in der Lage, Fehler zuzugeben. Einmal beenden wir eine Sitzung, bei der wir falsche Berechnungen besprechen, mit der Mao-Losung, dass man aus eigenen Fehlern lernen müsse. Eines der Teammitglieder erwidert, das treffe in erster Linie auf Mao selbst zu, der sich große Fehler geleistet habe. Interessant daran ist nicht nur, dass hier offen Kritik geäußert wird, sondern dass diese Kritik nichts an der grundsätzlichen Unantastbarkeit Maos ändert.
In meinem Tagebuch finden sich Einträge, die neben dem Lerneifer und dem tiefen Pragmatismus meiner Gegenüber auch ihre Sturheit wiedergeben, die wohl in diesem unerschütterlichen Vertrauen in die Partei und die Macht des Staates