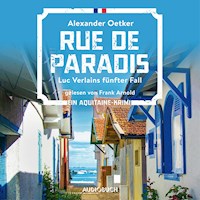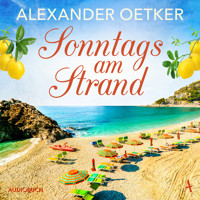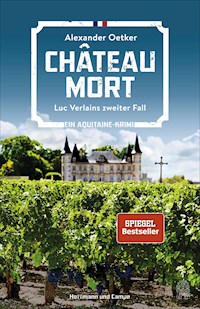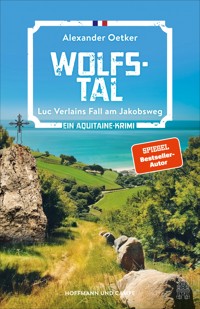Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Luc Verlain ermittelt
- Sprache: Deutsch
Sonnige Strände, gefährliche Gewässer – Luc Verlains geheimnisvollster Fall An einem Sommermorgen mit der ersten Fähre die Gironde zu überqueren, ist ein französischer Urlaubstraum. An diesem Tag aber bleibt beim Anlegen das erste Auto an Bord stehen und blockiert alle anderen. Der Fahrer, ein beliebter Malermeister, ist verschwunden, und keiner der Passagiere will etwas Verdächtiges gesehen haben. Dann findet man den Mann – tot, in der Tasche eine seltene Muschel. Commissaire Luc Verlain und sein Team ermitteln unter Hochdruck, als auch in Paris eine Leiche mit einer solchen Muschel gefunden wird. Besteht wirklich ein Zusammenhang? Oder ist alles nur Zufall, der Maler Opfer tragischer Eifersucht? Erst ein Tauchgang in die Vergangenheit bringt Licht in den rätselhaften Fall. Mord in der Aquitaine - Luc Verlain ermittelt: - Band 1: Retour - Band 2: Château Mort - Band 3: Winteraustern - Band 4: Baskische Tragödie - Band 5: Rue de Paradis - Band 6: Sternenmeer - Band 7: Revanche - Band 8: Wilder Wein Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Oetker
Revanche
Luc Verlains geheimnisvollster FallEin Aquitaine-Krimi
Roman
Hoffmann und Campe
PrologMiniatures
Fähranleger Blaye in Richtung LamarqueVendredi, 8 juillet, 6:12
Keine Sorgen. Keine Ängste. Keine Hektik. Nur sie und der Strom. Deborah Galhaud gab noch ein wenig Schub. Der PS-starke Bootsmotor unter ihr reagierte sofort, indem er noch lauter grummelte als ohnehin und die Sébastien Vauban spürbar vorwärts schob. Sie nahm die Hände vom Steuerrad, faltete sie ineinander und streckte die Arme. Sie reckte sich und gähnte einmal lang und ausgiebig, bevor sie nach der Tasse griff, die in einer kleinen Mulde auf ihrer Kapitänsbrücke stand. Der starke schwarze Kaffee hatte jetzt genau die richtige Temperatur. Perfekt.
Um sie herum war nur Dunkelheit, die Lichter des Hafens von Blaye lagen schon weit hinter ihr, genau wie die Industrieanlagen südlich der Stadt. Es gab nur noch den schwarzen Fluss, der nach dem Schiff griff und es in seine Strömung zog. Die Flut drückte das Wasser aus dem Atlantik in Richtung Bordeaux, der alte Schiffsmotor musste gar nichts mehr tun. Deborah Galhaud zog den Hebel nach hinten. Das Motorengeräusch wurde merklich leiser, nun tat die gute alte Gironde ihren Job und trug die Fähre ein Stück flussaufwärts. Die Kapitänin musste kaum steuern, um das gegenüberliegende Ufer zu erreichen; es war ein Kinderspiel.
Viel lieber wäre sie den Fluss komplett hinaufgefahren, eine lange Fahrt in dieser wunderschönen Morgenstimmung, einfach getragen von der Flut, eingehüllt in die sanften Klänge der Wellen, die gegen das Schiff schlugen, und die Gesänge der Möwen über ihr.
Hier draußen gab es keine Sorgen, keine Ängste und keine Hektik. Die reale Welt war weit weg. Deborah Galhaud war sich ganz sicher: Wenn alle Menschen so in den Tag starten könnten wie sie an diesem Morgen, dann gäbe es keine Kriege und keinen Streit mehr. Sie fühlte sich von Harmonie durchflutet.
Ihr Blick fiel auf das Deck unter ihr. Dort standen nur zwei Autos, ein weißer Kleinbus und ein grauer Renault Mégane. Von hier oben sahen sie wie Spielzeuge aus. Um die beiden Fahrzeuge herum waren viele Plätze leer. Auf der Ladefläche der Fähre hätten hundert Autos Platz gefunden – selbst dann reichten an den Wochenenden in der Hochsaison die Plätze nicht aus, und die Touristen mussten am Anleger ewig auf die nächste Überfahrt warten. Dennoch ersparten sich die Urlauber auf diese Weise ermüdende Stunden im Stau, der seit den Bauarbeiten auf der Rocade, der Ringautobahn um Bordeaux, dauerhaft herrschte. Also nahmen sie lieber die Fähren, entweder die nördliche von Royan nach Verdon-sur-Mer oder diese hier, die kleinere über den engeren Teil der Gironde-Mündung. Doch heute war es noch viel zu früh, als dass die Fähre von Blaye nach Lamarque schon Touristen, die mit Fahrrädern die Médoc-Halbinsel erkunden wollten, an Bord gehabt hätte. Nein, die erste Fähre des Tages nutzten nur die Arbeiter aus Blaye und Umgebung, die auf den Weinfeldern der berühmten Châteaus des Médoc ihre Brötchen verdienten. Dazu vielleicht noch Putzleute und der junge Frühstückskoch des Hotels Cordeillan-Bages, den die Kapitänin gut kannte, weil er jeden Morgen die Fähre nahm. Gleich würde er den steinreichen Gästen des noblen Fünfsternehotels ihre Omeletts zubereiten, nach einer viel zu kurzen Nacht in seiner kleinen Wohnung auf der anderen Gironde-Seite.
Sie mochte diese Fahrten mit den Einheimischen, denen ihr Schiff den Alltag erleichterte. Manchmal trat sie dann an die Reling und nickte hinunter, manchmal winkte sie sogar. Als der Hafen von Lamarque in den Blick kam, kniff sie die Augen zusammen, um zu erkennen, wie viele Autos am quai warteten. Aber es war zu dunkel, sie sah nur Scheinwerfer mit Standlicht, wie ferne Tieraugen in dunkler Nacht.
Fähranleger Lamarque/MédocVendredi, 8 juillet, 6:42
Eben noch war der Fluss ruhig gewesen, eine ölig schimmernde Fläche. Jetzt aber tauchten Lichter hinter der kleinen Insel auf und bewegten sich langsam auf ihn zu. Nach einer Weile schlugen die ersten Wellen an. Er hörte sie bloß, weil es noch dunkel war. Es waren nur Schatten im Wasser, kleine schwarze Wellen, die ankündigten, dass die Fähre gleich auf dieser Seite des Flusses anlegen würde. Pünktlich auf die Minute – wie stets.
Nun gut, wie stets zu dieser morgendlichen Stunde, korrigierte er sich in Gedanken und musste lächeln. Wenn nachher, zur Mittagszeit, die Holländer wieder versuchen würden, ihre Ungetüme von Wohnmobilen auf der Fähre zu verstauen und dabei komplett überfordert hin und her rangierten, dann würde es vielleicht etwas länger dauern.
Aber jetzt war noch die Zeit der Bordelais.
Benjamin Forestier saß in seinem weißen Fiat Fiorino und hatte die Heizung eingeschaltet. Es war zwar Juli, doch seit er die fünfundvierzig überschritten hatte, war ihm ständig kalt. Die Klimaanlage blies warme Luft auf seine Füße, was sich sehr schön anfühlte, obwohl er dicke Stiefel trug. Handwerkerschuhe eben. Seit ihm mal ein Farbeimer auf den Fuß gefallen war, achtete er penibel auf die Sicherheitsregeln.
Er liebte die erste Fähre des Morgens, und er freute sich auf diesen Tag. Mal wieder hatte er einen Auftrag drüben zu erledigen – auf dem Festland, wie die Leute im Médoc scherzhaft sagten. Scherzhaft, weil das Médoc natürlich auch Festland war – aber es war auch eine Presqu’île, eine Halbinsel, umgeben von zwei Meeren. Dem echten, dem Atlantik nämlich, und der Gironde.
Sein Auftraggeber zählte auf ihn: Benjamin sollte dessen altes Herrenhaus renovieren, weil der Mann es künftig als chambres d’hôtes vermieten wollte. Mit seiner Einmannfirma hatte Benjamin schon oft für den reichen Pariser gearbeitet, und zwar immer allein, weil nur so, wie sie beide befanden, die Qualität stimmte. Das Herrenhaus war groß, hatte bestimmt dreihundert Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf fünf Zimmer mit angrenzenden Bädern und einer gîte, die als Ferienwohnung vermietet werden sollte. Dieser Auftrag würde ihn also den ganzen Sommer über beschäftigen – mindestens.
Benjamin freute sich auf Blaye. Er mochte die Stadt mit der römischen Zitadelle am Hafen. In der Altstadt gab es einen sehr schönen Markt, und die Leute waren freundlich, wenn auch unverbindlich. Vor allem aber mochte er, dass es dort nicht bierernst zuging. Zwar kelterten auch die Einwohner von Blaye Wein, den Côtes de Blaye, aber sie schienen es eher aus Spaß an der Freude zu tun und nahmen auch nur wenig Geld dafür. Sie wussten, dass ihr Wein nur etwas für Eingeweihte war: Franzosen, die ihre Rebsorten schätzten. Der Wein aus Blaye wurde so gut wie nie exportiert, und groß von sich reden machte er auch nicht.
Hier im Médoc hingegen ging es verbissener zu. Um den Wein wurde ein riesiges Brimborium gemacht: Wann wird geerntet? Welche Preise wollen wir gewinnen? Wer darf überhaupt eine Flasche kaufen? Als ginge es um Leben oder Tod. Benjamin konnte diese Strenge nicht leiden. Schließlich ging es um Wein – das musste man doch genussvoll angehen!
Das Horn der Fähre riss ihn aus seinen Gedanken. Sie tutete so laut, dass er vor Schreck mit dem Fuß von der Bremse rutschte und sein Wagen einen Satz vorwärts machte. Benjamin musste lachen. Das war ihm ja noch nie passiert. Er sah zu, wie der Maat der Hafenwache die Leine zuwarf. Der Mann nahm das dicke Tau und wickelte es um einen Poller. Das große weiße Schiff näherte sich langsam dem quai.
Zeigte sich allmählich ein Lichtgesprenkel drüben auf der Festlandseite? Die Sonne würde bald aufgehen, man sah bereits ein gelbes Schimmern, das aus dem Dunkel auftauchte, gleich würde der neue Tag beginnen. Er schaute auf die kleine Fischerhütte, die carrelet, die auf Stelzen im flachen Wasser des Gironde-Ufers stand. Das riesige Netz hing davor, quadratisch und so montiert, dass es einfach in die Fluten hinabgelassen werden konnte, um die vorbeischwimmenden Fische zu fangen. Früher gehörten diese Hütten den Fischern, heute waren die Eigentümer Freizeitangler und Leute aus Bordeaux, die reichlich Kohle hatten und gerne auf den Fluss hinaussahen.
Die Autos verließen die Fähre. Es waren nur zwei, und auf sie folgten die Fußgänger, die sich zur Bushaltestelle und dann zu ihrer Arbeit im Médoc aufmachten. Schließlich ertönte das Horn der Fähre erneut. Das klare Zeichen für Eingeweihte: Es war Zeit zum Hinaufrollen. Benjamin trat die Kupplung und legte den Gang ein, dann fuhr er langsam an, nahm den Pier, der zum quai führte, und rollte auf die Brücke. Die Reifen knarzten auf dem Metall. Er manövrierte nach vorne zum Tor und schaltete den Motor aus. Erst jetzt hatte er Zeit, um nach oben zu sehen, zur Brücke. Doch er sah nur einen Schatten; schwer zu sagen, wer das Schiff heute führte. Aber an diesem schönen Morgen konnte ihm das auch egal sein.
Er würde jetzt an Deck gehen und sich den Sonnenaufgang ansehen. Wenn doch jeder Tag so beginnen würde!
Fähre Sébastien Vauban auf der GirondeVendredi, 8 juillet, 7:01
Dies war der schönste Moment des Tages. Denn sie sah die Sonne als Erste. Weil sie ganz oben auf der Brücke saß, zwei Decks höher als die Passagiere. Und dort drüben, gleich hinter den Häusern und Weinfeldern von Blaye, schob sich die gelbe Sichel empor. Sie bewegte sich viel langsamer als beim Sonnenuntergang, so schien es ihr jedenfalls immer, auch wenn das natürlich Quatsch sein musste. Die kleine glänzende Scheibe wanderte Zentimeter um Zentimeter nach oben und vermochte es bereits jetzt, den Fluss um sie herum in ein leichtes Gold zu tauchen. Auf einmal flogen Möwen um den Schornstein der Fähre herum. Einige folgten ihr, einige flogen sogar voraus, als wollten sie ihr den Weg weisen.
Doch Deborah Galhaud kannte das Ziel. Sie wusste nicht, wie oft sie diese Strecke schon gefahren war. Mindestens zweitausendvierhundertmal? Ihr Jubiläum der zweitausend Fahrten war irgendwann um Ostern gewesen.
Sie hatten auf der Brücke mit einem Glas Champagner angestoßen, sie und ihre Mannschaft. Das war zwar gegen die Regeln, aber … Herrgott, das hier war immer noch Frankreich!
Sie waren nun in der Mitte des Flusses, und Deborah steuerte das Schiff ein wenig nach links. Es gab hier eine kleine Untiefe, die auf den Seekarten verzeichnet war. Aber sie brauchte die Karte nicht, sie wich einfach aus, steuerte in Richtung der Île Nouvelle, die nicht bewohnt war. Dort gab es nur Bäume, die Nistplätze seltener Vögel und pure Natur. Auf der anderen Seite der Fahrrinne lag die Île Paté, auf der ein Fort lag, eine alte Befestigungsanlage – Deborah war als junges Mädchen einmal auf der Insel gewesen, mit einem Jungen aus der Nachbarklasse. Sie dachte gerne an diesen Nachmittag zurück, den sie, verborgen vor fremden Blicken, mitten im Fluss verbracht hatten.
Sie fuhr hart nach Steuerbord, es galt nun, die Gezeiten ideal auszunutzen, um praktisch ohne Motorhilfe die Anlegestelle von Blaye zu erreichen. Gerade hatte die Ebbe eingesetzt und zog das Salzwasser des Ozeans, das die Flut in Richtung Bordeaux gedrückt hatte, wieder zurück gen Westen, gen Atlantik. Sie musste die Fähre nur richtig in den Fluss stellen und den Gashebel zurückziehen, damit die Strömung das Schiff nach draußen zog. Es waren nur noch sechshundert Meter, die Strömung ersetzte die Kraft des Motors.
Sie betrachtete kurz die Passagiere auf dem Deck. Es waren nicht viel mehr als vorhin auf der ersten Fahrt. Handwerker standen an der Brüstung und rauchten, die Alten hatten es sich in der warmen Kabine gemütlich gemacht, wo der Kaffeeautomat stand. Gleich würde auch sie sich einen weiteren Kaffee aufbrühen.
Kurz vorm Hafen sah sie, wie die Lichter von Blaye erloschen. Die Straßenlaternen wurden ausgeschaltet, jetzt begann auch offiziell der Tag. Und mit einem Blick auf die goldgelbe Sonne und den wolkenlosen Himmel wusste sie, dass es ein strahlend schöner werden würde. Deborah würde noch achtmal hin- und zurückfahren. Sie hatte Frühschicht, es würde zwar schon viel los sein – aber gottlob weniger als nachher bei Jean, der die Spätschicht übernahm. In der Hochsaison gab es ab Freitagnachmittag keine Pause mehr. Es ging unablässig hin und zurück, nur beim Beladen hatte man kurz Zeit zum Durchschnaufen. Massenhaft Urlauber aus Deutschland, Holland, Belgien und der Schweiz kamen mit ihren Autos, Wohnwagen und Wohnmobilen, die Surfer mit Bullis – und alle wollten ans Meer, um dort ihren mühsam ersparten Urlaub zu verbringen. Ab Freitagnacht kamen dann auch die Hauptstädter, die nach Feierabend in Paris losgefahren waren. Der Samstag war immer die Hölle. Bettenwechsel, das hieß: volle Fähren bei der Hin- und Rückfahrt. So ging das von Anfang Juli bis Ende August – bis in der ersten Septemberwoche urplötzlich fast alle Urlauber verschwanden und die Fährgesellschaft den saftigen Sommerzuschlag auf den Preis der Überfahrt wieder strich.
Deborah brauchte nicht zu überlegen, wann sie das letzte Mal Urlaub gemacht hatte, denn sie brauchte keinen. Schließlich lebte sie da, wo andere ihren Urlaub verbrachten. Nach der Schicht würde sie auf ihren Motorroller steigen und an den Strand fahren. Eine Runde schwimmen und dann ein Nickerchen auf dem nackten, heißen Sand, bevor es auf ein frühes Bier ins Apérock ging. Sie musste pünktlich im Bett sein, denn morgen hatte sie erneut die Frühschicht.
Deborah war nun auf Höhe der Hafenmole. Sie legte den Gashebel wieder ein, drehte nach Backbord und gab Schub. Der kräftige Schiffsmotor meldete sich sofort mit Getöse, dann zog die Fähre an, und Deborah lenkte sie mit der Erfahrung des Profis bis kurz vor den quai. Sie sah, wie der Maat an die Reling trat und versuchte, die Leine herüberzuwerfen. Beim ersten Mal landete sie im Wasser. Er holte sie wieder ein und schien dabei zu fluchen. Deborah grinste. Dann der zweite Wurf, ein zielgenauer Treffer. Der Hafenmann nahm die Leine auf, band sie fest, und die Fähre zog sich wie von selbst an die Mauer.
Deborah wartete, bis der Maat grinsend zu ihr hochsah und mit dem Daumen ein Zeichen gab: alles fest, alles gut. Sie schaute zum Heck des Bootes: perfekt. Runde zwei war erledigt.
Sie drückte den Knopf. Es knarzte, und die riesige metallische Bordwand senkte sich ab, auf dass die Autos die Fähre verlassen konnten.
Fähranleger BlayeVendredi, 8 juillet, 7:17
Zuerst dachte Denise, der Fahrer im Auto vor ihrem würde noch auf sein Handy schauen, deshalb wartete sie. Der Maat am Bug winkte, doch es tat sich nichts. Allmählich reichte es ihr. Der Typ sollte runterfahren, was war denn los mit ihm? Sie musste pünktlich sein, sonst würde der Chef wieder meckern. Verdammter Chef! Er meckerte ohnehin ständig. Dabei war sie zuverlässig und pünktlich, meistens jedenfalls. Dass sie als echte Médocaine ausgerechnet auf die andere Seite des Flusses verbannt worden war, um dort die Post auszutragen, fand sie bis heute unerhört.
Sie konnte Dinge sehr lange unerhört finden, denn sie trug nun schon seit zwölf Jahren die Briefe dort drüben aus, in den kleinen Gemeinden nördlich von Blaye. Dass sie das gelbe Postauto jeden Nachmittag mit der Fähre wieder auf die andere Gironde-Seite brachte, wo sie wohnte, hätte ihren Chef bestimmt gestört – wenn er davon gewusst hätte. Doch die Jahreskarte hatte sie aus eigener Tasche bezahlt. Er hatte sie einmal auf die hohen Dieselkosten angesprochen, woraufhin sie sich damit herausgeredet hatte, dass die vielen kleinen Bauernhöfe so weit auseinanderliegen und sie nun mal von Hof zu Hof fahren müsse. Die alten Leute könnten ihr schließlich nicht entgegenkommen.
Denise Malesquier war nicht auf den Mund gefallen – und nie um eine Ausrede verlegen. Das war immer so gewesen, schon in der Schule. Und sie war stolz darauf, dass das so war. Wie hatte schon Papa immer gesagt? Große Leute kennen den Weg, kleine müssen sich ihren Weg durchs Leben suchen. Und Denise war eine Meisterin darin, Wege zu finden. Natürlich keine, die sie im Lauf ihrer sechsundvierzig Lebensjahre reich gemacht hätten – aber Wege, um einigermaßen gut zu leben, sich und den Kindern ab und zu einen schönen Urlaub zu gönnen und am Wochenende in Bordeaux die Sau rauszulassen. Wozu war sie schließlich geschieden?
Dass ihr Chef sie nicht leiden konnte, war der einzige Schatten in ihrem Leben – der Typ nervte gewaltig. Leider war er als Leiter der Post im Département Gironde sehr mächtig – und hatte sie seit Jahren auf dem Kieker.
Zwei Verspätungen hatte sie sich diesen Monat schon geleistet; eine Abmahnung konnte sie gar nicht gebrauchen. Nicht nach den beiden im letzten Jahr. Deshalb nervte sie dieser Dummbatz im Auto vor ihr enorm. Schlief er, oder was?
Sie drückte die Hupe und rief: »Nun komm aus den Hufen!«, bis ihr auffiel, dass ihr Fenster geschlossen war. Sie drehte es runter, doch dann kniff sie die Augen zusammen. Etwas war merkwürdig.
Auch der Maat kniff die Augen zusammen. Dann ging er auf den Wagen zu und schaute durchs Fenster. Denise lehnte sich durch die offene Scheibe aus dem Wagen und rief: »Was denn, Cédric, hat er ’n Herzkasper?«
Der junge Maat schaute in den Wagen, dann zu ihr und sagte: »Hmm, komisch. Das hat so gespiegelt eben, ich hab nichts gesehen. Aber … es ist überhaupt niemand im Auto.« Er griff zum Funkgerät an seinem Gürtel und drückte den Knopf. Es piepte, dann hörte Denise ihn hineinsprechen, während er um den Wagen herumging. Es dauerte nur Sekunden, dann ertönte das laute Horn der Fähre, so kräftig, dass sie zusammenzuckte. Schon dröhnte die blecherne Stimme der Kapitänin aus den Lautsprechern: »Verehrte Passagiere«, sie räusperte sich, »Messieurs-dames, der Fahrer des Transporters Fiat Fiorino mit dem amtlichen Kennzeichen FY-039-BU soll sich bitte dringend zu seinem Fahrzeug begeben. Die Fähre hat angelegt, und Sie blockieren die Ausfahrt.«
Denise sah, wie Cédric an der Fahrerseite den Türgriff betätigte. Die Tür ging auf. Immerhin etwas. Wieder beugte sie sich hinaus und rief:
»Steckt der Schlüssel drin? Dann fahr den Wagen weg. Wahrscheinlich hält er noch seine Morgenandacht auf dem Klo.« Sie lachte ihr tiefes Lachen.
Doch der Maat drehte sich kopfschüttelnd zu ihr um.
»Kein Schlüssel«, sagte er. »Du wirst warten müssen. Ich geh mal nachsehen.«
Er stieg die weiße Metalltreppe hinauf an Deck. Sie sah ihm nach, dann stieg sie aus dem Wagen. Denise war eine Frau, die nur glauben konnte, was sie mit eigenen Augen sah. Also ging sie um den Transporter herum, der ihrem eigenen ähnelte; dieser hier war weiß, ihrer gelb. Als sie beim Führerhaus angekommen war, musste sie feststellen, dass der Wagen tatsächlich leer war.
Fähranleger BlayeVendredi, 8 juillet, 7:40
Nach zehn Minuten war sie von der Brücke gegangen, um sich selbst zu überzeugen. Sie hatte das Passagierdeck überquert und die Toilettentüren geöffnet, alle waren leer. Dann war sie drinnen gewesen, beim Kaffeeautomaten. Hier war niemand mehr. Alle warteten unten auf den Ausstieg. Immer wieder hupte es. Mann, waren die ungeduldig. Sogar unter den Stühlen auf dem Außendeck hatte sie nachgesehen; nicht dass er nach einem Schwächeanfall daruntergerutscht war. Sie war über das Fahrzeugdeck gegangen, hatte hinter allen Autos nachgesehen. Doch der Fahrer blieb verschwunden. »Wart ihr unter Deck? Maschinenraum und Co?«
Cédric und der Bootsmann Philippe nickten. »Niemand unten.«
»Ich gehe gleich auch noch mal nachsehen.« Sie vertraute ihren Mitarbeitern. Doch sie war die Kapitänin. Sie hatte die Verantwortung. Und bevor sie sich auf andere verließ, sah sie lieber selbst nach. Sie blickte kurz hinüber zu den Autos, die an der Rampe hinter dem weißen Transporter standen. Die Postbotin lehnte an ihrem Wagen und rauchte, obwohl das hier unten strengstens verboten war.
»Lasst uns mit kühlem Kopf überlegen. Wo könnte er sein? Es war doch Benjamin, ich meine, Monsieur Forestier, oder? Wer hat ihn abkassiert?«
»Das war Enzo«, sagte Philippe.
»Dann hol Enzo her«, antwortete die Kapitänin.
Als zwei Minuten später der alte Kassierer vor ihr stand, nickte er ohne Umschweife. »Klar, das war der Maler. Er war bei mir am Kassenhäuschen und hat für eine Hin- und Rückfahrt bezahlt. Beides heute.«
»Wie war er?«
Enzo verstand die Frage, es brauchte keine Erklärung. »Lustig wie immer. Und sehr nett.«
»Hm«, sagte Deborah und atmete tief durch. »Etwas anderes hab ich auch nicht erwartet. Okay, ich werde jetzt unter Deck nachsehen, und dann gehe ich noch mal die ganze Fähre ab. Ihr beide auch. Enzo, du bleibst hier und …«
Wieder hupte es. Jetzt reichte es ihr. Sie wandte sich wütend um und schrie die Postbotin aus der Ferne an: »Wir können nicht zaubern, Herrgott! Jetzt wart halt mal!«
Ohne eine Antwort abzuwarten, nahm sie die metallischen Treppenstufen, deren weiße Farbe an vielen Stellen abgeplatzt war. Sie könnten mal wieder einen Anstrich vertragen. Im Winter, mahnte sie sich, im Winter. Jetzt gab es Wichtigeres. Sie ging durch den Maschinenraum, atmete den Geruch von Öl und Diesel, sah die schweren Maschinen, den Motor, das Getriebe, blickte hinter jeden Kasten und jedes Gerät – doch Benjamin Forestier blieb verschwunden. Dann tat sie das Gleiche auf dem Oberdeck, in der Kabine und auf dem Fahrzeugdeck, bis sie schließlich sogar die Brücke durchsuchte. Nach weiteren zwanzig Minuten kam sie wieder aufs Autodeck. Die drei Männer sahen sie erwartungsvoll an, genauso wie sie die drei Männer ansah.
»Habt ihr was?«
»Nichts. Und Sie, Capitaine?«
Deborah Galhaud machte ein gequältes Gesicht. »Ich fürchte, wir müssen Hilfe holen.«
Sie stieg die Treppen empor und betrat die Brücke, dann griff sie zum Funkgerät. Bevor sie den Sprechknopf drückte, schloss sie kurz die Augen. Wirklich? War wirklich etwas passiert? Sie konnte es sich nicht vorstellen. Sie wollte es sich nicht vorstellen. Sie sah das graue Wasser des Flusses unter sich. Sie spürte, wie sich ihr Atem beschleunigte. Beruhig dich, mahnte sie sich. Erst dann drückte sie auf den Knopf.
»Leitstelle Bordeaux für Gironde-Fähre Sébastien Vauban?«
»Leitstelle hört, guten Morgen, Capitaine.«
»Nein, kein guter Morgen, fürchte ich. Ich brauche die Police nationale hier. Wir haben einen vermissten Passagier am Hafen von Blaye.«
Café du Marché, Carcans PlageVendredi, 8 juillet, 8:12
»Gaston, machst du mir bitte einen Kaffee, mon cher?«, fragte Luc.
»Und mir auch – den größten, der deiner Kaffeemaschine möglich ist.« Anouk hatte sich kurzerhand angeschlossen.
Der alte Wirt stand lächelnd vor ihnen, die Hände auf den Tisch gestützt, seine liebste Geste. »Ein kleiner Espresso und ein riesiger Becher mit einem allongée. Das habe ich verstanden. Und die petite princesse, will die auch etwas? Ein bisschen Milchschaum?«
Zum sechsten Mal an diesem Morgen steckte Gaston seinen Kopf in den Kinderwagen, doch Aurélie hatte kein Herz für schockverliebte Wirte, sie schlief einfach weiter.
»Sollte sie in den nächsten sechs Stunden aufwachen, fragen wir sie, in Ordnung?«
»So lange wollt ihr bleiben? Macht mir bloß die Terrasse frei, bevor die Touristen kommen.« Gaston zog scherzhaft die Stirn in Falten, dann ging er nach drinnen, wo seine Frau an der Kaffeemaschine wartete, um die Bestellungen der frühen Kundschaft entgegenzunehmen.
Hier draußen streifte der leichte Morgenwind durch die Bäume, sodass die Blätter sanft knisterten. Die Gäste saßen unter einem grünen Dach. Zum hellgrünen Flimmern kamen die weißen Möwen, die über ihnen ihre Kreise zogen, Frühsport am Himmel gewissermaßen.
Abgesehen von ihnen und dem Kinderwagen war die Terrasse tatsächlich leer. Die Urlauber schliefen in ihren Ferienhäusern, Chalets und Wohnungen wohl noch aus.
Doch Anouk und Luc hatten es nicht ausgehalten in ihrer Cabane. Schon als Luc um kurz nach sieben die Fensterläden geöffnet hatte, waren die ersten Worte seiner Freundin: »Wow, was für eine schöne Morgensonne.« Dann hatte sie sich noch einmal an ihn geschmiegt und gemurmelt: »Noch im Bett bleiben oder ein Spaziergang?«
»Hm«, hatte Luc gemacht und Anouk zu streicheln begonnen, »ich finde, wir sollten noch etwas liegen…« Und genau in diesem Augenblick hatte Aurélie begonnen sich zu regen, mit ihrem ganz leisen Glucksen. Luc hatte Anouk angesehen, und sie mussten beide lachen.
»Da ist jemand wohl schon länger wach, hm?«, sagte Luc, nachdem er sich aus dem Bett geschwungen hatte und zum Kinderbettchen hinübergegangen war, in dem die Kleine mit weit aufgerissenen Augen vor sich hin giggelte, offenbar bester Laune, weil sie ihren Eltern das Schäferstündchen verdorben hatte.
»Also doch ein Spaziergang!«, hatte Anouk gerufen und war schon aus dem Bett.
Eine halbe Stunde später nahmen sie den Strandübergang über die Düne – und genau dort hatte es sich Aurélie noch einmal überlegt und war wieder tief und fest eingeschlafen. »Erst wirft sie uns aus dem Bett, und nun sind wir die Einzigen, die wach sind«, grinste Anouk. Doch als sie über die Düne kamen, verstummte sie. Der Anblick machte sie beide sprachlos – jedes Mal, an jedem neuen Tag.
Erst war da der Strandhafer, der sich sanft im Wind wiegte, waren da die Büsche und Sträucher, die den Deich stabilisierten. Dann der goldene Sand, endlos, angestrahlt von der Sonne hinter ihnen – und davor der Ozean, gerade in einem ganz hellen Blau, weil der Einfallswinkel des Sonnenlichts die Wellen wie fein geschnittene weiße Kronen aufleuchten ließ, schnittige Kronen, die heranrasten, majestätisch und wunderschön.
»Wow«, murmelte Luc nur. Sie standen da und genossen den einmaligen Anblick. Einmalig, weil es hier oben auf der Düne einfach jeden Morgen anders aussah – nie glich der Atlantische Ozean sich selbst, jeder Tag brachte neue Wellen, ein neues Panorama, mal aufgewühlt vom Sturm, mal klar und windstill, mal rau und lieblich zugleich – das gab es nur hier, an dieser Westküste, die keine Wünsche offenließ.
»Da juckt es in den Fingern, hm?«, fragte Anouk und hatte den Kinderwagen hin- und hergewiegt, damit Aurélie weiterschlafen konnte. »Willst du gleich mal surfen gehen? Du musst ja nicht so früh ins Büro wie ich.«
»Wenn ich mir das noch länger ansehe, dann hole ich wirklich gleich das Board raus«, antwortete Luc.
»Mach das doch«, ermunterte ihn seine Freundin. »Nachher sind die Urlauber da – und surfen dir alle Wellen weg.«
»Da du meine Chefin bist«, sagte Luc und legte den Arm um ihre Hüfte, »muss ich den Befehl befolgen, oder?«
»Ansonsten würde es zu einer Abmahnung führen.« Sie lächelte wieder und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Noch ein paar Minuten betrachteten sie die Wellen, die tosend den Strand erreichten. Diesen Strand, den Luc liebte, seit er denken konnte. Er war hier aufgewachsen, in diesem kleinen Dorf hinter der Düne, er hatte als Kind jeden Tag an diesem Strand verbracht. Immer noch betrachtete er ihn mit derselben Begeisterung wie damals. Inzwischen war er selbst Vater geworden, Vater dieser wunderschönen kleinen Tochter, die nun schon ein Dreivierteljahr alt war. Und den Kinderwagen hielt Anouk in ihren Händen, die in so kurzer Zeit, in nur zwei Jahren, ein elementarer Bestandteil seines Lebens geworden war. Noch vor drei Jahren hatte er nicht gewusst, ob er sich jemals fest binden wollte – und nun war es geschehen, Hals über Kopf, eine Liebe wie ein Blitzschlag, am Tag seiner Ankunft in der Aquitaine.
»Jetzt brauche ich aber dringend einen Kaffee«, hatte Anouk gesagt, die seit dem Abstillen geradezu koffeinsüchtig geworden war. Sie waren also wieder die Düne hinuntergelaufen und hatten ihre Stammplätze am Rand der Terrasse von Gastons Bistro eingenommen.
Drinnen war das Zischen der Kaffeemaschine zu hören, ein herrliches Geräusch, das sich vermischte mit dem Klang der Wellen auf der anderen Seite der Düne. Der Wirt pfiff ein heiteres Lied.
»Das wird ein richtig heißer Tag«, sagte Anouk und blickte zum Himmel, der noch mit kleinen Wölkchen überzogen war, Schäfchenwolken, die sich langsam durchs Blau schoben. Luc nickte. »Ja, ich glaube, ab heute Nachmittag wird es am Strand reichlich eng zugehen.« Er wusste natürlich, dass die ganze Küste vom nördlichen Médoc bis hinunter ins Baskenland ein einziger Sandstrand von fast dreihundert Kilometern Länge war. Deshalb war hier genug Platz für alle: Urlauber und Einheimische, Familien und Ruhesuchende. Es wurde niemals so eng wie an den Stränden der Provence und der Côte d’Azur, auch wenn die Strände an den Wochenenden in der Hochsaison definitiv gut besucht waren. Mit Grauen dachte der Commissaire an den Verkehr, der ab heute Nachmittag herrschen würde, wenn die Bordelais ihre Büros verlassen und sich direkt in ihre Autos setzen würden – ab gen Westen, ab an den Strand. Es würde eine schier endlose Odyssee werden, immer in Richtung Lacanau und Carcans. Mangels anderer Verbindungen wurde die Départementale zu einer gigantischen Staufalle. Züge gab es in diesem Teil des Médoc Atlantique nicht, und der Linienbus konnte sich um den Stau kaum herummogeln. Luc würde also nach Feierabend noch eine Weile in Bordeaux bleiben und erst spät am Abend wieder in den kleinen Strandort fahren.
»Sie schläft echt wie ein Murmeltier«, bemerkte Anouk und warf einen Blick in den Kinderwagen. Gaston kam mit dem Tablett, darauf standen die dampfenden Tassen und zwei Teller. Anouk schaute fragend zu ihm auf, doch Luc ahnte schon, was sie erwartete – und schwelgte in Vorfreude.
»Zwei Kaffee für meine Freunde«, sagte der Wirt. »Und du weißt es ja, Luc, Freitag backt Evelyne immer, weil die Boulangerie so überfordert ist mit dem Andrang der Urlauber. Deshalb machen wir unser Baguette selbst im Pizzaofen – und heute hat sie noch torsades mitgebacken. Hier, ich hab euch zwei mitgebracht, sie sind noch warm.«
Er stellte die Teller vor ihnen ab, und Anouk strahlte Luc an. »Ich komme nur noch freitags hierher!«, rief sie fröhlich aus und riss sich ein Stück von der torsade ab.
Luc mochte eigentlich keine süße Sachen, aber bei diesem Anblick und diesem Duft musste er einfach eine Ausnahme machen.
Torsade wurde dieses Gebäck nur hier im Südwesten genannt, im Rest des Landes war es schlicht eine suisse: ein längliches Gebäckstück aus Briocheteig, das in Kringel gelegt wurde. Es war mit einer feinen Schicht Crème pâtissière und kleinen Kugeln aus Schokolade sowie etwas Hagelzucker gefüllt. Luc konnte es nicht abwarten und biss herzhaft in dieses süße Teilchen, dann schloss er einen Moment die Augen, weil das Aroma, der warme Teig, die feine Süße, die leckere Creme ihn regelrecht überwältigten und er in diesem Augenblick so glücklich war – hier, auf dieser Terrasse hinter dem Strand, mit der Frau seines Lebens, seiner kleinen Tochter, dem Wirt und seiner Frau, die genau wie die anderen Händler und Bewohner des Dorfes Teil seiner Familie waren. An diesem Ort, den er endlich Heimat nannte.
»Sag Evelyne, sie soll nie wieder etwas anderes backen«, sagte Luc und griff nach der kleinen Espressotasse. Gaston lächelte stolz. Dann verschwand er, um das Kompliment auszurichten.
Als Luc den ersten Schluck Kaffee nahm, surrte es auf einmal. Anouks Handy. Sie stand auf, um in ihre Hosentasche zu greifen, und während sie das tat, surrte auch sein Telefon. »Was denn jetzt?«, murmelte er und sah Anouk fragend an, die auf das Display blickte und die Stirn in Falten legte.
»Präfekt«, flüsterte sie.
»Hugo«, flüsterte Luc nach einem Blick auf sein Handy.
Er hörte der Stimme seines Capitaine sofort an, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Um diese Zeit war niemand im Büro, aber Capitaine Hugo Pannetier hatte in dieser Nacht Bereitschaftsdienst in der Brigade criminelle gehabt.
»Luc, die haben mich eben angerufen, ihr müsst schnell kommen. Auf der Gironde-Fähre ist ein Passagier verschwunden.«
»Wie das?«
»Keine Ahnung. Er ist auf die Fähre hinaufgefahren, aber nun ist er wie vom Erdboden verschluckt. Sein Auto stand ganz vorne an der Ladebordwand, sodass niemand herunterfahren kann.«
»Na, wenigstens etwas«, bemerkte Luc trocken. Alle Zeugen an Bord, war sein erster Gedanke gewesen. Jedenfalls diejenigen, die ihren Wagen nicht missen wollten. Und …
»Blaye oder Lamarque?«, fragte er.
»An der Mole von Blaye.«
»Die sollen niemanden von Bord lassen.«
»Sage ich den Gendarmen, die schon da sind. Soll ich mich auf den Weg machen?«
»Fahr lieber ins Büro, Hugo. Falls der Gesuchte noch gefunden wird, sollten wir dort besetzt sein. Wir fahren sofort los – da die Fähre nicht mehr fährt, müssen wir um Bordeaux herum. Wird also etwas dauern um diese Zeit.«
»Alles klar, haltet mich auf dem Laufenden.«
»Ja, das machen wir, Hugo. Und danke.«
Anouk bedankte sich ebenfalls, dann legten Luc und sie fast gleichzeitig auf. Die Commissaire divisionnaire sah ihren Untergebenen und Freund besorgt an.
»Die Fähre?«
Luc nickte.
»Der Präfekt weiß es auch schon. Er ist in großer Sorge. Ein verschwundener Passagier auf einer Urlauberfähre zu Beginn der Hochsaison – das ist gar nicht gut.«
Luc trank den Espresso aus und stand auf. »Na, dann fahren wir mal hin. Aber die hier nehmen wir mit.«
Luc griff nach der torsade, dann sah er auf seine Armbanduhr.
»Alain müsste gleich kommen, um Aurélie zu nehmen. Dann können wir zusammen fahren.«
Fähranleger BlayeVendredi, 8 juillet, 9:47
Deborah Galhaud betrachtete das Hin und Her unter ihr auf dem Schiff. Der größere Teil der Passagiere stand oder saß auf dem Deck und hatte sich in das Schicksal gefügt, hier noch ausharren zu müssen. Nur drei Passagiere redeten an der Ladebordrampe wild auf eine junge Gendarmin ein. Die Kapitänin sah, wie ein Mann sie fast anstieß, so wütend gestikulierte er, doch die junge Frau blieb ganz ruhig, hatte die Arme vor der Brust verschränkt und blockierte den Ausgang. Die Crew stand unten auf dem Autodeck und sah den Gendarmen zu, die noch einmal das ganze Schiff absuchten. Sie sahen von hier oben wie kleine blaue Ameisen aus, die fleißig und zielstrebig auf und ab gingen. Sie hoben alles an, was sich anheben ließ, öffneten die Kammern der Schwimmwesten und Rettungsboote, sahen hinter jede Tür. Deborah hatte mitgezählt, die Toiletten waren nun schon ein Dutzend Mal gründlich durchsucht worden – doch das Ergebnis war immer dasselbe.
Sie lehnte sich in ihrem Kapitänsstuhl zurück. Verdammt, war das ein Albtraum. Sie hatte sich so auf einen pünktlichen Feierabend gefreut nach der üblichen Anzahl ereignisloser Hin- und Herfahrten, auf einen schönen Nachmittag am Strand, aber den konnte sie sich jetzt wohl abschminken. Was war hier passiert?
Sie konnte nicht glauben, dass Benjamin wirklich etwas geschehen war. Sie war auch gar nicht besonders unruhig. Warum auch? Das war Benjamin, der Maler, der Lackierer, der Mann, den sie schon so lange kannte. Natürlich konnte er gut schwimmen.
Und sicher war er auch überhaupt nicht im Wasser. Oder? Das konnte doch nicht sein.
Er musste wieder von Bord gegangen sein, bevor sie abgelegt hatten. Eine andere Erklärung gab es nicht. Vielleicht war bei ihm zu Hause etwas passiert. Eine unvorhergesehene Sache, vielleicht war eines der Kinder krank geworden. Ja, das musste es sein. Und er war Hals über Kopf aufgebrochen, sein Auto hätte er in Lamarque eh nicht wieder von Bord bekommen, es stand ja ganz vorne, wenden ging nicht. Aber dann wiederum war die Frage: Warum hatte er nicht Bescheid gesagt? Sie per Telefon informiert oder jemandem von der Crew den Schlüssel zugeworfen, damit der den Wagen wegfahren konnte? Eigentlich war Benjamin immer freundlich und handelte sehr überlegt – was konnte passiert sein, das ihn dazu gebracht hätte, egoistisch von Bord zu stürmen?
Wenn er das Schiff allerdings nie verlassen hatte … So ein Mist. Sie spürte, wie ihre Hand zitterte. Sie müsste den Polizisten sagen, dass sie bei Benjamin zu Hause anrufen sollten. Seine Frau war sicher noch daheim. Deborah blickte in ihre leere Kaffeetasse. Sie hätte gut noch einen Kaffee gebrauchen können. Andererseits würde sie dann noch aufgeregter. Wenn sie doch nur noch rauchen würde …
Sie riss sich aus ihren Gedanken, als unten vor der Mole ein alter grüner Jaguar hielt, sehr schönes Modell, toller Zustand. Ein Mann und eine Frau stiegen aus. Sie waren in Zivil und schienen wichtig zu sein, denn die Gendarmen salutierten und ließen sie auf die Fähre. Sofort wurden die beiden von den drei Passagieren an der Rampe bestürmt. Der Mann sagte etwas, was Deborah nicht hören konnte, und sofort verstummten die aufgeregten Fahrgäste und zogen sich endlich in eine Ecke des Autodecks zurück. Dann hörte sie Schritte auf der metallenen Treppe, sie kamen näher, und schließlich klopfte es an ihrer Tür.
»Ja?«
Die Tür öffnete sich, und die Frau trat zuerst ein, hinter ihr der Mann. Deborah nickte ihnen zu.
»Madame Galhaud, Sie führen das Schiff?«, fragte der Mann mit einer angenehm tiefen und warmen Stimme, die sehr ernst klang.
»Ja, ich bin die Kapitänin.«
»Das ist Commissaire Anouk Filipetti, Leiterin der Police nationale in Bordeaux, ich bin Commissaire Luc Verlain von der Brigade criminelle. Wir haben Grund zu der Annahme, dass auf Ihrem Schiff ein Verbrechen geschehen ist.«
Vendredi, 8 juilletMann über Bord
Kapitel 1
»Sie müssen uns ganz genau erzählen, was geschehen ist – während der Verladung in Lamarque, beim Ablegen, bei der Überfahrt. In Ordnung?«
»Natürlich, Commissaire.« Die Kapitänin sprach sehr ruhig und gab ihren Worten einen selbstsicheren Klang, doch ihre zitternden Hände straften die Worte Lügen.
»Kannten Sie den Passagier?«
»Natürlich. Monsieur Forestier. Die Crew und ich kennen alle, die zu dieser Zeit die Fähre nehmen. Das sind fast ausschließlich Stammgäste. Deshalb kann ich gar nicht glauben, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Haben Sie schon bei seiner Familie angerufen?«
»Das konnten wir noch nicht – es ist nicht Aufgabe der Gendarmen, uns über den Toten zu informieren, und so fangen wir gerade einfach von vorne an«, sagte Anouk. »Also, wer ist der Vermisste?«
»Er heißt Benjamin Forestier und ist ein Malermeister aus Pauillac. Er hatte wohl wieder einen Auftrag hier drüben, ich glaube, in Saint-Christoly, deshalb war er so früh unterwegs.«
»Er hat Familie?«
»Ja. Eine Frau und drei Kinder. Die sind noch klein. Sie müssen fragen, ob er nach Hause zurückgekehrt ist – vielleicht war eines der Kinder krank …«
»Kommt man denn noch von Bord, wenn man einmal auf die Fähre aufgefahren ist?«
»Na ja, nicht mit dem Auto.« Sie schüttelte energisch den Kopf. »Wir sind eine Roll-on-roll-off-Fähre. Wir haben zwei Luken, anders würde es im Hochsommer auch gar nicht gehen. Da können Sie nicht rangieren. Hier wird die Luke runtergelassen, und die Autos fahren raus, dann fahren die Autos in die andere Richtung wieder drauf. Und dann lassen wir die gegenüberliegende Luke am nächsten Hafen runter. Wenn die Autos also drauffahren, stehen sie ganz nah an der geschlossenen Luke, so wie Benjamins Wagen, sehen Sie?« Sie wies auf den weißen Transporter vorne an Deck. »Aber meine Crew ist dann natürlich damit beschäftigt, sich um die richtige Position der nachfolgenden Wagen zu kümmern, die sind alle hier vorne unterwegs und sehen nicht, wenn jemand hinten von Bord geht.«
»Okay, er könnte die Fähre also verlassen haben. Aber wie soll er ohne Auto nach Pauillac gekommen sein?«
»Die Busse sind mit der Ankunftszeit der Fähre synchronisiert«, erwiderte die Kapitänin. »Als wir anlegten, war der Bus da, um die Arbeiter aus Blaye in die Weinberge zu bringen – oder in die Hotels zum Frühstücksservice. Vielleicht ist er da eingestiegen.«
Luc nickte. Das klang logisch. Auch wenn er sich nicht erklären konnte, warum der Mann das Auto auf der Fähre hätte stehen lassen sollen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Andererseits: Wenn man in Sorge um ein Kind war, vergaß man vielleicht alles um sich herum. Seit er Aurélie hatte, konnte er sich das gut vorstellen.
»Gut, wir werden die Familie anrufen und nachfragen«, sagte er. »Und Sie sind sich ganz sicher, dass Sie Monsieur Forestier nach dem Ablegen nicht mehr gesehen haben?«
»Ich habe das Deck nur bis zum Hochklappen der Ladeluke im Blick. Wenn die Autos rangieren, wissen Sie? Ich prüfe, ob noch ein Wagen raufpasst, und gebe den Kollegen unten Bescheid. Aber so früh am Morgen ist das nicht nötig, weil wir dann ohnehin nie voll sind. Und wenn wir einmal abgelegt haben, konzentriere ich mich nur noch auf die Fahrt.«
»Mit anderen Worten, Sie haben ihn nicht gesehen.«
»Nein«, bestätigte die Kapitänin. Luc hatte nun Zeit gehabt, sie zu studieren: Sie war klein und drahtig, die Uniform mit der dunklen Stoffhose und dem blauen Hemd mit den Schulterstücken mit den drei blauen Streifen saß sehr locker. Die Kapitänsmütze hatte sie auf ihr Pult gelegt. Es sah nicht aus, als legte sie Wert darauf, sie zu tragen. Sie war nicht geschminkt und trug auch keinen Nagellack, stattdessen hatte sie Ölflecken an den Händen, so als hätte sie heute schon im Maschinenraum gearbeitet. Sie wirkte wie eine Frau, die gerne mit anpackte – und sie war jung, jünger als er sich eine Kapitänin mit einer so verantwortungsvollen Tätigkeit vorgestellt hatte. Luc fragte sich unwillkürlich, ob er darüber auch bei einem Mann nachgedacht hätte – und ja, auch bei einem Mann in so jungem Alter hätte ihn diese Position erstaunt.
»Okay, danke Ihnen, Madame la Capitaine.« Anouk wies auf das Deck. »Wir werden jetzt die Familie anrufen. Vielleicht fahren wir sogar besser dort vorbei. Jedenfalls dürfen Sie vorerst nicht auslaufen, und wir werden auch niemanden von Bord lassen können. Wie viele Passagiere hatten Sie an diesem Morgen dabei? Sie müssen doch alle zählen, oder?«
»Ja natürlich, Commissaire«, sagte die junge Frau, »hier hat alles seine Ordnung. Auf der Hinfahrt nach Lamarque waren wir sieben Passagiere und vier Mann Besatzung, auf der Rückfahrt nach Blaye waren es sechzehn Passagiere und vier Mann Besatzung. Na ja, sechzehn wären wir mit Benjamin gewesen. Wenn er wirklich von Bord gegangen ist, waren es nur fünfzehn.«
»In Ordnung, das ist ja übersichtlich. Ein Glück. Hören Sie, wir werden an Deck zuerst die Daten aller Crewmitglieder und Passagiere aufnehmen, und dann müssen wir sie einzeln befragen. Sollte er wirklich von Bord gegangen sein, dann hat das hoffentlich jemand gesehen. Und wenn nicht …«
Anouk und Luc hoben gleichzeitig den Kopf und sahen hinaus auf die graue Gironde, die in ihrem breiten Becken träge dahinfloss. Sie mochten beide nicht darüber nachdenken, was wäre, wenn Benjamin Forestier nicht daheim bei einem kranken Kind war.
Kapitel 2
»Ich fahre gerne zu der Familie … also, natürlich nicht gerne, aber … ich würde hinfahren.« Doch Luc sah, dass Anouk schon den Kopf schüttelte. »Ich mache das. Hoffen wir, dass ich klingele und er einfach die Tür öffnet, sich kurz wundert, was wir von ihm wollen und ihm dann siedend heiß sein Wagen einfällt. Du machst hier weiter. Auf diese geifernden Kunden dort habe ich wirklich keine Lust.«
Luc folgte ihrem Blick und sah, dass es nun eine Frau war, die wütend auf die Gendarmin einredete, die ihrerseits ein genervtes Gesicht machte. Es stimmte – er würde intervenieren müssen.
»Danke, Anouk«, sagte er, weil er wirklich nur ungern mit ihr tauschen wollte. Sie legte ihm kurz die Hand auf den Arm, dann nickte sie der Kapitänin zu. »Drückt mir die Daumen, dass er einfach zu Hause ist.« Sie öffnete die Tür zur Brücke und verschwand.
Luc überlegte kurz, ob er die Lautsprecheranlage der Fähre benutzen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Manche Dinge besprachen sich besser von Angesicht zu Angesicht.
»Kommen Sie bitte mit hinunter«, bat er die Frau, die ihm, ohne zu zögern, folgte. Sie stiegen die Treppe hinab aufs Sonnendeck, und sofort wandten sich ihnen sämtliche Gesichter zu. Ein Mann in Zivil, wohl ein Polizeibeamter, und die Kapitänin des Schiffs in Uniform – den Passagieren war die Hoffnung anzusehen, endlich mehr zu erfahren.
Luc positionierte sich so, dass er sowohl auf dem Ober- als auch auf dem Fahrzeugdeck gehört werden konnte, dann sagte er laut, langsam und deutlich: »Mesdames et messieurs, ich bitte Sie um Ruhe. Ich bin Commissaire Luc Verlain, und ich bin hier, weil ein Passagier dieser Fähre verschwunden ist. Die Crew und meine Kollegen haben nach ihm gesucht, bisher leider erfolglos. Deshalb können Sie die Sébastien Vauban erst einmal nicht verlassen. Wir werden Sie jetzt eingehend befragen – und so lange wir das tun, bitte ich Sie, die Ruhe zu bewahren und unsere Beamten nicht weiter zu bedrängen.« Dabei sah Luc die Frau an der Reling scharf an. »Es wird noch eine Stunde dauern, vielleicht auch länger. Ich muss Sie deshalb bitten, Ihre Vormittagstermine abzusagen und – falls nötig – Ihre Familie oder Arbeitsstelle zu informieren. Ich kann Ihnen versichern: Sie sind hier in Sicherheit, und wir tun alles dafür, dass Sie schnell von Bord gehen können – am schnellsten wird es aber gehen, wenn Sie jetzt mitarbeiten und meine Fragen beantworten. Wir treffen uns dazu auf dem Oberdeck. Die Kollegen werden Sie zu mir führen, sobald Sie an der Reihe sind. Sollten Sie versuchen, von Bord zu kommen, werden wir Sie verhaften müssen, haben das alle verstanden?«
Luc sah in aufgeregte, verständnislose und ängstliche Gesichter – aber er hatte diesen letzten Satz mit Absicht ausgesprochen. Denn ein bisschen Aufregung vor dem Verhör konnte nicht schaden. Wer auch immer etwas mit dem möglichen Verschwinden dieses Mannes zu tun hatte, musste auf dem Schiff sein, daran hatte er keinen Zweifel. Aber vielleicht würde auch gleich Anouk anrufen – und alles wäre in Ordnung. Er sah auf die Uhr: Sie war seit zehn Minuten unterwegs. Bis Pauillac würde sie sicher noch eine Stunde brauchen. Selbst mit Blaulicht war die Strecke von Blaye rund um Bordeaux und dann wieder nach Norden ins Médoc eine halbe Weltreise. Die Fähre wäre eine echte Zeitersparnis. Aber auf dieser Fähre saßen er – und die Verdächtigen.
Verdächtige. So nannte er sie also schon. Weil er – zugegeben – nicht sehr optimistisch war, dass Anouks Hoffnung sich erfüllte.
Er wandte sich, diesmal leiser, an die Kapitänin: »Wenn Ihnen noch etwas einfällt, Madame la Capitaine, ein Aufblitzen seines Gesichts, nachdem Sie abgelegt haben, irgendetwas in der Art, dann kommen Sie sofort zu mir, in Ordnung? Und jetzt wäre es gut, wenn Sie mir die Crew hochschickten, einen nach dem anderen. Fangen wir doch mit dem Kollegen an, der die Karten verkauft.«
»Enzo Pasquelli. Den schicke ich Ihnen sofort.«
Luc blickte ihr nach, wie sie die Treppe hinunterging, und dann hörte er sie sprechen. Er suchte sich einen Platz an der Reling auf der anderen, landabgewandten Seite. Als er nach unten sah, bemerkte er, wie schnell die Gironde floss. Das war kein träger Fluss, sondern ein ziemlich reißender Strom, der sich seinen Weg in Richtung Atlantik bahnte. Vierzig, vielleicht fünfzig Kilometer nördlich von hier endete die Halbinsel des Médoc, dort war die Mündung knapp vier Kilometer breit – und dort ergoss sich der Fluss in den riesigen Ozean. Das war auch der Grund, warum die Gironde so grau war wie der Sandstein in Bordeaux. Es lag nicht daran, dass der Fluss besonders schmutzig war, ganz im Gegenteil: Wäre er nicht so gefährlich, ließe sich darin sogar vortrefflich baden. Die graue Farbe wurde durch das Salz im Meerwasser hervorgerufen, das bei Flut in die Gironde gedrückt wurde. Dort traf es auf die Tonpartikel, die der Fluss Garonne aus den spanischen Pyrenäen mitbrachte, und Salz und Ton reagierten dann zu dieser hellgrauen Farbe, mit der die breite Gironde gen Nordwesten strömte. Luc überlegte: Wenn Benjamin Forestier wirklich über Bord gegangen war, dann wäre er bei dieser Fließgeschwindigkeit wahnsinnig schnell abgetrieben, selbst als erfahrener Schwimmer.
Er hörte wieder Schritte auf der metallenen Treppe, es klang nach schweren Stiefeln. Der Mann, der diese Arbeiterstiefel trug, war ein kleiner, dicker Zeitgenosse mit sehr dunklem Teint. Seine Arme waren stark behaart, und er wirkte wie ein Mann, der sein ganzes Leben draußen verbrachte.
»Enzo Pasquelli?«
»Ja, der bin ich. Seit dreiundfünfzig Jahren.«
»Sind Sie Italiener?«
»Viel besser: Korse.«
»Die Insel der Schönheit.«
»Schöne Insel, schöne Bewohner«, entgegnete der Mann und grinste über den eigenen Scherz.
Auch Luc lächelte und wies auf den Platz ihm gegenüber. Der Korse ließ sich auf den Plastikstuhl fallen, der bedrohlich knarzte.
»Sie verkaufen die Fahrkarten an Bord?«
Pasquelli nickte. »Aber nicht nur das. Ich putze und prüfe das Sonnendeck und die Automaten in der Kabine, also den Kaffeeautomaten und den mit den Süßigkeiten. Manchmal bin ich sogar mein bester Kunde.« Wieder grinste er. »Aber hauptsächlich bin ich, wenn’s losgeht, in meiner kleinen Billetterie auf dem Autodeck und verkaufe den Leuten die Karten, erkläre den Fahrplan – und das in zehn Sprachen. Durch die vielen Touristen im Sommer kann ich mittlerweile auch auf Holländisch und sogar auf Persisch sagen: Achtundzwanzig Euro, bitte. So viel kostet die Überfahrt für ein Auto mit zwei Leuten in der Hochsaison.«
»Aber zu dieser frühen Stunde waren ja keine Touristen an Bord, also eher kein Persisch?«
»Nee, um die Uhrzeit brauchen Sie auf dem Hinweg nur Rumänisch. Dann fahren die Arbeiter in die Weinberge – und das sind alle gens du voyage.«
Luc nickte. Fahrendes Volk. So wurden die Roma genannt, die traditionell in Wohnwagen durchs Land reisten, um Gelegenheitsarbeiten zu verrichten.
»Und auf dem Rückweg nach Blaye waren nur Einheimische an Bord.«
»Sie kannten Benjamin Forestier?«
»Vom Sehen.« Der Mann blinzelte. »Manchmal fährt er mit, wenn er drüben Aufträge hat. Er kommt aus Pauillac, oder? Ich hab da manchmal sein Schild gesehen. Er macht Werbung für seine Malerfirma. Aber er fährt nicht so häufig mit, dass er eine Jahreskarte hat. Die kostet achthundertvierzig Euro, das muss sich lohnen. Da kommt er billiger weg, wenn er Einzelkarten kauft.« Pasquelli beugte sich nach vorne und sprach leiser: »Wir sind ja ein Unternehmen, das dem Département gehört, also staatlich. Und da die Leute von hier eh Steuern zahlen, knöpfe ich den Einheimischen morgens nicht den Tarif der Hochsaison ab, sondern den niedrigeren vom Winter – sonst werden die doch arm. Aber das muss ja keiner wissen, oder, Commissaire?«
Luc nickte ihm beruhigend zu. »Nein, das braucht niemand zu erfahren, Monsieur Pasquelli. Also hat Monsieur Forestier bei Ihnen heute Morgen ein vergünstigtes Ticket gekauft?«
»Na klar, Benjamin war ja der Erste, der aufgefahren ist, oder?« Er kratzte sich am Kopf. »Ja, so war es. Und da kam er gleich an meine Kabinentür und hat mir durchs Fenster fünfundzwanzig Euro gereicht. Und dann hab ich gesagt: Nee, nee, Monsieur, lassen Sie mal, und dann hab ich ihm zwölf wiedergegeben. Dreizehn Euro kostet die Passage im Winter für Auto und Fahrer und 24,50 Euro im Sommer. Und dann hat er gesagt: ›Na, dann machen wir halbe-halbe‹, und hat mir gedankt und zugezwinkert und mir fünfzehn Euro gelassen. ›Der Rest ist für Sie‹, hat er gesagt, ›ist ein guter Auftrag, den ich drüben habe.‹ Das war schon nett von ihm.«