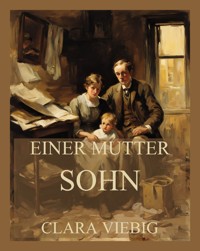Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frau Regierungsrätin Dallmer ist unglücklich, weil sie nicht glaubt, ihre Tochter Nelda jemals unter die Haube zu bekommen. Aber was soll aus ihr werden, wenn ihr Mann stirbt und Nelda ohne Vermögen zurückbleibt? Immerhin, Nelda ist jung und hübsch, und bald lernt sie den jungen Ferdinand von Ramer kennen, der sich für sie zu interessieren scheint. Kann Frau Regierungsrätin Dallmer jetzt aufatmen? Aber schließlich sieht sich Ramer gezwungen, der jungen Frau einen bitteren Schmerz zuzufügen ... Clara Viebig, selbst in Trier aufgewachsen, hat die Eifel-Welt dieser "Rheinlandstöchter" wahrlich "aus dem Leben gegriffen" und schildert sie in diesem frühen Roman mit packendem Realismus und einem großen, idealistischen Herz. "Rheinlandstöchter" ist der Roman, mit dem Clara Viebig der Durchbruch als Schriftstellerin gelang – zu Recht!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Rheinlandstöchter
Roman
Saga
Erstes Buch
1
„Nein, ich glaube ganz entschieden nicht, dass meine Nelda heiratet,“ sagte Frau Regierungsrätin Dallmer mit einem Seufzer und häkelte nervös hastig an dem feinen Hemdenspitzchen. „Ich werde wohl das Glück nicht haben,“ setzte ihre gedrückte Stimme noch leiser hinzu.
„Aber, verehrteste Rätin, warum denn nicht?“
„Du meine Zeit, es heiraten noch ganz andere — was für eine Idee!“
„Gott, sie ist ja noch jung und auch ganz hübsch!“
„Wie kommen Sie darauf, haben Sie etwa schon Erfahrungen gemacht?“
Ein ganzer Chorus von Stimmen stürmte auf Frau Regierungsrätin Dallmer ein, die auf dem Sofa, hinter dem mit Kaffeetassen und Kuchenkörben bedeckten Tisch sass.
Jetzt liess sie die Hände in den Schoss sinken.
„Lieber Gott, ich hab’s so im Gefühl — Nelda hat gar nicht das, was andere junge Mädchen haben. Wir haben zu wenig an ihr erzogen, mein guter Mann hat eben ganz andere Ansichten als ich. Und wenn ich nun denke, dass Dallmer so leidend ist und Nelda ohne Vermögen zurückbleibt! Was soll werden, wenn sie sich nicht verheiratet? Ach, es kostet mich manche schlaflose Nacht!“
Die kleine Frau duckte sich wie ein Vogel vor dem Sturm und hielt einen Augenblick die Hand vor die Augen. Der Chorus benutzte dies, um sich verständnisinnig zuzunicken.
„Teure Freundin,“ sprach Frau Oberkonsistorialrätin Zänglein würdevoll und legte die fleischige weisse Hand auf die Schulter der Zusammengesunkenen, „des Herrn Wege sind wunderbar, sein Ratschluss unerforschlich! Vertrauen Sie ihm, gehen Sie fleissig zur Kirche! Es ist, glaube ich, bei Ihnen nicht oft genug der Fall. Das ist eben das Kreuz der gemischten Ehen: entweder zerrt ein Teil den andern herum, oder sie sind beide lau. Ihre Nelda ist auch nicht Fisch noch Fleisch, obgleich sie protestantisch eingesegnet ist. — Am nächsten Sonntag hält mein Gatte die Hauptpredigt, ich werde Ihnen einen Platz in unserer Bank reservieren. Er, der die Lilien kleidet und die Vögel unterm Himmel speist,“ — das starr Schwarzseidene hob sich höher vom Sofa, die Stimme der Sprecherin bekam ganz den sonoren Kanzelton des geistlichen Gemahls, aber sie gelangte nicht zu Ende, sie schnappte ab wie eine verstimmte Orgel. Von jenseits des Tisches erhob sich das hohe Organ der Höheren-Töchter-Schulvorfteherin, des Fräulein Aurora Planke. Dieser allerhöchste Diskant machte jedwedes ringsum tot.
„Liebste, ich habe es immer gesagt, warum liessen Sie Nelda nicht die Selekta besuchen und das Examen gleich hinterher machen? Dann war sie gesichert. Lehrerin an einer höheren Schule, Gouvernante in feiner Familie zu sein, ist für eine Tochter aus unseren Ständen doch immer eine hübsche Perspektive. Ich begreife Sie nicht, verehrte Rätin! Dieses Warten auf den Mann! Die einzige Versorgung in der Ehe zu erblicken, hat für mich — nehmen Sie’s nicht übel — entschieden etwas Herabwürdigendes.“
Fräulein Aurora Planke richtete den flachen Oberkörper kerzengerade auf, ein ziegelfarbenes Rot stieg ihr in die Wangen bis hinauf unter die glattangeklebten Haare.
„Da könnte heute einer kommen und mir seine Hand und Gott weiss was bieten, ich sagte: Nein. Nein und nochmals Nein!“
Der Diskant steigerte sich, die Höhere-Töchter-Schulvorsteherin schlug sich auf die Stelle, die man Busen zu nennen pflegt; es klang, als ob eine Ente mit dem Flügel in seichtes Wasser platscht.
„Ich — wie stehe ich da in meiner Stellung?! Vollständig selbständig, habe niemanden zu fragen, brauche mich nicht an die Launen eines womöglich eifersüchtigen Gatten zu kehren; kein Kindergeschrei. Bin ich zum Kaffee bei guten Freundinnen“ — sie machte eine Schwenkung nach rechts, wo die Wirtin, Doktorin Schmidt, sass, — „habe ich keine Hast nach Haus, ich werde nicht mit kleinlicher Ungeduld erwartet. Ich bin eben frei. Wir brauchen keine Männer — wozu? Erheben wir uns doch über die Befriedigung niedriger animalischer Triebe, seien wir Menschen, wohlverstanden: höhere Wesen! Es ist etwas Ekelhaftes um diese Männer mit ihrer Brutalität — selbst die besten sollen die haben. Ja, meine Damen, obgleich die Mehrzahl von Ihnen verheiratet ist, Sie werden mir doch zugeben müssen, es ist etwas Herrliches um die Jungfräulichkeit. Ich heirate nie! Nie!“
Und mit diesem wohlberechneten Effekt schloss Aurora Planke ihre Jungfernrede.
Ein Gemurmel entstand, mehr widersprechend als beifällig.
„Das glaub ich,“ flüsterte die allerliebste Hauptmann Xylander ihrer Nachbarin zu, „die Trauben sind sauer!“ Und laut sagte sie: „Nun, ich bin sehr glücklich. Ich habe einen lieben Mann und liebe Kinder, ich bin so glücklich, wie ich es mir als Mädchen nicht habe träumen lassen. Sie können ja die Ehe gar nicht beurteilen, bestes Fräulein Planke; Sie reden wie der Blinde von der Farbe.“
Fast klang’s, als ob die Höhere-Töchter-Schulvorsteherin das Kosewort ‚Gans‘ unterdrückte, jedenfalls zogen sich ihre Mundwinkel verächtlich herab, das Ziegelrot der Wangen wurde Scharlach, eine scharfe Antwort war vorauszusehen. Da schob sich der dicke Kanzelton der Oberkonsistorialrätin wie ein Bollwerk zwischen die Parteien.
„Schon die Bibel sagt: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei! Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie, ein Männlein und ein Fräulein. Liebes Fräulein Planke, Sie haben noch keine Traurede von meinem Gatten gehört! Er traut bald; wissen Sie, die hübsche Agnes Röder mit dem Leutnant von Osten! Sie müssen kommen, ich schicke Ihnen ein Billettchen.“
„Was, Frau Oberkonsistorialrat, die kleine Röder heiratet so bald schon? Nein, macht die ein Glück! Den schönen und reichen von Osten! Noch dazu vom Garderegiment Königin!“ Eine wahre Aufregung bemächtigte sich der Tafelrunde.
Selbst Frau Regierungsrätin Dallmers nervös tätige Hände feierten, ihre matten Augen — Augen, die viel geweint — bekamen Glanz. „Ach, macht die ein Glück,“ echote sie nach.
„Ja, die Röder ist aber auch ein reizendes Wesen,“ meinte ehrlich Frau Doktor Schmidt, „ganz anders als Ihre Nelda; so etwas anmutig Mädchenhaftes, echt Weibliches! Wenn sie auf dem Ball sich auf den Arm ihres Tänzers lehnt und den Blick zu ihm erhebt, so weich, fast möchte ich sagen schmachtend — es ist rein zum Verlieben!“
In der Schule war sie eine dumme Pute,“ warf Fräulein Planke trocken ein. „Sie wird’s wohl auch geblieben sein — natürlich, wo wäre sie sonst auf den faden Leutnant hereingefallen! Ich habe noch kein gescheites Wort von ihr gehört!“
„Der Herr gibt’s den Seinen im Schlaf,“ orgelte Frau Zänglein. Sie legte wieder die fleischige Hand auf die Schulter der kleinen Rätin, die von der Breite des oberkonsistorialrätlichen Seidenkleides ganz in die Sofaecke gequetscht wurde. „Ihre Nelda sollte sich an der Weiblichkeit von Agnes Röder ein Beispiel nehmen; statt dessen lacht sie. Mein Milchen kam neulich ganz entsetzt aus dem Kränzchen nach Hause. ‚Denke dir, Mama‘, erzählte mir das gute Kind, ‚Nelda Dallmer sagte heut, ein Ball käme ihr vor wie ein Gänsemarkt; die Mütter sässen als Verkäuferinnen ringsum, und die Gänse, die am feistesten wären und am lautesten schnatterten, gingen am ersten ab.‘ O — o!“ Die Zänglein schlug die Augen gen Himmel und richtete sie dann strafend auf das niedergeschmetterte Opfer in der Sofaecke. „Sie sollten Ihrer Nelda solche Reden abgewöhnen, liebe Freundin! Sie passen schlecht für wohlerzogene Töchter. Übrigens hat Ihre Nelda unrecht, Agnes Röder ist weder feist, noch schnattert sie viel!“
„Ha ha — ha ha ha!“ Frau Hauptmann Xylander wollte sich totlachen. „Diese Geschichte von Fräulein Nelda muss ich meinem Mann erzählen. Wird der sich amüsieren! Er mag Fräulein Nelda so gern, er sagt immer, sie hat etwas Urwüchsiges; man ginge bei ihr wie durch einen tannenduftigen Wald, und plötzlich käme ein Windstoss daher und bliese einen fast um. Aber der erquickte. Ha, ha, nein, zu komisch!“
Mit wehmütig dankbarem Lächeln sah Rätin Dallmer die junge Frau an.
„Ich freue mich, dass Ihr Herr Gemahl Nelda leiden mag! Freilich, es wäre besser, wir hätten sie nicht jedes Jahr zum Bruder meines Mannes, dem Bürgermeister auf der Eifel, geschickt; da hat sie so viel ohne Aufsicht herumgetobt. Aber Dallmer hat ja immer seine eigenen Ideen — ach!“ Sie zuckte resigniert die Achseln.
„Lassen Sie’s gut sein, Frau Rätin!“ flüsterte die junge Frau und legte ihre warme Hand auf die kalten, rastlos häkelnden Finger. „Ich muss übrigens den Damen jetzt Adieu sagen,“ fuhr sie laut fort und stand auf, „so leid es mir tut! Mein Mann erwartet mich zeitig und mein Kleinster wird schon schreien. Guten Abend — angenehme Unterhaltung! Leben Sie wohl, vielen Dank für den hübschen Nachmittag!“
Knixen und Händeschütteln. Die ganze Tafelrunde war auf den Beinen.
„Schon so früh?“
„Ach, wie schade!“
„Vielen Dank für Ihren lieben Besuch, Empfehlung an den Herrn Gemahl!“
„Ich bitte Sie, ich habe nur zu danken!“
„Kommen Sie gut nach Haus!“
Alles schwirrte durcheinander. Noch einmal Händeschütteln, sogar ein paar Umarmungen.
Frau Hauptmann Xylander eilte zur Tür. Adieu, adieu! Ich bin sehr eilig!“
„Natürlich, bei fünfen!“ bemerkte Fräulein Planke.
Während man sich drinnen wieder setzte und das Dienstmädchen Vanillencrême mit Sandtorte und obligater Pomeranzenbowle präsentierte, klinkte Frau Hauptmann Xylander die Haustür hinter sich zu.
„Gott sei Dank,“ sagte sie energisch und liess sich von dem frischen Winterwind unter die Kapuze blasen. Man wusste eigentlich nicht, warum sie ‚Gott sei Dank‘ sagte, auch nicht, warum plötzlich ein mitleidiger Ausdruck in ihre heitern blauen Augen trat.
„Armes Ding,“ kam es von ihren Lippen, und dann schüttelte sie sich, als ob ihr ein Gruseln über den Leib ginge. Ihre Schritte beschleunigten sich, sie lief fast über den hartgefrorenen Schnee. Es war nicht wahr, ihr Mann erwartete sie gar nicht, aber eine plötzliche Sehnsucht nach ihm, nach ihren Kindern hatte sie überkommen inmitten des süssen Kuchengeruchs und bitteren Redens.
Die Schlossstrasse mit ihren erleuchteten Fenstern lag schon hinter ihr, nun durchquerte sie den dunklen Schlossplatz; noch eine kleine Strecke und sie war an der Rheinbrücke. Schwarz und massig tauchte gegenüber der Ehrenbreitstein auf, daneben, einen schwachen Lichterkranz am Fuss, der Asterstein. Da wohnten sie. Auf der Brücke wehte der Wind schärfer, sie hielt den Atem an und strebte eilig vorwärts. Nun war sie drüben.
Dunkel und einsam zog sich die Chaussee nach dem Vorort Pfaffendorf; auf der einen Seite die Höhen, auf der andern der Rhein, in weiten Zwischenräumen Villen und niedrige Häuschen. Es war glatt, beschwerlich zu gehen, dazu spärlicher Laternenschein, nur ab und zu eine kläglich flimmernde Laterne. Auch ein, zwei Grad kälter war’s hier, als in den Strassen der Stadt; aber das machte nichts, es war auf alle Fälle Winters und Sommers draussen gesünder, und die Wohnungen waren bedeutend billiger. Darum wohnten auch Xylanders hier, sie machten daraus kein Hehl; ein Hauptmann mit fünf kleinen Kindern, nur mit dem Kommissvermögen, kann nicht die geringsten Sprünge machen.
Auch Dallmers wohnten auf der Chaussee; jetzt eben kam die Frau Hauptmann an dem kleinen einstöckigen Haus vorüber. Sie konnte nicht umhin, sie blieb stehen und sah zu den Fenstern im oberen Stockwerk auf — da hatte der Regierungsrat sein Arbeitszimmer. Schrecklich, dass der arme Mann so hustete! Das Winterwetter und die zugige Brücke waren Gift für ihn.
Ob Nelda zu Hause war? Die junge Frau betrat das Vorgärtchen und spähte ins niedrige Parterrezimmer; ein voller vibrierender Ton drang eben durch die Scheiben an ihr Ohr. „Ah, sie singt,“ sagte die Lauscherin und liess die schon zum Klopfen erhobene Hand sinken, „ich will sie nicht stören.“ Und dann stahl sich Frau Hauptmann Xylander zum Gärtchen hinaus und erreichte im Laufschritt die Villa, in der sie den zweiten Stock inne hatten; die Sehnsucht nach den Kindern ward immer stärker.
Kaum klingelte sie, da stürmte es auch schon die Treppe herunter.
„Das ist die Mama! Mama — Mama!“ Ein blondköpfiger strammer Junge stürzte ihr entgegen, hinterdrein zwei ebenso blonde Mädchen.
„Mama, Lollo und Vicky sind so eklig: Sie spielen immer mit ihrem dreckigen Kochgeschirr und der kaputten Anna, sie wollen nie meine Pferde sein. Mama, du musst sie hauen!“
„Huh huh, der Wilhelm,“ heulten Lollo und Vicky, „er hat unserer Anna ein Bein ausgerissen, Mama, kuck emal!“
Mit wahrem Jammergeheul hielten sie der Mutter die Puppe entgegen und klammerten sich dann schutzsuchend an die Falten des mütterlichen Kleides.
„Mama, Mama, er haut uns!“
„Pst, pst, Kinder!“
Frau Hauptmann Xylander hielt sich lachend die Ohren zu; im Gefolge ihrer kleinen Horde trat sie ins Kinderzimmer. Eine nicht gerade balsamische Luft schlug ihr entgegen. Auf der Stuhllehne vor dem eisernen Ofen hingen mehrere Windeln zum Trocknen; im kleinsten Bettchen in der Reihe der übrigen, lag Friedrich, der jüngste Sprössling des Hauses, und kreischte in den höchsten Tönen. Karl, der zweitjüngste, sass zufrieden in seinem Stühlchen daneben; er hatte einen Schuh ausgezogen und benagte diesen eifrig.
„Mein Gott!“ Die Mutter eilte auf die Wiege zu. „Wo ist denn Settchen und wo Buschmann? Ich hatte doch befohlen, keiner sollte weggehen!“
„Och die!“ sagte Wilhelm altklug. „Settchen ist nach der Apotheke gerannt, sie holt Kamillentee; Fritz hätt’ Bauchschmerzen, sagt sie. Und wie das Settchen weg war, ist der Buschmann zu seinem Schatz gegangen — ‚nur mal eben‘ hat er gesagt — er kommt so jetzt wieder. Wir sollen so lang acht geben. Hü, hott! Lollo, Vicky, wollt ihr wohl?“
Mit Donnergepolter stürzte ein Stuhl um, wie die Wilden jagten sich die drei um den Tisch. Plötzlich einstimmiges Freudengeschrei: „Mama, kuck emal, der Karl! Der Karl isst Schuhbändel — hau, Schuhbändel!“
Die mit dem Jüngsten beschäftigte Mutter drehte sich erschrocken um. Auf dem Stühlchen sass Karl, der Phlegmatiker, im ganzen Gesicht wunderlich beschmiert; die eine dicke Patsche hielt den Schuh, die andere stopfte eben das letzte Ende des abgenagten Schuhbändels ins Mäulchen.
„Es schmeckt ihm,“ jubelten die Geschwister, während die Mutter angstvoll auf ihn losstürzte.
Jetzt ging draussen die Tür; Settchen kam mit Kamillentee gerannt, auch Buschmann, breitmäulig grinsend, polterte herein. Frau Hauptmann vergass das Schelten, sie war froh, dass Hilfe erschien. Den Schweiss von der Stirn wischend, legte sie endlich Kapuze und Mantel ab; ihr rundliches Gesicht mit den Grübchen in Wangen und Kinn war hochrot.
„Hat mein Mann gesagt, wann er nach Hause kommt?“ fragte sie das Mädchen.
„Der Herr Hauptmann is ja zu Haus,“ antwortete Settchen ganz beleidigt. „Jesses, wo wär ich dann weggegangen, wann der Herr Hauptmann nit zu Haus tät sein!“
„Zu Hause?!“ Die junge Frau war wie erstarrt. „Und den Lärm nicht gehört?!“
Sie eilte durch die beiden dunklen Nebenzimmer, aus der Türritze des dritten schimmerte Licht; leise öffnete sie.
Auf dem Schreibtisch brannte die grüne Studierlampe, Bücher und Hefte lagen aufgeschlagen, Pläne und Karten. Der Hauptmann der Artillerie, Paul Xylander, sass davor, aber er schrieb nicht; er stützte den Kopf in die Hand und blickte starr, mit weit offnen Augen vor sich hin. Die Hand, die den Kopf stützte, war schlank und blau geädert, das schwarze Haar an den Schläfen von leicht grauen Fäden durchzogen. Seine Haltung hatte etwas Lässiges, sie war nicht die eines schneidigen Soldaten, eher die eines Gelehrten, der viel über Büchern sitzt. Er war ja auch der Denker unter den Kameraden, ‚ein feiner Kopf‘, wie die Vorgesetzten sagten; der Generalstäbler in spe. Woran dachte er? Ein verträumter Glanz war in den Augen, ein weicher Zug um seinen Mund.
„Paul!“ sagte die junge Frau. Er hörte nicht.
„Paul!“ wiederholte sie lauter. Ihre helle Stimme hallte ordentlich erschreckend durch das stille, halbverdunkelte Zimmer, der glasklare Ton fuhr aufstöbernd in alle Winkel. „Paul!“
Er zuckte zusammen, einen Augenblick sah er sie wie geistesabwesend an, dann lächelte er und streckte die Arme nach ihr aus. „Du bist’s — ah!“
Mit einem fröhlichen Lachen bot sie ihm die glühende Wange zum Kuss.
„Du Träumer,“ scherzte sie und zupfte ihn am Ohr, „an was dachtest du? Beichte mal!“
„Ich?“ Seine Stimme hatte einen angenehmen Klang. „Lisabeth, ich dachte an dich!“
Er zog sie auf seinen Schoss und legte den einen Arm um ihren Leib, seine andere Hand schloss sich um ihre vollen, ein wenig verarbeiteten Finger.
„Meine fleissige Frau!“ flüsterte er zärtlich und hob ihre Hand in die Höhe. „Wie sie rauh ist und war mal so weich und hübsch! Sie hat sich zerschafft um meinetwillen — komm, ich will die braven Fingerchen küssen!“
Sein dunkler Schnurrbart drückte sich auf die Hand, die Frau liess es achtlos geschehen, ihre Blicke hafteten unverwandt auf seinen Schläfen.
„Mein Gott, Paul,“ sagte sie plötzlich, „du bist viel grauer geworden in letzter Zeit! Ich muss mir wirklich mal eine Stunde abmüssigen und dir die garstigen Haare ausziehen — es macht gar keinen guten Eindruck, wenn ein Hauptmann schon anfängt grau zu werden!“
Sie tippte mit dem Finger auf seinen Kopf; er wehrte lächelnd ab, das weiche Licht in seinem Auge war noch nicht erloschen.
„Meine Lisabeth, ja, die Jahre gehen!“ seufzte er leicht. „Unser Ältester ist bald zehn. Wie ich vorhin hier so allein sass, fiel mir die Feder aus der Hand; ich dachte zurück, wie ich dich kennen lernte, der junge Leutnant das blutjunge Mädchen — weisst du noch, Elisabeth, beim Walzer auf deinem ersten Ball war’s?! Du warst die Allergefeiertste; es schmeichelte mir kolossal, dass du im Kotillon zweimal einen Orden auf meine Brust stecktest.“
„Natürlich weiss ich’s —“ die Grübchen in ihren Wangen vertieften sich — „ich dachte mir gleich: den möchtest du heiraten!“
„Und weisst du,“ fuhr er ernster fort, „wie wir dann einmal miteinander durch den Wald gingen und hoch oben auf dem Aussichtspunkt allein standen und herunter sahen auf den Rhein und die Schiffe und die Häuser so winzig schienen und die Menschen ganz verschwanden? Um uns her nur die grosse Ruhe der Natur. Da drang etwas von dem göttlichen Funken in unsre Seele; wir verstummten, aber unsre Hände tasteten, bis sie sich fanden und hielten. Sag, Lisabeth, war’s nicht so?“
Er sah ihr in die Augen.
Sie erwiderte erstaunt seinen Blick und schüttelte dann vergnügt den Kopf.
„Keine Ahnung mehr! Hab ich ganz vergessen. Aber ich weiss, wie froh ich war, als du bei der Tante um mich anhieltest. Ich hatte keine Eltern mehr und keinen Pfennig, da war meine einzige Aussicht eine Heirat. Und nun noch dazu eine so gute Partie! Weisst du, Paul,“ plauderte sie weiter, „du hättest nur hören sollen, was die alte Jungfer, die Planke, schwätzte — heut auf dem Kaffee bei Frau Doktor Schmidt — huh, grässlich war’s! Ich hab ihr aber ordentlich eins drauf gegeben und gesagt, wie glücklich ich mit meinem lieben Mann und meinen Kindern bin.“
Sie küsste ihn.
„Und nicht wahr, da ich jetzt gerade so schön Zeit habe, siehst du mal mit mir die letzten Rechnungen durch? Und etwas mehr Wirtschaftsgeld gibst du mir auch für nächsten Monat! Die Mädchen brauchen Schuh und Wilhelm ein Paar neue Hosen, der alte Hosenboden geht nicht mehr zu flicken — nicht wahr, du gibst mir zwanzig Mark extra?!“
Er nickte freundlich, aber der Glanz in seinen Augen war fort. Er sah aus wie ein Ernüchterter.
2
Nelda Dallmer stand vom Piano auf, an dem sie gesessen hatte — die Mutter blieb immer lang auf solch einem Kaffee wie bei Frau Doktor Schmidt — aber halt, da ging doch die Gittertür am Vorgärtchen!
Ihr scharfes Ohr hatte knisternde Tritte vernommen, sie schob den Fenstervorhang zur Seite und schaute hinaus. Nichts zu sehen. Doch! Jetzt eilte eine weibliche Gestalt, kaum erkennbar, über die Chaussee. Das musste Frau Hauptmann Xylander sein, keine andere trug solch grellrote Kapuze!
„Gut, dass sie nicht herein gekommen ist,“ sagte das Mädchen laut und liess den Vorhang zufallen, „das hätte mir gefehlt!“
Sie schob den Stuhl vor den Tisch, auf dem ein halbfertiger Tüllrock lag, und fing an, unten herum eine Falbel festzunähen. Eine Weile nähte sie emsig, der blonde Kopf neigte sich tief über die Arbeit; die bescheidene Hängelampe goss ein mildes Licht darüber hin. Es war sehr still in der engen Stube. Eine Winterfliege glitt auf der Lehne des altmodischen grünen Sofas hin und her, der Regulator an der Wand tickte, Staubatome sanken lautlos auf die Visitenkarten in der Alabasterschale unterm Pfeilerspiegel. Die Nähende atmete gleichmässig; jetzt wurde der Atem plötzlich hastig, unruhig rückte sie hin und her. Als brenne der Rock, so liess sie ihn aus den Fingern fallen und reckte beide Arme hoch empor.
„Ha — — —!“ Sie dehnte sich. Ihre Blicke glitten durch das stille Zimmer mit seinen peinlich geordneten Möbeln, den schlohweissen Gardinen und dem buntgeblümten Sofateppich; mit einem Ausdruck des Unmutes liess sie die Arme sinken.
„Der verflixte Ball,“ murmelte sie und schob den Tüllrock achtlos weiter von sich. „Wenn ich nur nicht hinzugehen brauchte! Schön tanzen kann ich doch nicht. Ich mach mir auch gar nichts draus!“ Sie stemmte beide Ellenbogen auf den Tisch und legte den Kopf zwischen die Hände. „Ich wünschte, ich könnte einmal sein, wie ich wollte, mich ordentlich ausrennen und dann —!“ Sie stiess mit den Ellenbogen fest auf die Platte und presste die Lippen zusammen. So sass sie scheinbar regungslos, aber ihre Nasenflügel zitterten, und der Blick der grauen Augen hatte etwas Unterdrücktes, heimlich Brennendes.
Dumpf und hohl klang jetzt anhaltendes Husten durch die Zimmerdecke, mit einem Satz war sie auf den Füssen und zur Tür hinaus. Sie liess diese hinter sich offen und sprang eilig die Treppe hinan; oben, vor der Stube des Vaters, stand sie einen Augenblick still, ängstlich horchend. Wie er hustete! Leise öffnete sie, noch war es dunkel drinnen.
„Nelda, bist du’s?“ fragte eine heisere Stimme.
„Ja, Papa!“ Sie antwortete sehr heiter. „Kann ich dich ein bisschen besuchen? Wart, ich zünde Licht an!“
Das Streichhölzchen sprühte auf, die Lampe brannte und zeigte die durchaus einfache Einrichtung von Regierungsrat Dallmers Arbeitszimmer. Da war ein Stehpult, daneben ein kleines Tischchen mit Akten bedeckt; an der andern Wand ein Bücherregal, darüber in Lithographie Kaiser Wilhelm I., rechts von ihm Bismarck, links Moltke. An dem Fenster Häkelgardinen; vor dem lederbezogenen Sofa ein schmaler gestickter Teppich — karmoisinrote Rosenbuketts, blaulila Veilchengirlanden, giftgrüne Füllung. Das war alles.
Mit einem behaglichen „So“ kauerte sich Nelda auf dem gestickten Teppich nieder und legte die Arme auf den Schoss des Vaters. Der Regierungsrat hatte sich aufs Sofa gestreckt, er sah sehr müde und erschöpft aus; die Hand, mit der er jetzt zärtlich der Tochter die Haare aus der Stirn strich, war heiss und trocken.
„Papa, du hast wieder zu viel gearbeitet,“ sagte das Mädchen und haschte nach der Hand auf ihrem Scheitel. „Lass da liegen, Papa, es tut mir gut!“
Er liess die Hand auf dem blonden Kopf ruhen; sie schwiegen alle beide, bis Nelda plötzlich unvermittelt hervorstiess: „Nimm doch deinen Abschied, Papa; was quälst du dich? Ich mag gar nicht auf den Ball gehen. Wir wollen in die Berge ziehen, am liebsten nach Manderscheid, wo der Onkel wohnt. Es ist herrlich da! Wenn du den ganzen Tag im Wald bist und der Eifelwind dir um die Ohren saust, dann wirst du gesund, Papa, so wahr ich Nelda Dallmer heisse! Lass doch die Schinderei!“ fuhr sie heftig fort. „Siehst du, ich mag gar nicht auf den Ball gehen — nein, ich mag nicht!“ Sie warf den Kopf zurück. „Wenn ich mit dir in den Bergen herumstreifen könnte, das wär mir tausendmal lieber! Weisst du, Papa, wie ich noch ganz klein war und ihr Gesellschaft hattet, und ich mich unter unsern Küchentisch verkroch? Und als du mich da hervorholtest, weil ich drinnen ‚Händchen geben‘ sollte, schrie und strampelte ich — ‚ich wollte nicht bei die Affen‘ — haha, Papa, akkurat so ist mir’s heut noch!“
„Nelda, Nelda!“ Der Vater klopfte leise den Scheitel der Tochter. „Das ist ein harter Kopf!“
Zugleich lächelte er aber, und es war Stolz in seiner Stimme.
„Hab ich nicht recht, Papa?“ nickte sie.
„Freilich, ganz unrecht hast du nicht — doch erörtern wir das nicht weiter!“ Regierungsrat Dallmer hustete wieder. „Als ich jung war und kräftig, dachte ich auch so wie du, aber seitdem ich alt und marode bin, heule ich mit den Wölfen. Sieh zu, wie weit du kommst im Leben, Nelda! Den eignen Weg zu gehen, ist für eine Frau noch zehnmal schwerer als für einen Mann. Du wirst dir die Seele blutig stossen und zuletzt mit geknickten Flügeln unterliegen. Mir ist bange um dich, Nelda! Ich wünschte, ich lebte so lange, bis ich dich wohl versorgt weiss. Ich bin oft sehr müde“ — ein schmerzliches Lächeln huschte um seine schmalen Lippen — „aber ich darf es nicht sein. Wenn ich meine Stellung aufgebe, was sind wir dann? Gar nichts! Das Gehalt fällt weg, Vermögen keins — wie soll es mir dann gelingen, dich standesgemäss zu versorgen? Es muss sein! Sowie du dich verheiratest, quittiere ich den Dienst.“
„Sowie ich mich verheirate,“ wiederholte die Tochter mit eigentümlicher Betonung. Sie hatte sich so hastig aufgerichtet, dass die liebkosende Hand von ihrem Scheitel glitt; nun kniete sie auf den karmoisinroten Rosen und sah ihrem Vater unruhig forschend in die Augen, die Arme über der Brust gekreuzt.
„Ich bin nicht beliebt, Papa!“ sagte sie kurz und trocken. „Ausser dir hat mich kein Mensch lieb, und ich liebe auch ausser dir keinen so, wie ich lieben könnte!“ Ihre Augen flammten auf. „O, ich könnte lieben — ja!“ Sie biss die Zähne aufeinander und schüttelte den Kopf. „Doch sie sind mir alle egal — ja, das sind sie! Sie sind Puppen mit beweglichen Gliedern und beweglichen Zungen, aber das Herz liegt tot wie ein Klumpen in ihnen.“ Sie machte eine Pause und setzte tonlos hinzu: „Ich bin oft sehr unglücklich, Papa!“
Der Kopf sank ihr auf die Brust.
Über des Vaters Gesicht huschte ein leichtes Lächeln und verschwand dann unter dem Ausdruck besorgter Liebe.
„Mein Kind, das sind die Stimmungen der Jugend; solche Unglücksgefühle lassen sich tragen. Wer von uns hätte in seinen jungen Jahren nicht das gleiche gefühlt?! Das wogt in uns und kommt und geht, aber das gibt sich, das legt sich alles; man wird duldsam, die Ansprüche sind nicht mehr zu hoch gespannt. Liebes Kind, was verlangst du von den Menschen? Du verlangst zuviel. Sollen sie alle immer nur das Herz sprechen lassen? Das würde ein schönes Durcheinander auf der Welt geben. Nein, mein Kind,“ — er strich wieder mit der heissen Hand über ihr Haar — „schick du dich in die Welt, dann wird sie dir gefallen, und du wirst ihr auch gefallen. Es geht nicht anders,“ schloss er mit einem Seufzer.
„Das ist nicht dein Ernst,“ fuhr sie auf. „Du redest nur so. Kannst du das nett finden, wenn sie im Kränzchen immer nur von Herren sprechen, und was der gesagt hat und jener, und wieviel Geld er hat und was er für eine gute Partie ist?! Und dann necken sie sich gegenseitig — und legen sich Karten und kichern — und werden rot wie die Krebse und beneiden sich gegenseitig — es ist mir zu erbärmlich! Selbst Milchen Zänglein, die doch voll Frömmigkeit steckt zum Platzen, macht auch mit. Ich kann das nicht, ich mag das nicht! Ja, einen mal ordentlich lieb haben, so recht aus Herzensgrund, dass einem nichts zu viel wäre für ihn zu tun — gar nichts — ja das mag ich! Aber so an jedem herumschnuppern — pfui!“
„Nelda, Nelda, wenn dich die Mutter hörte! Sie ist so glücklich, wenn du mit den andern Mädchen verkehrst. Es sind doch auch nette darunter; sei nicht gleich so schroff!“
„Ach,“ murrte sie, „da muss man mit ihnen eingepfercht sitzen und könnte statt dessen in die Berge oder den Rhein entlang laufen, wo einem die Brust weit wird und bessere Gedanken kommen. Ba!“
Dallmer sah in das unglücklich verzogene Gesicht seiner Tochter und musste lachen, aber er wurde gleich wieder ernst. Ein Ausdruck von Pein trat in seine Augen.
„Kind, ich will dich nicht belügen,“ flüsterte die heisere Stimme, „mir ist das Getue eben so unangenehm wie dir, es gehört aber nun einmal zum Leben, du hast ohne das keine Existenzberechtigung. Ich habe es nun bald sechzig Jahre durchgemacht, da wirst du mit zwanzig doch nicht die Waffen strecken? Mir wird oft vorgeworfen, dass ich mich von der Welt zurückgezogen habe; nun, ich bin müde, ich habe die Entschuldigung meiner Kränklichkeit, aber du —?! Du musst! Du musst dich versorgen! Willst du dein Lebenlang in abhängiger Stellung vegetieren?“
„Warum habt ihr mich nichts lernen lassen?“ stiess sie hervor.
„O, denkst du’s dir verlockend, fremder Leute ungezogne Kinder zu hüten? Als Gesellschafterin die Ablagerungsstätte für jede schlechte Laune zu sein? Du bist nicht geschaffen dafür — oder meinst du?“
Sie schüttelte sich. „Grässlich, Papa!“
„Siehst du!“ Die bleichen Wangen Dallmers überzogen sich auf den Backenknochen mit einer hektischen Röte. „Du tätest mir auch leid. Also, Nelda, immer en avant! Mühe dich, ein bisschen liebenswürdig zu sein; vom nächsten Ball bringst du mir gewiss mehr Kotillonsträusse nach Haus als sonst.“
„Über den lumpigen einen von Hauptmann Xylander bring ich’s doch nicht!“ murmelte sie.
„Ich bleibe auf und sehe sie mir noch in der Nacht an.“ Der Vater hob mit dem Zeigefinger das Kinn der Tochter in die Höhe. „Du machst mir die Freude, Nelda, nicht wahr?“
Sie sah ihm fest in die Augen, ganz lange, ganz ernsthaft — da tönte plötzlich unten im Flur eine klagende Stimme.
„Mein Gott, wer hat die Stubentür sperrangelweit aufgelassen? Das ganze Zimmer ist ausgekältet. Laura, Laura, wo stecken Sie, haben Sie das denn nicht gemerkt? Es ist ja rein grässlich, all die Kohlen, das ganze Holz umsonst! Das ist wirklich zum Weinen!“
Die Verteidigungsrede der Magd war nicht zu verstehen, nur undeutliches Stimmengewirr schallte nach oben.
Jetzt knarrte die Treppe, die Tür ging auf. Frau Rätin Dallmer kam vom Kaffee. Mit kläglicher Miene stand sie auf der Schwelle, ihre zarte Gestalt verschwand fast in dem weiten Abendmantel, ihre Nase guckte spitz und weiss aus der dunklen Kapuze.
„Es ist doch schrecklich,“ jammerte sie, „kaum kommt man nach Haus, geht der Ärger los. Nelda, du hast wieder die Tür sperrangelweit offen gelassen! Wie konntest du? Ich sage ja —“
„Guten Abend, Lorchen!“ schnitt Dallmer ihr die Rede ab.
„Guten Abend, Mama!“ kam es kleinlaut von den Lippen der Tochter.
„Guten Abend, guten Abend,“ nickte Frau Dallmer hastig.
„Nun, wie hast du dich amüsiert, Mutterchen?“ fragte der Mann.
„Ach, ausgezeichnet!“ seufzte die Rätin und sank auf den nächsten Stuhl, Mantel und Kapuze lockernd.
„Was sind das für liebe Menschen! Nur die Planke ist verrückt, rein verrückt! Die passte gut zu Nelda mit ihren verschrobenen Ansichten. Wirklich ein Skandal, wie sie geredet hat! Aber mein Gott, ich hab ja gar keine Ehre, was über sie zu sagen, wenn die eigne Tochter —“
„Mutter, wie kannst du mich mit der Planke vergleichen?“ unterbrach sie Nelda brüsk. „Die schimpft auf die Männer, weil sie keinen kriegt, und hebt das weibliche Geschlecht in den Himmel — ich schimpfe ja gar nicht, ich hebe nur nicht in den Himmel. Sie sind mir alle Jacke wie Hose!“
„Um Gottes willen!“ Frau Dallmer rang die Hände. „Was sind das für unanständige Redensarten! Die Oberkonsistorialrätin hat ganz recht, wenn sie sich über Nelda aufhält und ihr Milchen am liebsten nicht mehr ins Kränzchen liesse; man muss sich schämen. Aber ihr lasst mich ja nie ausreden! An dir, Joseph, hab ich auch gar keine Unterstützung! Ich bin wirklich eine beklagenswerte Mutter!“
Sie schluchzte auf, und die Tränen begannen ihr über die Wangen zu rinnen.
Der blasse Mann auf dem Sofa rückte unruhig hin und her und machte Miene aufzustehen — da war Nelda schon bei der Mutter. Sie hatte bis dahin mit trotzigem Gesicht gestanden, die Brauen finster zusammengezogen; nun wurde sie glühend rot und kauerte vor der Weinenden nieder, wie vorher beim Vater.
„Mama, o sei wieder gut! Mama, es tut mir so schrecklich leid, dass du dich geärgert hast“ — sie drückte ihr Gesicht an das dünne grauseidne Kaffee-Staatsfähnchen — „lass doch die Zänglein reden! Und die Tür, das kam, weil ich den Papa husten hörte, da rannte ich schnell herauf. Meine goldige Mutter, sei wieder gut, weine nicht! Du sollst nicht weinen,“ rief sie lauter, mit dem Fuss aufstampfend.
„Ich weine ja gar nicht mehr.“
Frau Rätin trocknete ihre Tränen und machte ein ganz vergnügtes Gesicht.
„Nein, denkt euch, die hübsche Agnes Röder heiratet schon bald! Die Zänglein erzählte es, ihr Mann traut. Die Hochzeit muss ich sehen! Schade, Neldachen, dass du nicht eingeladen wirst; es wäre eine Gelegenheit. Übrigens, hast du deinen Tüllrock fertig? Kommt jetzt beide, es ist über neun, ihr habt noch kein Abendbrot — ich kann nichts mehr essen, bei der Doktorin war’s sehr gut. Nimm die Lampe, Kind, unten ist’s dunkel.“
Frau Dallmer trippelte eilig die Treppe hinunter. Vor der grossen, hagern Gestalt des Vaters schritt Nelda her, die Lampe mit kräftiger Hand hoch haltend. Der Schein fiel voll auf ihre weichen gesunden Wangen und spielte über die Stirn unter den widerspenstigen aschblonden Haarringeln.
Sie hatte ein tiefes Fältchen über der Nasenwurzel.
3
In der guten Stadt Koblenz donnerten die Karossen. Im Kasino war grosser Ball; Militär und höheres Beamtentum gaben das zweite diesjährige Winterfest.
Wenn ein Ort auch in die Vierzigtausend geht, sämtliche Einwohner nehmen an solch wichtigem Ereignis doch teil, wenn sie auch nur auf der Gasse gaffen und sich von den vorüberfahrenden Wagen mit Schmutz bespritzen lassen. In der Kasinostrasse, vorm Haupteingang, standen die Menschen dichtgedrängt.
„Hau, die is schön!“
„Kuck mal!“
„Die in Weiss! Und die in Rosa — ne, die is nit so schön!“
„Potztausend, is die fein!“
Bei jedem Wagen, der vorfuhr und sich seines Inhalts entledigte, ging die Kritik von neuem los. Wie eine Welle flutete der Schwarm der Neugierigen näher, vorwitzige Buben schlüpften bis ans Trittbrett und stellten Betrachtungen über die Grösse der atlasbeschuhten Füsse an, die sich da hinabschwangen.
Mütter hielten ihre vermummten Kleinen in die Höh:
„Kuckt, wat feine Damens!“
„Die sind glücklich!“ dachte manch armes junges Ding bei sich, das fröstelnd in der Gosse stand, mit begehrlich glänzenden Augen, die klammen Finger in die Schürze gewickelt.
Nelda Dallmer war durchaus nicht glücklich, als sie mit der Mutter über die dunkle Chaussee patschte. Tauwetter. Sämtliches Eis geschmolzen; von den kahlen Bäumen tropfte es nieder in Lachen und Rinnsale, dass sie aufspritzten.
Beide Damen waren hochgeschürzt, darüber weite Mäntel und Tücher um den Kopf; in den plumpen Gummistiefeln steckten die dünnen, weissbestrumpften Wädchen der Rätin und leuchteten gleich Wegweisern vor Nelda her. Missmutig schlenderte diese hinterdrein. Ach, der Ball — und bei solchem Wetter! Die Mutter hatte schon den ganzen Tag lamentiert über das Opfer, das sie der Tochter bringen musste, über die unausbleibliche Erkältung und so weiter, und doch hatte sie mit fiebernder Geschäftigkeit an dem Schlachtopfer herumgeputzt. Wie ein solches liess Nelda alles über sich ergehen.
Als sie fix und fertig, im weissen Tüllkleid, unten in der Wohnstube vorm Pfeilerspiegel stand, ging der Vater mit dem Lorgnon betrachtend um sie herum.
„Du siehst gut aus, mein Kind!“
„Ach ja,“ meinte die Frau Rätin, „hier zu Hause! Aber sind wir erst da, fällt sie doch sehr ab zwischen all den reizenden Erscheinungen. Du solltest wenigstens die Blumen nehmen, Nelda,“ — sie brachte ein paar unmögliche Kornblumen herzu — „das macht gleich lieblicher.“
„Ich danke, Mama!“ hatte das Mädchen kurz erwidert und das blitzblaue Gewinde beiseite geschoben.
„Warum denn nicht?“ Und nun hatte es einen kleinen Kampf gegeben, der damit endete, dass die Mutter mit roten Bäckchen, erhitzt, vorausstapfte, und die Tochter, bleich, mit zusammengepressten Lippen, folgte — ohne Blumen.
Die Damen Dallmer besuchten stets zu Fuss Bälle und Gesellschaften in der Stadt. Ein Wagen über die Brücke kostete hin und her, mit Warten und allem, gegen zehn Mark, das war denn doch zu teuer; und da man zum Vergnügen musste, ging man einfach. Xylanders machten’s ebenso; komisch, dass man sich nie unterwegs traf! Das war so eine unschuldige List der guten Rätin. Sie lauerte hinterm Fenster, bis Hauptmanns vorüber gewandert waren, und blies dann erst selbst zum Aufbruch. Es brauchte doch keiner vom andern zu wissen, dass er zu Fuss ging; man konnte ebensogut gefahren sein.
Es war schon ziemlich spät, als Dallmers am Kasino anlangten, die letzten Wagen rasselten eben vor. Auf der Treppe waren Teppiche gelegt, hellgrau, mit pompös roten Rändern; die schmutzigen Galoschen der beiden Fussgängerinnen liessen hässliche nasse Tappen darauf zurück.
Nun waren sie in der Damengarderobe. Heiss, vollgedrängt. Ein Gewirr von blauen, gelben, grünen, rosa Toiletten. Dazwischen Mütter in steifseidnen Kleidern, raschelnd, sich blähend wie aufgetakelte Fregatten. Erregte Väter, galante Gatten draussen wartend auf dem Gang; vor der Saaltür ein ganzer Trupp junger Männer — Offiziere, befrackte Herren — sie lassen die Ausstellungsobjekte Revue passieren.
„Du — wenig weiss!“ flüsterte Frau Dallmer der Tochter ins Ohr, als sie vorm Spiegel an ihr herumzupfte. „Sehr angenehm für dich! Warte, nein, halt! Hier die Haarnadel muss ich noch mal herausziehen — und was ist denn das? Mein Gott, du hast ja unten die Falbel ganz schief aufgenäht! Nein, so kannst du unmöglich gehen! Gott, Gott, ich habe es zu Hause bei der schlechten Beleuchtung gar nicht gesehen! Nadeln, Nadeln!“
„Lass nur, Mama, es ist ganz gut so!“ Nelda schüttelte gelassen die etwas zerdrückten Röcke. „Komm jetzt ’rein!“
Die beiden drängten sich durch.
„Ah, Frau Rätin! Guten Abend! Ohne den Herrn Gemahl? Und Fräulein Nelda, so strahlend! Ganz entzückend!“
„Nein, wie reizend, dass wir uns treffen!“ sagte beglück! die gute Dallmer und schüttelte Frau Doktor Schmidt die Hand. „Sind Oberkonsistorialrats auch schon hier?“
„Freilich, da stehen sie ja! Sehen Sie nur, wie sie die Töchter wieder gemustert hat — kaum glaublich! Milchen mit dem Rosenkranz über dem finnigen Gesicht, und Tonchen in Hartrosa bei ihren starken Farben!“
„Grässlich,“ stimmte Frau Rätin zu.
Eben kam die geistliche Dame angerauscht; ihre würder volle Gestalt prangte in Seide von einer unbeschreiblichen braunen Farbe, auf ihrem, mit mächtigen Flechten gezierten Haupt bäumten sich drei weisse Straussenfedern. Rechts und links trippelten Milchen und Tonchen in Blau und Rosa.
„Ah, meine teuren Freundinnen,“ — der sonore Kanzelton hatte etwas ungemein Schmelzendes — „seien Sie gegrüsst! Welche Fügung, dass wir uns schon hier treffen! Wir wollen uns nachher zusammensetzen. Ich spiele ja keinen Whist, es verträgt sich nicht mit unserm Stand — ach, man handelt schon gegen seine Überzeugung, dass man überhaupt hier ist! Aber —“ sie zuckte die Achseln und streifte Blau und Rosa mit einem mütterlich stolzen Blick — „was tut man nicht seinen Kindern zuliebe?!“
„Natürlich, natürlich! Nein, wie einzig Fräulein Milchen und Tonchen aussehen! Wie ein Frühlingstraum!“
Blau und Rosa knixten, verschämt errötend, und umschlangen dann Nelda.
„Ich bin schon zu drei Tänzen engagiert,“ wisperte Tonchen mit den Apfelbacken, und Milchen mit dem Finnengesicht musterte schnellen Blicks das weisse Kleid der Kränzchengenossin:
„Du hast nur Satin drunter, nicht? Ich habe Seide, das ist doch viel angenehmer.“ Und dann zwitscherten beide unisono: „Zu nett, dass wir uns gleich getroffen haben, liebste Nelda!“
„Ja, zu nett,“ war die eigentümlich betonte Antwort. Dann schritten alle drei, in lieblich schwesterlicher Eintracht, zur Garderobe hinaus.
Draussen auf dem Gang empfing der Herr Oberkonsistorialrat die Seinen; er reichte seiner Frau den Arm, Blau und Rosa schwebten vor den Eltern her. Die Gruppe an der Saaltür machte mit untertänigen Bücklingen Platz, aber Frau Zängleins scharfes Ohr fing doch eine nur hingehauchte Bemerkung auf. ‚Sie sieht aus, wie ein aufgezäumtes Schlachtross des Altertums‘ — ‚und die beiden Bunten wie die Läufer, die voran plänkeln‘, flüsterte eine zweite Stimme. Frau Oberkonsistorialrätin zuckte zusammen. Heute war ein entschiedener Pechtag, schon beim Aussteigen hatte ein Gassenjunge ‚dat Elefantenbein!‘ gerufen, und die Gaffer hatten gelacht.
„Unverschämt,“ murmelte sie und gab Blau und Rosa einen kleinen Puff in den Rücken. „Haltet euch nicht steif, nicht so wie Nelda Dallmer, die einen Ladestock im Rücken hat. Verneigt euch doch!“ Und Blau und Rosa verneigten sich.
Im Saal standen massenweis junge Damen an den Wänden herum, Tanzkarten in den Händen. Auf der Estrade stimmte die Militärkapelle ihre Instrumente.
Eine erwartungsvolle Stille schwebt über dem grossen, glänzend parkettierten Raum — die Stille vor dem Sturm. Eine Gaskrone und viele Kandelaber strahlen, ein leicht beklemmender Duft von Blumen und Parfüms schwebt in der Luft.
Über dem grossen Kronleuchter hockt etwas Seltsames; man sieht es nicht, aber man fühlt es. Es senkt sich von da oben herab in den Saal, es treibt die jungen Herren zu schwänzeln und zu tänzeln, die jungen Damen zu lächeln und zu äugeln, die biedern Elternpaare verbindliche Dinge zu sagen und im Herzen das Gegenteil zu fühlen. Es ist etwas Merkwürdiges, etwas Lauerndes wie auf der Jagd, was im Saal herumstreicht — gleich wird der Kapellmeister den Taktstock heben — schnedderedengdeng! huss! heissah! fass! Die Hatz geht los!
Nelda Dallmer stand ruhig an der einen Seitenwand, weiss und klar hob sie sich von ihrer bunten, unruhig trippelnden Umgebung ab. Was sich die Mädchen nicht alles zu sagen hatten! Sie waren plötzlich die intimsten Freundinnen, besonders wenn ein Herr sich näherte, einer mit klingenden Sporen und siegreichem Schnurrbart, oder ein befrackter, chapeau claque unterm Arm. Dann steckten sie die Köpfchen zusammen und tuschelten und kicherten und bebten wie Blumen vorm Sturmwind. Und die Herren der Schöpfung strichen herum, schlugen die Hacken zusammen, naschten hier ein wenig Honig und dort, setzten den schärfsten Klemmer auf die Nase und suchten die beste Ware aus. ‚Schwer reich‘ ging am reissendsten ab, dann ‚schön‘ und ‚tanzt gut‘; das übrige wurde verauktioniert.
Neldas Tanzkarte war noch nicht gefüllt. Ein paar Mal war schon der ängstliche Blick der Mutter fragend zu ihr herüber geflogen, sie hatte als Antwort gelächelt. Jetzt setzte die Musik ein, als sollte eine Kavalleriebrigade ins Feuer rücken, die Tänzer stürzten auf ihre Erkorenen los — ein Scharren, ein Beugen in den Knieen — heidi, fort ging’s!
„Darf ich bitten, Fräulein Nelda?“ Hauptmann Xylander hielt dem Mädchen seinen Arm hin. Er sagte nicht ‚gnädiges Fräulein‘; er kannte sie ja schon, als sie noch mit wehenden Zöpfen auf der Chaussee Seilchen sprang.
Der lange Hauptmann mit den kurzsichtigen Augen, um dessen Mund es oft so gutmütig sarkastisch zuckte, war kein grosser Tänzer vor dem Herrn; er stiess mit den Knieen und trat vorzugsweise gern auf fremde Füsse, doch war er Nelda lieber als der schneidigste Ballöwe. Er raspelte kein Süssholz, er sagte nie, was er nicht wirklich meinte. Er war Nelda sympathisch, und ihr jedesmaliges Kotillonbukett stammte entschieden von ihm; das war schon usus.
Mit einem freundlichen Nicken legte sie die Hand auf seinen Arm; sie tanzten davon, ein-, zweimal herum, dann suchten sie ein Plätzchen in einer Ecke.
„Fräulein Nelda,“ sagte Hauptmann Xylander, „machen Sie nicht so finstre Augen, es steht Ihnen nicht. Sehen Sie sich nur einmal die Jugend rund umher an! Ihre Freundinnen verstehen es alle besser, die Blicke spielen zu lassen.“
„Es sind nicht meine Freundinnen.“ Die Antwort klang herb. „Ich danke dafür.“
„Nun, nun, ich wollte Sie nicht beleidigen, pardon!“ Er machte eine leichte Verbeugung. „Wie konnte ich Sie auch mit den Gänschen auf dem Gänsemarkt vergleichen? Ha ha, Fräulein Nelda, der hübsche Vergleich ist mir zu Ohren gekommen. Sehen Sie, drüben schnattern ein paar recht lustig!“
Er wies mit den Augen auf die andre Saalseite, wo gerade Lena Röhling und Anselma von Koch in lebhaftester Unterhaltung mit ihren Tänzern begriffen waren.
Lena Röhling — Tochter eines Grossindustriellen, Vater machte in Eisenbahnschienen — war klein, dick, lachlustig, sehr begehrt; hätte nicht nötig gehabt, so zu kokettieren, wie sie es eben tat. Doch zweierlei Tuch, besonders wenn ein Adelswappen darauf klebte, war zu ausserordentlich einnehmend. Sie legte den Kopf auf die Seite und blinzelte von unten herauf den jungen Offizier an, schelmische Grübchen erschienen in Wangen und Kinn; man sagte, sie hätte Perlzähne, nun nutzte sie auch jede Gelegenheit sie zu zeigen. Jetzt kicherte sie hell auf, hielt sich mit dem Fächer die Augen zu und hob neckisch drohend das Fingerchen.
Anselma von Koch, die Freundin der kleinen Dicken, machte es anders. Als Tochter des Kommandierenden war sie stets von Leutnants umlagert, die bunten Jacken verdrängten jedes befrackte Individuum aus ihrem Strahlenkreise, aber die moderne junge Dame hatte praktischen Sinn; sie zog das Reelle vor. Heut hatte ihr ein günstiger Wind — ‚Fügung‘ würde die Oberkonsistorialrätin sagen — den kürzlich nach Koblenz versetzten Landrat schon zum ersten Tanz in die Arme getrieben. Hübscher Mann, wenn auch nicht ganz jung, und sehr wohlhabend; sie nagelte ihn gleich ordentlich fest. Es wurde ihr nicht schwer, sie war ein schönes Mädchen mit voller Büste und Wespentaille, dazu hatte sie prachtvolle, blaue Augen und etwas Sieghaftes im Ton. Die Sache konnte sich machen.
Den Leutnants wurde angst, sie massen den unverschämten Zivilisten mit durchbohrenden Blicken und schlugen die Hacken zusammen, dass die Sporen klirrten. „Gnä’ges Fräulein, befehlen Extratour?“ „Gnä’ges Fräulein — ä — ä — so ungnädig heute abend?!“ Es verfing nicht, die Leutnants blitzten ab, Anselma von Koch blieb bei dem einmal für gut Befundenen.
Nelda Dallmer musste laut lachen, und Hauptmann Xylander stimmte mit ein. Eine Weile lachten sie, dann hob das Mädchen, plötzlich ernst werdend, die Augen zu dem Partner, kluge Augen von einem weichen Grau unter dunklen Brauen.
„Tanzen wir, ich werde sonst wieder boshaft, und ich hasse mich, wenn ich boshaft bin.“
„Wie Sie befehlen.“
Sie machten noch eine Tour. Mitten im Drehen fragte Xylander:
„Warum sind Sie boshaft? Wenn Sie nicht wollen, müssten Sie doch so viel Gewalt über sich haben — wie?“
Sie murmelte etwas Unverständliches. „Gewalt über mich? O!“ Die Hand auf seinem Ärmel zuckte. „Ich habe keine Gewalt über mich,“ stiess sie hervor. „Ich könnte manchmal alles zusammenschlagen, mich selbst mit — grässlich — ich kann’s nicht ändern — manchmal könnt ich auch lieb sein — dann muss ich jedes Kind auf der Chaussee küssen — albern — ich kann’s auch nicht ändern! Nein, ich habe keine Gewalt über mich — o nein!“
Sie tanzte beschleunigt fort, fast wild und riss ihn mit; sie kamen aus dem Takt. Gut, dass die Musik mit einem Pankenschlag endete.
Kleine Pause. Die Konversation im Saal wurde lebhafter. Geschwirr, Rauschen von Schleppen, Lachen, Scharren; man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen.
Xylander warf verstohlen einen Blick auf Neldas Tanzkarte — gerade der erste Walzer nicht besetzt, wie unangenehm für das Mädchen!
„Soll ich Sie zu meiner Frau führen? Elisabeth würde sich so freuen mit Ihnen zu plaudern. Sie sind erhitzt, Fräulein Nelda, es wäre besser, Sie pausierten den nächsten Tanz. Bitte, tun Sie es!“
Sie lächelte und sah ihm gerade in die Augen.
„Wie nett Sie sind! Aber verstellen Sie sich nicht. Ich bin nicht erhitzt — und wenn auch! Es ist Ihnen unangenehm, dass ich den nächsten Tanz schimmle. Mir nicht. Aber bitte, bringen Sie mich zu Ihrer Frau!“
Frau Elisabeth Xylander war sehr vergnügt, sie ging so gern auf den Ball, trotz ihrer fünfe. Mit sorgloser Fröhlichkeit, wie eine Siebzehnjährige, gab sie sich dem Wiegen des Tanzes hin. Heute war’s freilich ein heisser Tag gewesen — grosse Wäsche, selbst Buschmann musste dabei helfen — Frau Hauptmann hatte allein die Kinder zu hüten, das Essen zu kochen, und wie immer alles im ungeeignetsten Moment kommt, so war es auch heute gewesen. Wilhelm kehrte mit einer Beule aus der Schule zurüss, dick wie ein Hühnerei; Lollo und Vicky zankten, gingen mit Stöcken auf einander los und zerschlugen den Spiegel über der Kommode. Während die Mutter auf der Diele kniete und die Trümmer zusammen las, kam Karl angekrochen und zerschnitt sich an einem Scherben das Fingerchen. Grosse Heulszene mit Rutenstreichen und so weiter. Heiss und abgehetzt war Frau Elisabeth im letzten Augenblick in den Ballstaat geschlüpft. Der war schon geraume Zeit immer der gleiche, ein weissseidenes Kleid, je nach Bedürfnis zurecht gemacht; allzuviel hatte sie ja überhaupt nicht dem Vergnügen des Tanzes huldigen können, von wegen der fünfe.
Nun stand sie aber, freundlich wie ein Sonnentag, im hell erleuchteten Ballsaal. Die rundlichen Schultern sahen weiss und appetitlich aus dem Festgewand, an der Brust trug sie ein Sträusschen roter Winterbeeren und ein paar Efeublätter — die Kinder hatten’s im Garten zusammengelesen.
„Gut, dass du kommst, Paul,“ rief sie lachend, noch atemlos von der letzten Tour, ihrem Mann entgegen, „und wie schön, dass du Fräulein Nelda mitbringst!“ Herzlich streckte sie dem jungen Mädchen die Hand entgegen. „Hier, Ramer ist wieder in seiner schwärzesten Laune, es will mir nicht gelingen, ihn aufzuheitern. Vielleicht glückt’s unserm losen Züngelchen da besser!“
Sie griff scherzend nach Neldas Ohrläppchen und zwickte es.
„Kommen Sie, Kind, lassen Sie sich miteinander bekannt machen. Paul, stelle mal vor!“
„Gestatten Sie — Premierleutnant Ferdinand von Ramer, mein langjähriger Freund und jüngerer Kamerad vom Kadettenhaus her, jetzt zu meiner grossen Freude hierher versetzt — Fräulein Nelda Dallmer, unsere Nachbarin auf der Chaussee!“
Nelda verneigte sich; sie sah, wie die Augen des fremden Offiziers gleichgültig aufblickten und sich sofort wieder zu Boden senkten. Auf einmal schoss es ihr durch den Kopf — Ramer, Ramer — wo hatte sie den Namen doch schon gehört? Richtig, vor drei, vier Jahren hatte er in sämtlichen Zeitungen gestanden, da regte dieser abscheuliche Spielerprozess alle Gemüter auf. War das etwa der Sohn von jenem berüchtigten Ramer oder sonst ein Verwandter? Sie sah den Fremden mit einem gewissen Interesse an. Er hatte sich halb abgewendet und liess Frau Elisabeth auf sich einreden; er sah nicht mehr jugendlich genug für einen Premier aus, obgleich sein Gesicht hübsch war und seine Haltung eine tadellose.
Xylander trat dicht an Nelda heran und flüsterte, seinen Schnurrbart drehend, hinter der vorgehaltenen Hand: „Sie kennen doch die böse Geschichte? Habe ihn heute zum ersten Mal herausgelotst — armer Kerl, famoser Mensch — seien Sie ein bisschen nett zu ihm, Fräulein Nelda, er hat’s nötig!“ Laut setzte er hinzu: „Empfehle mich den Herrschaften. Du verplauderst wohl den nächsten Tanz mit Fräulein Nelda, Lisabeth? Habe selbst noch eine Pflichttour abzumachen — o je!“ Und mit einem komischen Seufzer chassierte der lange Hauptmann durch den Saal auf ein verblühtes ältliches Mädchen zu, das ihm aufleuchtenden Blicks entgegensah.
Die drei schauten ihm nach. „Wie gut Paul ist,“ sagte der Fremde plötzlich, „noch immer der alte liebenswürdige Mensch!“
„Ja, das ist er,“ nickte Frau Elisabeth stolz, doch mischte sich ein Teilchen Unzufriedenheit in ihren Ton. „Wenn er nur nicht immer so unpraktisch wäre! Selbst mit dem Tanzen ist es so, an die Schönen und Begehrten macht er sich nicht, immer nur, was da so herumsitzt.“ Sie bewegte die Hand bezeichnend nach der verblühten Dame hin. „Ich predige ihm oft, aber er nimmt immer das, was kein andrer mag!“
„Ja, mit mir hat er auch getanzt. Sehen Sie, Frau Hauptmann, und noch hinter zwei Tänzen steht sein Name!“ Nelda hielt der Verblüfften ruhig ihre Tanzkarte hin.
„Aber — aber — Kind — Sie — wie können Sie nur denken?!“ stammelte Frau Elisabeth in tödlicher Verlegenheit.
„O, das macht gar nichts,“ lachte Nelda, „ich nehme es nicht übel. Wenn ich einen so netten Mann hätte wie Sie, wäre mir auch das Allerbeste nur gerade gut genug für ihn. Aber es geht ja im Leben nicht immer nach Wunsch. Ich wäre auch lieber wo anders, als hier!“ Überrascht sah der Fremde auf, sie merkte es nicht. „Finden wir uns beide drein und nichts für ungut!“ Sie hielt der Verlegenen die Hand hin.
Frau Elisabeth war es ganz heiss geworden; ein Glück, dass jetzt ein Herr vom Regiment auf sie zukam und um den nächsten Walzer bat.
„Ich wollte — ich sollte — mein Mann wünschte — nein, nein, ich danke!“
„Aber, gnädige Frau, Sie, als vorzüglichste Walzertänzerin, werden doch nicht pausieren? Ich bitte, ich bitte dringend!“
Die junge Frau schwankte — eben hob der Kapellmeister den Taktstock, die ersten Töne der ‚schönen blauen Donau‘ wiegten durch den Saal — sie sah auf Nelda.
„Natürlich wird die Frau Hauptmann tanzen,“ sagte diese.
Der schweigsame Leutnant von Ramer fuhr wie aus einem Traum auf. „Vielleicht nehmen gnädiges Fräulein inzwischen mit mir vorlieb?“ Er machte Nelda eine tiefe Verbeugung. Sekundenlang sah sie in ein paar schwermütige Augen von unbestimmter Farbe, die mit einer gewissen Bewunderung auf ihr ruhten. Wider ihren Willen errötete sie; sie fühlte es, sie ärgerte sich darüber, und die Glut stieg ihr noch tiefer, bis hinab in den Ausschnitt des weissen Kleides.
Sie stand regungslos und neigte nur zustimmend den Kopf; schon wirbelten die ersten Paare vorüber, auch Frau Elisabeth walzte selig davon. Mit einer wunderlich gemischten Empfindung von Dankbarkeit und Mitleid legte Nelda Dallmer ihre Rechte in die Hand Leutnant von Ramers — eine nervös zuckende heisse Hand, sie fühlte es bis in die Fingerspitzen.
Nie hatte Nelda Dallmer gut Walzer getanzt, heut konnte sie ihn; sie tanzte mit erwachender Lust.
4
Ferdinand von Ramer und Paul Xylander kannten sich von Jugend an. Sie waren im Kadettenkorps zusammen gewesen; wenn auch der ältere Xylander dem anderen um mehrere Klassen vorauf war, gemeinsames Turnen, gemeinsame Spiele und Spaziergänge hatten sie doch mit einander bekannt gemacht.
Nach Jahren traf man sich in der gleichen Garnison wieder, der eine als Sekond-, der andre als Premierleutnant. Dem liebenswürdig-herzlichen Wesen Xylanders war schwer zu widerstehen, selbst Ramer, der allezeit Zurückhaltende, fühlte sich lebhaft angezogen. Man frischte Kindheitserinnerungen auf, man lachte über längst Vergangenes, man erzählte von diesem alten Lehrer und jenem; es war gerade kein warmes, intimes Zusammensein, dazu neigte der Jüngere nicht, aber es war eine gegenseitige Achtung, ein aufrichtiges Wohlwollen, was man im Leben so allgemein Freundschaft nennt.
Sie kamen dann auseinander; Xylander wurde versetzt, heiratete, wurde dahin und dorthin geworfen, lebte als Hauptmann in Koblenz und hörte kaum mehr von dem früheren Kameraden. Immer hatte er schreiben wollen, eigne Freuden, eigne Sorgen nahmen ihn in Anspruch; da gelangte eine Kunde an sein Ohr, die ihn tief erschütterte.
Ramers Vater war Militär, ein Mann von Meriten, die Brust voller Orden; er lebte als Kommandant von Hannover auf einer Art Ruheposten, aber immerhin in einer Stellung, die die Blicke auf sich zog. Wenn der alte Herr mit dem eisgrauen Schnurrbart, das schöne, noch frische Gesicht in vornehmer Ruhe, seinen Morgenritt durch die Promenaden der Stadt machte, zogen die Bürger ehrfurchtsvoll den Hut. Er grüsste freundlich mit leutseligem Lächeln; er war beliebt bei jung und alt.
Kein Diner ohne den alten Ramer; er führte stets die Hausfrau zu Tisch, die schönsten Mädchen gaukelten mit kindlicher Schmeichelei um ihn herum. Papa Ramer, Papachen Ramer, ach, das reizende Papachen! Sie küssten die zierlichen Fingerspitzen und warfen ihm die schmelzendsten Blicke zu.
Der Kommandant machte ein sehr angenehmes Haus. Wie er’s fertig brachte, ohne persönliches Vermögen, war freilich unklar; nun, er musste es doch können. Die drei Töchter hatten sich verheiratet, sie waren nicht besonders hübsch; allen dreien musste er Zulage geben, sonst wäre nichts aus den Partien geworden. Der Sohn als Leutnant brauchte doch auch etwas — aber wen ging’s was an? Haus, Dienerschaft, Reitpferde, alles elegant; den dunklen Gerüchten, die plötzlich auftauchten, um ebenso plötzlich zu verschwinden, schenkte kein Mensch Glauben.
Da brach es eines Tages herein mit Donnergekrach, dass den guten Bewohnern von Hannover die Ohren gellten und die schönen Bewundrerinnen des ‚reizenden Papachens‘ entsetzt in alle Winde flatterten. Die Polizei hob eine Spielhölle auf im Haus der berühmten und berüchtigten Stadtschönheit, Madame Adrienne Gwiazdowska.
Dies exotische Gewächs war, Gott weiss woher erschienen, fuhr in eigner Equipage, schmachtend hingegossen, täglich durch die Strassen, mit ihren grossen schwarzen Augenrädern und Similibrillanten einen Haufen Verehrer an sich lockend. Manchen war diese ‚Dame aus der Fremde‘ bald verdächtig; man munkelte und wusste doch nichts Bestimmtes. An einem späten Abend stieg der Polizeichef selbst, mit der nötigen Begleitung, die teppichbelegten Stufen zu Madame Adriennes Wohnung hinauf, schob die erbleichenden Diener zur Seite und überraschte die Spielgesellschaft in flagranti, neben der schönen Exotischen im zärtlichsten Einverständnis — den hochgeehrten allbeliebten Kommandanten von Ramer!
Ein Entsetzensschrei, eine Panik sondergleichen. Die Spannung aller Kreise ging ins Unglaubliche. Von Tag zu Tag entrollten sich schwärzere Bilder, wunderbare Dinge gelangten plötzlich in die Öffentlichkeit; Personen, deren Unantastbarkeit über allen Zweifel erhaben gewesen, wurden mit hineingezogen, die Zeitungsschreiber allerorten hatten überwältigenden Stoff. Majestät mischte sich persönlich ein. In dem eleganten Haushalt des Herrn Kommandanten wurde alles versiegelt; man munkelte von unterschlagenen Geldern, Kassendefekten. Die arme Frau von Ramer, die stets schüchtern und gedrückt neben dem glänzenderen Gatten dahingelebt hatte, brachte man in eine Irrenanstalt. Mit einem markerschütternden Getöse brach der ganze stolze Bau von Ehre, Reputation, Wohlanständigkeit zusammen. Was blieb dem ‚reizenden Papachen‘, dem unglücklichen Menschen übrig —?! Nur der Mut der Verzweiflung, der die Pistole in die gekrallten Finger drückt und mit eisig kaltem Flüstern ins Ohr raunt: „Schiess — schiess!“ Kommandant von Ramer schoss sich tot. Er hinterliess seinen Kindern nichts als ein Gefühl unauslöschlicher Schande — seinem Sohn einen gebrandmarkten Namen. Majestät waren sehr gnädig. Als Leutnant von Ramer in bitterster Verzweiflung seinen Abschied einreichte, kam ein huldvolles Handschreiben:
‚Es sei ferne von uns, den Sohn für den Vater verantwortlich zu machen. Wir wünschen nicht, einen braven Offizier unsrer Armee zu verlieren.“
O diese Huld — und doch diese Pein! Tage, die dahinschlichen! Nächte, Nächte, die das verstörte Gemüt an die Grenze des Wahnsinns hetzten!
Er griff nicht zur Todeswaffe, wie die Kameraden fürchteten, die sorglich alles aus dem Wege räumten; er rang sich durch. Aber ein innerstes Verzagen blieb, eine unauslöschliche Bitterkeit, ein krankhaftes Sichverschliessen. Am liebsten hätte sich Ramer in einen Winkel verkrochen, den nie ein Lichtstrahl trifft; alles, jedes tat ihm weh, das gutgemeinte Mitgefühl, die zarte Rücksichtnahme der Kameraden — ah, was hatten sie, was wollten sie, warum taten sie behutsam wie mit einem Kranken?! Misstrauen packte ihn. Er fühlte sich getroffen von jeder harmlosen Bemerkung, er zuckte zusammen, wenn ein Fremder ihm gegenübertrat und er seinen Namen nennen musste — den schrecklichen, schmachvollen Namen. Der Name war sein Fluch; es ging ihm ein Zittern mitten durchs Herz, wenn jemand ‚Ramer‘ sagte. Die fixe Idee setzte sich in ihm fest: du bist ein Gebrandmarkter, du hast zu verzichten auf alle Freuden von Leben und Liebe. Nur nicht den Namen fortpflanzen, nur nicht noch andere mit hineinziehen in die unauslöschliche Schande — allein, zu Ende!
Ferdinand von Ramer stand seit wenigen Wochen in der Garnison Koblenz. Mit offenen Armen hatte ihn sein alter Kamerad Xylander empfangen. Bald nach der Katastrophe hatte ihm dieser einen wahrhaft freundschaftlichen Brief geschrieben, Ramer hatte sich nicht entschliessen können, zu antworten; diese Versäumnis tat der Herzlichkeit des Wiedersehens keinen Abbruch.
„Willkommen, alter Junge!“ hatte der Hauptmann gesagt. „Siehst du, hier ist meine Frau, hier sind meine Kinder, komm zu uns, so oft du magst! Und nun, lieber Freund, musst du wieder heraus in die Welt; es geht nicht anders!“
Paul Xylander konnte trefflich zureden mit seiner angenehmen Stimme; es war noch gerade wie früher, der Jüngere mochte und konnte sich den ruhigen, herzlichen Worten nicht verschliessen. Keine sechs Wochen waren verstrichen und Leutnant von Ramer besuchte den Kasinoball. Schwer war es ihm angekommen, er tat’s dem Freund zuliebe; aber ein Gefühl grenzenloser Vereinsamung überkam ihn inmitten des Trubels. Da war keins unter diesen lachenden, kokettierenden Geschöpfen, das ihn hätte erheitern können; sie waren auch gar nicht begierig darnach. Leutnant von Ramer — Ramer — puh! Nur das Mädchen mit den klaren Augen und der freimütigen Sprache nötigte ihm einiges Interesse ab. Diese Nelda Dallmer! Bei jedem Tanz holte er sie zu einer Extratour, er klammerte sich in seiner Vereinsamung an sie wie ein Ertrinkender an den Strohhalm; als es zu Tisch ging, war sie seine Dame.
Frau Rätin Dallmer war nicht zufrieden mit dem erklärten Herrn ihrer Tochter, sie winkte sie heimlich beiseite. „Nelda,“ flüsterte sie, „lass den Menschen etwas abfallen! Ist ja gar keine Partie — ich bitte dich, und dann dieser Name! Alle sprechen sie schon darüber. Ich finde es direkt unverschämt, sich mit dem Namen in die Gesellschaft zu drängen. Alle sagen —“
„Wer sagt?“ unterbrach Nelda laut und hart, eine glühende Blutwelle schoss ihr ins Gesicht. „Deine Frau Zänglein und Konsorten!“
„Pst, pst, Nelda, nicht so laut — um Gottes willen!“
Ohne weiteres Wort, mit einem Zucken der Schultern, wandte sich das Mädchen ab und schritt quer über den Saal auf Leutnant von Ramer zu, der mit untergeschlagenen Armen finster dastand. Sie legte ihm die Hand auf den Ärmel:
„Bitte, wollen wir jetzt zu Tisch gehen?“ Dabei lächelte sie ihn freundlich an.
Frau Dallmer war ausser sich; sie gebärdete sich wie eine Henne, die Enteneier ausgebrütet hat und der nun die Brut auf dem Wasser schwimmt, anstatt sich unter die schützenden Flügel zu ducken. Sie rannte unruhig hin und her, ihr armes kleines Gesicht trug einen verängstigten Ausdruck, der schlecht zu dem Seidenfähnchen, der Spitzenhaube, dem Lichtglanz und der Musik passte.
„Beste,“ raunte ihr die Oberkonsistorialrätin zu, „leiden Sie es doch nicht, dass Ihre Nelda sich so ausschliesslich dem einen Herrn widmet. Das fällt auf!“
„Mama!“ Milchen kam gelaufen und schmiegte mit zarter Kindlichkeit ihr Finnengesicht an die stattliche Wange der Mutter. „Denke, wie entzückend! Herr Emil Bovenhagen hat mich zum Souper engagiert!“ Sie kicherte verschämt in sich hinein.
„Ah — ah!“