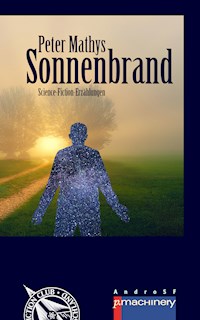Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Feldweibel Franz Häfliger von der Zürcher Sittenpolizei ist sehr erfolgreich als Ermittler von strafrechtlich relevanter Pädophilie. Sein beruflicher Erfolg kommt ins Wanken, als ein angesehener Gerichtspräsident in das Fadenkreuz seiner Ermittlungen gerät... Eine Geschichte die auf einem wahren Fall beruht. Ein Tatsachenroman. In einer packenden, lebensechten, spannenden Sprache wird von einem Justizskandal erzählt, über die Vertuschung eines Pädophilen-Falles gegen einen hohen Richter. Schonungslos werden Verantwortliche genannt, dokumentarisch dies beschrieben. Eine erschreckende Abfolge von rechtsstaatlich fragwürdigen Geschehnissen. Eine endlose Folge von Fehlern oder bewusster Vertuschung. Ein düsteres Stück Zeitgeschichte. Ein Fall der zum Nachdenken anregt. Nicht nur für Krimi-Freunde ein sehr empfehlenswertes Buch. http://richteraufdunklenabwegen.wordpress.com
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Zürich, Bahnhofstrasse 34, fünfter Stock
Samuel Weiss, 43 Jahre, Revierdetektiv
Roland Schwarz, 86 Jahre, pensionierter Polizist
Die erste Observation
Paris, das Ziel
Andy Grob, 44 Jahre, ehemaliger verdeckter Fahnder der Fahndungsgruppe Puma
Ein schrecklicher Fund
Die neue Kommissarin
Peter Hoffmann, 63 Jahre, noch aktiver Kriminalpolizist
Heinrich Berchtold, 78 Jahre, pensionierter Polizist
Anonym, Wachtmeister bei der Sitte, 43 Jahre
Offiziersrapport
Bruno Pfister, 71 Jahre, ehemaliger Fachgruppenchef bei der Sittenpolizei
Marlene Häfliger, Ehefrau des Feldweibel Franz Häfliger
Ehrendes Angedenken
Martin Elmer, 48 Jahre, noch aktiver Polizist
Feldweibel Franz Häfliger, ehemaliger Sittenpolizist
Ausgeklungen
Nachwort
Vorwort von Al’Leu
Der Begriff Pädophlie wurde erstmals 1886 vom Wiener Psychiater und gerichtsmediziner Richard von Kraft-Ebing in seinem Buch Psychopathia sexualis wendet. Zuvor hatte dieser Tatbestand keinen Namen und wurde strafrechtlich nur selten verfolgt.
Pädophilie bezeichnet ein primär und dauerhaft auf Kinder ausgerichtetes sexuelles Interesse von Erwachsenen. Gemäss der heute gültigen Definition muss der Täter oder die Täterin älter als 16 Jahre alt sein und 5 Jahre älter als das minderjährige Opfer. Bei der Recherche zu diesem Tatbestand fällt auf, dass die Vertreter der Psychologie und der Sexualforschung die Tendenz haben, Pädophilie in zahlreiche Krankheitsbilder zu fragmentieren und dadurch die Täterschaft weitgehend zu Opfern sozialer oder psychischer Umstände zu erklären.
Da ist beispielsweise die verharmlosende Definition der Berliner Charité, die Pädophilie als die »ausschliessliche oder überwiegende sexuelle Ansprechbarkeit durch vorpubertierende Kinderkörper« bezeichnet. Die Opfer werden mit keinem Wort erwähnt. Auch nicht die Täterschaft mit ihrem egoistischen Lustgewinn aus Trieb, Machtgenuss und Sadismus. Wie in vielen Bereichen wird auch hier versucht, persönliche Verantwortung für eine individuelle Veranlagung auf die Gesellschaft abzuwälzen. Dass der sexuelle Missbrauch von Kindern durch die Obrigkeit ein uraltes Thema ist, lässt sich schon in den ersten Quellen der Menschheitsgeschichte, den sumerischen Tontafeln, nachlesen.
Zu sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen kommt es in der Schweiz oft. Jährlich gehen bei Fach- und Polizeistellen zwischen 3.500 und 4.000 Meldungen von sexuellen Übergriffen auf Minderjährige ein.
Zürich, Bahnhofstrasse 34, fünfter Stock
Der Winter wollte einfach nicht weichen. Hartnäckig krallte er sich fest, wie wenn es dieses Jahr den Frühling zu verhindern gälte. Bitterkalt war es an diesem späten Märzabend. Die Banken- und Einkaufsmeile, die sich vom Zürichsee bis zum Hauptbahnhof hinzog, war nach einem garstigen Schneetreiben wie ausgestorben. Beim Paradeplatz ragte wuchtig die graue Glasfassade der Schweizerischen Volksbank in den Himmel. Neben diesen fünfzehn Stockwerken wirkte das gegenüberliegende Haus an der Bahnhofstrasse 34, geradezu winzig. Es war ein düsteres, Kälte ausstrahlendes altes Backsteinhaus mit einem schwarzen Gibeldach. Eine gebogene Hoflampe über der Eingangstüre beleuchtete den Vorplatz. Rechts neben der Tür ein grosses rundes Messingschild mit dem Züri-Leu-Wappen. Darauf war zu lesen: Regionalpolizei Zürich.
Drückte man tagsüber die Klinke der schweren, mit kunstvollen Handschnitzereien verzierten Eichenholztüre, setzte sich eine automatische Anschiebehilfe in Gang, und mit einem knarrenden Geräusch öffnete sich die Türe wie von Geisterhand, um Momente später wieder ächzend ins Schloss zurückzufallen. Das Treppenhausgewölbe im Innern war in gedämpftes Licht getaucht. Eine aus Stein gehauene, breite Treppe führte bis ganz nach oben in den fünften Stock. Dort, im Zimmer 510, dem Büro des Polizeioffiziers Fritz Stocker, brannte an diesem Abend noch Licht. Trotz der späten Stunde wurde hier noch gearbeitet.
Major Stocker sass hinter seinem Schreibtisch mit gesenktem Kopf im Schein einer Tischlampe in seine Arbeit vertieft. Vor ihm lag ein Stapel Bewerbungen für die vor kurzem ausgeschriebene Polizeioffiziersstelle. Der Major zog aus dem Stapel eine Bewerbungsakte, blätterte die Seiten durch. Gut. Sehr gut, dachte sich der Major, sogar eine richtige Bezirksanwältin bewirbt sich bei uns. Das wäre doch eine würdige Nachfolge für unseren Oberleutnant Stephan Gussmann der Ende Monat nach Bern zur Bundespolizei gehen wird. Er studierte jede Bewerbung so gründlich durch, dass er darüber ganz die Zeit vergass.
Major Fritz Stocker, Jurist, stellvertretender Kommandant der Regionalpolizei, verheiratet mit Britta, eine geborene von Muralt, ein altes, wohlhabendes Zürcher Geschlecht. Sein ganzer Stolz war seine dreijährige Tochter Anna. Der Major war Ende dreissig und ein grosser, knochiger Mann mit einem glatt rasierten, schmalen, blassen Gesicht, aus dem eine markant gebogene Nase herausragte. Die Locken seines strähnigen dunklen Haars waren stets sorgfältig zurückgekämmt. Was auf eine gewisse Eitelkeit schliessen liess. Da er bei seinen Uniformpolizisten mit Argusaugen stets auf die Korrektheit des Tenues achtete, traf man auch ihn nur in tadelloser Kleidung, meist im eleganten dunklen Anzug, an. Doch ansonsten, vom Wesen her, besass er ein sprödes, verschlossenes, wenig durchschaubares Naturell. Etwas Beunruhiges lag in seinem Blick. Nicht umsonst eilte ihm der Ruf nach, bei der Regionalpolizei die hinter den Kulissen Fäden spannende, graue Eminenz zu sein.
Endlich Feierabend. Er schob die Bewerbungsunterlagen zur Seite. Wieder einmal hatte er einen Zwölfstundentag hinter sich gebracht. Der Major erhob sich klemmte seine Aktenmappe unter den Arm, löschte das Licht, verschloss sein Büro und steuerte die Stufen hinab Richtung Ausgang. Im dritten Stock bemerkte der Major jedoch einen Lichtschein am Ende des Gangs. Dort befand sich der fensterlose Putzraum, wo die Putzfrau Maria Arrigoni, den Feierabend vor sich, gerade ihre Putzutensilien versorgte. Maria Arrigoni, zweiundfünzig Jahre alt, alleinerziehende Mutter von zwei halb erwachsenen Kindern. Eine, die ihren Mitmenschen immer alles recht machen wollte. Ein Nein war ein Wort, das sie nur schwer über die Lippen brachte. In den 1960er-Jahren war sie auf der Suche nach Arbeit aus Sizilien in die Schweiz eingewandert. Mit ihren langen Haaren und dem dunklen Teint war sie, trotz ihres Alters, immer noch eine Schönheit, die eine gewisse erotische Sinnlichkeit ausstrahlte.
Putzen, Putzen und nochmals Putzen bestimmte seither ihr ganzes Arbeitsleben. Berufliche Alternativen hatten sich nie ergeben. Dennoch machte ihr die Arbeit Freude, und sie war dankbar und froh, ja sogar ein wenig stolz, bei der Regionalpolizei angestellt zu sein. Als der Major den Lichtstrahl am Ende des Ganges sah, hellte sich seine Mine kurz auf. Oh wie schön! Maria ist noch da! Sofort machte er im Treppenhaus rechtsum kehrt und eilte in langen Schritten den Gang entlang, dem Lichtstrahl folgend.
Seine Schritte auf dem braun-weiss gemusterten Steinboden waren bis in den Putzraum zu hören. Erschrocken fuhr Maria auf, drehte sich herum und sah wie der Major unter der Tür auftauchte. Für die Frau war nicht schwer zu erraten, was dies für sie wieder bedeutete.
»Oh, Signor Stocker! Oh no, no! Nicht! Bitte!«
»Ach Maria, stell dich nicht wieder so an. Du brauchst es doch auch«, lautete die um Sanftheit in der Stimme bemühte Antwort des Majors. Maria Arrigonis Blick wanderte nach unten, er hatte seine Hosen samt der Unterhose bereits auf Kniehöhe heruntergelassen. So entblösst stand er vor ihr. Erwartungsvoll begann der Major, seinen Penis zu frottieren. Und schon packte er sie an den Hüften und zog sie mit einem kraftvollen Ruck rückwärts zu sich heran. Das blasse Gesicht des Majors wechselte die Farbe. Sein Gesicht wurde rot vor Erregung. Schweissperlen bildeten sich auf seiner Stirn, flossen ihm die Wangen herab, tropften auf Maria Arrigonis Hinterteil.
Der Major schob ihr hektisch den Rock hoch und riss ihren schwarzen Slip herunter. Ein hoher, spitzer Schrei entfuhr der Frau, als der Major von hinten in sie eindrang. In einem schnellen Rhythmus und mit harten Stössen wurde der Geschlechtsverkehr vollzogen. Mit der Zeit passte Maria Arrigoni sich dem Rhythmus des Majors an. Sie waren ein ungleiches Paar, doch es sah so aus, als hätten die beiden darin schon einige gemeinsame Erfahrung vorzuweisen. Bis weit in den Gang hinaus war das klatschende Geräusch vermischt mit einem tiefen, dunklen, männlichen Schnaufen und das Stöhnen der Frau zu hören. Keiner der beiden merkte, dass gerade ein Schatten an der Tür vorüberhuschte. Ganz wohlig und mit verschwommenem Blick ergoss sich der Major mit einem Schrei in ihr. Keuchend ging sein Atem. Einen langen Augenblick verharrten die beiden so ineinandergepresst in dieser Stellung. Dann stiess der Major die Frau abrupt von sich, trat einen Schritt zurück und zog schnell seine Hose hoch.
Und noch einmal spürte Maria Arrigoni ganz nah das Gesicht des Majors in ihrem Nacken, spürte seinen Atem an ihrem Haar und in einem schon fast drohenden Ton flüsterte er: »Und, Maria, halte dich daran, kein Sterbenswort nach aussen. Einer Ausländerin glaubt hier sowieso niemand. Dann ist deine Arbeitsstelle futsch. Hast verstanden Maria?«
»Si, si, Signor Stocker.«
Ihren Blick beschämt auf den Boden gerichtet, begann die Frau ihre Kleider in Ordnung zu bringen. Der Major warf einen kurzen Blick auf seine Armbanduhr. Herrgott noch mal, so spät schon, viertel vor elf! Eigentlich müsste er schon längst zu Hause bei seiner Familie sein. Jetzt musste er sich aber wirklich beeilen, wenn er noch vor Mitternacht zu Hause sein wollte. Ohne sich richtig zu verabschieden – nicht mal ein Gutnacht war es dem Major wert – verliess der Major den Putzraum. Die Art, wie er sich davonmachte, konnte man fast als Flucht bezeichnen. Mit schnellen Schritten ging es den Gang zurück ins Treppenhaus, die Stufen hinab. Unten im Parterre, am Auskunftsschalter vorbei, erreichte der Major die Eingangstüre. Er holte aus seiner Anzugstasche den Schlüssel hervor, steckte ihn ins Schloss, entriegelte die Türe, drückte die Klinke hinunter und mit einem Knarren öffnete sich die schwere Eichentür.
Draussen blies ihm ein eisiger Wind ins Gesicht. Schneeflocken wirbelten durch die Luft. Der ganze Paradeplatz war mit einer feinen weissen Schneeschicht überzogen. Kalte Luft drang durch seine Kleidung, liess ihn frösteln. Vorsichtig blickte er nach allen Seiten. Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Sehr gut!, dachte der Major. Eiligst stapfte er durch den Schnee und verschwand um die nächste Hausecke.
Samuel Weiss, 43 Jahre, Revierdetektiv
Dreiundzwanzig Jahre war ich alt, als sich mein Bubentraum erfüllte. Vor lauter Glück hätte ich die ganze Welt umarmen können, als ich im Februar 1995 den Brief der Regionalpolizei Zürich in den Händen hielt: Schwarz auf weiss stand darin, dass ich, Samuel Weiss, wohnhaft in Dübendorf, die Aufnahmeprüfung für die Polizeischule mit Erfolg bestanden hatte. Jetzt sah ich meine berufliche Zukunft klar vor mir. Vorbei die langweilige Zeit, in der ich mich als Angestellter einer Schweizer Grossbank mit Zahlen herumschlagen musste. Aktion pur war angesagt. Von nun an war ich ein nützliches Mitglied der Gesellschaft und durfte im Dienst des Gemeinwohls für Recht und Ordnung sorgen. Ein unvergleichliches Hochgefühl hatte ich schon zu Beginn der Polizeiausbildung, als ich zum ersten Mal die dunkelblaue Polizeiuniform anziehen durfte. Ein richtiger Uniformierter war ich, wie ich es mir immer gewünscht hatte.
Das Highlight meiner Ausbildung war das Praktikum bei der Kriminalpolizei. Ich wurde damals der Sitte zugeteilt, und dort kam mir auch das erste Mal der Name Franz Häfliger zu Ohren. Wo auch immer ich mich gerade aufhielt, sei es im Büro, in der Kantine oder auf dem Gang, immer wenn es um irgendwelche Pädophilengeschichten ging, fiel der Name dieses ehemaligen Sittenpolizisten. Unbegreifliches habe sich da im Jahr zuvor ereignet. Um einen pädophilen Richter sei es gegangen, der von höchster Stelle geschützt worden sei, sodass der Fall am Ende abgeklemmt worden sei. Und bei dieser Vertuschung sei diesem Franz Häfliger ein himmelschreiendes, menschliches Unrecht zugefügt worden. Seltsam an der Sache war, dass über diese Angelegenheit gesprochen wurde, als wäre es die harmloseste Sache der Welt. So, als ob über das Wetter gesprochen würde oder wie wenn ein Verkehrspolizist wegen einer Parkbusse ein Auge zudrücken würde. Ich war sprachlos. Von Neugier gepackt entschloss ich mich, im Rahmen meiner Möglichkeiten selbst einmal nachzuforschen, was da geschehen war. Mit Geduld und einer gewissen Hartnäckigkeit gelang es mir im Laufe der Jahre tatsächlich, einige Insider ausfindig zu machen. Die, die reden wollten, liess ich erzählen. Hörte zu, wie sie sich ihre unverarbeitete Last von der Seele redeten. Hörte einfach nur zu und ging dann wieder. So kam allmählich ein erschreckendes polizeiliches Sittenbild aus einer vergangenen Zeit zum Vorschein. Dabei ging es um Macht, Machtmissbrauch und die Ohnmacht des kleinen Polizisten. Ich hatte mehr gehört, als ich hören wollte. Und tief, sehr tief in mir drin veränderte sich mein Verhältnis zur Polizei.
Roland Schwarz, 86 Jahre, pensionierter Polizist
Ja, die Zeit vergeht, und wie die Zeit vergeht. Unsere Regionalpolizei von früher lässt sich mit der heutigen nicht mehr vergleichen. Früher, da war alles noch anders. Was? Gute alte Zeit? Nein, sicher nicht, Herr Weiss. Hören Sie doch auf, mir mit diesem blöden Spruch zu kommen. Überhaupt nicht besser war das damals bei uns, als ich in den sechziger Jahren in die Polizeischule eintrat. Militärische Zucht und Ordnung war angesagt, unter der Woche wurden wir kaserniert, wie Soldaten. Galt sogar für Verheiratete. Heute undenkbar, nicht wahr? Richtig preussisch ging es da zu. In aller Herrgottsfrühe mussten wir zur Tagwache antreten, dann schnell das Morgenessen heruntergeschlungen und ab in die Turnhalle Sihlhölzli zum Frühsport, anschliessend kurz geduscht und mit noch nassen Haaren im Laufschritt eines gehetzten Hundes zurück und in das grosse, nach Bohnerwachs riechende Schulzimmer. Diesen muffigen Gestank habe ich noch heute in der Nase. Dort mussten wir stumpfsinnig ständig irgendwelche alten Polizeirapporte abschreiben. Zur Übung, völlig sinnlos.
Nein, gar kein Zuckerschlecken war die Polizeiausbildung damals, geschlaucht wurden wir. Stellen Sie sich vor, sogar zum Küchendienst wurden wir abkommandiert! Und was unseren Lohn betraf: Polizist zu sein, das war das Betteln versäumt! Mit einem Anfangslohn von etwas über Tausend Franken im Monat musste ich eine Familie mit zwei Kindern durchbringen. Das Leben war damals im Vergleich zu heute zwar billiger, doch selbst ein Kinderwagen war nicht unter dreihundert Franken zu haben.
Um einigermassen über die Runden zu kommen, habe ich wie viele meiner Dienstkollegen abends, an den Wochenenden, sogar noch während der Ferien auf dem Bau gearbeitet. Richtige Schwarzarbeit war das, alles unter der Hand und cash, verstehen Sie? Glücklich schätzen konnte sich, wer vor seiner Zeit bei der Polizei einen Handwerkerberuf erlernt hatte. Gefragt waren vor allem Maurer, Maler, Schreiner, Sanitärinstallateure oder einfach handwerklich begabte Leute, die richtig mitanpacken konnten. Ganze Schwarzarbeitertrupps sind damals aus der Regionalpolizei heraus entstanden. Erst in den siebziger Jahren ging es mit unserem Lohn bergauf, sodass wir nicht mehr allzu stark auf eine zusätzliche Einnahmequelle angewiesen waren.
Nein, gut war die alte Zeit sicher nicht, nur anders. Ein völlig anderes Justizsystem hatten wir da, noch keine einheitliche Strafprozessordnung. Früher gab es in der Stadt Zürich noch eine Bezirksanwaltschaft. Gefängnisse hatten wir noch, die wir Zuchthäuser nannten. Ein Opferhilfegesetz? Völlig unbekannt. Erst Mitte der achtziger Jahren ergab sich die Möglichkeit des »genetischen Fingerabdrucks« mithilfe der DNA-Analyse. Eine richtige Revolution bedeutete das damals für unsere forensische, kriminaltechnische Abteilung. Wenn ich sehe, wie einfach es die heutige Polizistengeneration nur schon mit dem Rapportschreiben hat! Wir mussten uns damals noch mit mechanischen Schreibmaschinen herumschlagen: Keine Korrekturtaste, keine Löschtaste, keine Speichermöglichkeiten, keine digitalen Versandmöglichkeiten. Richtig neidisch könnte man da noch heute werden.
Jedenfalls, nach zwölf Jahren bei den Uniformierten konnte ich zur Kriminalpolizei hinüberwechseln und war dann im Zürcher Kreis 4, dem Kreis Cheib, sieben Jahre lang als Revierdetektiv tätig, vorwiegend im Rotlichtmilieu. Anfangs der neunziger Jahre bin ich schliesslich zur Sittenpolizei gekommen. Das war zu jener Zeit, als gerade die Drogenszene am Platzspitz und der Drogenstrich im Zürcher Seefeldquartier aktuell war.
Wegen dem Drogenstrich war ich mit meinem Kollegen, dem Karl Gruber, viele Nächte im Seefeldquartier unterwegs. Ja, ja, der Gruber-Kari lebt schon lange nicht mehr. Viel zu früh an einem bösartigen Gehirntumour gestorben ist der Kari. Bei ihm kann ich wirklich das Wort gebrauchen: ein Freund war er, und ein guter Kamerad. Blind vertrauen konnten wir einander.
Und dieser Drogenstrich mit all seinem Elend und den negativen Begleiterscheinungen. Wie Geier, ihre Beute erspähend, kurvten die Freier in ihren Autos dort herum, machten sich an die drogensüchtigen, jungen Frauen heran, umkreisten sie, um sie dann nach ausgiebiger Begutachtung als Sexmaterial in Beschlag zu nehmen. Die ganze Nacht über herrschte dort ein reger Autoverkehr. Die Seefeldstrasse ging’s runter, die Dufourstrasse wieder rauf. Das ständige Quietschen von Autobremsen, aufheulende Motoren, permanentes Hupen, das Schlagen von Autotüren, Herumgejohle von Betrunkenen, Geschrei, Fluchen, Streit, brutale Prügeleien.
Von einer Nachtruhe konnte über Jahre hinweg im Seefelder Wohnquartier keine Rede sein. Als wirkungsvollstes Polizeiinstrument gegen den Freierverkehr erwies sich kurioserweise nicht das Strafrecht, sondern das Strassenverkehrsgesetz. Wir von der Sitte haben uns damals diskret postiert und von allen vorbeifahrenden Autos die Kontrollschildnummern aufgeschrieben. Und wenn das gleiche Auto vier bis fünf Mal an uns vorbeifuhr, dann ging eine Anzeige an das Stadtrichteramt der Stadt Zürich wegen unnötigen Herumfahrens in einem Wohnquartier. Bussen bis zu achthundert Franken wurden den Freiern dann aufgebrummt.
Ja, wirklich, ganz üble Sachen geschahen zu jener Zeit im Seefelder Wohnquartier. Ich weiss noch genau, es war ein Freitag und eine der wärmsten Nächte in jenem Sommer, als der Lenker eines violetten Mercedes Benz 230 S mit Obwaldner Kontrollschilder wie ein gestörter Idiot ständig an uns vorbeikurvte, schliesslich keine zwanzig Meter von uns entfernt kurz anhielt, eine Drogenprostituierte einsteigen liess und wieder davonfuhr. Als der Kari das sah, erwachte sofort sein Polizisten-Jagdinstinkt. Er gab Gas, rief: »Diesen Sauhund krallen wir uns!«, und nahm die Verfolgung auf. Nach etwa zwei Minuten bog der Mercedes von der Bellerivestrasse nach rechts auf den grossen Parkplatz beim Zürichhorn ein. Dort stellte der Lenker den Motor ab und löschte die Scheinwerfer.
Auch wir stellten unser Fahrzeug ab, stiegen aus. Vor uns das in der Dunkelheit wie verlassen wirkende Auto. Wir näherten uns vorsichtig dem Mercedes. Die Autoscheiben waren bereits milchig beschlagen, ein Blick ins Fahrzeuginnere war nicht möglich. Mit der Faust klopften wir an die Fahrertür. »Aufmachen! Sittenpolizei! Kontrolle!« Keine Reaktion. Vorsichtig öffnete ich die Fahrertür, und wir schauten ins Wageninnere. Die beiden Vordersitze waren heruntergeklappt. Die junge Frau lag rücklings mit heruntergezogenen Hosen auf dem Beifahrersitz, während sich ein etwa hundert Kilogramm schwerer Mittfünfziger über sie hermachte. Mit seinen fetten, schweissigen Fingern machte der Mann gerade an der Scheide der jungen Frau herum.
Um dem Treiben schnell ein Ende zu setzen, kontrollierten wir die Personalien des Mannes. Wortreich waren auch seine Ausreden. Von einem wichtigen Geschäftstermin in der Stadt und einer zufällig am Strassenrand aufgelesenen Autostopperin erzählte er. Man habe schliesslich ein gutes Herz, nicht wahr? »Sie wissen schon, Herr Polizist, he he.« Es war immer das Gleiche, was für einen blöden Scheiss diese Freier uns als Ausreden erzählten. Einen solchen Stuss gab dieser Herr aus Obwalden von sich, dass ich saumässig ranzig wurde und ihm dabei so richtig übers Maul gefahren bin. Nein, richtig angebrüllt habe ich diesen Kerl: »Ach, halten Sie doch endlich Ihre dumme Klappe. Mein Name ist Schwarz, von der Sittenpolizei, und Sie sind hiermit verzeigt! Gehen Sie mir aus den Augen!«, und, mit dem Finger stadtauswärts zeigend: »Dort geht’s nach Obwalden zurück. Obwalden einfach. Haben Sie verstanden, Sie blödes, dummes Arschloch?«
Derart verjagt hat es mich, dass mir das mit dem blöden, dummen Arschloch halt einfach herausgerutscht ist. Richtiggehend zum Teufel gejagt haben der Kari und ich diesen Kerl.
Als der Obwaldner weg war, stand noch immer die junge drogensüchtige Frau da. Keine zwanzig Jahre alt war sie und von erschreckender Magerkeit. Nur noch aus Haut und Knochen bestand dieses arme Geschöpf. Ihre Haare waren ein Gewirr aus dunklen, ungewaschenen, verfilzten Locken. Ihre fiebrig glänzenden Augen starrten durch uns hindurch. Vom Drogenrausch völlig benebelt, wusste sie nicht, was um sie herum geschah. Für einen Augenblick standen der Kari und ich etwas verloren da, wussten nicht so recht, was wir mit der Frau machen sollten. Da stolperte sie schon schwankend drei, vier Schritte auf uns zu, knickte mit ihren dürren Beinen ein, sank zu Boden und blieb auf dem Asphalt liegen. Sofort lief ich zu ihr hin, beugte mich über sie und wollte ihr irgendwie hochhelfen, als ich an ihrem Unterarm eine grosse, übel aussehende eiterverkrustete Wunde bemerkte.
Für mich und den Kari war klar, dass diese Frau dringend medizinische Hilfe brauchte. Zackig habe ich über Funk die städtische Sanität aufgeboten. Nur sechs Minuten dauerte es, bis der Krankenwagen eintraf. Von einem der Sanitäter erfuhr ich, dass die Frau bereits klare Anzeichen einer Blutvergiftung aufwies. Sie wurde sofort in die Notfallstation des Universitätsspitals Zürich verbracht.
Was ist das für einer, der die Notlage von solchen Menschen derart ausnützt? Ein Schwein? Ein Mistkerl? Ein Stück Dreck? Ein alter, geiler Bock? Ein Charakterlump?
Je älter ich wurde und je länger ich bei der Polizei war, umso mehr Mühe bekam ich, mit solchen Situationen professionell umzugehen. Nur noch angewidert war ich, so etwas ständig von neuem miterleben zu müssen. Vieles frass sich als eine Art seelische Hypothek richtiggehend in mein Gehirn. Die Bilder bleiben, obwohl sie mit der Zeit etwas verblasst sind, jederzeit abrufbar und tauchen bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit wieder auf. Nur schon wenn ich in Zürich spazieren gehe, dort, wo ich als Polizist im Einsatz war, greift die Vergangenheit nach mir. Wohin ich auch gehe, überall stosse ich auf Erlebnisse aus meiner Polizistenzeit. Darunter schlimmste Sachen, die man nicht vergessen kann.