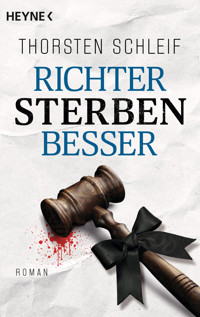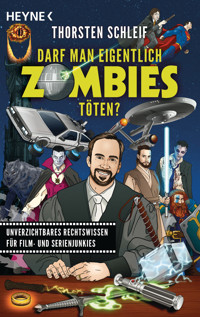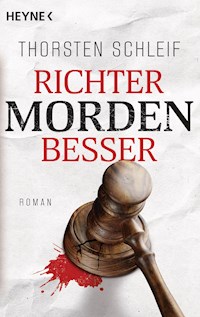
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Siggi Buckmann-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Richter, dein Henker
Als junger Jurastudent träumte Siggi Buckmann davon, die Welt ein Stück gerechter zu machen. Als alter Hase im Richteramt schiebt er nur noch Dienst nach Vorschrift. In den Justizbehörden regiert die Bürokratie und sämtliche Urteile, die Siggi fällt, werden in Berufungsverfahren wieder aufgehoben. Erst der Tod eines obdachlosen Junkies rüttelt Siggi wieder wach. Als niemand die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen will, beginnt Siggi, die Dinge anders zu betrachten. Da er das System seit Jahrzehnten kennt, weiß er, wie man dessen Schwachstellen nutzen kann. Vielleicht kommt ja auch er selbst mit einem Verbrechen davon?
»Hätten Kommissar Schimanski und Richterin Barbara Salesch einen unehelichen Sohn gezeugt, wäre er der geistige Zwillingsbruder von Strafrichter Buckmann.« Karsten Dusse, Autor von »Achtsam morden«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DASBUCH
Richter morden besser. Natürlich wäre es schön, wenn Richter überhaupt nicht morden würden. Und auf die meisten Richter trifft das zweifellos zu. Schon was geeignete Mordwerkzeuge betrifft, sind sie eher schlecht ausgestattet. Ein Arzt kann die Giftspritze benutzen, ein Metzger das Fleischermesser und ein Gärtner die Heckenschere. Aber ein Richter? In Amerika hat er wenigstens so einen kleinen, hübschen Holzhammer …
Auf dem Schreibtisch von Richter Siggi Buckmann finden sich lediglich Kugelschreiber und Papier. Und diese Werkzeuge eignen sich nur sehr eingeschränkt dazu, einen Menschen auf direktem Weg ins Jenseits zu befördern. Buckmann hat in diesem Umstand bislang nie ein Problem gesehen. Denn einer seiner Grundsätze lautet: Richter morden nicht. Und an diesen Grundsatz hat er sich mehr als fünfzig Jahre gehalten. Doch der Tod eines alten Bekannten veranlasst Buckmann, seinen Grundsatz zu überdenken. Und eine Alternative zum klassischen Tatwerkzeug zu suchen …
DERAUTOR
Thorsten Schleif, Jahrgang 1980, studierte Rechtswissenschaften in Bonn. Seit 2007 ist er Richter im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen. Er war am Landgericht Düsseldorf und in der Verwaltung des Oberlandesgerichts Düsseldorf tätig. In den Jahren 2014 bis 2019 war er alleiniger Ermittlungsrichter für die Amtsgerichtsbezirke Wesel und Dinslaken. Gegenwärtig arbeitet Schleif als Vorsitzender des Schöffengerichts und Jugendrichter am Amtsgericht Dinslaken. 2019 und 2020 veröffentliche er zwei Sachbücher, es folgten zwei Hörbücher im Jahr 2021, »Richter morden besser« ist sein erster Roman. Seit 2016 ist Schleif außerdem als Keynote Speaker tätig. Er lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern in Duisburg.
THORSTEN SCHLEIF
RICHTER
MORDEN
BESSER
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Für Anne
TEIL EINS
1
Diese verfluchte Kälte. Den ganzen Tag schon hatte er gefroren. Gegen Abend wurde es noch schlimmer. Seit einer Stunde quälte ihn ein Schüttelfrost. Aber Fredi hatte jemanden gefunden, der ihm etwas gegen die Kälte hatte verkaufen können. Und gegen die Schmerzen. In seinen schwachen Muskeln. In seinem leeren Magen. Jetzt brauchte er nur noch ein stilles Plätzchen. Die Eisenbahnunterführung an der Bundesstraße lag nur einen Steinwurf entfernt. Drei Minuten für einen Fußgänger. Fredi brauchte zehn. Seine Beine wollten nicht mehr. Die Waden und Oberschenkel krampften bei jedem Schritt. Endlich hatte er die hässliche, mit Graffiti beschmierte Betonunterführung erreicht. Es roch nach Urin und Hundekot. Aber das störte Fredi nicht. Er suchte eine Ecke, die von der Straße aus schlecht einsehbar war. Dann holte er einen alten Löffel und ein Wegwerffeuerzeug aus der Tasche seines zerschlissenen Mantels. Zuletzt die Spritze und das rote Zellophanpapier mit seiner Medizin. Gegen die Kälte. Gegen die Schmerzen. Mit geübten Handgriffen bereitete er die Lösung vor, zog die Spritze auf. Die Venen an seinen Armen waren nicht mehr zu gebrauchen, das wusste Fredi. Aber an seinem linken Fuß gab es noch eine gute Stelle. Er zog den kaputten Schuh aus und den dicken Wollsocken mit den Löchern. Dann krempelte er das Hosenbein hoch und knotete sich den Socken um die Wade. Die dünne Vene war jetzt besser sichtbar. Er setzte die Nadel an und verabreichte sich seine Medizin.
Nach einem kurzen Augenblick hörte das Zittern auf, die Kälte wich zurück. Jetzt erst spürte er den heißen Sommerabend. Auch die Schmerzen ließen nach. Schnell. Sehr schnell. Fredi stutzte. Das war zu schnell. Ihm fiel auf, dass sich seine Lungenflügel nicht mehr bewegten. Fredi hatte aufgehört zu atmen. Doch er fühlte sich nicht schlecht. Im Gegenteil. Es ging ihm richtig gut. Trotzdem griff er in seine Manteltasche und fühlte das Nasensprayröhrchen. Naloxon. Das hatte ihm der Arzt verschrieben. »Das hebt die Wirkung des Heroins sofort auf, Fredi«, hatte er gesagt. Und er hatte ihm gezeigt, wie er es benutzen musste.
»Papa.«
Hatte er sich das eingebildet? Fredi holte das Spray langsam aus der Manteltasche. Sein Blickfeld wurde enger, und er spürte, dass sein Herz immer langsamer schlug.
»Papa.«
Da war es wieder. Wie durch einen Nebel hörte er eine Stimme. Eine Kinderstimme. Fredi kannte sie gut. Und er vermisste sie. Er führte das Nasenspray wie in Zeitlupe zu seinem Gesicht.
»Papa.«
Die Stimme wurde klarer. Heller. Und schöner. Das Spray fiel ihm aus der Hand. Nicht schlimm. Er würde es wieder aufheben. Nur eine kurze Pause. Den Moment genießen.
»Papa.«
Fredi freute sich über dieses Wort. Zu lange hatte er es nicht gehört.
»Papa.«
Wenn er das Spray benutzte, würde die Stimme wieder verschwinden. Nur noch einmal das Wort hören. Dann würde er zum Spray greifen. Nur noch einmal. Sein Herzschlag setzte aus. Nur noch einmal. Fredi sackte zusammen.
»Papa.«
2
Montag ist mein Sitzungstag. Da komme ich dem am nächsten, was man einen altehrwürdigen Richter nennt. Oder besser dem, was sich die die meisten Menschen darunter vorstellen. Sie denken an Kinofilme wie Eine Frage der Ehre oder Zeugin der Anklage und sehen eine feine Holzvertäfelung, mit Leder überzogene Sessel und die mit Intarsien verzierte Richterbank. Die Wirklichkeit sieht eher aus wie in Independence Day. Nach dem Alienangriff.
An den fleckigen Teppich in meinem Sitzungssaal hatte ich mich mittlerweile gewöhnt. Auch an die vielen Spinnweben von der Größe eines Fischernetzes, die wenigstens verhindern, dass die alten flackernden Halogenlampen von der Decke fallen. Sogar über die wackligen und zerkratzten Bänke mit den Kaugummiresten im Zuschauerbereich konnte man hinwegsehen. Vorausgesetzt, man litt unter einer ausgeprägten Kurzsichtigkeit. Aber wirklich unschön waren die Handabdrücke auf den einstmals weißen Wänden und der schiefe Richtertisch, eine hellbraune Sperrholzkonstruktion aus den späten Siebzigerjahren, die vor zehn Jahren beschlossen hatte, langsam auseinanderzufallen. Wenigstens, das muss ich zugeben, rundete ich das Bild des Gerichtssaals optisch ab.
Es ist nicht so, dass ich auseinanderfalle, obwohl ich die fünfzig auch schon hinter mir habe. Aber, um es positiv auszudrücken: Würdevoll ist anders. An diesem Montag im Juli hätte allerdings selbst Sean Connery in seinen besten Zeiten keine gute Figur im Gerichtssaal abgegeben. Das Thermometer auf dem Richtertisch zeigte eine Temperatur von fast vierzig Grad an. Der Saal verfügte zwar über große, nach Süden ausgerichtete Fenster, aber leider nicht über Vorhänge, sodass die Sonne ab spätestens neun Uhr in den Raum hineinbrannte. Ich habe mich schon oft gefragt, warum der Denkmalschutz zwar offensichtlich keine Schwierigkeiten damit hat, das aus der Kaiserzeit stammende Gebäude verrotten zu lassen, sich aber vehement weigert, den Einbau einer Klimaanlage zu gestatten.
»Soll ich das Ding noch mal anschalten?«, fragte Sabine, meine Protokollführerin, und deutete auf den Ventilator in der Ecke.
»Bloß nicht!«, erwiderte ich und hob abwehrend die Hände. Die vor drei Jahren angeschafften Ventilatoren wirbelten lediglich die warme Luft auf und waren schon auf kleinster Stufe so laut, dass man das eigene Wort im Saal nicht mehr verstehen konnte.
»Hab ja nur gefragt«, grinste Sabine, die in ihrem leichten Sommerkleid trotz der hohen Temperatur noch recht frisch aussah. Für gewöhnlich trug auch sie eine schwere, schwarze Robe aus Schurwolle, so wie es das Protokoll verlangte. Aber heute hatte ich bereits in der ersten Verhandlung um neun Uhr die Robenpflicht aufgehoben. Viel geholfen hatte es nicht.
»Als wäre man auf Teneriffa!«, schnaufte eine tiefe Stimme links neben mir.
Ich blickte zum Tisch der Staatsanwaltschaft. Dort saß mein alter Freund, Staatsanwalt Ulrich Nussbaum, der heute die Anklage vertrat. Uli macht den Eindruck eines schneidigen preußischen Offiziers. Schlank und hochgewachsen, kurze graue Haare und ein gepflegter Schnurrbart. Er gehört zu der seltenen Sorte der absolut ehrlichen Menschen und würde für jeden, den er als Freund bezeichnet, auch eine Gewehrkugel abfangen. Seine schwarze Robe hing über der Stuhllehne, und die Ärmel des weißen Hemdes waren bis über den Ellenbogen aufgerollt.
»Auf Teneriffa ist es kühler«, antwortete ich.
Uli sah mich fragend an.
»Britta macht dort gerade Urlaub. Wir haben gestern Abend telefoniert. Die haben nur dreißig Grad.«
»Nur ist gut«, brummte Uli. »Wie geht es ihr?«
»Britta? Gut! Mark trägt sie schließlich auf Händen.«
Britta ist meine Ehefrau. Seit einundzwanzig Jahren sind wir glücklich verheiratet – und seit vier Jahren noch glücklicher getrennt lebend. Getrennt lebend, nicht etwa geschieden. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wir betrachten unsere Ehe nicht als gescheitert, sondern als eine für beide Parteien vorteilhaft beendete Kooperation nach erfolgreicher Projektrealisierung. Unsere erfolgreichen Projekte heißen Kiana und Ronja und sind – ganz objektiv betrachtet – die beiden tollsten Töchter der Welt. Ich vermisse sie sehr, seitdem sie für ihr Studium ausgezogen sind. Kiana verließ vor zwei Jahren als Erste das Haus und zog in eine kleine Studentenbude. Wenigstens in derselben Stadt, was aber nicht bedeutet, dass ich sie besonders häufig zu Gesicht bekomme. Vor einem halben Jahr zog Ronja aus. Meine kleine Tochter war noch nie ein Freund halber Sachen, und so verließ sie nicht nur die Stadt, sondern gleich das Land und studiert seit sechs Monaten in England. Britta zog übrigens kurze Zeit später ebenfalls aus, vor vier Monaten, um genau zu sein. Nicht für ein Studium, sondern für Mark, ihren neuen Freund. Netter Kerl. Fachanwalt für Steuerrecht, aber trotzdem nett.
»Morgen, Euer Ehren! Herr Staatsanwalt! Schön kuschelig habt ihr es hier.«
Rechtsanwalt Bollmann betrat den Saal. Gut gelaunt wie immer. Bollmann war einer unserer lokalen Strafverteidiger. Ein alter Fuchs, erfahren und fair. Auch deshalb gehört Bollmann zu meinem engen Freundeskreis. Er stellte zufrieden fest, dass wir keine Roben trugen, und warf seine Anwaltstracht unsanft über die Stuhllehne.
»Morgen, Oli! Da sagst du was«, erwiderte ich seinen Gruß. »Heute ohne einen Mandanten unterwegs?«
Oliver schüttelte den Kopf und legte seine Aktentasche auf den Tisch. »Wartet draußen. Habt ihr euch schon überlegt, wohin die Reise geht?« Seine klassische Umschreibung für: Gibt es noch einmal eine Bewährungsstrafe oder nicht?
»Puh. Kannst du irgendetwas vortragen, was dein Mandant Tolles kann?«, fragte ich.
»Bei seiner Vorstrafenlatte wäre etwas gut wie: ›Hat einen Atomkrieg verhindert‹ oder ›hat ein Heilmittel gegen Krebs entwickelt‹«, ergänzte Uli.
Als Strafverteidiger hat man es nicht immer leicht. Besonders dann nicht, wenn der größte Feind im Sitzungssaal weder der Staatsanwalt noch der Richter ist, sondern der eigene Mandant.
»Seit drei Monaten schreibe und telefoniere ich hinter ihm her und bequatsche seinen Anrufbeantworter«, schnaubte Oliver. »Gestern Abend, kurz vor Büroschluss, hat er sich endlich bequemt, in meine Kanzlei zu kommen. Natürlich unangemeldet. Das einzig Tolle, was ich über meinen Mandanten sagen kann, ist: Er kann gleichzeitig sitzen und atmen.«
»Das ist nicht viel«, entgegnete ich. »Aber vielleicht reicht es für die Berufung.«
»Also dann der übliche Weg«, stellte Oliver fest. Uli und ich nickten.
Der übliche Weg. Das bedeutete, es würde heute keine Bewährung geben. Aber nur heute nicht. Bollmann würde Berufung gegen mein Urteil einlegen, und in etwa zwei Jahren würde die Berufungskammer des Landgerichts die Strafe zur Bewährung aussetzen. Weil der Angeklagte gleichzeitig sitzen und atmen konnte.
Die anschließende Verhandlung verlief erwartungsgemäß unspektakulär. Bollmanns Mandant war wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Der junge Mann hatte wenig Verständnis dafür, dass seine Freundin ihn verlassen wollte. Sie hatte es doch gut bei ihm, und er ließ ihr viele Freiheiten. Sie durfte sich sogar weiter mit ihren Freundinnen treffen. Er erwartete nur, dass sie ihm dieselbe Freiheit einräumte. Und das bedeutete: Er wollte sich ebenfalls weiter mit ihren Freundinnen treffen. Das wollte sie nicht. Typischer Fall von Undank. Eines Tages beschloss sie, ihn zu verlassen, und rannte aus der Wohnung. Der Angeklagte jagte ihr nach und beförderte sie unsanft auf den Boden. Dann trat er ihr kräftig in den Rücken. Jedenfalls stand es so in der Anklage. Und jedenfalls hatte es so die Nachbarin gesehen und daraufhin die Polizei alarmiert. Und jedenfalls sprachen auch die Fotos vom Rücken der Freundin mit den unschönen blauen Flecken im Nierenbereich für diese Version. Anders sah es allerdings der Angeklagte. Er fühlte sich als klassisches Opfer eines Justizirrtums und behauptete, lediglich mit dem Fuß auf den Boden gestampft zu haben. Aus Hilflosigkeit. In der Nähe des Rückens seiner Freundin.
»Das hat nur so ausgesehen …«, begann der Angeklagte seine Erklärung.
»Ja nee, is’ klar«, dachte ich in diesem Augenblick. Leider laut. Das passiert mir öfters und hätte bei einem Konfliktverteidiger mit Sicherheit einen Befangenheitsantrag zur Folge gehabt. Aber Bollmann verzichtete auf solche Spielchen. Er dachte dasselbe wie Uli und ich: Welcher hirnverbrannte Schwachkopf sollte diesen Blödsinn, den sein Mandant da verzapfte, glauben?
Achtzehn Monate später wurde uns diese Frage beantwortet: der Vorsitzende der Berufungskammer, Richter Brun. Am selben Tag, an dem er den Angeklagten freisprechen sollte, beging dieser übrigens die nächste Körperverletzung. Aus Erleichterung vermutlich, dass der Justizirrtum endlich aufgeklärt wurde. Wieder war seine Freundin das Opfer, die dabei ein Stück Zahn verlor. Der übliche Weg.
»Die Berufung kommt dann gleich morgen«, sagte Oliver, während er seine Unterlagen zusammenpackte und in der Aktentasche verstaute. Sein unzufriedener Mandant hatte den Saal bereits wütend verlassen. »Wer wird beim Landgericht darüber entscheiden?«
Ich seufzte. »Kollege Brun.«
»Dann also eine sichere Bewährung«, brummte Uli und verdrehte die Augen. Richter Brun und seine absurden Entscheidungen waren der Staatsanwaltschaft allzu gut bekannt.
»Hält Richter Brun eigentlich immer noch den Rekord?«, fragte Bollmann interessiert.
Ich nickte. »Den wird ihm auch so schnell keiner mehr nehmen können.«
Der Rekord. Während einige Kollegen über die Milde der Berufungskammern verzweifelten und andere vor Wut fast zerplatzten, hatte ich vor einigen Jahren beschlossen, die Sache sportlich zu sehen. Und zwar wortwörtlich. Ich begann, eine offizielle Tabelle zu führen, wie bei der Bundesliga, mit einem einfachen Punktesystem: Sprach ein Berufungsrichter einen Schuldigen frei, gab es dafür zwei Punkte. Setzte er eine Freiheitsstrafe entgegen dem ursprünglichen Urteil zur Bewährung aus, dann einen Punkt. Null Punkte gab es, wenn das ursprüngliche Urteil bestätigt wurde – das war allerdings ein theoretischer Fall, jedenfalls bisher nicht vorgekommen. Diese Tabelle führte die Vorsitzende der Dritten Strafkammer des Landgerichts, Richterin Schnöde, so souverän an wie der FC Bayern die erste Bundesliga. Brun allerdings hielt den Rekord für den schnellsten Rückfall eines verschonten Straftäters. Monatelang war Richter Gurtmann stolzer Rekordhalter gewesen. Sein schnellster rückfällig gewordener Straftäter hatte nach der Verurteilung immerhin sechsundzwanzig Stunden durchgehalten, ehe er das nächste Verbrechen beging. Doch dann gelang Richter Brun eine neue persönliche Schlechtleistung: Der Angeklagte, den ich zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt hatte, hatte bei ihm in der Berufungsverhandlung noch einmal eine Bewährung bekommen, war aus dem Sitzungssaal sofort in das nahe gelegene Einkaufszentrum spaziert und hatte dort einer älteren Dame geholfen. Leider nur beim Tragen ihrer Geldbörse. Und das alles weniger als eine Stunde nach der Verurteilung, nämlich nach genau siebenundvierzig Minuten. Das verrieten die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras, die uns die Kaufhausdetektive zu rein sportlichen Dokumentationszwecken freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatten.
Oliver nahm seine Anwaltsrobe von der Stuhllehne, faltete sie grob zusammen und legte sie auf seine Aktentasche. Gerade wollte er den Saal verlassen, da drehte er sich noch einmal um und machte ein ernstes Gesicht.
»Übrigens, habt ihr es schon gehört?«
Ich blickte Oliver fragend an. »Nämlich?«
»Fredi ist tot.«
Der Satz traf wie eine Ohrfeige.
3
Friedrich »Fredi« Diepenberg war ein stadtbekannter Junkie, Gelegenheitsdieb und ein wirklich netter Kerl. Das war mir bereits aufgefallen, als ich ihn vor fast zehn Jahren zum ersten Mal verurteilte, weil er ein Parfum gestohlen hatte. Parfum, Rasierklingen, Zahnbürstenköpfe, Tabak oder Kaffee – alles Gegenstände, die bei Junkies sehr beliebt sind, da sie sich gut »verticken« lassen, um schnell ein paar Euro für den nächsten Schuss zusammenzubekommen.
Rechtsanwalt Bollmann verteidigte Fredi schon seit vielen Jahren und kannte seine Lebensgeschichte ebenso wie ich. Fredi hatte bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr nicht eine einzige Straftat begangen. Er war ein solider Handwerker, Dachdecker, ein Baum von einem Mann. Er lachte gern, viel und oft. Am liebsten mit seiner Tochter, der kleinen Corinna. Bis zu dem Tag, als sich zwei junge Männer ein Rennen in der Innenstadt lieferten und mit über hundert Stundenkilometern über eine rote Ampel rasten. Corinna war auf dem Heimweg von der Schule, gemeinsam mit ihrer besten Freundin. Sie hatten gewartet, bis die Fußgängerampel grün zeigte. So wie sie es gelernt hatten. Die Mädchen verstarben noch an der Unfallstelle. Sie waren erst acht Jahre alt. Beide Raser kamen mit einer Bewährungsstrafe davon. Fredi rutschte ab, verlor erst den Job, dann seine Frau. Er begann mit Alkohol und Tabletten. Irgendwann rauchte er Heroin. Glücklich machte es ihn nicht, aber wenigstens betäubte es seinen Schmerz. Für eine Weile.
Bald ging er dazu über, Heroin zu spritzen. Angeblich wirkt das schneller, und es braucht weniger Stoff für einen Kick. Fredis Arbeitslosengeld wurde immer knapper. Er verkaufte alles und verlor seine Wohnung. Seitdem lebte er auf der Straße. Im Winter wurde Fredi oft »zur Ausnüchterung« eingesperrt. Das war die offizielle Version. Inoffiziell nutzten unsere Gesetzeshüter die Gelegenheit, ihn aufzupäppeln. Fredi bekam etwas zu essen, eine Dusche und auch immer wieder ein paar gebrauchte, aber saubere Kleidungsstücke. Alle Polizisten kannten Fredi und seine Geschichte, und sie mochten ihn. Mir ging es nicht anders. Fredi war immer freundlich. Selbst dann, wenn er bei einem Diebstahl erwischt wurde. Nie versuchte er wegzulaufen oder wurde aggressiv.
Ich sperrte Fredi regelmäßig im November oder Dezember ein. Für drei Monate. Ein Gefängnisaufenthalt ist kein Zuckerschlecken. Auch für Kriminelle nicht. Und den großkotzigen Armleuchtern, die behaupten, deutsche Gefängnisse seien wie ein Urlaub im Club Robinson, wünsche ich einmal einen dreimonatigen Urlaub in so einem Feriendomizil. Ich bin überzeugt, dass das ihre Auffassung ändern würde. Für wenige arme Teufel wie Fredi ist jedoch selbst ein Gefängnisaufenthalt eine Verbesserung ihrer Lebensqualität. Wenn es ihm sehr dreckig ging und er sich mal wieder strafbar gemacht hatte, verschaffte ich Fredi für einige Zeit ein Dach über dem Kopf, drei Mahlzeiten täglich und eine ärztliche Grundversorgung. Meistens kam er im Dezember in den Knast und im Frühjahr wieder raus. Mit fünf bis zehn Kilogramm mehr auf den Rippen, manchmal auch clean. Wenigstens für kurze Zeit.
Inzwischen hatte Fredi drei Therapien hinter sich, die letzte erfolglos abgebrochen. Der Sozialhilfeträger übernahm die Kosten für einen weiteren Therapieversuch nicht mehr. Es war eine Frage der Zeit gewesen, bis ihm das Heroin den Rest gab.
Fredi und ich trafen uns oft in der Fußgängerzone der Altstadt, wenn ich zum Mittagessen ging. Er begrüßte mich immer freundlich mit »Hallo, Euer Ehren!«. Ab und zu wechselten wir ein paar Worte, ich drückte ihm ein oder zwei Euro in die Hand, und manchmal kaufte ich ihm etwas zum Essen. Fredi war ein guter Mensch. Und hilfsbereit. Auch dem Richter gegenüber, der ihn immer wieder einsperrte. Ich würde ihm niemals vergessen, was er vor drei Jahren für meine Familie getan hatte …
»Was ist passiert?« Staatsanwalt Nussbaum riss mich aus meinen Gedanken.
Bollmann zuckte mit den Schultern.
»Sie haben ihn heute Morgen gefunden. Unter der Eisenbahnbrücke. Da war er wohl schon kalt. Mehr weiß ich auch nicht.«
»Scheiße«, brummte Uli. Er kannte Fredi sogar länger als ich. »Fredi war in der Grundschule ein oder zwei Klassen unter mir.«
»Vielleicht war seine Zeit einfach gekommen«, sagte Oliver.
Uli nickte zustimmend.
»Fredi war ein anständiger Kerl«, stellte ich fest. »Ein wirklich anständiger Kerl.«
4
Kaffee. Wenn er jemals in den Katalog der illegalen Betäubungsmittel aufgenommen werden sollte, hätte ich ein ernsthaftes Problem. Schon als Kind hatte ich seinen Geruch gemocht. Meine Großmutter nutzte noch eine altmodische Kaffeemühle, um die Kaffeebohnen mit der Hand zu mahlen. Einmal am Morgen und einmal am Nachmittag. Auch heute noch, fast ein halbes Jahrhundert später, erinnerte mich der kleinste Hauch von frischem Kaffeeduft an die kleine Bergmannswohnung meiner Großeltern, in der ich jeden Tag nach der Schule meine Hausaufgaben machte, bis meine Mutter von der Arbeit kam. Aufgrund dieser schönen Kindheitserinnerungen wirkt Kaffee auf mich bis heute beruhigend und anregend zugleich.
An diesem Nachmittag blieb seine Wirkung allerdings auch nach der dritten Tasse aus. Fredi ging mir nicht aus dem Kopf, seit ich mich vor zwei Stunden von Uli und Oliver verabschiedet hatte. Ich schob die Strafakte, in der ich seit einer Viertelstunde unkonzentriert hin und her blätterte, von mir weg und blickte auf meinen Schreibtisch. Er sah wie immer etwas chaotisch aus. Neben dem handbreiten Noch-einmal-durchsehen-und-wegwerfen-Stapel türmte sich ein doppelt so hoher Noch-einmal-durchsehen-dann-auf-den-Noch-einmal-durchsehen-und-wegwerfen-Stapel-legen-Stapel. Drum herum lagen verstreut zwei Dutzend Papiere, die es bisher weder auf den einen noch auf den anderen Stapel geschafft hatten. Und mittendrin stand ein Kaktus, den mir meine kleine Tochter Ronja zu meinem einundvierzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Damals war sie sieben Jahre alt. Britta hatte gewettet, der Kaktus würde keine drei Monate überleben. Zugegeben, die meisten meiner Zimmerpflanzen machten es nicht lange. »Selten gießen« bedeutet eben doch »schon irgendwann mal gießen«. Aber der Ronja-Kaktus war ungewöhnlich zäh. Und ich hatte mich gebessert. Oder vielmehr: Ich hatte herausgefunden, wie man kalten Kaffee auch entsorgen konnte.
Als ich gerade beschlossen hatte, den Rest aus meiner Kaffeetasse mit Ronjas Kaktus zu teilen, klopfte es an der Tür, und eine Frau um die vierzig stürmte in mein Büro, noch bevor ich »Herein« sagen konnte. Dr. Nora Gülsen, genannt »Duracell«, die Vizedirektorin des Amtsgerichts. Ihr Spitzname entstammte einer Fernsehwerbung aus den Achtzigerjahren für die gleichnamige Batterie. Tatsächlich erinnerte Gülsens immer hektisches Auftreten stark an den beckenschlagenden, batteriebetriebenen Duracell-Hasen. Es wäre jedoch ein schwerer Fehler, sie lediglich als etwas nervtötend oder flippig abzutun. Duracell gehörte zu der gefährlichsten Sorte Richter, der ich in meinen mehr als zwanzig Dienstjahren begegnet bin.
Im Großen und Ganzen gibt es drei Arten von Richtern.
Die einen treibt der Idealismus in den Beruf; der naive Wunsch, den Menschen zu helfen und der Gerechtigkeit zu dienen. Das ist die mit Abstand dümmste Gruppe. Zu ihr gehörte ich auch einmal. Der Idealismus legt sich mit der Zeit, je länger man im Staatsdienst ist. Er geht aber nie ganz weg. Es ist wie eine Sucht. Selbst heute leide ich noch bisweilen unter idealistischen Vorstellungen.
Dann gibt es die Juristen, die einen sicheren Job mit regelmäßigem Einkommen suchen. Einen familienfreundlichen Beruf, in dem man auch Kinder bekommen und dauerhaft halbtags arbeiten kann. Das ist die mit Abstand größte Gruppe. Ebenso langweilig wie ein kräftiger Schluck lauwarmes Wasser, aber wenigstens harmlos.
Die dritte Art ist die mit Abstand schlimmste. Vertreter dieser Gruppe suchen Ruhm und Ehre, also einen gut klingenden Titel wie »Direktor« oder »Präsident« und eine möglichst hohe Besoldungsstufe. Der Weg in die freie Wirtschaft ist ihnen versperrt, da dort Unfähigkeit mit dem Verlust des Arbeitsplatzes bestraft werden kann, während im öffentlichen Dienst Inkompetenz noch nie ein Karrierehindernis war, sondern eher Beförderungsvoraussetzung. Der Büroschlaf eines Landgerichtspräsidenten wird nicht gestört, nur weil in einem einzigen Strafprozess Steuergelder in zweistelliger Millionenhöhe verbrannt werden. Zu dieser Sorte gehörte Duracell. Natürlich hatte sie keine Kinder. Kinder waren in ihren Augen nur ein Karrierehindernis. Einmal hatte sie einer schwangeren Kollegin, die nur noch halbtags arbeiten wollte, mit deutlichen Worten erklärt, was sie davon hielt: »Um Ihre Kinder kann sich jeder kümmern, um Ihre Karriere nur Sie selbst!«
»Raten Sie mal, was Tolles passiert ist!«, flötete Duracell ohne Begrüßung.
Ich hatte kurzfristig die Hoffnung, sie hätte sich freiwillig für ein Versuchsprojekt zur Erprobung starker Beruhigungsmittel gemeldet. Aber das war es wohl nicht. Leider.
Als ich nach einer für sie endlos scheinenden Sekunde immer noch nicht geantwortet hatte, riss ihr nanometerdünner Geduldsfaden. »Also, der Präsident des Landgerichts hat sich …«, begann sie.
»… versehentlich erfolgreich suizidiert?«, beendete ich ihren Satz.
Duracell machte ein verdutztes Gesicht. »Äh, nein«, sagte sie sichtlich verwirrt. Nicht mal das bekommt der hin, dachte ich.
Duracell setzte erneut an: »Also, der Präsident des Landgerichts hat sich …«
»… mit zwei Praktikantinnen in die Südsee abgesetzt?« Mein zweiter Versuch.
Sie wurde ungeduldig. »Lassen Sie mich doch ausreden! Also, der Präsident des Landgerichts hat sich für Freitag angekündigt. Er wird Sie überhören. Persönlich!« Duracell strahlte über das ganze Gesicht.
Eine Überhörung. Einen so blödsinnigen Namen können sich nur Juristen im Staatsdienst ausdenken. Es ist eine Art Überprüfung des Richters. Der Präsident oder einer seiner leibeigenen Richter kommt zu diesem Zweck in eine Gerichtsverhandlung, hört zu und schreibt anschließend alles auf, was er nicht verstanden hat, aber natürlich viel besser gemacht hätte.
»Toll«, entgegnete ich knapp. Das Erscheinen des Präsidenten war für mich nicht unbedingt ein Grund, in Ekstase zu verfallen. Ich musterte Duracell. Man konnte das offensichtlich auch anders sehen.
»Freuen Sie sich denn gar nicht?«, fragte sie.
»Doch, doch. Unglaublich.« Mein halbherziger Versuch zu lächeln scheiterte kläglich.
Duracell musterte mein Büro und rümpfte die Nase. »Vielleicht sollten Sie für Freitag einige Bilder abhängen. Falls sich der Herr Präsident noch mit Ihnen unterhalten will. Er schätzt es nicht, wenn solche Bilder im Büro eines Richters hängen.«
Ich blickte mich um. An den zuletzt vor fünfzehn Jahren gestrichenen Wänden meines Büros hingen die Hollywoodstars vergangener Tage. Über der Kaffeemaschine war ein gerahmtes Poster von Gary Cooper. Und die Wand, an der mein Aktenbock stand, schmückten Clint Eastwood und John Wayne. Alle natürlich stilecht mit Cowboyhut, Sattel und Gewehr.
»Warum nicht?«, fragte ich in einem ernsten Tonfall.
»Überlegen Sie doch: Welchen einzigen Rückschluss lassen solche Bilder auf den Menschen zu, der sie in seinem Büro aufhängt?«
»Dass dieser zwar klassische Western bevorzugt, allerdings auch dem Subgenre des Italowestern durchaus etwas abgewinnen kann?«
Duracell schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Doch, natürlich«, widersprach ich. »Cooper und Wayne sind die Prototypen des klassischen Westernhelden, während gerade die Dollar-Trilogie von Sergio Leone mit Clint Eastwood die europäische und besonders italienische Sichtweise auf den Wildwest-Mythos charakterisiert.«
»Sie können das ganz offensichtlich nicht begreifen«, begann Duracell mit dem Tonfall eines Oberlehrers. »Derartige Bilder lassen nur den Rückschluss zu, dass Sie, Herr Buckmann, es für richtig halten, das Gesetz mit dem Revolver durchzusetzen und die Straßen mit der Waffe zu säubern!«
Ich machte ein betroffenes Gesicht. »Jetzt wird mir so einiges klar!«
»Das freut mich.«
»Mich nicht! Ich bin sehr besorgt! Wenn das mit dem Rückschluss so eindeutig ist, dann …« Ich machte eine Pause.
Duracell sah mich fragend an.
»Sie haben doch neulich erzählt, dass Ihr Lieblingsfilm Titanic ist«, setzte ich nachdenklich an. »Ich muss darauf bestehen, vor Ihrem nächsten Segeltörn Ihren Ehemann zu warnen und …« Duracell funkelte mich wütend an, machte auf dem Absatz kehrt und riss die Tür auf. Dann drehte sie sich noch einmal um.
»Sie denken doch daran, dass sich morgen Nachmittag der neue Referendar vorstellt?«
Empört blickte ich sie an.
»Selbstverständlich denke ich daran!« Mist, den hatte ich komplett vergessen.
5
Eine halbe Stunde nach dem Gespräch mit Duracell stand ich bereits vor der kleinen Wohnung in der Altstadt, die ich angemietet hatte, nachdem meine Mädels aus unserem Haus am Stadtrand ausgezogen waren. Ein kleines Schlafzimmer, Küche, Bad und ein Wohnzimmer, das groß genug war, um auch noch meine Trainingsbank und ein paar Hanteln unterzubringen. Schon als ich die Tür öffnete, kam mir mein Mitbewohner entgegen. Wie immer unbekleidet. Er blieb stehen, gähnte herzhaft und kratzte sich ausgiebig hinter dem linken Ohr.
»Na, Grisu! Was hast du den ganzen Tag gemacht?«, fragte ich und schloss die Wohnungstür hinter mir. Was auch immer es war, es musste sehr hungrig gemacht haben, denn der schwarz-weiße Maine-Coon-Kater marschierte sofort in die Küche und schabte an der Tür des Schranks, in dem ich das Katzenfutter aufbewahrte.
»Etwas früh für das Abendbrot, oder?«, fragte ich. Grisu sah das offensichtlich anders. Wie immer. Ich nahm eine Dose mit Leckerchen aus dem Schrank und legte eine Handvoll davon in den Futternapf neben der Wasserschale. Grisu sah mich kurz an, als wollte er vorwurfsvoll sagen: »Ist doch nur was für den hohlen Zahn!« Dann fraß er die Portion auf und erinnerte dabei an einen Staubsauger auf höchster Stufe. Anschließend beschwerte er sich mit einem Mauzen, dass sein Napf wieder leer war.
Einmal mehr rechnete ich es meiner Frau hoch an, dass sie unseren Kater nicht mitgenommen hatte, als sie ausgezogen war, obwohl sie sehr an ihm hing. »Du brauchst Gesellschaft. Es ist nicht gut, wenn du immer allein bist«, hatte Britta gesagt. Und sie hatte vollkommen recht. Grisu war ein toller Mitbewohner. Er half mir ab und zu sogar bei der Arbeit. Ich schilderte einen Fall, Grisu hörte aufmerksam zu und gab mir einen Rat. Natürlich konnte er nicht sprechen, aber ich kannte ihn lange genug, um zu wissen, was er dachte.
»Friss nicht so schnell! Du bist in letzter Zeit ganz schön auseinandergegangen«, sagte ich.
Grisu hob in Zeitlupe den Kopf von seinem Fressnapf und sah mich durch zusammengekniffene Augen an. »Bitte?«
»Ich meine ja nur. Wenn du sitzt, kannst du deinen Bauch als Fußwärmer benutzen.«
Grisus Augen verengten sich weiter. »Das ist nur das Fell. Recht fluffig.«
Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, sprang er mit einem ebenso eleganten wie kraftvollen Satz auf die Küchenanrichte und stolzierte hinüber. »Fußwärmer? Fußwärmer am Arsch!«
Ich ließ mich nicht auf eine weitere Diskussion ein, sondern ging ins Badezimmer und reinigte das Katzenklo. Anschließend fragte ich mich, warum Katzen immer dann müssen, wenn man gerade sauber gemacht hat. Als ich mich im Wohnzimmer auf die Couch fallen ließ, folgte Grisu. Er sprang zu mir hoch, kuschelte sich an und gähnte herzhaft. Wenige Sekunden später war er eingeschlafen. Wenige Minuten später ich ebenfalls.
Es war bereits dunkel, als ich vom Summen meines Handys geweckt wurde. Auf dem Display erschien das Bild von Kiana, meiner großen Tochter. Wir waren für Freitag zum Abendessen verabredet. Ich freute mich sehr darauf, es war mein Höhepunkt der Woche.
»Hallo, meine Große! Wie geht es dir?«
»Hallo, Papa! Danke, gut. Viel zu tun. Schreibe an einer Hausarbeit über Sartre.« Kiana studierte im dritten Semester Deutsch und Philosophie.
»Das klingt anstrengend«, sagte ich.
»Ja … und deshalb … weißt du, ich wollte Freitagabend arbeiten …« Ich hasste Sartre.
»Papa? Ist das in Ordnung?« Wenigstens hatte Kiana ein schlechtes Gewissen.
»Ja klar! Weißt du doch. Dienst ist Dienst.« Oft genug hatte ich Abende und Wochenenden im Gericht verbracht, als Kiana und Ronja noch klein waren. Ich war der letzte Mensch auf der Welt, der meiner Tochter übel nehmen durfte, dass sie fleißig war. Aber enttäuscht sein durfte ich. Vielleicht fand ich ja noch eine Lösung.
»Was hältst du davon, wenn ich Essen hole und bei dir vorbeikomme. Essen musst du ja schließlich.«
»Das ist so lieb von dir Papa …« Oje, der typisch diplomatische Anfang einer Abfuhr. »Aber Tobi bringt etwas zum Essen für uns mit. Du kennst doch Tobi?« Klar kannte ich Tobias, den »Schöngefönten«, wie ihn Britta immer nannte. So ein Modeltyp. Und Dauerstudent. Hatte schon zwei Studiengänge abgebrochen. Kiana und er hatten nur eine lockere Beziehung. Jedenfalls redete ich mir das immer sehr erfolgreich ein.
»Klar kenne ich Tobi«, sagte ich, so freundlich ich konnte. »Das ist ja lieb, dass er etwas zu essen für euch mitbringt.« Wahrscheinlich holt er zwei Kindermenüs bei den goldenen Bögen. Im Zweifel musst du ihm noch die Kohle vorstrecken, da er sein letztes Geld für Haarwachs ausgegeben hat.
»Hast du was gegen Tobi?«, fragte Kiana. Nein, noch nichts Wirksames.
»Wie kommst du denn darauf?« Ich versuchte, möglichst erstaunt zu klingen.