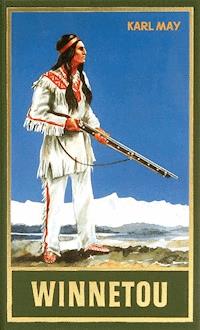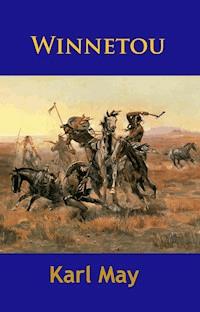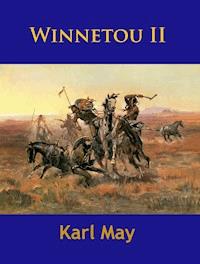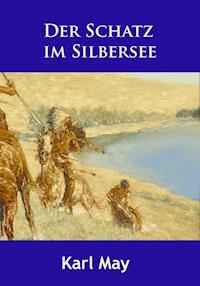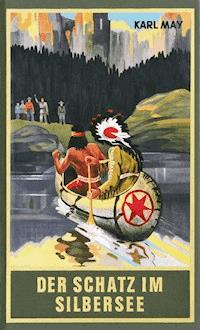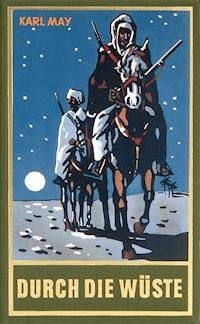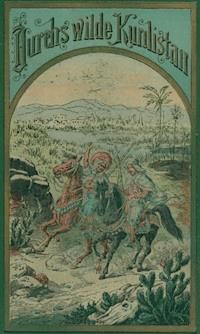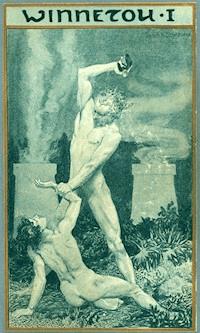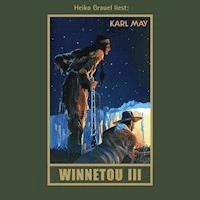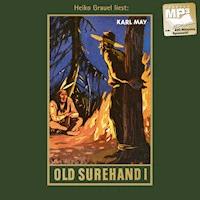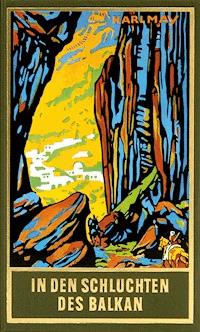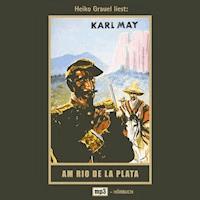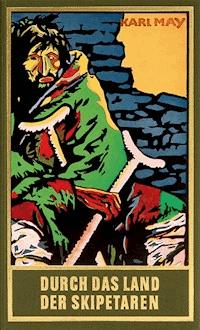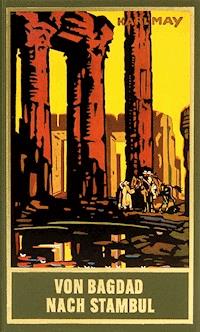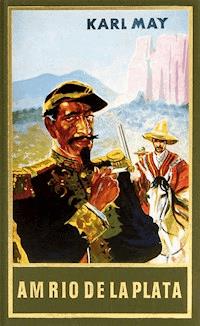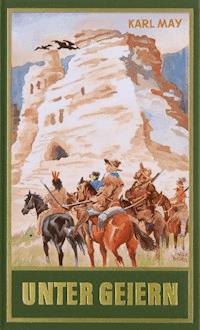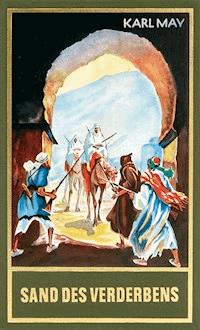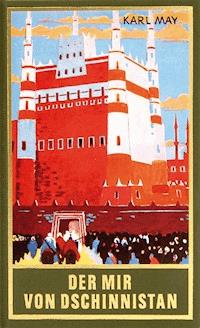Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Karl-May-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karl Mays Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Drei zu Ende des Mittelalters spielende Erzählungen aus Karl Mays frühester Schaffenszeit berichten von der Befriedung der Mark Brandenburg durch Burggraf Friedrich von Nürnberg. Im Mittelpunkt des Geschehens steht sein großer Widersacher, der zwielichtige Raubritter Dietrich von Quitzow. Der Band enthält folgende Erzählungen: 1.) Suteminn, der Einsame 2.) Der Falkenmeister 3.) Wildwasser Die Erzählungen spielen zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Bearbeitung von "Der beiden Quitzows letzte Fahrten".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KARL MAY’s
GESAMMELTE WERKE
BAND 69
RITTER
UND REBELLEN
HISTORISCHE ERZÄHLUNGEN
VON
KARL MAY
Herausgegeben von Roland Schmid
© 1960 Karl-May-Verlag
Die Erzählungen spielen zu Beginn des 15. Jahrhunderts.
Vorwort
Am Beginn von Karl Mays literarischem Schaffen standen vorwiegend kürzere Erzählungen, Novellen und Humoresken, auch Gedichte und zahlreiche Sachtexte. Den ersten umfangreicheren Roman bildete das vorliegende, 1876/77 entstandene Werk, das lange verschollen war und erst Jahre nach Karl Mays Tod in einer alten Zeitschrift aufgefunden wurde.
In seiner Selbstbiografie Mein Leben und Streben[1] erzählt May, wie er im Frühjahr 1875 Redakteur beim Verlag H. G. Münchmeyer wurde. Anfang März zog er nach Dresden und betreute dort das Wochenblatt Der Beobachter an der Elbe, in dem er auch zwei eigene Erzählungen veröffentlichen konnte, das dann aber mit dem gerade laufenden zweiten Jahrgang eingestellt wurde. Dafür gründete May im Herbst 1875 zwei neue Zeitschriften: Schacht und Hütte und Deutsches Familienblatt.[2] In diesem zweiten, nach dem Vorbild der berühmten Gartenlaube konzipierten Wochenblatt brachte er unter dem Reihentitel Aus der Mappe eines Vielgereisten seine ersten beiden Indianergeschichten[3], ferner als durch den ganzen Jahrgang laufenden Hauptroman Fürst und Junker von Friedrich Axmann, eine historische Erzählung aus der Geschichte Brandenburgs.
Dass gerade ein solches Thema gewählt wurde, hatte seinen Grund. Nach der Reichsgründung (1871) war man von offizieller Seite bestrebt, auch außerhalb Preußens die Verehrung für das neue Kaiserhaus, die Hohenzollern, zu fördern. Zahlreiche Romane und Erzählungen hatten Episoden aus der Geschichte der Dynastie zum Thema.
Der Verlag H. G. Münchmeyer mit seinem neuen Redakteur Karl May, stets auf der Suche nach aktuellen Stoffen, beauftragte den in Wien lebenden Schriftsteller Friedrich Axmann (1843-1876), einen Hohenzollern-Roman zu schreiben. Von Axmann waren bereits im zweiten Jahrgang des Beobachters fünf Erzählungen aus dem österreichisch-ungarischen Milieu erschienen. In Schacht und Hütte veröffentlichte May die beiden Axmann-Romane Geheime Gewalten und Ein moderner Abenteurer und im Familienblatt parallel dazu Fürst und Junker. Als Hauptquelle für den geschichtlichen Hintergrund diente das Werk von Karl Friedrich Klöden, Die Mark Brandenburg unter Karl IV. bis zu ihrem ersten hohenzollerschen Regenten oder Die Quitzows und ihre Zeit. Diese vierbändige, erstmals 1837 in Berlin erschienene Mischung aus historischem Sachbuch und Roman war für Axmann die maßgebende Grundlage. Wo keine Dokumente zur Verfügung standen, versuchte Klöden, ein renommierter Historiker und Geograf, durch eigene Fantasie das Gesamtbild abzurunden, und Axmann übernahm ganze Textpassagen wörtlich.
Kurz vor dem Ende des Romans verwies eine Fußnote auf die Fortsetzung, welche Axmann unter dem Titel Dietrichs von Quitzow letzte Fahrten für die neue Münchmeyer-Zeitschrift Feierstunden am häuslichen Herde geplant habe, die Schacht und Hütte ablösen sollte. Während der zweite Jahrgang des Deutschen Familienblatts bereits in Heft 1 mit einem neuen Hohenzollern-Roman aus der Feder Axmanns, nämlich Das Testament des großen Kurfürsten, begann, sollte der Quitzow-Roman in den Feierstunden mit Heft 20 einsetzen. Doch es kam ganz anders. Friedrich Axmann verstarb (im November oder Dezember 1876), war vermutlich vorher bereits krank und am Schreiben gehindert, sodass die Redaktion mit einer Fortsetzung des Quitzow-Romans nicht mehr rechnen konnte. Karl May, als Redakteur mit dem Thema bestens vertraut, sprang in die Bresche, und ab Heft 10 der Feierstunden, also etwa ab Mitte November 1876, erschien Der beiden Quitzows letzte Fahrten.Historischer Roman aus der Jugendzeit des Hauses Hohenzollern.
Auch May stützte sich bei den historischen Fakten stark auf Klödens Darstellung, ging mit dieser Quelle aber anders um als Axmann. Die Verbindung zu Fürst und Junker ist nur lose. Karl May übernahm einige Hauptpersonen, verstand es jedoch auch, die Szenerie mit einer Fülle neuer Gestalten zu bevölkern, von denen viele historisch sind und durch Klöden überliefert wurden. Dazu zählen Suteminn, der ,Einspännig‘ ebenso wie die trink- und raublustigen Ritter vom Kruge, Claus von Quitzow, Heyso von Steinfurth und Werner von Holtzendorff. Von Axmann übernommen wurde natürlich Dietrich von Quitzow, der ‚schwarze Dietrich‘, mit seinen Söhnen Dietz und Kuno (die bisher keine besondere Rolle spielten); sein Leibknecht Dietrich Schwalbe erhielt einen neuen Vornamen, um nicht zusätzliche Verwirrung zu stiften. Der knorrige Kaspar Liebenow gefiel Karl May so gut, dass er sogar Axmanns Beschreibung – die auch auf einen alten Trapper passen würde – übernahm. Freilich wird Liebenow erst bei May eine Gestalt aus Fleisch und Blut, ein Vorgänger jener für Mays Amerika-Romane so charakteristischen Westmänner. Suteminn, der bei Klöden nur eine Episodenrolle spielt, wird von May mit einem Hauch des Geheimnisvollen umgeben und zum Gegenspieler Dietrich von Quitzows gemacht.
Leider führte Karl May seinen historischen Roman nicht zu Ende und so bleibt der gewählte Titel rätselhaft: Von „beiden Quitzows“ tritt nur Dietrich handelnd auf. Der bedeutendere Hans von Quitzow und seine Burg Plaue werden kaum erwähnt. Ab Heft 29, also ab Mitte März 1877, lautet die Verfasser-Angabe „begonnen von Karl May, fortgeführt von Dr. Goldmann“. Hier liegt offenbar der Zeitpunkt der Trennung Mays von Münchmeyer aus den in Mein Leben und Streben genannten Gründen.
Der Schriftsteller Dr. Heinrich Goldmann (1841-1877), in Liegnitz geboren, wohnte während seiner Dresdener Zeit in der unmittelbaren Nähe des Münchmeyer-Verlags. Die im Verlag Adolf Wolf, Dresden, erscheinende Zeitschrift Weltspiegel (ein Blatt, an dem auch Karl May später mitarbeitete) brachte im Herbst 1876 zwei kürzere Erzählungen aus der Feder Goldmanns. Die aus diesen Texten gewonnenen Erkenntnisse über Stilmerkmale Goldmanns lassen vermuten, dass er den Quitzow-Roman erst ab dem 14. Kapitel selbstständig fortgesetzt hat. Das 13. Kapitel mit den für Karl May so typischen Abenteuern um den unterirdischen Schlupfwinkel des ,Feuerreiters‘ (im vorliegenden Band das Kapitel ,In der Wendenburg‘) stammt offensichtlich noch überwiegend von May selbst. Es ist anzunehmen, dass May schon aus Kollegialität seinen Nachfolger eingearbeitet und ihm seine Unterlagen zur Verfügung gestellt hat, darunter auch das Quellenwerk K. F. Klödens.
Dr. Goldmann verstarb, sechsunddreißigjährig, am 9. Mai 1877. Während er den Quitzow-Roman noch beenden konnte, wenn auch das Schlusskapitel große Hast verrät, blieb der von ihm ebenfalls fortgesetzte Axmann-Roman Das Testament des großen Kurfürsten unvollendet. Der Abschluss stammt aus der Feder eines bisher unbekannten Autors und erschien erst nach einer Pause von fünf Heften im Deutschen Familienblatt.
Ritter und Rebellenmuss sich im Wesentlichen auf die von Karl May verfassten Teile des Quitzow-Romans beschränken, was einige Textumstellungen notwendig machte.
Die beiden in sich geschlossenen Erzählungen Der Falkmeister und Wildwasser waren ursprünglich eigene Handlungsfäden. Sicherlich beabsichtigte May, sie später mit der Suteminn-Geschichte zusammenwachsen zu lassen; da Karl May diesen Plan nicht mehr verwirklichen konnte (und Goldmanns Lösung unbefriedigend ist), wurden sie aus dem Haupttext herausgenommen.
Die Vorbereitungen für die Neuausgabe im Rahmen der Gesammelten Werke beruhten zum großen Teil auf der Arbeit von Franz Kandolf. Der Schluss der Suteminn-Geschichte mit dem Ende Dietrichs war von Goldmann, abweichend von der historischen Wahrheit, völlig frei hinzuerfunden worden. Kandolfs Neufassung des Schlussabschnitts lehnt sich dagegen an die bei Klöden geschilderte Version an.
Karl Mays Ritterroman, vom Thema her fernab von allen seinen anderen Werken, ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass er – wie bei Der Alte Dessauer, Benito Juarez, Der sterbende Kaiser oder Der Weg nach Waterloo – vor historischem Hintergrund Gestalten und Ereignisse mit buntem Leben zu füllen verstand.
Suteminn, der Einsame
Nach dem Fall von Friesack
Die Mark Brandenburg atmete auf.
Während der letzten Jahrzehnte hatten in Stadt und Land unhaltbare Zustände geherrscht. Nacheinander im Besitz der Häuser Wittelsbach und Luxemburg, wurde die Mark im Jahre 1388 von König Sigismund, dem späteren Deutschen Kaiser, an seinen Vetter, den Markgrafen Jobst von Mähren, verpfändet. Jobst vermochte der Zerrüttung des Landes keinen Einhalt zu tun, die eine Folge der Angriffe äußerer Feinde und der Übergriffe des einheimischen Adels war. Nach seinem Tod im Jahre 1411 fiel die Mark an Kaiser Sigismund zurück und das mächtigste Adelsgeschlecht der Mark, die Quitzows, gab sich im Stillen der Hoffnung hin, dass nach der langen Fremdherrschaft die Verwaltung des Landes endlich einem bodenständigen Geschlecht – die Quitzows dachten dabei an sich selber – zufallen werde.
Umso größer war ihre und ihrer Anhänger Enttäuschung, als Sigismund 1415 die Hüterschaft des Landes abermals einem Fremden, und zwar dem Burggrafen Friedrich VI. von Nürnberg aus dem Hause Hohenzollern übergab. Der märkische Löwe, Dietrich von Quitzow, schüttelte zornig seine Mähne. Vor einem ,Hergelaufenen‘, vor einem ,Nürnberger Burggräflein‘ sollte er sein stolzes Haupt beugen? Fast der ganze einheimische Adel empfand die Ernennung des neuen Markgrafen als eine Zurücksetzung, während freilich die Städte dem neuen Herrn, dem der Ruf eines tapferen und gerechten Mannes vorausgeeilt war, mit freudiger Erwartung entgegensahen.
Und das hatte seinen Grund. Das Bürgertum in den Städten, die Handelsherren, die Handwerker und die kleinen Leute, verlangten nach einem gesicherten Frieden, um in Ruhe den Pflichten des Alltags und dem geordneten Erwerb nachgehen zu können. Das aber war nicht im Sinn der Adelsgeschlechter. Die Herren von, zu und auf, deren Vorfahren schon vom Genuss ihrer Standesvorrechte, von Krieg und Jagd, von Fron und Zins der unfreien Bauern gelebt hatten, verstanden es nicht, sich in durchaus geregelten Verhältnissen ihr Leben zu zimmern. Und sie wollten das auch nicht lernen. Sie pochten auf ihre ,verbrieften Rechte‘, betrachteten die Arbeit als unwürdige Knechtespflicht und strebten so aus Eigensucht danach, die bestehenden, nur ihnen genehmen Zustände für alle Zukunft unangetastet aufrechtzuerhalten.
Dagegen ging eine neue Zeit an, die mit dem Faustrecht der Herren aufzuräumen gedachte. Dass die Ritter dieser abhold waren, lässt sich denken. Ebenso gewiss aber war es auch, dass Selbstsucht den Gang der Dinge nicht aufzuhalten vermochte. Und so nahmen denn die Ereignisse ihren Lauf und führten, zumal der Burggraf von Zollern wirklich ein ganzer Mann war, schließlich zur Niederwerfung der eigenmächtigen Adelsgeschlechter in der Mark.
Die Quitzows und ihre Freunde schlossen sich zu einem Bündnis gegen den ihnen aufgedrungenen Markgrafen zusammen. Wenn sie es auch zunächst vermieden, ihm offen den Gehorsam zu verweigern, so ließ ihr Treiben doch keinen Zweifel darüber aufkommen, dass sie nicht gesonnen waren, auf ein einziges ihrer ,verbrieften Rechte‘ zu verzichten. Trotz des von Friedrich ausgerufenen Landfriedens setzten sie ihre Fehden lustig fort, am liebsten gegen jene, die sich mit der Neuordnung der Dinge abgefunden hatten und zu dem ,Burggräflein‘ hielten.
So erscheint Dietrich von Quitzow unserer Zeit schlechthin als Schädling und Übeltäter. In Wahrheit aber muss ein Mann wie er aus seiner Zeit heraus beurteilt und verstanden werden. Und es war eine wilde Zeit damals im ,Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation‘, besonders in der Mark Brandenburg. Die Nachbarn blickten begehrlich über die märkischen Grenzen herüber, von Mecklenburg und Pommern, von Polen und Sachsen. Gefürchtete Räuber brandschatzten das Land, unter denen der ,schwarze Dietrich‘ am meisten von sich reden machte. Und der Kaiser war weit! Er hatte mit so vielen Schwierigkeiten im Reich und außerhalb zu kämpfen, dass die Mark bis 1411 sich selbst und Jobst von Mähren überlassen blieb, der zwar ein vergnügter Zecher war, aber nichts zur Befriedung und Beruhigung des Landes beitrug. Kein Wunder, dass ihm die mächtigen Adelsgeschlechter allmählich die Gewalt aus der Hand nahmen, an ihrer Spitze die Quitzows. Von der Besitzergreifung der Macht jedoch bis zu ihrem Missbrauch war es nur ein Schritt. Sie führten ununterbrochen Fehde gegen die Städte, gegen Berlin, gegen Brandenburg, sogar gegen das mächtige Magdeburg. Und lagen sie in Fehde, so war der Kaufmann auf der Landstraße, der Bauer auf dem Felde seines Lebens und Eigentums nicht mehr sicher. Die Quitzows begingen auf Grund ihres ,ehrlichen‘ Fehderechts manche Tat, die wir – Kinder einer anderen Zeit – als nacktes Strauchrittertum bezeichnen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!