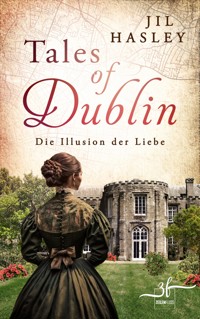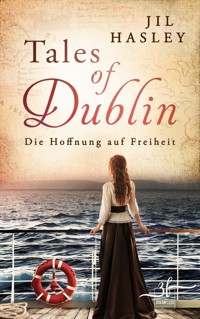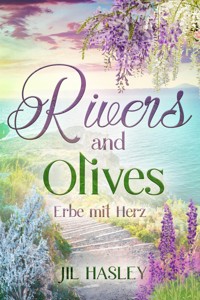
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
River Sanchez kehrt nach vier Jahren in ihre Heimat Neuseeland zurück, da sie die Reittherapie-Station ihres verstorbenen Mentors und ihrer großen Liebe, Professor George Schoska, erbt.
Voller Hingabe errichteten sie einst jene Anlaufstation für Menschen mit Handicap, bis eines Tages Georges lang gehütetes Geheimnis zum treibenden Keil in ihrer Beziehung wurde.
Erst durch seinen plötzlichen Tod holen River die Geschehnisse ein, lassen ihre besondere Liebe Revue passieren und führen ihr vor Augen, dass im Leben nicht alles nur schwarz-weiß ist. Schnell merkt sie, dass ihr dieses millionenschwere Erbe nicht nur Herz abverlangt, sondern auch Vertrauen.
Und dann erscheint auch noch Olive auf der Bildfläche - Georges Tochter, von der nicht einmal er selbst wusste, und die laut Gesetz ebenfalls Erbin seines großen Vermächtnisses ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Rivers & Olives
Erbe mit Herz
Dieses Werk bleibt ungewidmet und darf einfach sein! :) Alle Rechte vorbehalten. Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.BookRix GmbH & Co. KG81371 München1 - Vergiss deine Schlüssel nicht!
"Rob, das kann unmöglich dein Ernst sein. Du schummelst doch."
"Das würdest du mir zutrauen?"
"Auf jeden Fall."
Kopfschüttelnd schmiss ich mein Blatt und nahm einen Schluck aus der halb leeren Rotweinflasche, ehe ich diese weiter reichte. In diesem seit Tagen andauernden Canasta-Marathon am Lagerfeuer gegen Sven und Rob waren Ria, Robs Frau, und ich inzwischen bei einem Rekord von 40.475 Punkten angelangt und führten damit. Deshalb machte ich mir nichts daraus.
Stoisch begann ich, die Miesen zu zählen, genoss die Stille. Lediglich das stetige Knacken des Holzes und das sonore Zirpen der noch wenigen aktiven Zikaden mischte sich in die entspannte Geräuschkulisse.
"Ich denke, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Muss morgen wieder früh aus dem Bett."
Träge erhob sich der auserkorene Schummler, der im Übrigen tatsächlich einfach nur wiederholt Glück gehabt hatte. Er klopfte sich den Staub vom Hintern und streckte seine müden Gliedmaßen.
"Ich komme gleich nach", zwinkerte ihm Ria zu und gab mir die Flasche Wein zurück, nachdem sie ebenfalls einen kräftigen Schluck davon getrunken hatte.
Schon hatte er sich umgedreht und schlurfte davon, als ich ihm hinterherpfiff.
"Hey, vergiss deine Schlüssel nicht."
Stutzend tastete er nach dem Inhalt seiner Hosentasche und merkte erst dann, dass ich ihn schon zum zweiten Mal diese Woche ordentlich verschaukelt hatte. Etwas, das seinen Spielpartner Sven ziemlich zum Lachen brachte.
Schlüssel irgendwo liegen lassen, verlegen oder gar erst nicht wieder finden war nämlich unserer beider Spezialität. Da konnte ich einfach nicht anders.
Gedankenverloren starrten wir drei geraume Zeit in das knisternde Feuer und eliminierten noch die letzten Schlucke Wein. Nachdenklich drückte ich den Flaschenboden immer wieder in den Sand, begutachtete das Muster, das dabei entstand.
Zuhause hätte man sich wahrscheinlich nicht dazu hinreißen lassen, Alkohol aus der Flasche zu trinken. Schon gar nicht zu mehreren aus einer. Hier im Outback war das anders.
Warum war hier alles so viel einfacher und unkomplizierter? Keiner störte sich daran. Und keiner musste danach Weingläser abwaschen. War doch viel besser so, oder nicht?
Das letzte Mal, als ich in meiner Heimat Wein am Lagerfeuer getrunken hatte, war mir das filigrane Glas zerbrochen. Mir kam es vor, als wäre es gestern gewesen.
"So was schaffst auch nur du, River."
Betreten grinste ich und zog eine Schnute, blickte verschmitzt in die Augen meiner Freundin, während das kaputte Weinglas achtlos in der Kühltasche landete.
"Jetzt halte mich doch nicht für so unintelligent und denke, ich hätte damit vergessen, dass du meine Frage noch nicht beantwortet hast."
Manchmal war es schon nicht mehr schön, wie neugierig Gwen sein konnte.
"George und ich ...", hielt ich inne, "haben keine Affäre."
"Nicht?"
"Nein."
"Das sieht aber ganz anders aus."
Das wusste ich selbst. Und das mochte nicht zuletzt daran liegen, dass George und ich häufig zusammen arbeiteten, wodurch eine außerordentlich harmonische Einheit daraus erwachsen war. Ich verbrachte jede freie Minute auf der Einrichtung und lernte meist dort für die anstehenden Klausuren.
Vor rund einem halben Jahr hatte er seine Basisstation endlich mit Unterstützung von Charitégeldern eröffnen können und gab ihr den Namen "Primam Gratiam".
Erste Gnade oder Gnade zuerst, wie er zu betonen pflegte.
Die Institution sollte Menschen mit angeborener oder entstandener Behinderung eine Anlaufstelle bieten. Das Seelenheil, welches Pferde einem zurückgeben konnten, war mit kaum etwas aufzuwiegen. Nach langen Forschungen, Entwicklungen, Anträgen und Nervenkriegen ging sein lang ersehnter Traum einer Therapie-Station endlich in Erfüllung.
Umso überraschter war ich, als er ziemlich unmittelbar nach Genehmigung des Projekts auf mich zukam und mir eine Anstellung und weiterführende Ausbildung anbot. Der Zeitpunkt hätte nicht günstiger sein können, war ich schließlich gerade im letzten Jahr meines Psychologiestudiums und kurz davor, meine Masterarbeit zu schreiben.
"Wir führen keine Affäre. Ich bestehe darauf, dass du dieses Wort nicht in Zusammenhang mit mir in einem Satz bringst."
Abwartend zog meine Freundin die Augenbrauen hoch.
"Aber wir sind uns näher gekommen, das bestreite ich nicht mehr."
"Meine Güte, wusste ich's doch."
"Jetzt halt doch den Rand, Gwen. Posaun's doch gleich in der Weltgeschichte herum."
"Wie näher? Nun erzähl schon."
Entnervt stieß ich den Atem aus und lehnte mich an das Mauerwerk hinter mir, beobachtete die Glut des Lagerfeuers und die Menschen um uns herum, die allesamt in tiefe Gespräche verwickelt zu sein schienen.
"Da gibt es nichts zu erzählen."
"Natürlich nicht."
Das war der Zeitpunkt, an dem ich am liebsten aufgestanden und gegangen wäre. Aber Gwen zuliebe blieb ich. Ich kannte sie schon so lange.
"Wir haben uns geküsst."
Das war nun über sieben Jahre her. Und jetzt noch versetzten mir diese Erinnerungen Stiche in der Brust.
Ja. Er hatte mich geküsst.
Und er war 19 Jahre älter als ich.
Und er war mein Professor in Psychologie, ganze fünf Jahre lang, ehe er zu meinem Mentor und Ausbilder geworden war. Und noch viel mehr.
Bis er alles zerstört hatte ...
"Was meinst du? Gehen wir auch ins Bett?", riss mich Ria irgendwann abrupt aus den dunklen Gedanken.
"Eine gute Idee."
Schwerfällig kam ich auf die Beine, spürte ein klein wenig den Alkohol in meinem Kopf und freute mich darüber, dass ich keine Gelegenheit mehr hatte, in alten Erinnerungen zu versumpfen. Jetzt musste ich zusehen, dass ich es aufrecht ins Haupthaus schaffte.
Gerade einmal fünf Minuten lag ich im Bett, tauchten eben jene Bilder wieder in meinem Kopf auf. Schreckliche Momentaufnahmen, die sich tief in meinem Hirn festgesetzt hatten.
George war mein Seelenverwandter. Mein Mensch. Zumindest dachte ich das immer. Und irgendwie auch immer noch.
Er war ein so durch und durch intelligenter Mann. Als ich ihn in meinem ersten Semester kennengelernt hatte, war mir, als wünschte ich ihm die Pest an den Hals. Er quälte seine Studenten regelrecht, trieb sie mental ans Äußerste.
Erst als ich begriff, dass es seine Methode war, die Spreu vom Weizen zu trennen, die Jackpots von den Nieten, in seinen Worten, begann ich allmählich ihm gegenüber Sympathie zu entwickeln. Denn ich war ein Jackpot.
Ich sah ihn vor mir. Professor George Schoska. Mit seinem dunkelbraunen bis beginnend gräulichen Haar, das sich durch den Seitenscheitel leicht wellte. Seine blaugrünen Augen, die sich beim Lachen zu kleinen Dreiecken formten. Der Dreitagebart, die Falten um die Mundwinkel, die sich bei dem üblich wissenden Lächeln bildeten.
Er galt auf dem Campus als optisch charismatisch, nicht aber im Herzen. Nachdem ich mir mein Bild schon immer selbst gemacht hatte, befand ich, dass sie alle falsch lagen. Dass sie ihn schlichtweg nur nicht kannten. Hielt sie allesamt für Schwätzer. Da studierten sie Psychologie und ließen sich doch so leicht täuschen.
Schlussendlich schien es allerdings, als wäre ich wohl die Einzige gewesen, die falsch gelegen hat.
"Miss Sanchez, bitte bleiben Sie noch einen Moment."
Verwundert sammelte ich meine Unterlagen zusammen und klemmte sie unter den Arm, während die Stifte in der großen, kakifarbenen Umhängetasche versanken und ich die Stufen des Hörsaals hinunter schlenderte, bis ich vor dem Pult des Professors zum Stehen kam.
"Diese Unterlagen haben Sie unvollständig ausgefüllt zurückgereicht. Ich nehme an, dass es sich hierbei um ein Versehen handelt?!"
Er formulierte sich fragend und gleichzeitig feststellend.
"Selbstverständlich, Professor."
Wie konnte mir das passieren? Ausgerechnet die Anmeldung zum zweiten Semester!
"Ich werde sie baldmöglichst komplettiert nachreichen."
"Davon gehe ich aus", verengten sich seine Augen, während die Hände einen Stift festhielten.
"Ist sonst noch etwas?"
Leicht irritiert wartete ich auf eine Entlassung.
"Mir ist aufgefallen, dass Sie in meinen letzten Vorlesungen unausgeruht waren. Ihre Beteiligung lässt zu wünschen übrig und wenn vorhanden, dann ist sie völlig daneben."
Okay ... Ein Blatt nahm er wirklich nicht vor den Mund.
"Ich weiß, tut mir leid. Ich gelobe Besserung."
"Tun Sie sich den Gefallen, Miss Sanchez. Es liegt in Ihrem eigenen Interesse. Ich habe bisher große Stücke auf Sie gehalten. Machen Sie mir keine Schande."
"Werde ich nicht."
Irgendwie war diese Unterhaltung nicht sonderlich erbauend. Ich wollte mich gerade zum Gehen abwenden.
"Ich habe Sie nämlich als Stipendiatin vorgeschlagen."
Überrumpelt blieb ich wie angewurzelt stehen und drehte mich wieder um.
"Sie haben mich vorgeschlagen?"
Ein leichtes Schmunzeln lag auf seinen Lippen.
"Das habe ich."
"Das überrascht mich. Sie sagten doch soeben selbst, meine Leistungen liegen im Keller."
"So ist es auch. Aber ob sie mir nun glauben oder nicht. Ich arbeite schon seit einigen Jahren an dieser Uni, sehe Studenten kommen und gehen, scheitern und wachsen. Irgendwann gewinnt man einen Blick dafür, wer es schafft. Wer sich durchkämpft. Wer das Zeug dazu hat."
"Und das sehen Sie bei mir?"
"Durchaus."
"Wirklich?"
"Zweifelsfrei."
Nun war es an mir, skeptisch dreinzublicken, was er natürlich erfasste.
"Die Gründe kann ich Ihnen gerne bei Gelegenheit erläutern. Jetzt muss ich aber weiter. Und Sie auch."
Wie oft dachte ich an diesen Tag zurück. Mit diesem Stipendium hatte er mir Tür und Tor geöffnet. Es ermöglichte mir, mich voll und ganz auf meine Klausuren und Prüfungen zu konzentrieren und meine beiden Hilfsjobs zu kündigen. Von da an ging es im Grunde stetig bergauf für mich.
Diese Tatsache rief immer wieder ambivalente Gefühle in mir hoch. Grenzenlose Dankbarkeit in der einen Minute. Und in der nächsten wiederum diese Wut, weil schließlich wegen ihm Jahre später alles anders kam, als erhofft.
2 - Gelähmt
Dieser Moment, der in mir alles zum Erstarren brachte. Ich würde das niemals vergessen.
Immer und immer und immer wieder spielten sich die Szenen vor meinem inneren Auge ab.
Der Klingelton meines Smartphones. Die Stimme von Gwen. Gwen aus meiner Heimat.
Und sie teilte mir mit, dass er tot war.
Mein Herz zerbarst.
Eine schwarze Lücke zierte mein Gedächtnis. Ein kleines Zeitfenster nach diesem Anruf war einfach nicht existent. Ich konnte mich schlichtweg nicht daran erinnern. Ria erklärte mir, dass ich unter Schock gestanden hatte.
Und seitdem spürte ich dieses Nichts. Nur Leere.
"River. Süße, dein Gate wurde geöffnet. Du musst los."
Behutsam zog Ria mich an den Armen hoch und suchte Blickkontakt. Doch ich sah irgendwie an ihr vorbei, nahm kaum etwas wahr, ließ mich stoisch durch den Tumult schieben und gehorchte schließlich, als sie mich aufforderte, meine Tasche zu schultern.
Tränen liefen ihr über das Gesicht. Mitfühlend küsste sie meine Schläfe.
Warum konnte sie weinen und ich nicht? Das war doch unfair. Und paradox noch gleich dazu.
Ich sagte nichts und nickte lediglich auf ihre Frage, ob ich okay sei.
Was sollte ich darauf denn schon sagen?
Klar. Alles prima.
Teilnahmslos blickte ich durch die große Glasfront auf die Gangway, die mir gleich den Weg in das kleine Flugzeug ermöglichen würde.
"Ria, komm schon. Wir haben keine Zeit mehr. Die anderen warten schon."
Eilig nahm ich den Sattel von dem verschwitzten Pferdekörper und legte ihn über den Bock zum Auslüften.
Diese Überraschungsfeier hatten wir seit Tagen ausgiebig geplant. Es wäre eine Schande, würden wir zu spät erscheinen.
Yann hatte seine Reha erfolgreich überstanden. So erfolgreich man eben aus einer Rekonvaleszenz nach einem zweifachen Überschlagen im alten Pick-up des Onkels hervorgehen konnte. Er hatte das Gefühl in seinen Beinen nicht wieder erlangt. Doch ich zog den Hut vor ihm. Die eigentliche Genesung galt seinem tiefen Innern. Und nun machte er uns an Lebensmut beinahe allen etwas vor.
Ich hatte bis dato keinen Menschen kennengelernt, der so tapfer mit einer so vernichtenden Veränderung umgegangen war.
Als wäre es nicht schon stressig genug (duschen wollte ich ja immerhin auch noch), klingelte mein Smartphone.
Gwen.
Es war nur ein Bruchteil einer Sekunde, in dem ich überlegte, den Anruf wegzudrücken. Und ich tat es.
Doch es klingelte erneut.
Und dann wusste ich, dass etwas nicht stimmte.
Hastig kramte ich das Teil erneut aus meiner Brusttasche und nahm ab.
"Gwen?"
"River? Du musst nach Hause kommen."
Ihre Stimme war gebrochen, ja fast röchelnd.
"Er ist tot, River."
Herzzerreißend schluchzte sie in den Hörer.
"Wer Gwen? Wer ist tot?"
Ich spürte, wie Adrenalin meinen gesamten Körper durchströmte. Meine Finger waren kaum noch fähig, das Phone festzuhalten.
"George ..."
Nach Luft schnappend schreckte ich aus dem Schlaf, fuhr mir mit beiden Händen übers Gesicht und hatte daraufhin nasse Finger. Meine Augen fühlten sich geschwollen an.
Ich griff nach einer Wasserflasche und trank den halben Liter am Stück aus, blickte aus dem Fenster und reagierte nicht auf die Frage meines Sitznachbarn, ob mir etwas fehle.
Sanfte Sonnenstrahlen schoben sich zwischen die Wolken. Ließen es so aussehen, als würde das Flugzeug auf einem goldenen Teppich getragen.
So klar, wie diese Reflexion vor meinen Augen, verstand ich unerwartet heftig für einen winzig kleinen Moment, was geschehen war. Schaffte es kurz - und damit meinte ich wirklich kurz - die Realität zu begreifen.
George war tot. Er war weg.
Tränen bahnten sich ihren Weg nach draußen, ehe ich mich auch schon wieder fragte, aus welchem Grund ich eigentlich nun weinte. Und was das alles überhaupt sollte. Warum saß ich in diesem Flieger?
Klar, der Verstand erklärte mir, dass ich einen Anruf erhalten hatte. Dass mein ehemaliger Mentor George nicht mehr am Leben sei. Und dass ich nun auf dem Weg nach Hause in einem Flugzeug saß, um der Beerdigung beizuwohnen.
Schon klar.
Lächerlich.
Alles doch irgendwie nicht ganz wahr, oder?
"Miss Sanchez?"
Bildete ich mir das nur ein oder hielt er mich in letzter Zeit häufiger als andere nach den Lesungen auf? Was hatte er wohl wieder auszusetzen? Ich war ihm ja wirklich äußerst dankbar, dass er mich für ein Stipendium in die engere Auswahl katapultiert hatte. Wenn ständige Nörgeleien jedoch der Preis dafür waren, hätte ich doch lieber verzichtet. Nein. Eigentlich nicht.
Stoisch ließ ich die Bücher sorgfältig in der Tasche verschwinden und fand mich gefühlt in einem Déjà-vu wieder. Im Augenwinkel nahm ich wahr, wie auch er seine Utensilien in der cognacfarbenen Ledertasche verstaute und sich mit Daumen und Zeigefinger in den Hals kniff. Es war ein Tick, wie ich feststellte. Er tat das häufig. Genauso wie das immer wiederholende 'Bleistiftspitze-aufs-Pult-sausen-lassen', wenn er in das Korrigieren von Arbeiten vertieft war.
Aus meinen Überlegungen zurückgekehrt und doch nicht völlig abwesend gewesen, erkannte ich, dass er wusste, um was oder wen sich meine Gedanken drehten. Im Saal wurde es still und das Knallen der Tür hallte nach.
"Sie analysieren fleißig, wie ich feststellen kann?"
Wortlos trat ich vor ihn und wartete auf Weiteres.
"Und? Etwas herausgefunden?" Auffordernd zog er eine Augenbraue hoch und malträtierte innerlich seine Unterlippe.
"Ist das wichtig? Haben Sie mich deshalb aufgehalten?"
War ich nun genervt oder verunsichert?
"Beantworten Sie einfach meine Frage. Sie studieren doch Psychologie. Also muss Ihnen sicher etwas aufgefallen sein."
"Ihre Vorlesung ist doch bereits um. Bin ich denn dazu verpflichtet, Ihnen außerhalb der Vorlesungszeiten Rede und Antwort zu stehen?"
"Können wir gerne klären, wenn Sie das für nötig halten."
Worauf wollte er hinaus?
"Warum?" Machte er sich damit nicht etwas lächerlich? "Ich meine, warum spielen Sie dieses Spiel?"
"Sagen Sie es mir, Miss Sanchez. Sie sind hier die Studentin. Welche Motive stecken dahinter?"
Verblüfft stutzte ich. Damit hatte ich nun tatsächlich nicht gerechnet. Hin- und hergerissen zwischen dem Gedanken, mich auf so eine absurde Konversation nicht weiter einzulassen und dem Drang, ernsthaft eine Antwort auf seine Frage zu suchen (allmählich begann diese Unterhaltung nämlich Spaß zu machen, auch wenn ich es niemals zugeben würde), begann ich, an dem Verschluss meines Lederarmbandes zu spielen.
Verachtend stieß ich den Atem aus und wandte mich zum Gehen in dem festen Wissen, dass er nicht schweigen würde.
"Sie wissen es also nicht."
Ohne mich umzudrehen, ging ich knapp auf seine Erwiderung ein, womit ich schon halb verloren hatte.
"Und Sie wissen, dass das Schwachsinn ist. Ich weiß es. Aber Ihre Spielchen sind mir zu krank."
"Sie haben sich einen kranken Beruf ausgesucht, Miss Sanchez. Die Irrationalität, Widersprüchlichkeit und der Wahnsinn werden Ihnen darin immer wieder begegnen. Und da schreckt Sie eine Unterhaltung wie diese schon ab?"
Ich wusste, dass es ein Wettkampf war. Und dass ich ihn verlor in jenem Moment, als ich mich doch noch umdrehte.
"Sie tun es schon wieder."
"Ich weiß."
"Finden Sie es ethisch vertretbar, Menschen gegen ihren Willen zu manipulieren oder derart zu provozieren? Ist es nicht Ihr Job, Menschenseelen mit sich selbst in Einklang zu bringen, anstatt sie gegen sich selbst aufzuhetzen?"
"Nein. Nicht hier. Hier ist es mein Job, das Ihnen beizubringen. Der beste Weg, das zu tun, liegt darin, Sie mit allen Persönlichkeitstendenzen und Denkweisen vertraut zu machen."
"Das Ganze ist also Teil Ihres Unterrichts. Und was sagt der Stab dazu? Ist das legitim? Fließen Ihre Eindrücke in die Benotung mit ein? Und hat das nicht etwa was mit Bevorzugung zu tun?"
"Nein, aber sie beeinflussen wohl meinen Fokus auf den Einzelnen. Ich konzentriere mich vorrangig auf die Studenten, die die Gabe für diese Arbeit in sich haben. Zu viele werden stupide durch die Semester geschleift und dann auf die Welt losgelassen. Zu viele Seelenkranke suchen Zuflucht bei ihnen und müssen bitter enttäuscht feststellen, dass ihnen dort auch nicht geholfen wird."
Jetzt wusste ich nicht mehr, ob ich fasziniert oder entsetzt sein sollte.
"Das ist echt krank."
3 - Zum ersten Mal ...
„Wie gesagt. Ich bin okay, Ria. Jetzt mach dir nicht zu viele Sorgen.“
„Sagt sich so leicht“, grummelte sie in den Hörer.
„Ich muss Schluss machen, hörst du? Die anderen warten auf mich.“
„Melde dich.“
Ich hörte deutlich den Befehl dahinter.
„Natürlich.“
Wie in Zeitlupe beendete ich das Telefonat und betrachtete die Person vor mir ein weiteres Mal im Spiegel. Mein braun blondes Haar war zu einem strengen Dutt geknotet. Keine Strähne verirrte sich da raus. Meine Augen waren mit einem zarten Lidstrich versehen. Ein dezenter roséfarbener Lippenstift untermalte die schmalen Lippen.
Ich brachte sie zu einem zarten Lächeln. Woher diese Ruhe in mir so unerwartet herrührte, wusste ich nicht. War das auch so etwas wie Schockzustand? Nein. Ich vermutete nicht.
Gwen klopfte an der Tür und trat ein. Ich war bei ihr in Akaroa untergekommen. In diesem Gästezimmer hatte ich schon einige Male gewohnt.
„Wir wären dann soweit, River.“
„Ich auch. Komme sofort.“
Eine Stunde später standen wir um ein kleines Erdloch versammelt. Beerdigung durch Verbrennung. Anonyme Bestattung nannte sich das hier. Wir hatten nie darüber gesprochen. George und ich. Irgendwie hatte ich mehr mit einer Seebestattung gerechnet. Aber vielleicht kannte ich ihn doch nicht so gut. Oder er hatte selbst nicht so schnell mit seinem Ableben gerechnet.
Ich registrierte seine Mutter. Und auch seinen Vater. Beide hatten ihren Sohn überdauert. Es war nicht gerecht. Sie waren offenbar aus Polen angereist. Das Alter hatte seine Spuren hinterlassen. Ich habe sie vor vielen Jahren einmal kennengelernt, als ich mit George seine Heimat besucht hatte.
Ich hörte nicht wirklich zu, was gesagt wurde. Und sah auch nicht wirklich hin, als seine Urne im Boden verschwand und mit Erde überdeckt wurde. Das Ganze hatte doch gar nichts mehr mit ihm zu tun. Es war Staub, zersetzt vom Feuer. Diese Stelle hatte nicht er sich ausgesucht.
Wirklich zu dumm. Wirklich. Einfach nur bescheuert. Und das ausgerechnet heute.
Manchmal hasste ich mich für meine Schusseligkeit. Eine geschlagene Stunde saß ich schon vor dem Gebäudekomplex unweit der Universität, wo ich derzeit wohnte, und wartete auf meine Mitbewohnerin. Gwen saß noch mitten in der Vorlesung. Das mit den Schlüsseln war schon immer so eine Sache.
Mich damit abfindend, lehnte ich den Kopf gegen das Treppengeländer, auf dessen Stufen ich saß. Wenigstens regnete es nicht. Die Sonne strahlte durch die Steinbuchen, die die Straße säumten. Menschen liefen an mir vorbei. Manche geschäftig, andere in Gespräche vertieft. Verbitterten Ausdrucks, gut gelaunt. Alles war dabei.
Erst als ich einen von diesen erkannte, schwand meine Gelassenheit dahin. Was machte er denn hier?
„Professor Schoska“, grüßte ich reserviert.
„Miss Sanchez.“
Er nickte lediglich höflich und machte keine Anstalten, anzuhalten, während der Kumpel im Rollstuhl neben ihm seine Augen zwischen uns hin und her wandern ließ und – wie sollte es anders sein – die Bremse reinhaute.
„Guten Tag, Miss Sanchez. Ich bin Igor. Verzeihen Sie die schlechten Manieren meines Bruders.“
Er dirigierte seinen fahrbaren Untersatz auf mich zu, hielt mir grinsend seine Hand entgegen.
Bruder also.
„Hi Igor. Freut mich. Und keine Sorge, das gehört zur Ausbildungsstrategie Ihres Bruders. Nichts Außergewöhnliches.“
„So? Die solltest du schleunigst überdenken, Giggs.“
Amüsiert hielt ich ganz gewollt ein Schmunzeln nicht zurück.
Sehr cool. Professor Giggs. Ja, das gefiel mir.
„Und warum sitzen Sie so nicht abgeholt hier herum?“
Neugierig war das Brüderchen ja nicht.
„Ich wohne hier und hab meine Schlüssel vergessen.“
„Passiert.“
Belustigt grinste ich.
„Also. Begleiten Sie uns? Wir wollten ein Eis essen gehen.“
Aufgeschlossen und geduldig waren Igors Augen auf mich gerichtet. Sie ähnelten denen seines Bruders, in die ich als Nächstes sah. Es war wohl das erste Mal, dass sein Erscheinungsbild keine Herausforderung spiegelte. Keine Provokation, keine Erwartung. Nicht das Gefühl in mir auslöste, mich in Verteidigungsposition zu bringen.
Nur deshalb zog ich ernsthaft in Betracht, das Angebot anzunehmen. Was ich schließlich auch tat.
Igor hatte ein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis. Und im Gegensatz zu seinem Bruder absolut keine Tendenz, Menschen zu analysieren. Und es war wirklich erholsam, sich einmal nicht mit derart komplexen Dingen auseinandersetzen zu müssen. Die gesamte Konversation war so belanglos wie kaum eine andere in den letzten Wochen meines Lebens.
Wie schön. Vielleicht sollte ich öfter mit Igor Eis essen gehen. Und wenn sein Giggs sich auch so still verhielt, wie er es die letzten 45 Minuten getan hatte, konnte er auch gerne mitkommen. Beinahe durfte man ihn als angenehme Gesellschaft bezeichnen.
„Igor, bitte nicht. Die Story hast du doch schon Dutzende Male erzählt“, war der erste Satz, den er nach dieser knappen Stunde von sich gab.
„Dann will ich sie unbedingt hören“, hielt ich dagegen und funkelte den Professor verschmitzt an.
Ungläubig wanderten seine Augen zu mir, während er seine Lippen befeuchtete.
„Siehst du, Giggs. Jeder will sie hören. Also ...“
Allmählich bahnten sich die Schuldgefühle ihren Weg. Die unerträgliche Erkenntnis, dass ich mein Leben mit George unter Umständen zu leichtfertig aufgegeben hatte. Ihm keine weitere Chance gegeben hatte. Trotz des großen Vertrauensbruchs.
Ich erinnerte mich daran, als wäre es gestern gewesen. Meine wochen-, ja monatelangen inneren Kämpfe, wie mein Leben weitergehen sollte. Kehrte ich zu ihm zurück oder ließ ich es? So lange hatte ich mit mir gehadert, meine Entscheidungen immer wieder hinterfragt, bis ich schlussendlich einen Psychologen aufsuchte.
Nicht die beste Idee, wie sich im Nachhinein herausstellte. Wenn man erst einmal selbst Psychologie studiert hatte, analysierte man in einer Sitzung lediglich das Vorgehen des Kollegen.
Also ließ ich es wieder und focht meine Kriege weiter mit mir selbst aus. Wären Gwen und Hannah in der Zeit nicht gewesen, wüsste ich nicht, wo ich heute wäre. Sie hatten so viel Geduld mit mir gehabt. So viel Verständnis. Und mir hin und wieder auch zu verstehen gegeben, dass es keinen Zweck hatte, x-fach durchdachte Entscheidungen erneut zu durchzuexerzieren.
Es war ein so langer Weg. Eine Zeit, die ich nie wieder erleben wollte. Mein ganzes Leben schien vollkommen aus den Fugen geraten zu sein.
Wer war ich eigentlich?
Wer war River Sanchez?
Das Leben mit George hatte mich sehr verändert. Und auch die Trennung von ihm hatte mich zu einem anderen Menschen gemacht. Das Erlebte hinterließ tiefe Narben. Das Bild, das man von anderen hatte, begann ins Wanken zu geraten. Vertrauen gegenüber allen in meiner Umgebung wurde zum Problem. Ohne Anhaltspunkte. Ohne Grund. Einfach aus dem Nichts begann ich jedem zu misstrauen, jeden zu hinterfragen.
Und ich verstand zum ersten Mal, wie abgrundtief ein Vertrauensbruch einen Menschen niederreißen konnte.
Wozu weiter machen?
Ergab das Leben Sinn ohne diesen oder jenen Menschen an deiner Seite?
Hatte es Sinn, erneut Vertrauensvorschuss zu bieten, wenn man damit sowieso wieder auf der Nase landen würde?
War es von Nutzen, sich mit aller Kraft aus einem Loch zu ziehen, in das man doch wieder hineinfiel?
Für eine Zeit lang dachte ich: Nein. Machte es nicht.
Und nun saß ich hier. Knappe vier Jahre später. Und er war an einem Aneurysma gestorben. Einer Hirnblutung. So unscheinbar und unvorhergesehen. Er hatte einfach in seinem Bett gelegen und war nicht mehr aufgewacht.
Warum?
Es war so unnötig.
DAS ergab keinen Sinn. Wirklich nicht!
Ich wusste, dass es irgendwann später, vielleicht in ein paar Wochen, eine Phase geben würde, in der ich unfassbar wütend sein würde. Darüber, dass ich zurückgeblieben war. Dass mir das Los zuteilwurde, das hier zu ertragen.
Ich fühlte mich jetzt schon irgendwie verhöhnt.
Wofür sich die Mühe machen, ein liebenswerter Mensch zu sein? Es lohnte sich ja ohnehin nicht. Es wurde einem ja doch nicht gedankt.
Klar war das irrational. Und das wusste ich.
Und wie so oft im Leben gab es auch hier ein erstes Mal. Das erste Mal, dass ich die Denkvorgänge vieler Patienten verstand. Diese Empfindungen, die einen fest im Griff hatten, einem kaum eine Wahl ließen, als zu verbittern. Einem sogar den Wunsch raubten, etwas an diesem Denkmuster zu ändern. Nein. Man ergötzte sich beinahe daran.
Es gab einem – endlich – den legitimen Grund einfach aufzugeben.
Zu kapitulieren.
Aber so einfach war es leider nicht.
4 - Ich ... im Cello
Um ehrlich zu sein, hatte ich absolut keine Lust auf diese Testamentseröffnung. Zum einen wollte ich gar nicht wissen, was mir dabei eröffnet wurde. Und zum anderen wollte ich heute einfach niemanden sehen und hören, wollte mich einfach in meine Decke knüllen, sie über die Nasenspitze ziehen und mir einen dramatischen Tragödienfilm nach dem anderen reinziehen, um diesen dann die Schuld an meinen Tränen zu geben.
Stattdessen stand ich seit einer geschlagenen halben Stunde unter der Dusche und ließ mich von dem heißen Regen berieseln. Wusch mein verquollenes Gesicht, das inzwischen wieder gelernt hatte, zu weinen, und zählte die Minuten rückwärts, weil ich wusste, dass mir nicht mehr viel Zeit blieb.
Gwen saß geduldig in der Küche und studierte die Papiere und Unterlagen, die sich seit seinem Tod auf der Therapiestation angesammelt hatten und die sie schließlich zur Bearbeitung mit nach Hause genommen hatte.
Mir schwante Unerträgliches.
Ich hatte fürchterliche Angst vor dem, was mir der Notar in weniger als einer Stunde preisgeben würde.
Mit welchem Ballast, welcher Verantwortung, welchen Überraschungen würde ich den Raum wohl wieder verlassen? Es wäre für mich sicher nicht so schlimm gewesen, hätten George und ich vor vielen Jahren nicht über ein Testament gesprochen und darüber, was er dort festhalten lassen würde, sollte er jemals ein eigenes Testament schreiben.
Und eben dieses Wissen darum machte mich so nervös.
Denn nun gab es tatsächlich ein Testament.
Und dass ich geladen war, bedeutete, dass er mir etwas vermacht hatte.
So ein Mist.
Ich wollte die Therapieeinrichtung nicht. Nicht mehr.
Nicht allein. Nicht ohne ihn.
Gar nicht.
Bitte, bitte, bitte lass es nicht die Einrichtung sein. Lass es nicht das Primam Gratiam sein. Das waren meine Gedanken.
Denn diese Entscheidung hatte er damals getroffen.
Ich war seine Auserkorene, die sein Vermächtnis erhalten sollte, wäre er jemals der Erste, der ging.
„Denkst du über den Tod nach, Mr. Schoska?“
Sehr undeutlich kam Liam die Frage aufgrund seiner spastischen Lähmungen über die Lippen.
„Nicht sehr häufig, nein. Du etwa?“
Stoisch legte George dem gescheckten Wallach den Longiergurt auf den Rücken und schloss den Bauchgurt behutsam. Der Wallach litt wegen seines Vorbesitzers etwas unter Sattelzwang.
„Schon. Ich glaube, sterben ist nicht so schlimm wie viele denken.“
Jetzt wurde George aufmerksam und ging in die Hocke, um mit seinem Gegenüber auf Augenhöhe zu sein.
„Wie meinst du das? Du denkst doch nicht etwa daran, dem Tod in deinem Leben auf die Sprünge zu helfen?“
„Nein, meistens nicht“, schlug Liams rechter Arm etwas aus, was immer dann passierte, wenn er nervös war.
Forschend suchten meine Augen die meines Mentors. Dessen Blick traf meinen. Die leichte Bewegung seiner Augenbrauen verriet mir, dass die Aussage des 15-jährigen Jungen nicht unterschätzt werden durfte.
„Was heißt meistens nicht? Erklär mir das, ja?“
„Ein anderes Mal“, wackelte Liams Kopf leicht unkontrolliert, weil er lachte.