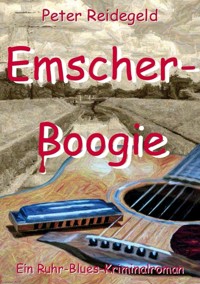Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Elvis ist verschwunden" Mit diesen Worten erhält Freddy Spieker, Blues-Musiker und Detektiv aus dem Ruhrgebiet, den Auftrag, den vermissten Straßensänger wiederzufinden. Bei seinen Recherchen glaubt er, auf ein großes Geheimnis zu stoßen. Aber die eigentliche Frage ist: Warum entführt man einen Obdachlosen? Freddys Bluesband fährt nach Bad Nauheim, wo Elvis früher einmal gewohnt hat, um das Rätsel zu lösen. Freddy Spiekers dritter Fall. l
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rock´n´Roll am Rhein-Herne-Kanal
von Peter Reidegeld
Ruhrkrimi-Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2023 Peter Reidegeld
© 2023 Ruhrkrimi-Verlag, Mülheim an der Ruhr
Coverbild: © Peter Reidegeld 2023
ISBN 978-3-947848-81-2
Auch als eBook erhältlich.
1. Auflage (Originalausgabe)
Disclaimer:
Alle Personen und Namen innerhalb dieses Buches sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
Die Verwendung von Text und Grafik ist auch auszugsweise ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.
https:/ruhrkrimi.de
Foto: Beate Krüger
Der Autor im Gespräch mit dem Bronze-Elvis in Bad Nauheim.
Peter Reidegeld wurde gezeugt, wenige Tage, bevor Elvis Presley Deutschland für immer verließ. In der Folgezeit widmete sich der gebürtige Gel-senkirchener und jetzige Bochumer neben seiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst ebenfalls der Musik, vor allem dem Blues. Und hier dem Gesang und dem Mundharmonikaspiel. Seine Erfahrungen als Musiker hat er in seinem mittlerweile dritten »Ruhr-Blues«-Roman als Krimi verarbeitet.
The Blues had a baby
And they named it Rock’n’Roll.
Muddy Waters
Seine Mutter und die Hebamme hörten es zuerst.
Diese unbändige Kraft in seiner Stimme,
kurz nachdem sich die kleinen Lungen
zum ersten Mal mit Luft gefüllt hatten.
Es war der Schock, den warmen Mutterleib
verlassen zu müssen und in eine kalte,
unberechenbare Welt geworfen zu werden.
Eine Kraft, die er der Musik schenkte,
die der Lebenslust in ihrer bis
dahin wildesten Form Raum verschaffte
und alte Konventionen hinwegfegte,
dem Rock’n’Roll.
1
Das Erste, was ihm auffiel, war, dass es ungewöhnlich leise war. Sehr leise. Er konnte nur seinen eigenen, rasselnden Atem hören.
Er war es gewohnt, dass er vom Motorengeräusch vorbeifahrender Autos geweckt wurde. Unter der viel befahrenen Brücke nahe des Bochumer Hauptbahnhofs verstärkte sich der Lärm der Fahrzeuge dadurch, dass er von den Wänden zurückgeworfen wurde und in seine Ohren drang. Sein Gehör war zwar im Laufe der Jahre schwächer geworden. Dennoch reichte das Geräusch aufheulender Maschinen übergeschnappter Poser aus, um ihn, trotz der Wattebäusche in seinen Ohren, zu wecken und ihn aus seinem Schlafsack zu zwingen, bevor ihn Mitarbeiter des Ordnungsamtes oder der Polizei hierzu aufforderten.
Es gab ruhigere Plätze als diesen, aber woanders gab es oft zu viele geschwätzige Menschen. Er konnte diese nicht ertragen. Ihr Gerede und ihr Gegröle nervten ihn mehr als die unaufhörlichen Verkehrsgeräusche, die er dann, abgesehen von den Posern, kaum noch wahrnahm. Außerdem war es trocken unter der Brücke. Er entschlummerte irgendwann, oft befördert von einer Flasche Rotwein, denn die tat auch seiner Stimme gut.
Letzte Nacht hatte er es sich wieder unter seiner Brücke bequem gemacht. Kurz nachdem er von zwei freundlichen Polizisten zum Gehen aufgefordert worden war, war er einmal um den Bahnhof herum gewandert und hatte seine Schlafstatt an genau derselben Stelle wiedereröffnet. Ein ganz normaler Vorgang.
Aber diesmal musste etwas Außergewöhnliches passiert sein. Er öffnete seine verklebten Augen und starrte im Halbdunkel gegen eine Wand, die mit Eierkartons beklebt war. Er sog die Luft ein. Es roch modrig und nicht nach mit Abgasen vermischter Durchzugluft. Das hier war nicht seine Brücke.
Das schwere, dumpfe Gefühl in seinem Kopf war neu. Er hatte zwar vor dem Schlafengehen eine große Flasche Lambrusco geleert, aber davon bekam er normalerweise keinen Kater. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Es schmeckte süßlich, aber chemisch und nicht nach Wein. Dazu hatte er einen ähnlichen Geruch in der Nase.
Er tastete nach seinem Schlafsack. Ja, er steckte noch darin. Genau so, wie er gestern hineingekrochen war, in seinem speckigen alten Ledermantel, dessen Kragen mit falschem Pelz besetzt war. Es war zwar bereits frühsommerlich, aber die Temperaturen in der Nacht waren frisch. Doch hier war es nicht kalt.
Er versuchte, sich auszustrecken. Sämtliche Gliedmaßen meldeten schmerzhafte Druckstellen und Verspannungen. Er spürte, dass er auf blankem Betonboden lag. Wo waren seine beiden Isomatten, die ihm ein einigermaßen bequemes Liegen ermöglichten?
Verwirrt und stöhnend richtete er sich auf und bemerkte ein völlig neues Geräusch. Das Rasseln einer Kette.
Er hob den Kopf und blickte in einen etwa drei mal vier Meter großen Raum in dämmerigem Licht.
Eierkartons klebten an der Decke und an allen Wänden. Kein Mobiliar. Durch eine kleine Fensterluke unterhalb der Decke drang ein wenig Licht. Gerade so viel, dass man bis zu einer verrosteten Metalltür auf der entgegengesetzten Seite sehen konnte. Auch auf dieser befanden sich Eierkartons, er konnte jedoch Scharniere, Metall und den Türknauf erkennen.
Er sah an sich herunter. Der Schlafsack war an der Seite, auf der sich der Reißverschluss befand, geöffnet worden. Eine massive Kette verschwand darunter.
Als er den Schlafsack an dieser Seite beiseiteschob, sah er, dass sein rechter Fuß mit einer Schelle an einer Kette befestigt war. Die Kette führte zu einem an einer Seite des Raumes eingemauerten Metallring.
Seine Füße steckten noch in den zwei Paar Socken, die er übergestreift hatte. Seine Schuhe und seine Isomatten lagen auf der anderen Seite des Raumes. Der große Einkaufswagen, den er von einem Supermarktparkplatz stibitzt hatte und in dem er seine gesamte Habe aufbewahrte, war nicht da.
Hatte er einen Albtraum? Dagegen sprachen seine schmerzenden Gliedmaßen und die Metallschelle, die gegen seinen Knöchel drückte.
Er versuchte, seine Gedanken zu ordnen. War er verhaftet und in eine Ausnüchterungszelle gesperrt worden?
Hatte er randaliert, weil er wieder einmal zu viel getrunken hatte?
Nein, er war sich sicher, dass er sich daran erinnern würde. In seinem Leben hatte er weiß Gott so manchen heftigen Rausch hinter sich gebracht. Einige Male endete ein Saufgelage mit einer handfesten Keilerei, aber noch niemals hatte er einen Blackout. Es wäre das erste Mal, dass ihm so etwas passierte.
Es gab keinerlei Anzeichen für eine Schlägerei, wie geschwollene Handknöchel, eine blutige Lippe oder fehlende Zähne.
Außerdem würde ihn selbst die Polizei nicht wie einen Hund in solch einer Zelle anketten. Panik ergriff ihn. Er suchte seine Taschen vergebens nach seinem altmodischen Handy ab. Dann fiel ihm ein, dass er es vor Wochen verloren und sich noch kein neues angeschafft hatte. Erleichtert erfühlte er aber das kleine handgeschnitzte Kästchen, das er immer bei sich trug.
»Hallo?« Seine Stimme klang belegt und wurde von den schallgeschützten Wänden geschluckt.
»Hallo?« Er rief lauter und kräftiger. Ja, seine Stimme war noch in Ordnung. Sein letztes Kapital, aus dem er zu wenig in seinem Leben gemacht hatte. Er holte tief Luft.
»Hallo? Ist da jemand?«
Eine Antwort blieb aus. Er zerrte an der Kette. Keine Chance, sie war fest verankert. Die Fessel war stabil. Es wurde ihm klar, dass er sich nicht selbst würde befreien können.
»He! Was soll die Scheiße hier? Macht mich los!«
Er war schreiend aufgestanden, aber sogleich wurde ihm schwindelig und er stürzte auf den kalten Betonboden.
Stöhnend richtete er sich langsam wieder auf und versuchte, die Metalltür zu erreichen, aber die etwa eineinhalb Meter lange Kette ließ das nicht zu. Hilflos steckte er seinen Arm nach dem Knauf aus, aber es fehlte mindestens ein ganzer Meter.
Schwankend sah er sich um, in der verzweifelten Hoffnung, irgendetwas entdecken zu können, das ihm einen Ausweg oder zumindest eine Erklärung bieten würde.
»Hilfe!« Er schrie, so laut er konnte. Keine Stimme war so laut wie seine.
»Hilfe!« Nur wenige konnten bei einer größeren Menschenmenge das Mikrofon weglassen. Er war eine Ausnahme. Seine Stimme war eine Naturgewalt. Zu gern hätte er sich in jungen Jahren einmal mit Tom Jones gemessen, der im Ruf stand, eines der lautesten Organe im Musikbusiness zu haben. Auch jetzt, in fortgeschrittenem Alter und körperlich reichlich angeschlagen, war seine Stimme noch topfit.
»Hallo! Hilfe! Hört mich jemand?«
Nein, diesmal konnte ihn tatsächlich keine Menschenseele hören.
2
»Elvis ist verschwunden!«
Die drei Menschen, die Freddy Spieker gegenüber saßen, sprachen den Satz im Chor und starrten ihn erwartungsvoll an. So, als ob er ihnen ohne Umschweife sagen könnte, wo sich der Gesuchte befand. Aber Freddy hörte in diesem Moment zum ersten Mal davon.
Er kannte Elvis, wie seine Gesprächspartner, wenn auch nur von gelegentlichen Abstechern in die Fußgängerzonen der Innenstädte des Ruhrgebiets.
»Seit Tagen ist er nicht mehr gesehen worden«, ergänzte Juan. Trotz seines spanischen Akzents war er stets bemüht, grammatikalisch korrektes Deutsch zu sprechen. Eines seiner Hobbys bestand darin, mit einem alten Duden unterm Arm die richtigen Artikel zu lernen und sich von jedem Muttersprachler, der sich in seiner Nähe befand, abhören zu lassen.
Freddy war sich sicher, dass sich ein Duden griffbereit in einer seiner Manteltaschen verbarg, um im Falle eines grammatikalischen Problems blitzschnell hervorgeholt zu werden. Da die Rechtschreibnormen vor einigen Jahren geändert wurden, war das Buch wahrscheinlich nicht so alt und verschlissen wie die Kleidung des Spaniers. Ansonsten legte Juan Wert auf ein sauberes Aussehen, soweit ihm dies beim Leben auf der Straße möglich war.
Juan machte eine verzweifelte Geste, die ihn für Freddy älter erscheinen ließ, als er mit Mitte Sechzig war. Freddy kannte ihn meistens nur gut gelaunt, aber Juans jugendlicher Elan war heute verflogen.
»Wir haben bei der Polizei Vermisstenanzeige erstattet«, ergänzte Carola mit ihrer tiefen, von jahrzehntelangem Nikotinkonsum verrauchten Stimme. »Aber die haben uns angeguckt, als hätten wir nicht alle stramm.«
Wutschnaubend richtete sie ihren massigen Körper auf und funkelte Freddy an, als wäre er für das Verhalten der Gesetzeshüter verantwortlich. Ihre grauen Haare standen in alle Richtungen ab, als seien sie elektrisch aufgeladen.
»Einen Obdachlosen als vermisst zu melden, schien denen wohl irgendwie nicht ...« Sie suchte nach dem richtigen Wort. »... plausibel.«
Das letzte Wort spuckte sie förmlich aus und Freddy meinte, einen winzigen Tropfen ihrer feuchten Aussprache auf seiner Wange gespürt zu haben.
»Haben die das gesagt?«, fragte Freddy.
»Nicht direkt!«, meldete sich Vitali mit rollendem »R« zu Wort, der jüngste der drei Besucher. »Aber die haben so komisch gegrinst. Erst haben sie uns den Standardsatz um die Ohren gehauen, dass ein Vermisster meist nach wenigen Tagen wieder auftaucht. Als wir nicht locker gelassen haben, meinten sie, dass sich ein Obdachloser sowieso mal hier, mal dort aufhalten würde. Wahrscheinlich hätte Elvis die Stadt gewechselt und uns nichts davon gesagt. Na ja, gelegentlich macht er ja so was, ist dann aber nach zwei, drei Tagen wieder da.«
Vitalis glasige Augen verrieten Freddy, dass der hagere Enddreißiger zum Frühstück Hochprozentiges zu sich genommen hatte. Er rutschte in seinem Trainingsanzug mit der Aufschrift CCCP, offenbar einer Reminiszenz an die Heimat seiner Eltern, ein wenig von der Couch herunter.
Freddys Kinderstube trug ihm normalerweise auf, seinen Gästen einen Kaffee anzubieten, aber er wollte die Drei möglichst bald loswerden. Er schämte sich ein wenig dafür. Schließlich hatte es das Schicksal mit den dreien nicht so gut gemeint wie mit ihm. Die Erbschaft seines Onkels erlaubte ihm, in diesem großen, gut ausgestatteten, frei stehenden Haus in Essens Nobelgegend Werden zu wohnen.
Er war verwundert darüber, dass seine Besucher herausgefunden hatten, dass er eine Detektei betrieb. Im Ruhrgebiet war er eher als Blues-Musiker bekannt. In der Vergangenheit hatte er zwar zur Aufklärung zweier spektakulärer Verbrechen beigetragen und war auch in den lokalen Medien lobend erwähnt worden, aber Juan, Carola und Vitali kannten ihn seines Wissens nur als Bassisten.
»Wie kommt ihr darauf, dass ich euch helfen kann?«
Die drei starrten ihn verständnislos an.
»Neben deiner Haustür hängt so’n komisches Schild«, antwortete Carola schnippisch. »Private Ermittlungen steht da drauf.«
»Wir sind schließlich nicht aus Dummsdorf«, ergänzte Juan beleidigt. »Ich lese die Zeitungen, die ich täglich aus den Papierkörben fische, sehr genau. Darin wurde ein gewisser Freddy Spieker schon lobend dafür erwähnt, dass er der Polizei bei der Aufklärung von Verbrechen sehr geholfen hat. Du seist der Talent schlechthin.«
»Das Talent«, verbesserte ihn Carola prompt.
Juan schaute sie einen Moment prüfend an. Dann kramte er seinen Duden hervor und fing an zu blättern.
»Außerdem hast du ja auch Werbeanzeigen geschaltet«, sagte Vitali.
»Und glaub’ nicht, wir hätten kein Internet«, schaltete sich Carola ein und hielt ihm ein Smartphone vor die Nase. »Wir leben auf der Straße und nicht hinterm Mond.«
»Schon gut. Das habe ich auch nicht damit sagen wollen.« Freddy hob beschwichtigend die Hände. »Habt ihr mal versucht, Elvis anzurufen?«
Carola winkte ab. »Der Idiot hat sein Handy vor einiger Zeit verloren. Und das nicht zum ersten Mal. Konnte außer zum Telefonieren nichts damit anfangen. Nach dem letzten Verlust meinte er, er bräuchte eh keins, weil er sowieso nur mit uns zusammen wäre.«
»Das macht es natürlich nicht einfacher«, murmelte Freddy, während er sich Notizen machte. »Hat die Polizei keine Mantrailer-Hunde eingesetzt?«
Einen Moment sahen ihn seine Besucher verständnislos an, dann lachten sie hämisch.
»Genau das haben wir denen auch vorgeschlagen«, sagte Juan. »Wir hatten aber nichts von Elvis, woran so ein Hund hätte schnüffeln können. Auch der Einkaufswagen, den er immer mit seinen Klamotten dabei hatte, ist verschwunden. Wir haben schon überall gesucht.«
»Inzwischen dürfte sich die Spur verflüchtigt haben. Der Bulle, der die Anzeige aufgenommen hatte, meinte nur, wir sollten ihm was von Elvis bringen, was ordentlich stinkt«, brummte Carola. »Vielleicht bräuchten wir dann noch nicht einmal Hunde. Dabei grinste der so dämlich, dass ich ihm fast eine reingehauen hätte.«
Vitali nickte heftig und ballte die Fäuste. Offenbar sah er den Polizisten in diesem Moment vor seinem geistigen Auge.
Das nächste Thema, das Freddy anschneiden wollte, würde sich noch schwieriger gestalten. »Bevor wir weiterreden, müssten wir noch über mein Honorar sprechen.«
Er erntete allgemeines Schweigen.
»Du willst Kohle?«, unterbrach schließlich Vitali die Stille und starrte Freddy entsetzt an. »Ich dachte, Elvis ist dein Freund.«
»Nun ja, Freund ...«
»Es geht hier um Leben und Tod«, ereiferte sich Vitali und breitete theatralisch die Arme aus. »Und du denkst ans Geld?«
Kopfschüttelnd ließ er die Arme sinken und schaute sich im nächsten Moment suchend in Freddys Wohnzimmer um. »Gibt es hier eigentlich nichts zu trinken?«
»Freddy hat Recht«, wandte sich Carola an ihre Begleiter. »Natürlich steht ihm ein Honorar zu. Fragt sich nur, woher wir das nehmen sollen.«
»Also müssen wir doch wieder klauen gehen?«, fragte Juan leicht verzweifelt.
»Oh! Moment mal. Dazu soll es natürlich nicht kommen«, griff Freddy ein. »Wir reden erst einmal und schauen dann, was wir machen können.«
Seine Besucher lächelten ihn selig an, als habe Freddy ihnen gerade ein paar Gratisurlaube beschert.
3
Elvis war seit Wochen weder in der Gelsenkirchener noch in der Bochumer Innenstadt gesehen worden. Auch in anderen Ruhrgebietsstädten fand man keine Spur von ihm. Untalentierte Möchtegernkünstler hatten seinen Platz eingenommen.
Seine volltönende Stimme hatte die Menschen fasziniert. Viele hatten ihre Shopping-Touren unterbrochen und waren mit vollen Einkaufstaschen stehen geblieben und hatten zugehört, wenn er seine Lieder sang.
Man kannte ihn nur als Elvis, seinen richtigen Namen wusste niemand. Er sang bevorzugt die Songs des King of Rock’n’Roll. Er tat es mit einer Inbrunst, die jedem Zuhörer dieses lyrischen Baritons eine Gänsehaut bescherte. Viele sahen in ihm die Reinkarnation des amerikanischen Superstars.
Manch einer behauptete, er sei es selbst. Der King sei gar nicht gestorben, sondern habe den Starrummel in Amerika nicht mehr ausgehalten und seinen Tod nur vorgetäuscht. Anschließend sei er nach Good Old Germany geflüchtet, das er ja aus seiner Armeezeit gekannt habe.
Elvis war nicht mehr der Jüngste, aber sein Alter war nicht leicht zu schätzen. Das Leben hatte an ihm gezehrt. Tiefe Furchen hatten sich in sein Gesicht gegraben, die nur zum Teil von seinem grauen, struppigen Bart verdeckt wurden. Dazu trug er ein Armee-Käppi, das dem der amerikanischen Südstaaten-Truppen während des Sezessionskrieges nachempfunden war. Unter dem dunkelbraunen Ledermantel sah man meist ein T-Shirt mit dem Konterfei des Kings. Er besaß mehrere hiervon und es war das einzige Kleidungsstück, das er regelmäßig wechselte. Wenn nicht Elvis Presley, waren andere Größen des frühen Rock darauf zu sehen: Buddy Holly, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, aber auch Blues-Idole wie B.B. King oder Muddy Waters.
Die Seitentaschen seiner aus Bundeswehrbeständen stammenden Hose waren vollgestopft mit Dingen, über die nur er Bescheid wusste. Die Hose selbst hatte seit Jahren keine Waschmaschine mehr gesehen, war zerrissen und verströmte einen Geruch, der sein Publikum mehrere Meter auf Abstand hielt. Viele überwanden sich dennoch und warfen Münzen und Geldscheine in das vor ihm liegende handgeschnitzte Kästchen, das sich schnell füllte.
Während andere Straßenmusiker meist nach kurzer Zeit von ihren Plätzen vor den Geschäften vertrieben wurden, sahen es andere Geschäftsinhaber gern, wenn Elvis vor ihrem Eingang sein Können zum Besten gab. Es kam vor, dass man ihm eine Flasche Wein oder Bier spendierte, nur damit er blieb. Nicht wenige seiner Zuhörer begaben sich anschließend in die nahe gelegenen Geschäfte, wo sie seiner Stimme im Hintergrund weiter lauschen konnten.
Mit steigendem Alkoholpegel kam Elvis meist richtig in Fahrt. Irgendwann jedoch begann er die Texte zu vergessen, sodass er sich wohl oder übel ein Plätzchen suchen musste, um seinen Rausch auszuschlafen.
Oft wurde er an der Gitarre von Juan begleitet, der wie er auf der Straße gelandet war. Juan besaß eine Konzertgitarre. Diese verzauberte mit ihrem Klang trotz ihres ramponierten Aussehens die Zuhörer und konnte mit jeder Flamenco-Gitarre, die im Laden mehrere Monatsgehälter eines Durchschnittsverdienenden kostete, mithalten.
Gern erzählte Juan, wie er in den Siebzigern als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen war und sich von seinen ersten Lohnzahlungen die Gitarre gekauft hatte. Im Gegensatz zu Elvis erzählte er seine Lebensgeschichte gern. Wie er als Teenager aus seinem Dorf in Andalusien aufgebrochen war, um im Ruhrgebiet nach Arbeit zu suchen. Schnell hatte er auf der Zeche Consolidation in Gelsenkirchen anheuern können. Bald darauf hatte er seine Frau Monika kennengelernt und einen Sohn bekommen.
Mit dem Zechensterben sank sein Stern. Er wurde arbeitslos, Alkoholiker und schließlich obdachlos, nachdem ihn seine Frau verlassen hatte. Fortan widmete er sich nur noch seiner Gitarre, dem perfekten Erlernen der deutschen Sprache und dem Rioja. Nach Spanien wollte er nicht mehr zurück. Die Schmach, in der Fremde versagt zu haben, konnte er nicht ertragen. Stattdessen schrieb er regelmäßig Briefe in die Heimat und berichtete, wie gut es ihm ginge und dass er zu Besuch kommen würde, sobald es ihm seine knappe Zeit erlaube.
Während er jetzt Freddy gegenüber saß, wanderte sein Blick mehrere Male zu der Gibson-Gitarre hinüber, die an einer exponierten Stelle im Wohnzimmer stand, beschienen von einem exakt ausgerichteten Spot. Es war eine besondere Gitarre, eine halbakustische ES-355 und dazu noch eine »Lucille«, ein Signature-Modell mit einer Original-Unterschrift von B.B. King, dem verstorbenen König des Blues.
Diese Gitarre war Freddy vor einigen Jahren gestohlen worden. Er hatte sie unter abenteuerlichen Begleitumständen, bei denen es zu Verbrechen gekommen war, die ihn selbst fast das Leben gekostet hätten, wiederbeschafft.
Freddy bemerkte Juans sehnsüchtigen Blick und wie dieser seine Fingergelenke lockerte. »Wenn du dir vorher die Finger wäschst, darfst du auch mal darauf spielen«, beantwortete Freddy Juans ungestellte Frage.
Juans Augen leuchteten. »Meinst du wirklich ...?«
»Ja klar. Aber erst einmal müssen wir ein paar Fragen klären.«
Freddy holte sein Notebook hervor und schaltete es ein. Ein Büro besaß er nicht. Er pflegte seine Aufträge, bei denen es vor allem um untreue Eheleute ging, stets am Wohnzimmertisch zu bearbeiten. Seine Kunden machten es sich in angenehmer Atmosphäre gemütlich und plauderten aus dem Nähkästchen. Einige wenige Male hatte er mit verschwundenen Teenagern zu tun, die er aber meist nach wenigen Tagen wieder ausfindig machen konnte.
Seine Begeisterung für die Detektivtätigkeit hielt sich in Grenzen. Dabei hatte er selbst vor Jahren die Idee gehabt, eine Detektei zu eröffnen und seinen Job im Baumarkt aufzugeben. Freddy hatte zuvor seine Fähigkeiten als Ermittler bei der Aufklärung von Mordfällen bewiesen und war sogar vom Polizeipräsidenten in Bochum belobigt worden. Das Alltagsgeschäft erwies sich in der Folge als weniger spektakulär und Freddy begann, sich zu langweilen. Am liebsten hätte er sein Büro wieder geschlossen.
Aber sein Einkommen als Musiker war zu bescheiden, als dass er auf dieses recht einträgliche Geschäft verzichten konnte. Vor wenigen Jahren hatte er einen lukrativen Auftrag erhalten, der es ihm bei Erfolg erlaubt hätte, seine Detektei zumindest für einige Zeit zu schließen und sich ganz der Musik zu widmen. Aber etwas war schief gegangen und er hatte noch eine Rechnung offen mit jemandem, der ihm übel ins Handwerk gepfuscht hatte.
Seufzend verdrängte er den Gedanken. Auch von seinen neuen Auftraggebern konnte er nicht damit rechnen, ein fürstliches Honorar zu ergattern, ganz im Gegenteil.
»Wann habt ihr Elvis zum letzten Mal gesehen?«, begann er seine Befragung.
»Vor etwa zweieinhalb Wochen«, antwortete Carola. »Wir haben wie üblich am Hinterausgang vom Bochumer Hauptbahnhof gefeiert. Elvis hat ein paar alte Rock’n’Roll-Nummern zum Besten gegeben. Juan hat Gitarre dazu gespielt und wir anderen haben die Wodkaflasche kreisen lassen.«
Juan und Vitali nickten zur Bestätigung.
»Irgendwann sind ein paar Junkies aufgetaucht und meinten, wir sollten entweder mit dem Krach aufhören oder was Vernünftiges spielen. Ein Wort gab das andere, dann haben die einen Ghettoblaster mit ihrem Scheiß Hip-Hop aufgedreht und es gab einige Rangeleien. Nix Ernstes, aber als Vitali einen von denen umgestoßen hatte, kamen die Bullen und haben uns die Rote Karte gezeigt. Platzverweis. Aber da war Elvis schon nicht mehr zu sehen. In dem ganzen Durcheinander muss es ihm wohl zu unruhig geworden sein und er hat das Weite gesucht.«
»Der hat sich bestimmt wieder auf seine Lieblingsschlafstelle unter der Bahnhofsbrücke zurückgezogen«, ergänzte Vitali. »Wir sind bis zum Stadtpark gelaufen und haben es uns dort bequem gemacht, um den Junkies aus dem Weg zu gehen. Als wir Elvis am nächsten Morgen unter der Brücke gesucht haben, war er verschwunden.«
»Da haben wir uns aber noch nichts dabei gedacht«, ergriff Juan das Wort. »Wahrscheinlich haben ihn die Bullen wieder von dort vertrieben, wie so oft. Wir dachten, dass er in die Glückauf-Bahn nach Gelsenkirchen gestiegen ist und sich in der Neustadt mit ein paar Leuten getroffen hat. Aber als wir am nächsten Tag dorthin sind, hatte ihn niemand gesehen. Wir haben ihn dann noch in Essen, Duisburg und Dortmund gesucht. Fehlanzeige. Vor einer Woche haben wir Vermisstenanzeige erstattet. Aber wie gesagt, die Polizisten haben uns nicht ernst genommen.«
Freddy kratzte sich nachdenklich am unrasierten Kinn und wiegte seinen Kopf, sodass seine angedeutete Vokuhila-Frisur etwas hin und her schwang.
»Nun ja, ignorieren können die eure Anzeige auch nicht. Sie werden schon Ermittlungen anstellen. Habt ihr mal nachgefragt, was sie in der Zwischenzeit unternommen haben?«
»Pfff!«, machte Carola. »Die haben doch glatt gefragt, ob wir mit ihm verwandt sind. Dann kamen sie uns mit Datenschutz. Wir wüssten ja noch nicht einmal seinen richtigen Namen.«
Freddy stutzte. »Wie jetzt? Ihr wisst noch nicht einmal, wie Elvis mit richtigem Namen heißt?«
Als Antwort bekam er sechs zuckende Schultern.
»Hat er denn nie etwas gesagt? Ihr kennt ihn doch schon lange.«
»Er sagte immer, sein richtiger Name tue nichts zur Sache«, erklärte Juan. »Der stamme aus einem früheren, beschissenen Leben und sei Geschichte. Jetzt zähle nur noch Rock’n’Roll. Deshalb der Pseudonym.«
»Das Pseudonym«, verbesserte Carola genervt. Juan blätterte im Duden.
»Spielt das eine Rolle, wie er wirklich heißt?«, fragte Vitali. »Ihn kennt man doch nur als Elvis.«
»Die Polizei kann solch eine Vermisstenanzeige ohne seinen richtigen Namen nicht bearbeiten. Den kriegen sie aber sicher übers Sozialamt, Einwohnermeldeamt und über diverse Sozialarbeiter raus. Dann werden sie versuchen, Angehörige zu kontaktieren und nachfragen, ob er bei ihnen aufgetaucht ist.«
»Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die sich solch eine Mühe wegen eines Penners machen?« Carola schnaubte verächtlich. »Deshalb kommen wir ja zu dir. Du bist wie wir Fan von Elvis und es kann dir doch nicht egal sein, was mit ihm passiert ist.«
Sie hatte nicht unrecht. Freddy war fasziniert von Elvis’ volltönender Stimme. Sein Stimmumfang war wie der des Originals beeindruckend, sodass Freddy einmal erwogen hatte, ihn in seine Band, die Blues Bandits, aufzunehmen. Aber mit dem charismatischen Showman Mike Bruns hatte er bereits einen guten Sänger, der zudem hervorragend Mundharmonika spielen konnte.
»Wisst ihr denn, wo Elvis ursprünglich herkam? Ich meine, der war doch kein klassischer Ruhrgebietstyp.«
»Wenn er sprach, hatte er so einen hessischen Einschlag«, sagte Juan.
Die anderen schauten ihn anerkennend an. Ein Spanier, der deutsche Dialekte heraushören konnte. »Ich meine, er sagte mal irgendetwas von Nauheim oder so.«
»Bad Nauheim«, ergänzte Carola. Juan schaute nachdenklich seinen Duden an und suchte mit den Augen Freddys Bücherregal nach einem Atlas ab. Sein Blick blieb jedoch bei der Gitarre hängen.
»Darf ich jetzt?«, fragte er Freddy.
Auch wenn Freddy selbst kaum Gitarre spielen konnte, war er sehr eigen darin, sein wertvollstes Instrument jemand anderem zu überlassen.
»Zeig mal deine Hände«, forderte er Juan auf.
Zu Freddys Verwunderung waren diese bis auf ein wenig Schmutz unter den Fingernägeln recht gepflegt. Als gelernter rechtshändiger Flamenco-Gitarrist waren die Nägel an der linken Hand kurz geschnitten, an der rechten Zupfhand dafür etwas länger. Juans lange zurückliegende Zeit der harten Arbeit auf der Zeche hatte keine bleibenden Schäden hinterlassen.
»Okay«, sagte Freddy. »Sie ist an den kleinen Verstärker daneben angeschlossen. Aber mach nicht so laut.«
Erfreut ergriff Juan das Instrument, stellte den Verstärker an und spielte zu Freddys Freude den Mississippi-Blues von Willie Brown.
»Mann, ich könnte jetzt einen ordentlichen Schluck gebrauchen«, meldete sich Vitali zu Wort. »Wenn uns Elvis und Juan was vorgespielt haben, hat’s mit ’nem ordentlichen Drink noch mal so gut geklungen.«
»Wie wär’s mit Tee?«, fragte Freddy und erntete einen angewiderten Gesichtsausdruck.
»Zurück zum The...ma!«, befahl Carola und amüsierte sich über ihr kleines Wortspiel, während Juan anfing zu improvisieren. »Es gibt da ein paar Streetworker, die ab und zu bei uns nach dem Rechten sehen. Vielleicht wissen die, wie Elvis mit richtigem Namen heißt.«
»Das könntet ihr als Erstes versuchen«, meinte Freddy.
»Wieso wir?«, protestierte Carola. »Du bist doch hier der Detektiv.«
»Der nicht weiß, wie seine Auftraggeber ihn bezahlen wollen.«
»Jetzt fängst du schon wieder damit an«, erwiderte Carola beleidigt. »Wir haben schließlich auch Menschenrechte. Und auch Elvis hat das Recht, dass sich jemand um ihn kümmert. Es ist schon schlimm genug, dass wir Obdachlosen dem Rest der Gesellschaft scheißegal sind. Es interessiert keinen, warum man auf der Straße gelandet ist. Ich musste meinen Kiosk aufgeben, weil mein Göttergatte mit ’ner Jüngeren durchgebrannt ist und mich mit den ganzen Schulden sitzengelassen hat. Wenn du ein Herz hast, hilfst du uns.«
Die toughe Frau hatte plötzlich Tränen in den Augen. »Elvis und seine Stimme waren ein echter Lichtblick in unserem sonst so beschissenen Leben. Wenn er gesungen hat, konnten wir für eine kurze Zeit den ganzen Kummer vergessen. Seit er verschwunden ist, ist alles wieder so trist und öde ...«
Ihr versagte die Stimme. Tränen rollten ihre Pausbacken herunter. Vitali streichelte ihr mit traurigem Gesichtsausdruck den Rücken.
»Ich bin sicher, Freddy findet ihn, Carola. Wenn ihn einer findet, dann Freddy Spieker.« Er schaute Freddy hoffnungsvoll an.
Freddy stöhnte. Sie hatten geahnt, dass unter seiner oft rauen Schale ein weiches Herz schlug. Sie hatten wohl darauf gebaut, dass sie ein gefühlvoller Musiker nicht genauso abblitzen lassen würde wie ein seelenloser Bürokrat.
»Okay! Passt auf!«, fuhr Freddy fort. »Ihr kennt eure Streetworker, im Gegensatz zu mir. Wenn ihr herausfindet, wie Elvis wirklich heißt und wo er ursprünglich herkommt, kann ich versuchen, etwas herauszubekommen. Es könnte ja sein, dass sein Verschwinden irgendetwas mit seinem früheren Leben zu tun hat.«
Die anderen nickten erleichtert. Juan begann »Muss i denn zum Städtele hinaus« zu spielen.
»Bad Nauheim ist ja vielleicht ein Anfang«, meinte Carola hoffnungsvoll.
Freddy dachte nach. »Wie alt ist Elvis eigentlich?«
Die anderen sahen sich fragend an.
»Na, so zwischen sechzig und fünfundsechzig, schätze ich mal«, antwortete Carola.
Freddy kam ein unglaublicher Gedanke. Konnte das wirklich möglich sein?
4
Kriminalhauptkommissar Bruno Peppelinski lehnte sich zufrieden in seinem neuen rückenfreundlichen Bürosessel zurück.
Es hatte doch noch geklappt mit seiner Beförderung. Dabei hatte es lange Zeit so ausgesehen, als würde er es bis zu seinem Ruhestand nicht mehr schaffen. Mit Mitte fünfzig war ihm die Zeit davon gelaufen und er musste mitansehen, wie erheblich Jüngere, vor allem Frauen, mit ihrer Karriere an ihm vorbeizogen. Er hatte schon befürchtet, dass ihm eins dieser jungen Dinger direkt vor die Nase gesetzt würde und er nach ihrer Pfeife tanzen musste.
Auf die kürzlich durch den Ruhestand eines Kollegen vakant gewordene Stelle im Bochumer Polizeipräsidium hatte sich glücklicherweise keine Frau beworben. Da man seiner langen Berufserfahrung den Vorzug vor jüngeren Kollegen gegeben hatte, hatte seinem Aufstieg nichts mehr im Wege gestanden. Dabei war ihm zugutegekommen, dass er bei den letzten Mordfällen, die sich in einer Bochumer Veranstaltungshalle und beim großen Open-Air-Festival »Bochum total« ereignet hatten, eine schnelle Aufklärung präsentieren konnte.
Die Fälle hingen zusammen und die Hintergründe der Taten schienen offensichtlich zu sein. Dennoch sagte ihm sein Gefühl, dass noch irgendetwas anderes dahinter gesteckt haben musste. Der Täter hatte jedoch nach seiner Verhaftung kein Wort mehr gesagt und es nach dem dritten Versuch schließlich geschafft, sich in seiner Zelle umzubringen. In der Haut der JVA-Bediensteten, die dies trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht hatten verhindern können, wollte er nicht stecken.
In den Jahren zuvor hatte es einen Mordfall in Zusammenhang mit dem Verschwinden einer wertvollen Gitarre gegeben, bei dem sich er und sein Assistent Rico Bein kräftig blamiert hatten. Ein Musiker und Hobbyermittler namens Freddy Spieker hatte im Wesentlichen zur Aufklärung der Straftaten beigetragen und dabei eine gewisse Berühmtheit in den lokalen Medien erlangt. Sogar eine Belobigung des Polizeipräsidenten hatte der Mann erhalten und danach eine Privatdetektei eröffnet.
Auf irgendeine Weise war Spieker auch in die letzten Mordfälle verwickelt, jedoch konnte Peppelinski dessen Rolle nicht eindeutig klären. Im Gegenteil, Spieker hatte sogar zwei Frauen, die der Täter zuvor entführt hatte, befreien können. Zumindest hatten die Polizisten nicht wieder als Deppen dagestanden, auch wenn Spieker erneut als Held gefeiert wurde.
Peppelinski strich sich den neuen modischen Anzug glatt, den er sich von seiner Gehaltserhöhung gegönnt hatte. Seine abgewetzten Cordklamotten gehörten der Vergangenheit an. Er nahm sich vor, seine gehobene Stellung auch nach außen zu tragen. Man sollte ruhig sehen, dass er einen Karrieresprung gemacht hatte. Ausschlaggebend war ausgerechnet die abfällige Bemerkung einer jungen Kollegin, die sich zwar bewerben wollte, aber deren Dienstgrad als einfache Kommissarin unter seinem lag und die daher als Bewerberin chancenlos war. Woher man diese schrecklichen Cordklamotten bekäme, hatte ihn dieses freche Ding gefragt. Dann würde sie sich auch welche kaufen, um befördert werden zu können. Dann hatte sie irgendetwas von alten weißen Männern gemurmelt und ihre fertig geschriebene Bewerbung in den Papierkorb geworfen.
Wäre Peppelinski verheiratet oder zumindest liiert gewesen, hätte er vielleicht schon eher einen kräftigen weiblichen Wink mit dem Zaunpfahl bekommen und sein Outfit geändert.
Während er seinen Anzug nach Fusseln absuchte, betrat sein Assistent Rico Bein das Büro.
»Kein eindeutiger Hinweis auf eine Gewalttat«, platzte er in seinem typisch sächselnden Akzent heraus und knallte seinem Chef die Ermittlungsakte des jüngsten Falles auf den Tisch. Das Wort »eindeutig« hatte er verächtlich ausgeprochen.
Peppelinski zuckte zusammen. Bein war mitunter sehr forsch. Seine Ermittlungsmethoden, vor allem seine Befragungen und Verhöre, gestalteten sich oftmals ruppig. Zeugen fühlten sich wie Verdächtige und Verdächtigte wie abgeurteilte Straftäter.
Der neue Hauptkommissar war sich Beins Solidarität sicher, auch wenn er ihn gelegentlich ausbremsen musste. Bein hatte Peppelinskis kurze ruhige Phase, in welcher er noch einmal ausgiebig das Gefühl der gelungenen Beförderung genießen wollte, gestört. Seufzend schlug er die Akte auf.
»Was bedeutet: Kein eindeutiger Hinweis?«, fragte er.
»Das bedeutet, dass bei dem Toten kein konkreter Beweis für eine äußere Gewalteinwirkung gefunden wurde«, antwortete Bein und klang, als sei er über das Ergebnis der Leichenschau erbost.
Der neue Todesfall gab den Ermittlern einige Rätsel auf. Auf dem lange verlassenen Gelände des alten Güterbahnhofes Gelsenkirchen-Wattenscheid an der Stadtgrenze zu Bochum war vor zwei Tagen die Leiche eines jungen Mannes entdeckt worden. Der Mann war vermutlich illegal auf dem Gelände unterwegs. Alte Gebäude, seit Jahrzehnten verlassen, lockten mitunter junge Abenteurer an, die sogenannte »Lost Places« erkundeten. Sie machten Fotos und Videos und teilten diese in den sozialen Medien.
Diese Orte waren oft unzureichend gesichert. Es war gefährlich, die oft maroden verlassenen Gebäude zu betreten.
Peppelinski las den Bericht der Rechtsmedizin. Der Tote hieß Julian Beckert, war Mitte zwanzig, ledig und als Jurastudent an der Universität in Bochum eingeschrieben. Ein Jurastudent, der sich bewusst sein musste, dass er etwas Illegales tat. Der Hauptkommissar schüttelte den Kopf. Was sollte aus der Justiz bloß werden, wenn solche Leute künftig Rechtsanwälte würden? Oder, was noch schlimmer wäre, Richter oder Staatsanwälte.
Man hatte festgestellt, dass Beckert an den Folgen eines Genickbruchs verstorben war. Zudem hatte er weitere Knochenbrüche im Beckenbereich, der Schulter und der Beine. Daraus wurde am Ende des Berichts geschlossen, dass er sich seine Verletzungen bei einem Sturz aus großer Höhe zugezogen haben musste.
Seltsamerweise war er jedoch auf ebener Fläche in einem Gebüsch aufgefunden worden. Die KTU hatte Schleifspuren festgestellt, die zur Leiche führten und vom Körper des Opfers stammen mussten. Zudem hatte es einige offenbar bewusst verwischte Schuhabdrücke gegeben, die jedoch nicht mehr rekonstruiert und nachverfolgt werden konnten.
Nicht ins Bild passte ein Hämatom am linken Oberarm, obwohl festgestellt worden war, dass der tödliche Aufprall auf der rechten Körperseite erfolgt war. Einige Spuren an der Kleidung des Opfers mussten noch einer DNA-Analyse unterzogen werden. Auf das Ergebnis würden sie einige Tage warten müssen.
»Das heißt, dass der junge Mann nicht an dem Ort ums Leben kam, wo er gefunden wurde«, stellte Peppelinski fest.
»So ist es«, bestätigte Bein. »Wir werden noch einmal das ganze Gelände absuchen, um festzustellen, wo er abgestürzt ist. Es kann aber auch sein, dass es ganz woanders passiert ist.«
»In jedem Fall sieht es nicht nach einem Unfall aus. Das Hämatom am linken Arm kann darauf hindeuten, dass er heftig gestoßen wurde und anschließend aus mehreren Metern hinabgestürzt ist.«
»Kann«, bemerkte Bein. »Der Rechtsmediziner sagte mir, dass er das nicht feststellen könnte. Der Mann habe sich vielleicht auch irgendwo gestoßen und sei verunglückt.«
Bein klang säuerlich. Mit vagen Äußerungen hatte er seine Probleme. Er benötigte klare Aussagen. Beins abfälliger Tonfall ließ Peppelinski vermuten, dass dieser von den Fähigkeiten des Rechtsmediziners nicht viel hielt.
»Immerhin hat er festgestellt, dass der Bursche schon tot gewesen sein muss, bevor er an dem Ort abgelegt wurde«, sagte Peppelinski. »Aber wenn er verunglückt ist, warum macht sich jemand die Mühe, ihn irgendwo in einem Gebüsch abzulegen, statt den Notarzt zu rufen? Da will jemand etwas vertuschen.«
»Offenbar wollte der Täter damit erreichen, dass man die Leiche nicht oder spät entdeckt.«
»Sie gehen also von Mord aus?«, fragte Peppelinski und sah Bein zum ersten Mal in die Augen.
»Natürlich!« Beins Antwort klang so, als hätte man ihn etwas völlig Abwegiges gefragt. Er legte sich in den meisten Fällen vorschnell auf ein Tötungsdelikt fest, wenn man einen Toten fand. Vielleicht hatte er seit seiner Kindheit zu viele Krimis geschaut, wie Peppelinski vermutete. Oder lag es daran, dass er aus der ehemaligen DDR stammte und, wie früher die Stasi, hinter jeder Aktion etwas Illegales vermutete? Er war zwar noch Jugendlicher, als es mit dem ostdeutschen Staat zu Ende ging, aber offenbar war er von dieser Zeit geprägt.
»Wenn sich jemand die Mühe macht, die Leiche an einem anderen Ort abzulegen, muss er etwas zu verbergen haben«, dachte Peppelinski laut. »Das Hämatom am linken Arm ist ein Indiz dafür, dass er gestoßen wurde, aber kein Beweis. Wir müssen herausfinden, wo es passiert ist. Dort muss es mehr Spuren geben.«
»Ich brauche mehrere Leute, Chef«, sagte Bein. »Das Gelände ist weiträumig. Ein bis zwei Tage werden wir mindestens benötigen, um alles gründlich abzusuchen.«
»Die sollen Sie kriegen.« Peppelinski hatte den Telefonhörer schon in der Hand, um für seinen eifrigen Mitarbeiter das benötigte Personal anzufordern.
5
Er atmete schwer. Die Luft im Raum war verbraucht. Vor das kleine Fenster knapp unterhalb der Decke war von außen ein massiver Gegenstand geschoben worden, sodass kaum noch Frischluft hineinströmte. Zudem war es dunkel. Nur ein dünner Lichtstrahl quälte sich durch den Spalt unterhalb der Stahltür.
Er schätzte, dass er jetzt schon vier oder fünf Tage in diesem Gefängnis verbracht hatte. Er hatte kein richtiges Zeitgefühl mehr, da seine Armbanduhr fehlte. Seit er in diesem Raum aufgewacht war, war sie verschwunden.
Es mochte vorgestern gewesen sein, als seine Hilferufe Gehör fanden. Ein junger Mann schaute plötzlich durch das Oberlicht hinein und versprach, eine Möglichkeit zu suchen, ihn zu befreien. Dann war er verschwunden und tauchte nicht mehr auf. Darauf konnte er sich keinen Reim machen. Wieso kam er nicht wieder? Aber vor allem, wer hatte ihn hier eingesperrt?
Jemand hatte ihm, während er für kurze Zeit eingeschlafen war, zwei große Plastikflaschen Wasser und ein paar Schokoriegel hineingestellt. Zudem einen Eimer, der wohl als Toilette dienen sollte.
Das Wasser hatte er inzwischen getrunken. Der Durst war unerträglich geworden. Natürlich fehlte ihm der Alkohol. Aber seine Entzugserscheinungen waren inzwischen abgeklungen. Die Kopfschmerzen und die Krämpfe hatten nachgelassen, aber er sehnte sich nach einer Flasche Rotwein. Danach würde es ihm sicher besser gehen. Die Schokoriegel hatte er inzwischen auch verschlungen. Zum Glück befanden sich darin keine Nüsse, gegen die er allergisch war und ohnehin mit seinen verbliebenen, ruinenhaften Zähnen schlecht kauen konnte.
Seine Glieder schmerzten. Wie auch immer er sich setzte oder legte, er konnte keine bequeme Position finden. Die Isomatten und sein Wintermantel boten ihm auf die Dauer wenig Polsterung auf dem harten Boden. Vor seiner Entführung hatte er sich oft eine Nacht in einer Obdachloseneinrichtung gegönnt, wenn er mal wieder ein weiches Bett haben wollte.
Schlimmer noch war die Panik, die von ihm Besitz ergriffen hatte. Verzweifelt hatte er wieder und wieder um Hilfe gerufen. Dann hatte er wild losgeflucht und den Unbekannten und Ungesehenen, der ihm das angetan hatte, wild beschimpft. Die nachfolgende Totenstille war grausam. Er hatte sich schon oft einsam in seinem Leben gefühlt. Aber dieses Mal war es anders. Die erdrückende Trostlosigkeit seines Gefängnisses fraß sich wie der nahende Tod in seine Seele. Die Ungewissheit, was hier noch mit ihm geschehen würde, führte ihn von Minute zu Minute tiefer in den Wahnsinn. Immer wieder schrie er die Wände und die rostige Tür an, die eine brutale Gleichgültigkeit ausstrahlten.
Sein Gehirn versuchte, eine Erklärung zu finden. Man hatte ihn verschleppt. Aber wer entführte einen alten Penner? Eine Entführung hatte in der Regel zum Ziel, Lösegeld zu erpressen. Bei ihm aber war nichts zu holen. Auch hatte er niemanden, den man erpressen konnte.
Konnte Rache ein Motiv sein? Es gab in der Vergangenheit sicher einige Dinge, auf die er nicht stolz war. Das meiste hatte er verdrängt, was er hervorragend beherrschte.