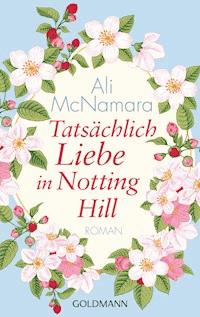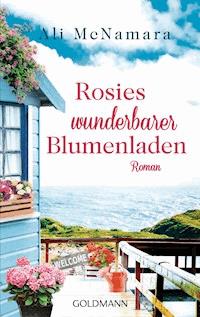
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Poppy den Blumenladen ihrer Großmutter Rosie im malerischen Küstenstädtchen St. Felix in Cornwall erbt, ist sie alles andere als begeistert. Im Gegensatz zum Rest ihrer Floristen-Familie möchte Poppy weder mit Blumen noch mit St. Felix etwas zu tun haben – denn mit beidem verbindet sie traurige Erinnerungen. Doch den letzten Wunsch ihrer geliebten Großmutter zu ignorieren, bringt sie einfach nicht übers Herz. Und als die Renovierung des alten Ladens ihr unverhofft nicht nur gute Freunde, sondern auch eine neue Liebe beschert, fragt Poppy sich, ob Rosies wunderbarer Blumenladen tatsächlich die Kraft besitzt, Wunden zu heilen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ali McNamara
Rosies wunderbarer Blumenladen
Roman
Aus dem Englischen von Sina Hoffmann
Goldmann
Zum Buch
Als Poppy Carmichael den Blumenladen ihrer Großmutter Rosie im verschlafenen Küstenstädtchen St. Felix in Cornwall erbt, ist sie alles andere als begeistert. Im Gegensatz zum Rest der Carmichaels, die alle erfolgreiche Floristen sind, möchte Poppy weder mit Blumen noch mit St. Felix etwas zu tun haben. Denn mit beidem verbindet sie schmerzhafte Erinnerungen, die sie lange hinter sich gelassen hat. Doch den letzten Wunsch ihrer geliebten Großmutter zu ignorieren, bringt sie einfach nicht übers Herz. Und als die Renovierung des alten Ladens Poppy nicht nur neue Feinde, neue Freunde und eine neue Liebe beschert, muss sie sich schließlich fragen, ob Rosies wunderbarer Blumenladen nicht die Macht besitzt, ihre Wunden zu heilen.
Weitere Informationen zu Ali McNamara sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die englische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »The Little Flower Shop by the Sea« bei Sphere, an imprint of Little, Brown Book Group, London
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Ali McNamara
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Getty Images / Hannah Bichay, FinePic®, München
Redaktion: Lisa Caroline Wolf
MR · Herstellung: kw
Gesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-20421-1V002
www.goldmann-verlag.de
Für Jake, meinen Basil
Prolog
1993
Mein Bruder und ich laufen durch die Stadt. Wir schlängeln uns durch die Urlauber hindurch, die sich entlang der Harbour Street tummeln, denn an diesem Samstag ist es besonders voll. Manche Leute essen Eis und Törtchen, andere wiederum suchen sich in einem der vielen, gut besuchten kleinen Läden Souvenirs aus, und wieder andere genießen einfach nur das sonnige Wetter.
Doch Will und ich wollen nicht von Geschäft zu Geschäft bummeln oder ein Eis essen, obwohl ich sehnsüchtig eine Frau anstarre, die ein großes, weißes, cremiges Eis mit Schokoladenraspeln in der Hand hält. Es ist ein ziemlich heißer Tag, und ich hätte liebend gern eins, obwohl wir gerade erst zu Mittag gegessen haben. Meine Großmutter sagt immer, mein Magen sei wie eine tiefe Grube, die man nie ganz auffüllen könne. Doch ich kann nichts dafür, ich habe eben immer Hunger – besonders, wenn wir hier am Meer sind.
Doch heute haben wir keine Zeit für ein Eis, ganz gleich, wie verführerisch es aussieht. Denn Will und ich sind unterwegs, um einen unserer Lieblingsmenschen zu treffen.
Will hält eine Papiertüte fest umklammert, und ich trage einen Blumenstrauß, den mir meine Großmutter in die Hand gedrückt hat, kurz bevor wir ihren Blumenladen verlassen und uns auf den Weg zur Bäckerei gemacht haben.
»Grüßt Stan von mir«, sagte sie wie immer. »Wünscht ihm alles Liebe von mir, ja?«
»Machen wir!«, riefen wir noch schnell, bevor wir aus dem Laden stürmten und die Straße hinunterliefen.
Endlich lassen wir das geschäftige Treiben der Harbour Street hinter uns und rennen zum Hafen, wo die Leute auf Bänke gequetscht die Sonne aufsaugen und die lauernden Seemöwen davon abzuhalten versuchen, sich ihre Fish and Chips oder den köstlichen Kuchen zu schnappen, den sie aus der Konditorei haben, die sich nur ein paar Häuser neben dem Laden meiner Großmutter befindet.
Mmmh, denke ich, als ich all das sehe, ich hätte schon wieder Lust auf ein Puddingtörtchen.
Irgendwann haben wir die Urlauber und die verführerischen Düfte der vielen Leckerbissen hinter uns gelassen und erklimmen den schmalen Pfad hinauf zu Pengarthen Hill.
»Da seid ihr ja, meine lieben jungen Freunde«, begrüßt uns unser Freund Stan, als wir auf dem Hügel ankommen. Von hier oben aus hat man einen herrlichen Blick über die Stadt und den Hafen. »Und ihr bringt Geschenke mit – ich frage mich, was das wohl sein könnte?«
»Eine Pastete natürlich!«, erwidert Will fröhlich und händigt ihm die Tüte aus.
»Und Blumen von unserer Großmutter«, erkläre ich und überreiche ihm den Strauß.
»Ah, die Blumen bringen immer so herrlich Farbe in meine bescheidene Hütte«, erwidert Stan und schnuppert daran. »Worauf habt ihr beide heute Lust? Wollt ihr eine Geschichte hören? Oder lieber gleich hinauf ins Schloss?«
»Geschichte!«, rufe ich, während Will zur gleichen Zeit »Schloss« sagt.
Stan lächelt. »Wie wäre es mit beidem? Ich erzähle euch eine Geschichte, während wir den Hügel zu Trecarlan hinaufgehen?«
Voller Vorfreude grinsen Will und ich, dann laufen wir Seite an Seite neben Stan her, und er erzählt uns eine seiner seltsamen, zauberhaften Anekdoten über sein wunderbares Zuhause.
Damals war alles so aufregend. Wir hatten tatsächlich einen Freund, der in einem Schloss lebte! Dort oben stellte ich mir immer vor, eine Märchenprinzessin zu sein.
Während ich mich daran erinnere, wie fröhlich wir gemeinsam den Hügel hinaufgelaufen sind, wünsche ich mir sehnlichst, damals schon gewusst zu haben, dass jene kostbare Zeit in den Sommerferien, die wir in St. Felix verbracht haben, die glücklichste Zeit meines Lebens sein würde.
1.
Narzisse – Neuanfänge
Das kann er doch wohl nicht sein, oder?
Ich stehe vor dem alten Blumenladen meiner Großmutter und starre zu dem Schild hinauf. The Daisy Chain steht dort in einer schnörkeligen gelben Schrift. Doch an den Ecken blättert allmählich die Farbe ab, sodass dort in Wahrheit he Daisy Chai steht, was eher nach einer orientalischen Teestube klingt.
Ich schaue die Straße mit dem Kopfsteinpflaster hinunter, auf der ich als Kind so oft unterwegs war, um beim Konditor die köstlichsten Kuchen und Pasteten und beim Zeitungshändler die Tageszeitung für meine Großmutter zu holen, und wo wir in einem Geschäft am Ende der Straße immer zum Ferienbeginn stundenlang einen glänzenden neuen Eimer und eine Schaufel aussuchen durften.
Doch, das ist der Laden, ganz sicher: Von hier aus sehe ich ein paar Häuser weiter den Konditor, der jedoch jetzt The Blue Canary heißt, nicht mehr Mr Bumbles wie damals. Der Zeitungshändler befindet sich weiter den Hügel hinauf, auf dem sich die Straße emporschlängelt, und es gibt immer noch einen Laden, der so aussieht, als würde er im Sommer Eimer und Schaufeln verkaufen. Doch heute, an einem regnerischen Montagnachmittag Anfang April, sind seine Türen geschlossen und das Licht ausgeschaltet.
Bereits so früh den Laden zu schließen, kann ich niemandem verdenken; es ist nicht gerade einer der besten Tage, um sich am Meer aufzuhalten. Ein nasskalter Nebel wabert über der Stadt und lässt alles feucht und farblos erscheinen, und in der kurzen Zeit seit meiner Ankunft in St. Felix habe ich kaum Urlauber gesehen. Oder überhaupt irgendwen, wenn ich so darüber nachdenke.
Dieser Effekt, den das nasse Küstenwetter auslöst, ist schon ein seltsames Phänomen. In einem Urlaubsort können sich in einem Augenblick noch die Besucher tummeln und die Sonne genießen, während im nächsten Moment die wechselnden Gezeiten dunkle Regenwolken mit sich bringen und alle Urlauber mit einem Schlag verschwunden sind und sich in ihre Hotels, Feriencottages oder Wohnwagen zurückziehen, die sie in dieser Woche ihr Zuhause nennen.
Als ich damals im Sommer während der Hauptsaison bei meiner Großmutter gewesen bin, habe ich mir manchmal tatsächlich Regenwetter gewünscht, um in Ruhe am Strand und an den Klippen entlangwandern zu können, ganz alleine und weit weg von allen anderen.
Mein Blick geht über das Kopfsteinpflaster die kurvige Straße hinauf. Oberhalb des Konditors, des Zeitungshändlers und des Strandshops entdecke ich einen kleinen Supermarkt, einen karitativen Second-Hand-Laden, eine Apotheke und etwas, das wie eine Kunstgalerie aussieht – sie befindet sich am oberen Ende der Straße, deswegen kann ich von hier aus nicht genau erkennen, um was es sich handelt. Aber das war’s auch schon: Ein paar kleinere Läden inmitten schrecklich vieler leerstehender Geschäftslokale, deren Schaufenster weiß gestrichen worden sind. Wo sind bloß all die Souvenirläden hin? Früher, als ich immer herkam, waren sie richtig beliebt gewesen. St. Felix hat sich mit der Qualität und der großen Auswahl an Souvenirs stets gebrüstet; und es hat hier auch nirgendwo diesen billigen, geschmacklosen Kram gegeben, den es sonst überall am Strand zu kaufen gab, wie alberne Hüte und T-Shirts mit unflätigen Slogans darauf. St. Felix ist stets ein Hafen für ortsansässige Künstler und ihre Arbeiten gewesen. Was ist nur geschehen?
Das Geschäft meiner Großmutter befindet sich am unteren Ende der Harbour Street, genauer gesagt an dem Punkt, wo das Kopfsteinpflaster zum Hafen hinunterführt. Als Erstes ist mir durch den Kopf gegangen, dass der Laden ein wenig heruntergekommen wirkt, doch nachdem ich nun all die anderen verfallenen Geschäfte gesehen habe, bin ich einfach nur froh, dass er überhaupt noch da ist. Unten im Hafen kann ich ein paar neue Fischerboote entdecken sowie einen hellgelben Sandstreifen – das Meer muss sich gerade auf dem Rückzug befinden. Hoffentlich nimmt die Ebbe das schlechte Wetter gleich mit.
Ein langer Tag liegt bereits hinter mir; die Fahrt von meiner Wohnung im Norden Londons bis nach St. Felix, der kleinen Stadt an der nördlichen Küste Cornwalls, wo sich der Blumenladen meiner Großmutter befindet, ist sehr ermüdend gewesen. In der Hoffnung, dass dies die anstrengende Fahrt mildern würde, hat mir meine Mutter vorher einen Leihwagen besorgt, einen brandneuen schwarzen Range Rover. Doch der Komfort dieses Wagens und die luxuriöse Ausstattung haben die Reise an einen Ort, zu dem ich gar nicht hinwollte, nicht leichter gemacht.
Mein Magen grummelt, als ich ein wenig verloren mein leicht zerzaustes Spiegelbild im Schaufenster des Blumenladens betrachte. Kein Wunder, dass mich der Mann an der Tankstelle, an der ich kurz Halt gemacht habe, so seltsam angestarrt hat. Mit meinem langen schwarzen Haar, das ich heute offen trage und das mein blasses Gesicht umrahmt, sehe ich sicher deutlich jünger aus als dreißig. Wahrscheinlich dachte der Mann, ich sollte eher hinten auf der Rückbank sitzen als auf dem Fahrersitz.
Ein älteres Ehepaar, das zwei süße Kleinkinder an den Händen hält – Zwillinge, ihrer Kleidung nach zu urteilen –, geht an mir vorbei. Die Dame bleibt kurz stehen, um einem der Mädchen die Jacke zu schließen. Als sie ihm die Kapuze über den Kopf zieht, um es vor den starken Windböen zu schützen, gibt sie ihm einen Kuss auf die Wange.
Diese kleine Geste rührt mich zu Tränen.
Meine Großmutter hat das früher bei mir auch immer getan …
Ich wende mich von ihnen ab und richte meinen Blick wieder auf den Laden – nicht ohne Gewissensbisse wie schon so oft heute. Zum einen, weil ich mich so sehr darüber beschwert habe, nach St. Felix zurückkehren zu müssen, und andererseits, weil ich das schon viel früher hätte tun sollen.
Denn meine Großmutter ist gerade gestorben.
Sie hat nicht das Zeitliche gesegnet, befindet sich nun nicht an einem besseren Ort, oder wie auch immer die Leute es nennen, um das Offensichtliche leichter akzeptieren zu können.
Sie ist schlicht und einfach gestorben und hat uns verlassen – wie es jeder letztlich tut.
Danach haben alle geweint. Ich jedoch nicht. Ich weine nicht mehr.
Schwarz tragen – der Teil fällt mir leicht, das ist ohnehin mein Ding.
Zu ihrer Beerdigung gehen und darüber reden, wie wunderbar sie gewesen ist. Bei ihrer Beerdigung so viel Essen in sich hineinstopfen wie möglich. Auch das alles bedeutete keine Schwierigkeit für mich.
Die gesamte Familie ist zur Testamentsverlesung von einem Anwalt einbestellt worden, der extra von Cornwall in ein nobles Londoner Hotel heraufgereist kam, um uns zu treffen.
Die gesamte Familie – das sind ich, meine Mutter und mein Vater, Tante Petal sowie meine zwei nervigen Cousinen, Violet und Marigold. Tatsächlich wurde die Testamentsverlesung nach der schrecklichen Beerdigung zunächst relativ unterhaltsam. Violets und Marigolds Gesichtsausdruck, nachdem ich als die Alleinerbin des Besitzes meiner Großmutter verkündet wurde, war amüsant – zumindest ein paar Sekunden lang. Als sich dann jedoch alle von diesem Schock erholt hatten, meine Mutter mich mit Tränen in den Augen umarmte und erklärte, dass damit endlich etwas aus mir werden würde, ist mir die Bedeutung dessen, was meine Großmutter da getan hat, allmählich klar geworden – und mit einem Mal hatte ich Mühe, ruhig zu atmen.
»Tut mir leid, Miss, aber dort werden Sie heute keine Blumen bekommen«, ertönt eine Stimme hinter mir und holt mich abrupt ins Hier und Jetzt zurück.
Als ich mich umdrehe, steht ein hochgewachsener junger Polizist vor mir, der die Arme hinter dem Rücken verschränkt hat und unter dessen Schirmmütze eine wahre Matte aus schwarzen Locken hervorlugt. Er deutet mit einem Kopfnicken auf die Schaufensterscheibe des Blumenladens. »Montags ist hier niemand – zumindest jetzt nicht mehr.«
»Aber sonst ist jemand da?«, frage ich überrascht. Soweit mir bekannt ist, hat niemand mehr den Laden betreten, seit meine Großmutter vor mehr als einem Jahr so krank geworden ist, dass sie sich nicht mehr um sich selbst kümmern konnte und in eine spezielle Privatklinik eingewiesen werden musste. Ihre Töchter haben darauf bestanden, die Kosten dafür zu übernehmen.
Er zuckt mit den Schultern, und anhand der fehlenden Rangabzeichen auf seinen Schultern erkenne ich, dass er ein Constable ist, ein Wachtmeister.
Ich bin nicht sonderlich stolz auf mein Wissen, woran man den Dienstrang eines Polizisten erkennt, mit dem man gerade zu tun hat, doch wenn man bereits so viele Begegnungen mit der Polizei hatte wie ich … Ich will es mal so ausdrücken: Es geht einem in Fleisch und Blut über.
»Doch, fünf Tage die Woche ist jemand da. Zumindest …«
Ich warte darauf, dass er fortfährt.
»Wissen Sie, die Floristin, der das Geschäft gehörte, ist leider verstorben. Offenbar ist sie eine sehr liebenswerte Dame gewesen.«
»Offenbar?«
»Ja, ich habe sie leider nie kennengelernt. Ich bin neu hier und erst seit ein paar Monaten im Dienst.«
»Wer führt denn den Laden jetzt?«
»Die örtliche Frauengemeinschaft.« Er schaut sich kurz um und senkt dann die Stimme. »Das ist eine resolute Truppe. Nicht wirklich geeignet für den Umgang mit einer zarten, grazilen Blume, wenn Sie verstehen, was ich meine. Die Damen jagen mir ein wenig Angst ein.«
Ich nicke verständnisvoll.
»Doch«, fährt er fort, »ich möchte nicht schlecht über irgendwen reden. Sie betreiben den Laden freiwillig und aus der Güte ihres Herzens heraus – was zumindest in meinen Augen nie schlecht sein kann.«
»Ja, natürlich.« Ich lächle ihn höflich an.
»Aber montags ist er geschlossen, verstehen Sie? Wenn Sie also Blumen kaufen wollen, haben Sie heute leider kein Glück.«
»Ach, nicht so schlimm«, erwidere ich in der Hoffnung, er würde mich nun in Ruhe lassen. »Dann vielleicht ein anderes Mal.«
»Bleiben Sie länger in St. Felix?«, fragt er und scheint offensichtlich unser Gespräch fortsetzen zu wollen. Er schaut zum Himmel hinauf. »Denn heute ist leider nicht gerade der beste Tag, um die Stadt von ihrer schönsten Seite zu erleben.«
»Ich bin noch nicht sicher. Hoffentlich nicht allzu lange.«
Er sieht mich überrascht an.
»Also, vielleicht ein paar Tage.« Auch ich schaue zum Himmel hinauf. »Kommt ganz aufs Wetter an …«
»Ah, verstehe. Guter Plan. Guter Plan.« Er lächelt. »Das mit dem Laden tut mir leid – und ich möchte die Damen nicht beleidigen, wenn ich das so sage, Sie verstehen schon –, aber ihr Umgang mit den Blumen ist ein wenig altmodisch. Wenn Sie etwas Moderneres suchen, sollten Sie besser den Hügel hinauf zu Jake gehen. Er wird sich um Sie kümmern.«
»Und Jake ist …?«, erkundige ich mich und ahne sogleich, dass ich die Frage noch bedauern könnte.
»Ihm gehört die Gärtnerei oben auf Primrose Hill. Er liefert Blumen ins gesamte Umland aus. Unter uns gesagt …« Er beugt sich zu mir vor und senkt ein weiteres Mal die Stimme. »Ich gehe immer zu ihm, wenn ich Blumen für die eine besondere Dame in meinem Leben brauche.«
»Und das ist … Ihre Mutter?« Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, ihn aufzuziehen. Dieser Constable hier ist so vollkommen anders als die Beamten der Metropolitan Police, die mir in London begegnet sind. Obwohl ich beim Gedanken daran feststellen muss, dass die meisten Begegnungen mit ihnen nicht gerade freundschaftlicher Natur gewesen sind; meistens bin ich festgenommen worden. Nichts Schlimmes – meine Vergehen reichten von Ruhestörung über Trunkenheit und Ordnungswidrigkeiten bis hin zu meinem heimlichen Favoriten, nämlich dem Versuch, oben auf dem Trafalgar Square auf einen der Löwen zu klettern. In meiner Jugendzeit bin ich ein kleiner Rebell gewesen, das ist alles. Wirklich kriminell kann man das nicht nennen.
»Ja. Ja, das stimmt«, murmelt er, während sich seine Wangen röten. »Blumen für meine Mutter. Na gut, ich muss los – ich habe einiges zu tun, wissen Sie? Diese Stadt funktioniert nicht von allein.«
Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn geneckt habe, dabei scheint er ein ziemlich netter Kerl zu sein.
Er nickt. »Schön, Sie kennengelernt zu haben, Miss.«
»Ebenfalls, Police Constable …«
»Woods«, antwortet er stolz. »Aber alle hier nennen mich nur Woody. Ich versuche immer wieder, das zu unterbinden, doch irgendwie ist der Name an mir klebengeblieben. Mir graut ein wenig davor, was meine Vorgesetzten sagen, wenn sie davon erfahren – schließlich zeugt er nicht gerade von Autorität.«
Ich muss grinsen. »Aber ich finde, der Name passt gut zu Ihnen. Vielen Dank jedenfalls für den Tipp mit den Blumen, Wood…, also ich meine PC Woods. Ich bin sicher, dieser Tipp wird sich noch als sehr hilfreich erweisen.«
Er nickt. »Ich erledige nur meine Arbeit, Miss.« Dann dreht er sich elegant auf dem Absatz seiner schwarzen, glänzenden Schuhe um und läuft mit schnellem Schritt die Kopfsteinpflasterstraße entlang, während seine Arme entschlossen links und rechts mitschwingen.
Ich drehe mich wieder um und mustere das Geschäft.
»Na gut, dann lass uns mal sehen, was du mir da vererbt hast, Grandma Rosie«, sage ich leise und suche in meiner Tasche den Schlüssel, den meine Mutter mir heute Morgen in die Hand gedrückt hat, bevor ich sie und meinen Vater für ihren Rückflug in die Staaten in Heathrow abgesetzt habe. »Oder sollte ich besser sagen, was du mir da zum Verkauf hinterlassen hast …«
Als ich zum ersten Mal seit fünfzehn Jahren müde die Ladentür öffne, schnürt es mir die Kehle zu. Denn einmal mehr schweifen meine Gedanken zum Tag der Beerdigung zurück.
»Warum um alles in der Welt hat Grandma Rosie mir ihren Blumenladen vermacht?«, protestierte ich mitten hinein in die Stille der Hotellounge. »Ich hasse Blumen, und sie wusste das! Hat sie mich wirklich so sehr gehasst?«
»Poppy!«, ermahnte mich meine Mutter daraufhin. »Sprich nicht so über deine Großmutter. Rose hat dich sehr geliebt, und das weißt du auch. Der Laden ist das erste Unternehmensglied in der Daisy-Chain-Kette. Sie hätte dir den Laden nicht vermacht, wenn sie nicht überzeugt gewesen wäre, du …« Sie hielt inne, und mir wurde klar, was sie dachte: Ihre Mutter musste den Verstand verloren haben, ihren geliebten Laden mir zu vererben.
Ich habe das alles schon einmal gehört, viel zu oft sogar – dass in dieser Familie die Blumen schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben … und von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Dass mindestens eine Person jedes Familienzweiges der Carmichael-Familie einen Blumenladen besitzt, leitet oder dort als Florist arbeitet. Es kommt mir wie eine gesprungene Schallplatte vor, die allerdings nie vom Plattenteller genommen wird. Aber das ist noch nicht alles. The Daisy Chain ist mittlerweile ein internationales Unternehmen: Meine Mutter hat eine Filiale in New York, eine entfernte Cousine besitzt einen Laden in Amsterdam, und ein anderer Cousin wird in diesem Jahr noch einen in Paris eröffnen. Alle Carmichaels lieben Blumen – alle außer mir. Mir mag die Bürde der Familientradition auferlegt worden sein, dass alle Kinder einen Namen mit Blumenbezug tragen müssen, doch da hört die Affinität bei mir auch schon auf. In meinem Leben gibt es keine Blumen, und ich habe nicht vor, das in absehbarer Zeit zu ändern.
»Jetzt sag es schon …«, forderte ich sie auf. Ich wollte es aus dem Mund meiner Mutter hören. Mir ist klar, dass ich das schwarze Schaf der Carmichael-Familie bin; ich bin diejenige, über die man bei Familienfeiern hinter vorgehaltener Hand redet. Vielleicht hat meine Großmutter das einfach ignoriert und gedacht, dass es mir helfen wird, wenn sie mir den Laden vererbt. Wie konnte sie sich nur so irren?
Meine Mutter holte tief Luft. »Sie hätte dir den Laden nicht vererbt, wenn sie nicht gedacht hätte, dass du etwas Gutes daraus machst.«
»Vielleicht.« Ich zuckte mit den Schultern.
»Poppy.« Meine Mutter streichelte tröstend mit den Händen über meine Oberarme. »Ich weiß, wie schwierig das alles für dich ist, das weiß ich wirklich. Aber deine Großmutter hat dir hier eine einmalige Gelegenheit eröffnet. Die Gelegenheit, mit deinem Leben etwas Positives anzustellen. Bitte gib der Sache wenigstens eine Chance.«
Dann kam mein Vater dazu. »Kannst du nicht wenigstens hinfahren und dir den Laden einmal ansehen, Poppy? Für deine Mutter, wenn du es schon nicht für dich tust? Du weißt doch genau, wie viel ihr der Laden deiner Großmutter bedeutet – und der ganzen Carmichael-Familie.«
Ein feiner Sprühregen hat eingesetzt, sodass ich nicht mehr länger unentschlossen vor der Türschwelle hin und her wandere, sondern nach drinnen husche und schnell die Tür hinter mir schließe. Das wirklich Letzte, was ich will, ist, dass die anderen Ladenbesitzer rundum sehen, dass ich hier bin, und dann herüberkommen und ans Schaufenster klopfen, um sich mit mir zu unterhalten. Denn ich habe nicht vor, lange zu bleiben.
Ich widerstehe der Versuchung, das Licht anzuschalten, weshalb ich nun versuchen muss, in dem wenigen Tageslicht, das durch die Scheiben hereinfällt, das Innere des Ladens so gut wie möglich zu erkennen.
Das Ladenlokal ist größer, als ich es in Erinnerung habe. Vielleicht weil es bisher immer randvoll mit Blumen vollgestopft war. Als meine Großmutter noch gelebt hat, konnte man sich hier kaum bewegen, ohne in ein Blechgefäß zu laufen, das mit leuchtend bunten Blüten gefüllt war, die nur darauf warteten, zu einem Strauß gebunden zu werden und dann in die Welt hinauszukönnen, um jemandem den Tag zu verschönern.
Im Geschäft wimmelt es immer noch vor Blecheimern, doch heute sind diese auf eine unheimliche Art und Weise leer, als würden sie immer noch darauf hoffen, dass jemand vorbeikommt und sie mit den jüngsten Knospen füllt.
Ich seufze. Obwohl ich keine Blumen mag und nichts mit ihnen zu tun haben will, habe ich meine Großmutter geliebt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich bei ihr in St. Felix viele sonnige Ferientage verbracht habe. Hier sind mein Bruder und ich zu Experten darin geworden, wie man am Strand Sandburgen baut, und als wir ein wenig älter und kräftiger waren, haben wir hier surfen gelernt. Wenn abends in St. Felix die Flut kam, brachen hohe Wellen auf den Sand Cornwalls hinunter und zerstörten die am Tage sorgsam gebauten, aber nun verlassenen Sandburgen. Meine Großmutter hat uns immer von ihrem rot-weiß gestreiften Liegestuhl aus angefeuert, während sie eine Thermosflasche mit heißem, dampfendem Kakao für uns bereithielt, mit dem wir unsere nassen, schmerzenden Körper wieder aufwärmen konnten, wenn wir nicht mehr länger gegen die Wellen ankämpfen konnten …
Ich schüttele den Kopf.
Das gehört alles der Vergangenheit an. Ich muss mich auf das konzentrieren, was ich hier und jetzt zu tun habe. Darum taste ich mich vorsichtig in dem gedämpften Licht vorwärts und versuche dabei, die Ausstattung und das Inventar abzuschätzen. Wahrscheinlich muss ich alles einzeln verscherbeln, wenn ich den Laden zum Verkauf anbiete und der Käufer das Inventar nicht haben will. Aber ehrlich gesagt sieht alles nicht danach aus, als sei es noch viel wert. Um mich herum kann ich nur schwere dunkle Eichenmöbel erkennen. Die hohen Anrichten und Vitrinen sind leer und stehen vor schmutzigen, ehemals cremefarbenen Wänden. Wer will solche Schränke schon kaufen? Heutzutage entscheiden sich Ladenbesitzer für eine moderne, helle Ausstattung – um das »Einkaufserlebnis« für den Kunden so angenehm wie möglich zu gestalten.
Einmal habe ich ein paar grausige Monate während der Vorweihnachtszeit in einem großen Supermarkt gearbeitet und an der Kasse gesessen. Ich wurde beinahe wahnsinnig dabei, wie ich stundenlang die immensen Weihnachtseinkäufe der Leute über den Barcodescanner schieben musste. Es wurde so schlimm, dass ich Albträume bekam von den »Drei für zwei«- und den »Zwei zum Preis von einem«-Angeboten, bis ich schließlich den Punkt erreicht hatte, an dem ich mitten während einer meiner Schichten auf das Kassentransportband sprang – wie auf ein Laufband im Sportstudio. Dabei schrie ich allen zu, die es hören wollten, dass die Gier uns noch umbringen würde und dass wir uns schämen müssten.
Wenn dieser Zwischenfall nur ein Traum gewesen wäre, wie ich ihn oft vom Supermarkt gehabt habe, wäre alles nicht so schlimm … Doch es war keiner. Zwei Leute vom Sicherheitsdienst, die es wahnsinnig aufregend fanden, endlich etwas anderes zu tun zu haben, als den ganzen Tag lang nur auf die Überwachungsmonitore zu starren, zerrten mich vom Transportband herunter und brachten mich zum Büro des Geschäftsführers, wo ich auf der Stelle gefeuert und mir bei jedem Zweig dieser Supermarktkette im Umkreis von fünfzig Meilen ein Hausverbot erteilt wurde.
Dies war ein weiterer Punkt auf der immer weiter anwachsenden Liste mit dem Titel: Jobs, die Poppy in den Sand gesetzt hat.
Warum sollte es bei diesem Laden – immerhin der ganze Stolz meiner Mutter – anders werden?
»Alle anderen von uns hätten sich regelrecht darum gerissen, Großmutters Laden zu übernehmen«, meldete sich Marigold bei der Testamentseröffnung zu Wort. »Es wäre eine Ehre für uns alle gewesen. Wer weiß, warum sie ihn dir vermacht hat, Poppy.«
»Ich weiß …«, schloss sich Violet dem Genörgel an. »Ausgerechnet dir! Kannst du so etwas überhaupt schaffen?« Sie neigte den Kopf zur Seite und musterte mich mit übertriebenem Mitleid. »Ich habe mitbekommen, dass du immer noch in medikamentöser Behandlung bist.«
»Die einzige Medizin, die ich nehme, ist eine Pille, um mit nervigen, unhöflichen Cousinen klarzukommen«, entgegnete ich, als sie mich finster anstarrte. »Wie du sehr wohl weißt, Violet, geht es mir seit einiger Zeit sehr gut. Vielleicht hat Mum ja recht, und Grandma Rosie wusste das und wollte mir eine Chance geben. Anders als andere Leute.«
Wie ein bockiges Kind streckte Violet mir daraufhin die Zunge heraus.
»Ich weiß ja nicht, Flora«, wandte sich Tante Petal mit besorgtem Blick dann an meine Mutter. »Das Daisy Chain ist ein so wichtiger Teil unserer Geschäftstradition. Sollen wir wirklich Poppy erlauben, dafür verantwortlich zu sein? Mit ihrer … Vergangenheit?« Sie flüsterte das letzte Wort, als sei es pures Gift.
»Hallo? Ich stehe hier neben euch, wisst ihr das?«, erinnerte ich sie.
»Poppy.« Meine Mutter hob die Hand, um mich zum Schweigen zu bringen. »Meine Tochter mag in der Vergangenheit ihre Probleme gehabt haben, das wissen wir alle. Genauso sehr, wie wir alle wissen«, fügte sie spitz hinzu, »wodurch diese ausgelöst worden sind.«
Daraufhin schauten die anderen allesamt verlegen zu Boden, und ich schloss die Augen. Ich kann es nicht ertragen, wenn andere mich bemitleiden.
»Aber sie hat sich verändert, nicht wahr, Poppy? Wie lange bist du bei deinem letzten Arbeitgeber angestellt gewesen?«, fragte mich meine Mutter und nickte mir aufmunternd zu.
»Sechs Monate«, murmelte ich.
»Seht ihr!«, schrie Marigold auf. »Sie kann an keiner Sache wirklich mal dranbleiben.«
»Dieses Mal war es aber nicht meine Schuld. Ich dachte, der Typ im Hotelzimmer wollte mich anmachen, was hätte ich denn da bitte tun sollen?«
Mit meinem letzten Job war ich eigentlich recht glücklich gewesen; ich hatte als Zimmermädchen in einem Fünf-Sterne-Hotel in Mayfair gearbeitet. Die Arbeit an sich war hart gewesen, aber nicht sonderlich anspruchsvoll, und es hatte mir doch mehr Spaß gemacht als zunächst befürchtet. Tatsächlich hatte ich diesen Job länger behalten als jeden anderen zuvor. Zumindest bis eines Abends ein Gast mir für meinen Geschmack ein wenig zu nah gekommen ist, nachdem ich angeklopft hatte, um sein Bett für die Nacht fertig zu machen – übrigens ein ziemlich sinnloser Teil des Jobs, wenn man mich fragt. Mal ehrlich, wer konnte denn bitte nicht selbst seine Bettdecke zurückschlagen? Es hatte jedoch zu meinem Aufgabenbereich dazugehört. Also klopfte ich jeden Abend gegen sechs Uhr an alle Türen des Hotels. Bei besagter Gegebenheit war mir im Nachhinein mitgeteilt worden, ich hätte überreagiert, als ich eine Wasserkaraffe über dem Kopf eines Gastes ausgekippt hatte, nachdem mir dieser vom Bett aus vorgeschlagen hatte, ihm dabei zu helfen, »seine Ausstattung zu testen, um zu sehen, ob alles funktioniert«. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass er sich fünf Minuten zuvor bei der Rezeption gemeldet hatte, um zu fragen, ob jemand kommen und sich um das Surround-Sound-System kümmern könne, das offenbar nicht funktioniert hatte?
So kam es dazu, dass ich gebeten worden war, schon wieder einen Job an den Nagel zu hängen.
Meine Mutter ignorierte die Unterbrechung und schien ihr Lächeln offenbar festbetoniert zu haben.
»Na ja, egal, wie lang du da beschäftigt warst«, erklärte sie, »es war jedenfalls eine Verbesserung, und das ist alles, was wir sehen wollen.« Sie nickte den anderen zu und hoffte auf Zustimmung. »Ich finde, wir sollten Poppy eine Chance geben, sich nicht nur uns gegenüber zu beweisen, sondern auch sich selbst. Ich weiß, dass du es kannst, Poppy«, stellte sie fest und drehte sich zu mir um. »Und Grandma Rosie wusste das auch.«
Ich starre durch die Dunkelheit zum hinteren Teil des Ladens, um zu sehen, ob die hölzerne Theke, an der meine Großmutter ihre Kunden bedient hat, noch existiert. Zu meiner großen Überraschung steht sie tatsächlich immer noch da, also bahne ich mir vorsichtig einen Weg durch den Laden zur Theke hin, stoße dabei allerdings einen der leeren Blecheimer um, die auf dem Boden stehen, und stelle ihn schnell wieder auf.
Mein Bruder und ich haben viele Stunden damit verbracht, uns hinter der Theke zu verstecken, wenn Kunden hereinkamen; aus Spaß sind wir dann manchmal aus unserem Versteck hervorgesprungen, um sie zu erschrecken. Na gut, ich habe das getan; Will war immer zu höflich und wohlerzogen, um tatsächlich jemandem Angst einzujagen.
Sanft streiche ich mit der Hand über die glatte, warme, mittlerweile abgenutzte Holzoberfläche, und Erinnerungen füllen den Verkaufsraum. Es ist, als hätte ich an einer Wunderlampe gerieben und damit einen Flaschengeist befreit, der aus Erinnerungen besteht.
Ich frage mich …?
Schnell knie ich mich hinter die Theke, hole mein Handy heraus und aktiviere die Taschenlampenfunktion. Als die Unterseite der Theke von Licht erfüllt wird, dirigiere ich den Lichtstrahl in eine Ecke.
Sie ist immer noch da.
Links oben befindet sich eine Inschrift. In einem Moment der Kühnheit – vielleicht auch ein wenig als Mutprobe – ist sie grob mit einer Blumenschere meiner Großmutter hineingeritzt worden.
W & P waren hier – Juli’95
Den Teil hat Will geschrieben. Ich muss lächeln, als ich seinen korrekten Apostroph sehe, das die Zahl neunzehn ersetzt. Bei Will mussten selbst Graffiti stets grammatikalisch korrekt sein.
Rebellen für immer …
Das habe ich darunter geritzt.
Nur dass wir keine echten Rebellen waren; wir waren liebe Kinder, wenngleich auch manchmal ein wenig frech. Ich war zehn, als wir das geschrieben haben, Will zwölf.
Ich hätte nie gedacht, dass ich selbst zwanzig Jahre später immer noch rebellisch sein würde.
»Ich … ich weiß es nicht«, stotterte ich vor meiner gespannten Familie, die auf meine Entscheidung wartete. »Ich hasse Blumen – ihr alle wisst das, und ich trage auch nicht gern Verantwortung, das ist einfach nicht mein Ding. Vielleicht sollte ich den Laden verkaufen?«
Ein kollektives Keuchen ertönte.
Meine Mutter seufzte schwer. »Gebt mir eine Minute«, bat sie die anderen, bevor sie sich alle auf mich stürzen konnten. Sie nahm meine Hand und zerrte mich ins Foyer des Hotels.
»Poppy, Poppy, Poppy«, sagte sie traurig und schüttelte den Kopf. »Was mache ich nur mit dir?«
»Na ja, ich bin vielleicht ein wenig zu alt, um den Hintern versohlt zu bekommen«, scherzte ich. Das ist mein gewohnter Verteidigungsmechanismus, wenn die Situation für mich zu ernst wird. »Man sieht nicht viele Dreißigjährige, die mit einer Haarbürste eine Tracht Prügel versetzt bekommen – zumindest nicht in einem Foyer eines so vornehmen Hotels wie diesem hier. Vielleicht eher oben auf den Zimmern …«
Meine Mutter blickte mich tadelnd an. »Das hier«, sie legte sanft einen Finger auf meinen Mund, »wird dir eines Tages noch einmal große Probleme einhandeln. Du bist temperamentvoll, Poppy, sehr angriffslustig mit einem scharfen Verstand und einem hitzigen Gemüt. Das ist eine gefährliche Kombination.«
Ich lächelte reumütig. »Schon passiert. Mehrfach.«
Meine Mutter trat einen Schritt zurück, um mich zu mustern. »Weißt du, wahrscheinlich hast du dein Temperament von ihr geerbt«, erklärte sie nachdenklich. »Ich erinnere mich noch gut daran, wie deine Großmutter meinen Vater nur mit ihrer scharfen Zunge unter Kontrolle halten konnte. Sie hat es nie ernst gemeint, alles war immer ein Scherz – genau wie bei dir.« Dann beugte sie sich vor, um mir übers Haar zu streichen. »Als sie noch jünger war, hatte deine Großmutter eine rabenschwarze Mähne wie du. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich ihr vor ihrem Frisierspiegel stundenlang das Haar gekämmt habe. Damals gab es so etwas wie Glätteisen noch nicht, um eine Mähne wie die deine zu zähmen – ich denke mal, dass deine Großmutter ihr Haar darum die meiste Zeit hochgesteckt getragen hat.« Sie musste seufzen, als diese schönen Erinnerungen von ihren derzeitigen Sorgen abgelöst wurden, bei denen ich wie immer eine Rolle spielte. »Ich habe keine Ahnung, was meine Mutter sich dabei gedacht hat, dir ihren geliebten Laden zu überlassen, Poppy – ich habe nicht die geringste Ahnung. Sie hatte keinerlei Illusionen, wie du bist. Aber wie ich sie kenne, hatte sie ihre Gründe … und obwohl ich es in jüngeren Jahren niemals zugegeben hätte, in den meisten Fällen hatte sie recht.«
Dann sah sie mich an; ihre dunklen Augen flehten mich an, es mir noch einmal zu überlegen.
»Okay, okay – ich fahre hin«, murmelte ich schnell und starrte auf meine Doc Martens hinunter. Sie glänzten ungewohnt, da ich sie extra für die Beerdigung poliert hatte.
»Tatsächlich?« Ihr Gesicht leuchtete auf, als hätte ich ihr gerade einen Lottogewinn mitgeteilt. »Das ist eine wunderbare Nachricht!«
»Aber unter einer Bedingung. Ich werde nach St. Felix fahren und mir den Laden ansehen, aber wenn das nichts für mich ist oder ich irgendwelche … Probleme haben sollte, wenn ich dort bin, dann wird das Geschäft verkauft. Okay? Keine moralischen Verpflichtungen.«
Meine Mutter zuckte leicht zusammen, nickte dann aber. »Klar, Poppy, abgemacht. Ich hoffe nur, dass St. Felix seinen Zauber auf dich wirken lassen kann wie damals, als du noch klein warst.« Dann tat sie etwas, das schon seit einer Ewigkeit nicht mehr geschehen war: Sie zog mich in ihre Arme und drückte mich fest. »Vielleicht bekomme ich dann meine alte Poppy wieder. Ich vermisse sie nämlich.«
Als ich die Umarmung meiner Mutter erwiderte, war mir eines mit absoluter Sicherheit klar: Solange St. Felix nicht das Rad der Geschichte zurückdrehen konnte, würde ich niemals mehr diese Poppy sein.
2.
Kamelie – Mein Schicksal in deinen Händen
»Ist hier jemand?«
Als ich unter der Theke sitze und in tröstlichen Erinnerungen schwelge, reißt mich plötzlich eine Stimme aus meinen Gedanken. Sie lässt mich so sehr aufschrecken, dass ich mir den Kopf stoße.
»Schei…benkleister!«, bekomme ich so gerade noch die Kurve, als mich ein männliches Gesicht über die Ladentheke hinweg fragend ansieht.
»Was machst du da?«, fragt es mich beunruhigt, und jetzt erkenne ich, dass es zu einem hochgewachsenen, breitschultrigen Körper gehört.
»Ich suche etwas.« Ich erhebe mich und reibe mir den Kopf. »Warum? Was geht dich das an?«
»Darfst du hier sein?«, fragt er, während mich seine schokoladenfarbenen Augen von oben bis unten misstrauisch mustern.
»Hältst du mich für eine Verbrecherin? Sollte ich eine sein, so wäre ich keine besonders schlaue: Hier gibt es nichts zu stehlen.«
»Du wärst zudem eine sehr laute.«
Ich starre ihn ausdruckslos an.
»Ich bin eben die Straße hinuntergegangen und habe gehört, dass hier drinnen etwas umgefallen ist«, erklärt der Mann. »Deswegen wollte ich nach dem Rechten sehen.«
Ich schaue zu dem Blecheimer hinüber, den ich eben umgeworfen habe. »Oh … Ich verstehe.«
»Also: Was hast du hier zu suchen?« Der Mann steht breitbeinig und mit verschränkten Armen vor mir. Die klassische männliche Abwehrhaltung. Eine meiner früheren Therapeutinnen war eine Expertin für Körpersprache – sie hat mir viel beigebracht.
Ich seufze und klimpere vor seinen Augen mit dem Schlüssel. »Ich bin die neue Besitzerin.«
Offenbar überrascht ihn diese Antwort. »Ich dachte, Rosies Enkelin würde den Laden übernehmen.«
»Woher weißt du das?«, frage ich.
»Ihre Mutter hat angerufen und mir gesagt, dass sie bald kommt. Ich bin Jake Asher, der Besitzer der Gärtnerei im Dorf.«
»Oh, du bist Jake!«
»Ja«, erwidert er zögerlich und sieht mich verwirrt an. »Und du bist …?« Doch bevor ich antworten kann, hebt er die Hand. »Nein, warte, du musst Rosies Enkelin sein.« Er nickt zuversichtlich. »Ja, das würde alles erklären.«
»Was denn?«
»Nichts. Nur ein paar Dinge, die deine Mutter mir am Telefon über dein Temperament erzählt hat …«
Seine Stimme verebbt, als ich ihn mit zusammengekniffenen Augen anstarre.
»Vielleicht sollten wir noch einmal von vorn anfangen, hmmm?«, fragt er und streckt mir seine Hand entgegen. »Willkommen in St. Felix!«
Ich beäuge ihn skeptisch, bevor ich seine Hand ergreife, die überraschend groß ist. Seine Finger schlingen sich um meine und schütteln sie.
»Danke.«
Plötzlich raschelt es oben auf einem der Holzregale, und im Dunkeln kann ich einen Schatten erkennen, der daran hinunterklettert.
»Was zum Teufel ist das?«, schreie ich und will mich schon wieder unter die Theke ducken.
»Schon gut«, beschwichtigt Jake und streckt den Arm aus. »Das ist nur Miley.«
Etwas springt vom Regal herunter und landet auf Jakes Schulter.
»Ist das ein Äffchen?«, frage ich erstaunt, da ich in dem unbeleuchteten Ladenlokal immer noch nichts richtig erkennen kann.
»Das ist sie in der Tat.« Er geht zur Tür und schaltet das Licht im Laden an. »Ein Kapuzineräffchen, um genau zu sein.«
»Aber warum?«, frage ich und starre das winzige, pelzige Wesen an.
Es beäugt mich argwöhnisch, während es sich die linke Pfote leckt.
»Warum das ein Kapuzineräffchen ist? Weil Mama Affe und Papa Affe was miteinander hatten und dann …«
»Sehr witzig. Nein, ich meinte: Warum hast du einen Affen? Ist es nicht grausam, ihn als Haustier zu halten?«
»Normalerweise würde ich dir zustimmen.« Jake streichelt das Äffchen unter dem Kinn, woraufhin es sich in seine Hand schmiegt. »Aber Miley ist anders. Drüben in den Staaten ist sie trainiert worden, bei Behinderten als Hilfe eingesetzt zu werden. Doch sie ist den Anforderungen nicht gerecht geworden. Für den Geschmack der Hilfsorganisation war sie ein wenig zu rebellisch. Sie konnte jedoch nicht wieder in die Wildnis oder einen Wildpark entlassen werden, da sie sich zu sehr an Menschen gewöhnt hatte. Als mir Freunde, die in den USA leben, von ihr erzählt haben, war ich sofort bereit, sie zu mir zu nehmen.« Miley streicht über Jakes rotblondes Haar, bevor sie dann zu meinem großen Entsetzen anfängt, ihn zu entlausen.
Ich verziehe das Gesicht.
»Schon gut, sie wird in meiner Haarmähne nichts zu essen finden!«, scherzt Jake und holt eine Nuss aus seiner Tasche. Diese reicht er Miley, die gierig auf eine leere Kommode springt und sofort anfängt, die Schale zu entfernen. »Sie tut nur das, was für sie vollkommen natürlich ist.«
Misstrauisch beäuge ich Miley von meinem Platz hinter der Theke aus.
»Du hast dich also bereit erklärt, dich um ein Äffchen zu kümmern – einfach so?«, frage ich zweifelnd. Affen sieht man normalerweise im Zoo oder im Fernsehen. Für mich ist es ungewohnt, jemanden vor mir zu haben, der einen Affen als Haustier hält.
»Ja«, erwidert Jake zu meiner Überraschung knapp. »Einfach so. Warum? Hast du damit ein Problem?«
»Neeeein …« Abwehrend hebe ich die Hände. »Was du mit deinem Affen treibst, geht mich nichts an.«
Jakes Mundwinkel fangen an zu zucken.
Als mir allmählich klar wird, was ich da gesagt habe, werde ich rot. Ich schaue zum Äffchen hin: Mittlerweile ist sie mit ihrer Nuss fertig und beäugt mich wieder argwöhnisch.
»Isst sie Obst?«, erkundige ich mich schnell. »Ich habe einen Apfel in meiner Tasche.«
Jake nickt. »Ja, Miley liebt Äpfel.«
Ich krame in meinem Lederrucksack herum und hole einen grünen Apfel heraus, der schon ein wenig mitgenommen aussieht. Ich halte ihn ihr hin.
»Ähm …«, stottert Jake.
»Oh, mag sie keine Golden Delicious?«
Jake grinst. »Sie ist zwar wählerisch, aber so wählerisch dann auch nicht. Der Apfel ist zu groß für sie.«
»Oh! Oh klar, natürlich!« Eilig schaue ich mich nach etwas um, womit ich den Apfel kleinschneiden kann. »Warte mal«, sage ich und eile ins Hinterzimmer, wo meine Großmutter immer die Blumen zu wunderschönen und oftmals exotischen Sträußen gebunden hat, die ein strahlendes Lächeln auf die Lippen des glücklichen Empfängers zauberten.
Es ist, als würde ich eine Zeitreise machen: Hier im Hinterzimmer hat sich kaum etwas verändert. Wenn überhaupt, dann ist es hier aufgeräumter als früher – was wahrscheinlich der örtlichen Frauengemeinschaft zu verdanken ist oder allen, die sich um den Laden kümmern.
Auf einem Regal finde ich einen Topf mit allen möglichen Floristenwerkzeugen, darunter auch das Messer, das ich gesucht habe. Meine Großmutter hat es immer benutzt, um die Blumenstiele in einem scharfen Winkel abzuschneiden, damit sie schneller und besser Wasser aufnehmen können. Schon seltsam, woran man sich so alles erinnert, denke ich, packe das Messer sowie ein Holzbrett und kehre in den Verkaufsraum zurück.
»Du musst dir nicht all die Mühe machen«, erklärt Jake. »Sie hatte jetzt eine Nuss, damit wird sie eine Weile lang zufrieden sein.«
»Schon gut, ehrlich. Ich habe ihr eben einen Apfel angeboten, deswegen wäre es nicht fair, das Angebot wieder zurückzuziehen. So etwas mache ich nicht.«
Jake beobachtet mich, während ich den Apfel in dünne Spalten schneide. »So, was soll ich jetzt tun?«
»Halte es ihr einfach hin. Wenn sie den Apfel will, wird sie schon zu dir kommen. Aber ich muss dich vorwarnen, Miley mag normalerweise Fremde gar n… oh!«
Miley sitzt bereits vor mir auf der Ladentheke und nimmt eine Apfelspalte in ihre winzigen Pfoten.
»… aber offensichtlich mag sie dich«, beendet er seinen Satz.
Schweigend beobachten wir, wie Miley grazil an einem Apfelstück knabbert.
»Warum hat meine Mutter dich angerufen?«, platzt es zur gleichen Zeit aus mir heraus, als Jake mich fragt: »Was hast du mit dem Laden vor?«
»Deine Frage zuerst«, entscheidet er. »Sie hat mich angerufen, weil ich den Laden mit Blumen beliefere, und sie wollte mich wissen lassen, dass von nun an du hier die Verantwortung hast. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ein paar Frauen aus dem Dorf haben sich um den Laden gekümmert, seitdem deine Großmutter ins Krankenhaus gekommen ist. Sie haben ihr Bestes gegeben, doch ihre Vorstellung davon, wie Blumensträuße auszusehen haben, ist nicht ganz das, woran St. Felix gewöhnt war.«
Eine Blume ist eine Blume, oder? Ich muss plötzlich an Woody denken. Warum scheinen die Leute hier anderer Meinung zu sein?
»Aber es ist toll von ihnen, dass sie diese Aufgabe übernommen haben.«
»Ja, auf jeden Fall«, stimmt er mir zu. »Deine Großmutter war hier sehr beliebt. Ein paar Leute sind sogar rauf nach London zu ihrer Beerdigung gefahren.«
»Ja, ich weiß.«
»Du musst also nun meine Frage beantworten«, fordert er mich auf. »Aber bitte gib Miley nicht den ganzen Apfel, ja? Wenn sie zu viel isst, bekommt sie schreckliche Blähungen.«
Ich muss ein Kichern unterdrücken. »Die Antwort lautet, dass ich noch nicht weiß, was ich mit dem Laden anstellen soll.« Ich schaue mich ein weiteres Mal um. »Blumen und ich … na ja …« Ich deute auf meine Kleidung – heute trage ich eine schwarze hautenge Jeans, meine bordeauxroten Doc Martens sowie ein weites, langes schwarzes Sweatshirt. »Wir passen nicht wirklich gut zusammen.«
»Da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen«, erwidert Jake sarkastisch. »Als ich dich eben zum ersten Mal gesehen habe, war mir gleich klar, dass du nicht gerade der Blümchentyp bist.«
Eigentlich sollte ich mich über seine Worte freuen. Doch aus unerfindlichen Gründen fühle ich mich durch seine Annahme beleidigt.
»Wahrscheinlich verkaufst du dann den Laden am besten«, fährt er fort. »Nimm das Geld und düs damit in ein heißes Klima, um dich dort zu sonnen. Du siehst aus, als könntest du das brauchen.«
»Bargeld oder Sonne?«, will ich von ihm wissen und verschränke die Arme.
Jake verzieht ironisch das Gesicht. »Ich sehe schon … Ich bin in Schwierigkeiten, ganz gleich, was ich auch sage … Ich meinte natürlich die Sonne: Du siehst ein wenig blass aus.«
»Das ist mein natürlicher Teint!«, protestiere ich. »Nur weil ich mich nicht mit Selbstbräuner einschmiere wie irgendein Barbie-Püppchen!«
Weil ich ein wenig laut geworden bin, zuckt Miley zusammen.
»Tut mir leid, Kumpel«, entschuldige ich mich sanft. »Ich meine natürlich meine Kleine … Süße … Ach, wie redet man eine Affendame an?«, frage ich Jake.
»Benutz einfach ihren Namen, das funktioniert normalerweise.«
»Tut mir leid, Miley«, sage ich leise. »Ich wollte dir keine Angst einjagen.«
Wie zwei pralle Rosinen, die sich in einem fellbesetzten Kopf verstecken, richten sich ihre Augen wissend auf mich, als könne sie meine Gedanken lesen. Dann streckt sie mir feierlich ihre Hand entgegen.
»Sie will Freundschaft mit dir schließen«, übersetzt Jake. »Halt ihr deine Hand hin.«
Das tue ich.
Doch anstatt mir die Hand zu schütteln, wie ich es erwarte, legt mir Miley vorsichtig die Apfelkerne hinein. Dann springt sie auf Jakes Schulter zurück.
»Tut mir leid«, entschuldigt er sich. »Sie kann manchmal ein wenig launisch sein.«
»Schon gut«, winke ich ab und betrachte die Apfelkerne. »Das ist nicht das erste Mal, dass ich den Müll von jemandem mit mir herumtrage, und es wird bestimmt auch nicht das letzte Mal sein. Das ist normalerweise alles, was andere mir anvertrauen.«
Jake mustert mich fragend, doch ich kläre ihn nicht weiter auf.
»Lust auf einen Drink?«, fragt er. »Am Ende der Straße befindet sich ein Pub. Du siehst aus, als könntest du einen vertragen – tut mir leid«, entschuldigt er sich dann schnell. »Ich äußere schon wieder Vermutungen.«
Einen Augenblick lang betrachte ich ihn. Er wirkt harmlos, und es kommt mir unwahrscheinlich vor, dass ein Kerl, der mit einem Äffchen auf der Schulter herumläuft, sich als Serienmörder entpuppen könnte.
Ich nicke. »Das, Jake Asher, ist das Vernünftigste, was du gesagt hast, seit du diesen Laden betreten hast.«
3.
Löwenmäulchen – Jemandem einen Korb geben
Das Merry Mermaid muss aus dem gleichen Felsstück gemeißelt worden sein, aus dem sich St. Felix entwickelt hat. Dieser Pub hat sich schon am Hafen befunden, solange ich denken kann, und obwohl ich mehr als fünfzehn Jahre lang nicht mehr in St. Felix gewesen bin, sieht der Pub immer noch genauso aus wie damals.
Die Ausstattung und die Besitzer mögen über die Zeit hinweg gewechselt haben, doch das Ambiente und die Gemütlichkeit drinnen sind die gleichen geblieben – warm und gastfreundlich gegenüber alten und neuen Freunden, Besuchern und Touristen.
»Was darf ich dir bestellen?«, fragt Jake, während wir an der Bar warten.
Ich überlege kurz. Ich muss nicht mehr fahren; es ist vorgesehen, dass ich im Cottage meiner Großmutter übernachte, solange ich hier bin.
»Ein Pint, bitte.«
Jake sieht mich überrascht an.
»Noch nie ein Mädchen gesehen, das ein Bier trinkt?«, frage ich und ziehe die Augenbrauen hoch.
»Doch, natürlich«, erwidert er schnell. »Ich habe nur kurz überlegt, ob du ein Pint Bier meinst … und nicht etwa Schnaps?« Jake zieht die Brauen mindestens genauso hoch wie ich – doch seine Augen darunter zwinkern.
Ich muss grinsen. »Ja … Ein Pint Bier wäre toll, vielen Dank.«
»Zwei Bier, bitte, Rita.« Jake dreht sich zu der Frau hinter der Bar um, die ein geblümtes Kleid im Fünfzigerjahre-Stil trägt. Ihr Haar ist leuchtend rot und zu einer toupierten Hochfrisur gesteckt, was den Retrolook noch unterstreicht.
»Na klar, Süßer«, erwidert Rita. »Was bekommt Miley?« Sie winkt Jakes Äffchen zu.
»Im Augenblick nichts, vielen Dank.«
Miley sitzt mittlerweile auf der Theke und spielt mit ein paar Bierdeckeln.
»Na gut!« Rita mustert mich interessiert, während sie nach zwei Biergläsern greift. »Kennen wir uns?«, fragt sie mich. »Ich habe das Gefühl, dass wir uns irgendwo schon mal begegnet sind.«
»Das ist Poppy«, erklärt Jake, bevor ich antworten kann. »Sie ist Rosis Enkelin.«
Ritas Gesicht leuchtet auf. »Oh, Liebes, jetzt erkenne ich dich – du bist ja deiner Großmutter wie aus dem Gesicht geschnitten!« Dann macht sie ein langes Gesicht und schaut mich traurig an. »Mein Beileid zu ihrem Tod«, erklärt sie. »Rosie war hier bei allen sehr beliebt. Wie kommst du klar?«
Ich will gerade den Mund öffnen, um ihr zu antworten, da ruft Rita schon dazwischen.
»Was für eine blöde Frage!« Sie schüttelt den Kopf. »Natürlich trauerst du noch, nicht wahr? Hätte ich mir aufgrund deiner Kleidung auch eigentlich denken können. Richie!«, schreit sie dann, was mich zusammenfahren lässt. Am anderen Ende der Bar taucht ein Mann auf. »Komm her und sieh dir an, wer hier ist!«
Richie bedient noch seinen Gast, bevor er dann hinter der Bar zu uns geschlendert kommt. Zu einer Jeans trägt er ein Hemd mit einem kunterbunten Blumenmuster. Er nickt mir zu.
»Das ist Rosies Enkelin«, platzt es aus Rita heraus.
»Ja, das sehe ich.« Richie streckt die Hand aus. »Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Poppy, oder?«
»Stimmt, aber woher weißt du, wie ich heiße?«
»Deine Mutter hat gestern angerufen und uns gesagt, dass du kommst.«
Gibt es eigentlich irgendwen in ganz St. Felix, den meine Mutter nicht angerufen hat?
»Wie ich sehe, hast du Jake schon kennengelernt«, stellt Richie fest. »Und Miley.«
Miley hat ihr Spielchen aufgegeben, die Bierdeckel zu einem Turm zu balancieren; stattdessen ist sie nun damit beschäftigt, sie in so viele Stücke wie möglich zu zerreißen.
»Ja, das habe ich. Jake ist eben im Laden aufgetaucht.«
»Oh, übernimmst du den Blumenladen?«, fragt Rita aufgeregt. »Wie wunderbar!« Erleichtert schaut sie zu Richie hinüber. Er nickt begeistert.
»Poppy wird den Laden wahrscheinlich verkaufen«, erklärt ihnen Jake, bevor ich etwas sagen kann.
Ich starre ihn finster an, doch er schlürft in aller Ruhe weiter sein Bier.
Verlegen lächle ich Rita und Richie an. »Die Wahrheit ist, dass ich mich noch nicht entschieden habe.«
Jakes Verkündung scheint den beiden für einen Augenblick die Sprache verschlagen zu haben. Doch dann ergreift Richie als Erster wieder das Wort. »Aha. Na ja, es wäre eine Schande, wenn du das wirklich vorhättest, junge Dame. Aber es ist deine Entscheidung. Wenn es wirklich das ist, was du willst, dann kann ich dir nur einen schnellen, profitablen Verkauf wünschen.«
Ritas Gesichtsfarbe hat mittlerweile einen Rotton erreicht, der kurz davor ist, sich ihrer Haarfarbe anzugleichen.
»Du kannst doch nicht den Laden verkaufen!«, explodiert sie mit einem Mal. »Tut mir leid, Richie, ich weiß, der Gast hat immer recht und all das, aber sie kann das doch nicht so einfach tun – Rosie hat so an ihm gehangen! Das Besondere ist der Ort. Du weißt es selbst am besten!« Sie wirft ihm einen vielsagenden Blick zu.
Ein paar der Gäste in der Bar drehen sich zu uns, um zu sehen, worüber Rita sich so ärgert.
»Rita!«, warnt Richie sie. »Wir haben uns schon öfter darüber unterhalten, dass du deine Meinung für dich behalten sollst, wenn du hinter der Theke stehst. Tut mir leid, Poppy«, entschuldigt er sich.
»Schon gut«, erwidere ich, ein wenig überrascht von Ritas Leidenschaft, mit der sie sich für den Blumenladen einsetzt. »Ich mag Menschen, die sagen, was sie denken, und Rita darf ruhig ihre Meinung haben. Wie ich eben schon erklärt habe …«, jetzt bin ich an der Reihe, Jake einen vielsagenden Blick zuzuwerfen, »… habe ich noch nicht entschieden, was ich mit dem Laden anstellen werde. Ich denke, in ein paar Tagen weiß ich mehr.«
»Du musst versuchen, sie umzustimmen«, fleht Rita und packt Jakes Hand. »Sag ihr, welch große Bedeutung der Laden für die Stadt hat.«
Jake drückt Ritas Hand und legt sie dann sanft auf die Theke zurück.
»Poppy wird das ganz allein entscheiden, Rita«, stellt er fest. »Sie ist eine erwachsene Frau und bildet sich ihre eigene Meinung.«
Rita schnaubt.
»Ich werde nichts überstürzen, versprochen«, erkläre ich in dem Versuch, sie zu beschwichtigen.
Rita nickt mir knapp zu. »Gut. Na, das ist ja immerhin schon mal etwas, denke ich.«
»Dann lassen wir euch jetzt mal mit euren Drinks allein«, verkündet Richie. »Sagt Bescheid, wenn ihr was essen wollt. Ich hab Spaghetti Bolognese auf der Abendkarte, die sind ein echter Knaller, und …«, er sieht sich in dem beinahe menschenleeren Pub um, »… wenn es hier nicht gleich noch ein wenig voller wird, werden Rita und ich sie den gesamten Rest der Woche noch essen. Nein, die Drinks gehen aufs Haus«, winkt er ab, als Jake ihm einen Geldschein hinhält, um unser Bier zu zahlen. »In Gedenken an Rosie.«
Auf der Suche nach durstigen Kunden zieht Richie Rita mit sich.
Ich trinke einen Schluck Bier.
»Hast du mich darum hierhergeschleppt?«, frage ich Jake. »Weil du wusstest, dass sie so reagieren und mich dazu überreden würden, nicht zu verkaufen?«
Jake zuckt mit den Schultern. »Nein, überhaupt nicht. Ich bin mit dir hergekommen, weil das hier in St. Felix der einzige Pub ist und ich ein Bier trinken wollte.«
Ich betrachte ihn über den Rand meines Bierglases hinweg.
»Ehrlich. Für mich macht es keinen Unterschied, ob du den Laden verkaufst oder nicht.«
»Natürlich macht es das«, widerspreche ich und folge ihm, als er mir andeutet, an einem Tisch Platz zu nehmen, der in der Zwischenzeit am Fenster frei geworden ist. »Sollte ich den Laden an jemanden verkaufen, der ihn nicht als Blumenladen weiterführen will, dann gehst du pleite.«
Jake lacht.
»Warum lachst du? Was ist daran so witzig?«
»So wunderbar, wie deine Großmutter auch war, so ist ihr Geschäft doch nicht meine einzige Einkommensquelle. Ich beliefere Blumenläden in ganz Cornwall.«
»Oh, das wusste ich nicht.«
»Weißt du überhaupt etwas über Blumen?«, erkundigt sich Jake und setzt sein Pint auf dem Tisch ab. »Ich dachte, das sei ein Familienunternehmen.«
»Nein, nicht viel«, gebe ich zu. »Ich bin einer Beteiligung immer aus dem Weg gegangen.«
»Warum?«
Ich zucke mit den Schultern. »Keine Ahnung. Blumen sind eben nicht mein Ding.«
»Was ist denn dein Ding?«
Darüber muss ich nachdenken. »Ich glaube, das habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden, um ehrlich zu sein.«
Jake mustert mich, während er aus seinem Bierglas trinkt.
»Was?«, will ich wissen.
»Nichts, Chefin, ehrlich!«, ruft er und hebt beschwichtigend die freie Hand. »Du bist aber ganz schön gereizt, oder?«
»Nein, bin ich nicht. Nur weil ich nicht ins Familienunternehmen eingestiegen bin, heißt das noch lange nicht, dass ich ein Problem habe!«
»Das habe ich nie behauptet.« Jake schüttelt den Kopf. »Ich denke, ich bleibe jetzt besser schweigend hier sitzen und trinke einfach nur mein Bier. Das scheint mir einfacher zu sein.«
Wir beide schnappen uns unsere Biergläser, trinken einen Schluck und schauen überallhin, nur nicht zum anderen. Ich beobachte Miley, die auf der gegenüberliegenden Seite der Theke spielt; Rita hat ihr ein paar Erdnüsse gegeben. Vorsichtig bricht sie jede Nuss einzeln auf und schiebt die Schalen ordentlich unter ein Geschirrtuch, bevor sie sich dann gierig über den Inhalt hermacht.
»Tut mir leid«, entschuldige ich mich nach einer Weile und schaue zu Jake. »Tut mir leid, dass ich dich eben so angefahren habe. Eine schlechte Angewohnheit von mir.«
»Kein Problem«, erwidert er und zuckt freundlich mit den Schultern.
»Es ist nur so, dass ich das alles schon hundertmal gehört habe«, fahre ich fort, weil ich es ihm gern erklären will. »Dass ich doch wie alle anderen ins Familienunternehmen einsteigen soll. Wie sonderbar ich sei, weil ich in meinem Leben nichts geregelt bekomme.«
»Ich habe nie behauptet, dass ich dich seltsam finde«, entgegnet Jake und schaut mich an – anders als zuvor. »Hältst du dich denn für seltsam?«
»Jetzt klingst du wie meine Therapeuten«, erwidere ich und verdrehe die Augen, »wenn du mir wie gerade das Wort im Mund verdrehst.«
»Du warst in Therapie?«, fragt Jake und klingt dabei ziemlich interessiert. Er richtet sich auf seinem Stuhl auf.
»Ja, warum? Viele Leute sind in Behandlung.«
»Ich habe ja gar nicht behauptet, dass das irgendwie schlecht ist. Du meine Güte, das ist aber echt schwierig mit dir.«
Ich sehe Jake an. Ich habe es ihm aber auch nicht gerade leicht gemacht – was nicht fair ist, da er lediglich versucht, nett zu sein. »Ich weiß. Auch das habe ich schon mal gehört. Manche bezeichnen das auch als ›wartungsintensiv‹.«
»Wie nennst du es denn?«, fragt er und zwinkert mir – auf eine sehr attraktive Art und Weise – wieder zu.
»Im Grunde bin ich nur ein unbeholfenes Biest«, erwidere ich, hebe mein Bierglas und trinke einen Schluck, während ich auf seine Reaktion warte.
Zu meiner Freude lacht Jake. Wir grinsen uns über den Tisch hinweg an, und von den Spannungen, die vorher zwischen uns waren, ist nun nichts mehr zu spüren.
»Wollen wir etwas zu essen bestellen?«, fragt Jake und wirft einen Blick auf seine Uhr. »Mir ist klar, dass es erst fünf Uhr ist, aber ich sterbe vor Hunger.«
»Klar«, erwidere ich begeistert, da ich Essen niemals ablehnen kann. »Mir geht’s genauso.«
»Dann besorge ich uns mal die Karte«, antwortet Jake und steht auf. »Ich müsste auch mal kurz einen Anruf erledigen.«
»Klar.« Ich beobachte, wie er zur Bar schlendert. Dort sammelt er Miley ein, nimmt zwei Speisekarten, kommt zurück und reicht sie mir. »Ich bin gleich wieder zurück«, sagt er und wedelt mit seinem Handy.
Ich tue so, als würde ich mir die Speisekarte anschauen, doch während Jake nach draußen verschwindet, um seinen Anruf zu tätigen, gehen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Ist das klug, Poppy, frage ich mich. Du bist erst wenige Stunden hier und doch schon kurz davor, mit einem Fremden zu Abend zu essen – mit einem zugegebenermaßen ziemlich attraktiven Fremden, aber das sollte doch keinen Unterschied machen.
Eigentlich ist Jake so gar nicht mein Typ. Er ist ein wenig reifer als der Typ Mann, auf den ich normalerweise abfahre – ich schätze mal, dass er Ende dreißig bis Anfang vierzig ist. Seine breiten Schultern und die kräftigen Arme lassen vermuten, dass er regelmäßig Sport treibt, doch das könnte auch daran liegen, dass er in seiner Gärtnerei viel arbeiten muss. Er scheint ein wirklich netter Kerl zu sein, aber ich will zu diesem Zeitpunkt mit niemandem etwas anfangen, insbesondere mit niemandem, der hier in St. Felix wohnt, sonst komme ich hier nie wieder weg.
Nein, ich muss einen kühlen Kopf bewahren und mich darauf konzentrieren, warum ich hierhergekommen bin, selbst wenn Jake das süßeste Lächeln hat, das ich seit Langem gesehen habe …
Jake kehrt zurück und setzt sich mit Miley auf der Schulter mir gegenüber, während ich so tue, als sei ich ganz in die Speisekarte vertieft.
»Tut mir leid«, entschuldigt er sich, als ich ihn über die Karte hinweg ansehe. »Ich musste meiner Familie kurz Bescheid sagen, dass ich später komme.«
»Kein Thema«, erwidere ich beiläufig, doch meine Gedanken rasen schon wieder.
Familie?
Heimlich werfe ich einen Blick auf seine Hände, während ich vorgebe, die Karte zu studieren. Zum ersten Mal fällt mir ein goldener Ehering auf.
Verdammt, ich wusste es, es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein! Er ist verheiratet.
»Ist es denn für deine Frau in Ordnung, dass du heute außer Haus essen gehst?« Mit einem Mal fühle ich mich recht unbehaglich. Mit einem Mann essen zu gehen, den man gerade erst kennengelernt hat, ist ja eine Sache, aber mit einem verheirateten Mann …
»Ich habe nicht meine Frau angerufen«, erwidert er, »sondern meine Kinder.«
O Gott, er hat auch Kinder! Ich fange schleunigst an, mir Ideen zurechtzulegen, wie ich so schnell wie möglich den Pub verlassen kann. Das ist genau der Grund, warum ich dem männlichen Geschlecht aus dem Weg zu gehen versuche. Seit gefühlten fünf Minuten bin ich erst hier, und schon habe ich mich von einem netten Lächeln und einem Knackarsch hinters Licht führen lassen. »Ah, verstehe«, erwidere ich vorsichtig. Meine Speisekarte wird plötzlich wieder sehr interessant.
»Das sind Teenager, sie sind also durchaus in der Lage, sich selbst um ihr Abendessen zu kümmern«, fährt Jake fort, der anscheinend nichts von meinem Unbehagen mitbekommt. »Aber ich sage ihnen immer gern Bescheid, wo ich bin, wenn ich später nach Hause komme.«
»Klar.«
»Was ist los?«, fragt Jake und schaut mich fragend über den Tisch hinweg an. »Du bist plötzlich so still geworden. Und du magst vieles sein, Poppy, aber das gehört nicht dazu.«
Da ich für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund nehme, falle ich gleich mit der Tür ins Haus. »Ich will nicht mit verheirateten Männern zusammen sein.«
Jake schaut sich um. »Ich sehe hier keine verheirateten Männer.«