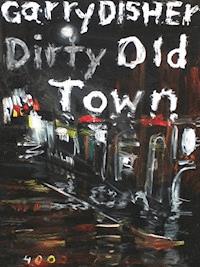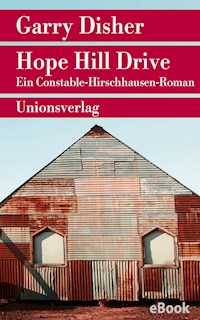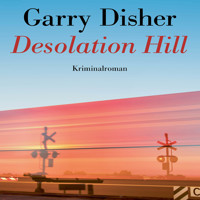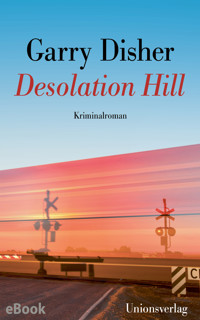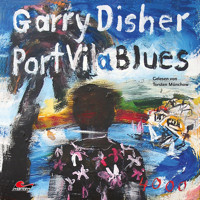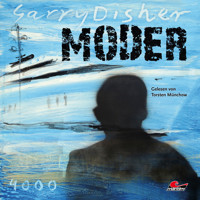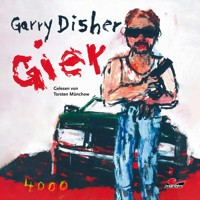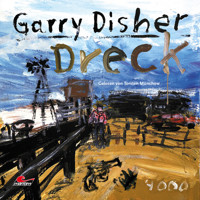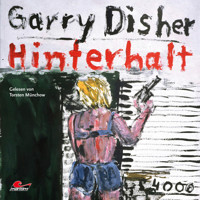9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Polizei von Waterloo hat alle Hände voll zu tun. Scharen von Schulabgängern fallen auf der Peninsula ein, um ihren Abschluss zu feiern. Als wäre das nicht genug, halten zwei schwere Verbrechen Hal Challis und Ellen Destry in Atem: Der Inspector und seine Kollegin müssen den brutalen Überfall auf den Kaplan einer Privatschule und den Mord an einer jungen Frau untersuchen, die sich für den Erhalt eines Fischerhäuschens einsetzte. Zusätzlicher Druck wird von einem bekannten Politiker ausgeübt, der mit der Polizei noch eine Rechnung offen hat. Dass Hal und Ellen seit Neuestem ein Liebespaar sind, macht die Sache nicht gerade einfacher – und verstößt obendrein gegen das Polizeireglement.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Inspector Hal Challis und seine Kollegin Ellen Destry müssen den brutalen Überfall auf den Kaplan einer Privatschule und den Mord an einer jungen Frau untersuchen, die sich für den Erhalt eines Fischerhäuschens einsetzte. Dass die beiden seit seit Neuestem ein Liebespaar sind, macht die Sache nicht gerade einfacher.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Garry Disher (*1949) wuchs im ländlichen Südaustralien auf. Seine Bücher wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter zweimal der wichtigste australische Krimipreis, der Ned Kelly Award, viermal der Deutsche Krimipreis sowie eine Nominierung für den Booker Prize.
Zur Webseite von Garry Disher.
Peter Torberg (*1958) studierte in Münster und in Milwaukee. Seit 1990 arbeitet er hauptberuflich als freier Übersetzer, u. a. der Werke von Paul Auster, Michael Ondaatje, Ishmael Reed, Mark Twain, Irvine Welsh und Oscar Wilde.
Zur Webseite von Peter Torberg.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Garry Disher
Rostmond
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Peter Torberg
Ein Inspector-Challis-Roman (5)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel Blood Moon bei The Text Publishing Company in Melbourne, Australien.
Die Übersetzung aus dem Englischen wurde unterstützt von der australischen Regierung mithilfe des Australia Council for the Arts.
Originaltitel: Blood Moon (2009)
© by Garry Disher 2009
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Zoltán Balogh
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30357-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 19:23h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ROSTMOND
1 – An einem Dienstagmorgen Mitte November, im Spätfrühling …2 – In einem alten Farmhaus an einer Schotterstraße …3 – Challis und Destry nahmen zwei Autos. Das ergab …4 – In der Zwischenzeit war Ellen auf dem Revier …5 – Caz Moon war in der Trevally Street …6 – Challis verließ die Villanova Gardens, fuhr zum Krankenhaus …7 – Kaum war Challis allein, klingelte schon das Telefon …8 – Ellen Destry, die keine Minute länger in einem …9 – Ludmilla Wishart brachte in ihrem Büro im Planungsamt …10 – »Ich hab nichts damit zu tun«, sagte Scobie …11 – Tankards und Crees erster Einsatz, nachdem sie der …12 – Am späten Nachmittag klingelte Challis’ Telefon, und der …13 – Ellen Destry hatte einen langen, öden Dienstag hinter …14 – Challis holte etwas zu trinken, und Ellen erzählte …15 – »Ich genieße das«, meinte Ellen später in der …16 – Das war am Dienstag gewesen. Am Mittwoch war …17 – An einer anderen Stelle in Penzance Beach joggte …18 – Während Challis und Murphy an diesem Mittwochmorgen ihren …19 – Der Vormittag neigte sich dem Ende zu …20 – Zum Mittagessen holte sich Challis ein Schinken-Salat-Brötchen und …21 – Um sechzehn Uhr erschien John Tankard gut ausgeruht …22 – Challis eilte die Treppe hinunter und ging zum …23 – Scobie Sutton, seine Frau Beth und ihre Tochter …24 – Donnerstagmorgen25 – Als die Spurenfahnder am Tatort fertig waren …26 – Pam Murphy war in Waterloo auf dem Parkplatz …27 – Am späten Donnerstagvormittag war Ellen Destry im Gebäude …28 – Athol Groot, Direktor des Bezirksplanungsamts, sagte: »Das ist …29 – Adrian Wishart hatte seinen Bruder als Alibi angegeben …30 – Zwei Schoolies waren die Fahrräder gestohlen worden …31 – Ellen Destry hätte ebenfalls beim letzten Briefing des …32 – Am frühen Abend saßen Challis, Sutton, Murphy und …33 – Am Ende des Briefings sagte Ellen, sie habe …34 – Freitagmorgen35 – Zeitgleich waren Destry und Murphy unterwegs, um den …36 – An den Sea-Breeze-Apartments erfuhren sie allerdings, dass Josh …37 – »Man könnte argumentieren«, sagte Challis vorsichtig, als sei …38 – Danach fuhr Challis vom strandnahen Brighton in die …39 – Es hatte keinen Sinn, eine bewaffnete Sondereinheit einzusetzen …40 – Es war früher Nachmittag. Scobie Sutton hatte den …41 – Ein Arzt kam aufs Revier, untersuchte Josh Brownlee …42 – Alle nahmen an, dass Ellen Josh Brownlees Zimmer …43 – Hal Challis kannte durchaus nicht alle Stimmungen von …44 – Am Samstagmorgen gingen sie als Erstes die Liste …45 – Als Erstes rief Ellen Scobie Sutton an. »Wo …46 – Es gibt einen Augenblick, wenn man unterwegs ist …47 – Der Ehemann der Ermordeten wurde erneut ins Befragungszimmer …48 – Pam Murphy wollte eigentlich nichts anderes, als den …49 – Nachdem Scobie Sutton seine Tochter zum Gemeindesaal hinter …50 – Scobie Suttons Anruf war eine Erleichterung. Challis …51 – Pam Murphy holte gerade eine Akte aus ihrem …52 – In der Zwischenzeit war es Nachmittag geworden …53 – Test, Test, eins, zwei, drei, das kleine Schwein …54 – Pam Murphy versuchte, einen kühlen Kopf zu bewahren …55 – Am Ende dieses langen Tages sagte Challis: »Oje …56 – Dirk Roe, vollgedröhnt mit Wodka und Amphetaminen …Mehr über dieses Buch
Über Garry Disher
Garry Disher: Gedanken über die Arbeit am Schreibtisch
Garry Disher: »Ich genieße es, im deutschsprachigen Raum auf Lesereise zu gehen.«
Über Peter Torberg
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Garry Disher
Zum Thema Australien
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Für Wendy und Martin
1
An einem Dienstagmorgen Mitte November, im Spätfrühling, die Luft draußen vor dem Schlafzimmerfenster warm und pollengeschwängert, beobachtete Adrian Wishart seine Frau beim Pinkeln. Er saß frisch angezogen und mit adrett gekämmtem Haar am Fußende des Betts und schnürte sich die Schuhe zu. Seine Frau hockte im angrenzenden Badezimmer nackt auf dem Klo und starrte ein Loch in die Luft, war weit weg und bemerkte nicht, dass sie beobachtet wurde. Sie riss meterweise Toilettenpapier von der Rolle, wischte sich ab, und als die Wasserspülung alles mit sich fortriss, stellte sich Adrian in die Tür und sagte gepresst: »Wir schwimmen nicht im Geld.«
Ludmilla erschrak, warf ihm einen gehetzten Blick zu und erwiderte: »Entschuldigung.«
Sie kauerte sich zusammen, beinahe unbeweglich, öffnete die Glastür der Duschkabine. Adrian drehte das Handgelenk um und tippte auf die Uhr. »Ich stoppe die Zeit.«
Nur Kleinigkeiten, aber sie gingen ins Geld. Niemand musste ewig duschen. Keine Frau brauchte derart viel Klopapier. Wenn man ein Zimmer verließ, musste man das Licht nicht brennen lassen. Wozu drei- oder viermal die Woche einkaufen, wenn man das in einem Aufwasch erledigen konnte?
Adrian Wishart schaute zu, wie seine Frau ihre Schultern unter dem Wasserstrahl bewegte. Das Wasser färbte ihr rotes Haar dunkler und lief ihr über den Körper, sie hatte an Oberschenkeln und Hüften zugelegt, fand er. Sie träumte mal wieder vor sich hin, also klopfte er ans Glas, um sie aufzuwecken. Sofort fing sie an, sich die Haare zu waschen.
Wishart schlich sich aus Bad und Schlafzimmer und ging zur Garderobe, wo Ludmilla immer ihre Handtasche deponierte. Portemonnaie, Handy, Tampons, ein Toffee – na, so viel zu ihrer Diät –, der Kalender und ein Parkschein, den er sich genauer anschaute: ein Parkplatz in der Stadtmitte von Melbourne, vielleicht von gestern, als sie bei der Anhörung der Planungsbehörde war. Adrian entsperrte ihr Handy, ging die ausgehenden Anrufe durch, die Nachrichten, die Namen im Adressbuch. Es fiel ihm nichts Ungewöhnliches auf. Unglücklicherweise hatte er nicht mehr genug Zeit, sonst hätte er ihren Laptop gestartet und noch ihre E-Mails kontrolliert. Andererseits hatte sie auch bei der Arbeit einen Computer, wer weiß, was für Mails sie dort bekam.
Ludmillas kleiner silberner Golf parkte im Carport hinter seinem Citroën. Der Tacho stand bei 46 268, sie war am Vortag also fast hundertfünfzig Kilometer gefahren. Adrian schloss die Augen und rechnete. Der Weg von zu Hause in ihr Büro in Waterloo und zurück war sieben Kilometer lang. Das konnte nur eins bedeuten: Statt am Vortag mit einem Dienstfahrzeug zur Anhörung in die Stadt zu fahren, hatte sie ihren eigenen Wagen genommen.
Ihr Haus lag auf einem kleinen Hügel oberhalb des Küstenstädtchens Waterloo. Adrian starrte über den Ort hinaus auf die Western Port Bay, ohne etwas wahrzunehmen, und kochte innerlich: Sie schwammen nicht im Geld.
Er sah auf die Uhr. Ludmilla hatte vier Minuten unter der Dusche gestanden. Er eilte zurück.
Ludmilla trocknete sich ab, ihre Haut war vom Wasserstrahl ganz rosig massiert. Als sie sich dehnte und streckte, zeigten sich hier und da kleine, aber unverkennbare Fettpölsterchen. Sie ließ sich gehen! Sie brüskierte ihn damit. Adrian holte die Waage unter dem Bett hervor, trug sie ins Bad und schnippte mit den Fingern: »Rauf mit dir.«
Ludmilla schluckte, hängte das Handtuch über die Heizung und trat auf die Waage. Knapp über sechzig Kilo. Vor zwei Wochen hatte sie noch neunundfünfzig gewogen.
Wishart kochte tief innerlich vor verzehrender Wut. Seine Stimme hatte sich in ein leises, gefährliches Krächzen verwandelt: »Du hast schon wieder zugenommen. Das gefällt mir nicht.«
Ludmilla stand wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht, das reglos und stumm auf den Schuss wartet.
»Hast du Geschäftsessen gehabt?«
Sie schüttelte wortlos den Kopf.
»Du wirst fett.«
Sie fand ihre Stimme wieder: »Das liegt nur an meinen Tagen.«
»Freitagmittag habe ich dich mehrmals angerufen«, sagte Adrian. »Du bist nicht drangegangen.«
»Adrian, um Himmels willen, da war ich in Penzance Beach bei einem Treffen des Bürgerkomitees.«
Adrian sah sie wütend an. Das Bürgerkomitee war ein Haufen mildtätiger Rentner, der unbedingt eine alte Bruchbude erhalten wollte. »Mit deinem Auto oder mit einem Dienstwagen?«
»Mit einem Dienstwagen.«
»Gut.«
Sie frühstückten gemeinsam – auf sein Drängen hin taten sie alles gemeinsam –, dann fuhr Ludmilla zur Arbeit; Adrian ging in sein Atelier, legte sich Architektenstifte, Lineale und Millimeterpapier zurecht und sortierte sie.
2
In einem alten Farmhaus an einer Schotterstraße, ein paar Kilometer landeinwärts von Waterloo, sagte Hal Challis: »Oje.«
»Was denn?«
»Ein Makel.«
Detective Inspector Challis stützte sich auf und spielte mit dem Haar von Sergeant Destry, das, abgesehen von ein paar Strähnen, die ihr feucht an Hals, Schläfen und Brüsten klebten, auf dem Kissen ausgebreitet lag.
»Höchst unwahrscheinlich«, entgegnete sie.
Ellen Destry lag auf dem Rücken und streckte ihre unvergleichlichen Gliedmaßen zufrieden von sich. Challis spielte mit der freien Hand weiter in ihren Haaren, doch sein liebevoller Blick wanderte ruhelos von ihren Augen und Lippen zu den trägen Brüsten. Ellen wirkte schläfrig, aber doch nicht so sehr, als sei sie schon mit ihm fertig, und das war ihm nur recht. Er befreite seine Hand aus dem Gewirr und fuhr mit der Handfläche an ihrer Seite entlang, über ihren Bauch hinab bis dorthin, wo sie sich feucht unter seinen Fingern räkelte.
»Welcher Makel?«, fragte sie unsicher.
»Spliss.«
»Aber nicht auf diesem Kopf, Freundchen«, entgegnete sie und versetzte ihm einen Hieb.
Als Antwort darauf ließ er sich auf den Rücken rollen und zog sie mit sich. Gerade als er eine Brustwarze zwischen die Lippen nahm, klingelte das Telefon. »Lass es läuten«, fuhr ihn Ellen scherzhaft an, aber das konnte er natürlich nicht, das wusste sie. Er war unter ihr gefangen, also griff sie nach dem Telefonhörer. »Destry«, sagte sie auf ihre dienstlich knappe Art.
Challis rührte sich nicht, schaute sie an und lauschte.
»Einen Augenblick«, sagte sie, rollte von Hal herunter und gab ihm das Telefon.
»Challis«, sagte er.
Der diensthabende Sergeant meldete einen Fall von schwerer Körperverletzung in der Trevally Street vor den Villanova Gardens in Waterloo. »Die Reihenhaussiedlung gegenüber vom Jachtklub, Sir.«
»Ich weiß.«
»Das Opfer liegt im Koma«, fuhr der Diensthabende fort. »Sein Name ist Lachlan Roe.«
»Straßenraub? Schwerer Diebstahl?«
»Keine Ahnung, Sir. Die Notrufzentrale hat die Meldung entgegengenommen. Die Nachbarin ist vors Haus gegangen, um ihre Zeitung zu holen, und hat Mr. Roe in einer Blutlache in seinem Vorgarten gefunden.«
»Ist schon jemand von der Kriminalpolizei dort?«
»Scobie Sutton und Pam Murphy.«
Sutton und Murphy waren Detective Constables in Challis’ Einheit. »Spurensicherung? Krankenwagen?«
»Die Techniker sind unterwegs. Der Krankenwagen ist schon wieder weg.«
Challis fragte sich, wozu man ihn überhaupt angerufen hatte, und rollte mit den Augen, Ellen grinste und wackelte mit den Brüsten. Er streckte die Hand aus, doch sie wich zurück, erhob sich vom Bett und ging nackt, wie sie war, ans Fenster. Hal schaute ihr anerkennend nach. »Hübscher Hintern«, murmelte er mit einer Hand über der Sprechmuschel.
Ellen schaukelte mit den Hüften und zog die Vorhänge auf. Die Morgensonne umstrahlte ihre Gestalt, Staubkörnchen schwebten im Licht, und die Welt draußen vor dem Fenster sprühte nur so vor Leben: das Grün der Pflanzen, die Frühlingsblumen, die Wellensittiche, die umherjagten und auf den Ästen wippten.
Challis konzentrierte sich wieder auf das Telefongespräch. »Also ist alles unter Kontrolle.«
Es trat eine kurze Pause ein. Schließlich meinte der Diensthabende: »Es könnte heikel werden.« Das konnte nur eins bedeuten, das Opfer stand im Rampenlicht oder verfügte über gute Beziehungen, und das würde den untersuchenden Beamten letztlich Kopfschmerzen bereiten. »In welcher Hinsicht?«
»Das fragliche Opfer ist Kaplan an der Landseer School.«
Die Landseer School, Internat und Tagesschule auf der anderen Seite der Peninsula. Nicht so alt wie die Geelong Grammar School, das Scotch College oder das Presbyterian Ladies’ College, aber ebenso kostspielig und renommiert. Ein paar finanzkräftige und einflussreiche Leute schickten ihre Kinder auf diese Schule, und Challis konnte sich das Interesse der Medien bildhaft vorstellen. Er sah auf die Uhr auf dem Nachttisch: 6.53 Uhr. »Bin schon unterwegs«, sagte er.
Er legte auf und sah zu Ellen, die immer noch vom Fenster eingerahmt wurde. Besonders faszinierten ihn Taille und Wirbelsäule, also ging er zu ihr hinüber und schmiegte sich an ihren nackten Rücken.
Ellen machte sich von ihm los. »Haben wir denn noch Zeit?«
»Natürlich nicht.«
Hinterher seiften sie sich gegenseitig in der Dusche ein, und Challis teilte ihr in groben Zügen mit, was er über den Überfall wusste. »Die Landseer School?«, fragte Ellen bestürzt.
»Genau die«, antwortete Challis. Das Wasser floss über ihre Brüste. Er schaute gebannt zu.
»Konzentrier dich auf deine Arbeit, Freundchen.«
»Schön«, erwiderte er, »ganz wie du willst.«
Er spülte sich das Haar aus und stieg aus der Dusche. Ellen stellte sich unter den Brausekopf und ließ sich genüsslich Zeit. »So ists recht«, meinte Challis, »verschwende ruhig Wasser.«
»Das mach ich.«
»Na gut, mach das.«
Das war nur gedankenloses Scherzen von Verliebten, doch dann kam ihnen unausweichlich die Arbeit dazwischen. »Ich fahre zu dem Überfall«, sagte Challis, trocknete sich ab und schaute Ellen dabei zu, wie sie sich ein Handtuch um den Kopf und ein anderes um ihren Körper wickelte.
Sie warf ihm einen vieldeutigen Blick zu. »Und du möchtest, dass ich ins Büro fahre?«
Challis nickte. »Wenn du dich um die Fälle von sexueller Nötigung von Samstagnacht kümmern könntest …«
Ein winziger Hauch von Spannung lag zwischen den beiden; sie bewegten sich auf dünnem Eis, denn er war ihr Chef, und dennoch lebten sie zusammen. Keine Ahnung, welches Nachspiel die Angelegenheit haben würde, dazu war alles noch zu frisch; früher oder später würde sich das schon herausstellen. Während sie sich ankleideten, hatten sie beide denselben Gedanken. Challis trug heute einen Anzug; er ging davon aus, später vor den Medien oder bei seinem Boss Eindruck schinden zu müssen. Er band sich die Krawatte um und schaute zu, wie Ellen eine perfekt sitzende Hose und Schuhe mit flachen Absätzen anzog, dazu eine anthrazitfarbene Jacke über einem strahlend weißen T-Shirt; die dunklen Farben bildeten einen attraktiven Kontrast zu ihrer blassen Haut und den strohblonden Haaren. Challis war dieses Outfit vertraut, die angemessene Arbeitsbekleidung für eine Beamtin, die in einem Augenblick noch am Schreibtisch saß, im nächsten aber vielleicht durchs Gras stapfen musste, um eine Leiche in Augenschein zu nehmen; heute Morgen wirkte sie allerdings adrett und verrucht zugleich. Sie sah ihn aus ihren klugen, ausdrucksstarken Augen an und ertappte ihn dabei, wie er sie anstarrte. »Was?«
»Ich könnte dich den ganzen Tag lang anschauen.«
Ellen wurde ein wenig rot. »Geht mir genauso.«
Sie frühstückten an einem wackligen Campingtisch auf der hinteren Veranda, wo die Sonne durch ein Rankengewirr, das schon kräftig ausgeschlagen hatte, bis zu ihnen drang. Challis hatte die Marmelade vergessen und ging in die Küche zurück. Er war sich ziemlich sicher, dass von dem Quittengelee, das er im letzten April eingekocht hatte, noch ein Glas übrig sein musste. Als er in der Speisekammer nachschaute, stellte er fest, dass auf dem mittleren Regalbrett, auf dem er sonst Marmelade, Honig und Vegemite unterbrachte, nun Gewürze, Saucen und Vorratsbehälter mit Reis und Nudeln standen. Die Gläser waren nach unten verbannt worden.
3
Challis und Destry nahmen zwei Autos. Das ergab zwar wirtschaftlich und ökologisch keinen Sinn, aber sie wussten, dass sie durch die Arbeit im Laufe des Tages getrennte Wege gehen würden. Ellen fuhr als Erste in ihrem neuen Corolla davon, strahlend blau, aber zugestaubt und schlammverschmiert wie die Wagen aller Nachbarn. Challis folgte ihr in seinem unzuverlässigen Triumph. Der Wagen hatte seine Geheimnisse jahrelang eisern für sich behalten, doch nun zeigten sie sich alle zugleich: Rostflecken unten an den Türen und im Fußraum, Öllachen, Korrosion, ein defektes Tachokabel, eine schleifende Kupplung, ein jaulendes Differenzial. Auch die Stoßdämpfer waren hinüber. Challis erwischte in seiner Einfahrt ein Schlagloch und spürte den heftigen Stoß durchs Lenkrad.
Als Challis die Einfahrt hinter sich ließ, sah er zu seinem Haus hinüber. Hübsch, kalifornischer Bungalowstil, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Mit den drei Morgen Rasen, den Obstbäumen und Sträuchern hier und da passte es gut in die Umgebung. Die einzigen Nachbarn waren ein Obstbauer und ein Winzer. Challis mochte die Abgeschiedenheit, sie entsprach seinem Naturell. Aber kam Ellen damit klar? Bis zu ihrer Trennung und der Scheidung von Alan Destry hatte Ellen in Penzance Beach gelebt, in einem kleinen Vororthäuschen in einer ganzen Reihe mit ähnlichen Häusern, neben Leuten, die ihren Rasen mähten, im Hinterhof grillten, an die Tür klopften und um eine Tasse Zucker baten, manchmal zu laut Musik hörten.
Vielleicht sollte er besser fragen, ob sie die Abgeschiedenheit nach einer Weile stören würde? Sie waren ja erst seit drei Wochen zusammen. Challis hatte Ellen gebeten, auf sein Haus aufzupassen, als er sich vom Dienst beurlauben ließ, um bei seinem Vater zu sein, der im Sterben lag. In den paar Stunden nach seiner Rückkehr waren sie ein Liebespaar geworden. Das hatte sie beide überrascht – irgendwie. Ellen hatte, wenn auch nur halbherzig, gemurmelt, sie wolle sich eine eigene Bleibe suchen, aber Challis hatte sie dazu bewegt, zu bleiben.
Nun versuchte er zu ergründen, warum. Natürlich spielte die körperliche Anziehung die größte Rolle, Verlangen, Zuneigung, auch wenn er ihr gegenüber nichts davon gesagt hatte. Sie waren beide nicht sonderlich gut darin, Gefühle zu äußern. »Ich liebe dich«, hatten sie bisher noch nicht gesagt. Wie es schien, dachten wohl beide, dass Zärtlichkeiten und Erklärungen nur allzu schnell schal wurden.
Außerdem konnte Challis nicht von der Hand weisen, dass er sich ein wenig verloren und verletzlich gefühlt hatte, nachdem er von der Beerdigung seines Vaters auf die Peninsula zurückgekehrt war. Er schlief nicht gut, die Arbeit brachte noch mehr menschliches Leid und eintönige Tage, und der Tod seines Vaters war noch frisch. Als seine Mutter starb, hatte er zu Beginn alle paar Minuten an sie gedacht, dann alle paar Wochen, später Monate, und irgendwann war sein Kummer hinter glücklichen Erinnerungen verblasst, doch als sein Vater im Sterben lag, war die Trauer wieder in ihm aufgeflammt. Doppelte Trauer. Jetzt hörte er die Stimmen seiner Eltern, wenn er am wenigsten damit rechnete und es häufig noch weniger wollte, er sah ihre Gesichter und erinnerte sich mit erschreckender Klarheit an die Vergangenheit.
Challis hatte eigentlich nie Halt gebraucht, aber er konnte nicht abstreiten, dass Ellen Destry Balsam für seine Seele war, abgesehen von allem anderen. Himmel, wie sehr er es hassen würde, wenn irgendetwas ihren Versuch, glücklich zu werden, torpedieren würde.
Aber arbeiteten sie andererseits nicht zu eng zusammen, an zu komplizierten Dingen, als dass es mit der Liebe klappen könnte? Mal ganz abgesehen davon, dass ihnen früher oder später irgendein Polizeibürokrat irgendeine Vorschrift unter die Nase reiben würde.
Challis erreichte das Ende der Schotterstraße und hielt an. Er hatte das alte Autoradio durch eines mit CD-Spieler ersetzt und war gerade in der Stimmung für Chris Smither. Als Drive You Home Again losdröhnte, bog er auf die asphaltierte Straße in Richtung Waterloo ein. Schon bald kam er an einem pseudofranzösischen Chalet und einer toskanischen Villa vorbei, die sich nicht in die Landschaft einfügten, sondern die höheren Lagen des immer weiter schrumpfenden Farmlandes dominierten. Manchmal schien es, dass er nur blinzelte, und schon war über Nacht ein neues Anwesen aus dem Boden geschossen.
Auch die Städte auf der Peninsula änderten sich. Die neuen Wohngebiete, die junge Familien anlockten, welche dann all ihre Ersparnisse und ihr Einkommen in Häuser und Grundstücke steckten, die sie sich nicht leisten konnten, waren weit über die angestammten Stadtgrenzen hinausgewachsen. Das Ergebnis war einerseits die immer tiefer werdende soziale Kluft zwischen den Benachteiligten und den wohlhabenden Rentnern und sich ständig auf dem Sprung befindlichen Topjobbern, andererseits überlastete öffentliche Dienste wie Schulen, Krankenhäuser, Sozialämter oder Polizei.
Challis kam an die Kreuzung mit der Coolart Road und hielt an, um einen Schulbus passieren zu lassen. Der neokoloniale Palisadenzaun zu seiner Rechten hielt eine Herde Alpakas in Schach. Vor zehn Jahren hatte es noch keine Alpakas auf der Peninsula gegeben. Heute sah man sie überall, sie wirkten wie Spielzeug, künstliche Geschöpfe. Dann war der Bus, auf dessen breitem Heck »The Landseer School« geschrieben stand, vorbei. Challis seufzte. Eine der exklusivsten Schulen des Landes, Schulgebühren von fast 20 000 Dollar im Jahr, ein Ort, mit dem er normalerweise nichts zu tun hatte – doch nun musste er einen seiner Leute hinschicken, um festzustellen, ob der Angriff irgendwie mit der Schule in Verbindung stand.
Challis folgte der Straße, vorbei an Weinreben und noch mehr Alpakas, bis er zu den Gartencentern, Installateuren und Sägewerken am Rande von Waterloo kam. Die Stadt, eine der größten Ansiedlungen auf der Peninsula, war vor einer Weile noch ziemlich heruntergekommen gewesen, erlebte aber gerade eine Renaissance: ein K-Mart, neue Häuser, ein Delikatessengeschäft, das importierte Köstlichkeiten anbot. Die winzigen alten Secondhandläden waren niedergewalzt worden, um Platz zu schaffen für kleine Arkaden mit Rauchglasscheiben. Das alles verlieh dem Ort einen gewissen Stolz.
Challis umfuhr die Südseite der Stadt und kam zur Trevally Street, einer langen Straße, die parallel zur Küste verlief. Auf der einen Seite lagen Wohngebiete, auf der anderen gab es Grünanlagen, das städtische Freibad, Skateboardrampen, Wanderwege und einen Jachtklub. Abgesehen von einer dichten Ansammlung von knallbunten Zelten auf einem brachliegenden Grundstück neben den Tennisplätzen, war Challis dies alles vertraut.
Die Zelte. Das erste war am Freitagnachmittag aufgetaucht, Dutzende weitere am Wochenende, aufgebaut von Achtzehn- und Neunzehnjährigen, die den Abschluss der zwölften Klasse feiern wollten, ein Phänomen mit dem Namen »Schoolies Week«. Zwar waren die Haupttreffpunkte der Schulabgänger die Gold Coast in Queensland, gefolgt von den viktorianischen Städtchen Loren und Sorrento, doch hatten die Kosten, die Entfernung und die Nervosität der Eltern einige junge Leute dazu gebracht, nach billigen Alternativen wie Waterloo Ausschau zu halten. Letztes Jahr waren hundert Schulabgänger in der Stadt aufgetaucht, die unter dem Ansturm ein wenig gelitten hatte. Dieses Jahr wurden erheblich mehr erwartet, dafür waren die Ortsansässigen aber besser vorbereitet. Motels und Pensionen boten Sonderpreise an, offenes Gelände wurde zum Campen freigegeben, und die Präsenz von Polizei und freiwilligen Helfern war verstärkt worden, um mit den Betrunkenen, dem Drogenmissbrauch und den Tränen fertig zu werden.
Das alles hatte allerdings den sexuellen Übergriff samstagnachts nicht verhindern können. Das Opfer, eine Achtzehnjährige aus einer Mädchenschule in der Stadt, hatte den Angreifer nicht gekannt, ihn nicht gesehen, ihn auch nicht wiedererkannt, und zu seiner Identifizierung nichts anderes vorzuweisen, als einen spätnachts in den Dünen erduldeten Samenerguss auf T-Shirt und Shorts. Und man konnte darauf wetten, dass es im Computer keine passende DNA-Probe gab.
Challis fuhr langsamer, als er Scobie Suttons Volvo Kombi außerhalb der Siedlung Villanova Gardens sah. Der Volvo war zwanzig Jahre alt, aber immer noch bestens in Schuss, ein Wagen, der niemals die Geschwindigkeit übertreten hatte – was nicht heißen sollte, dass der Wagen ordentlich gefahren worden war, denn Scobie Sutton war ein berüchtigt schlechter Fahrer. Neben dem Volvo standen ein Streifenwagen und ein schwarzer Astra mit Stoffverdeck.
Villanova Gardens war nach einem italienischen Seemann benannt worden, der vor hundert Jahren, als Waterloo noch eine Ansiedlung von windschiefen Fischerhütten und Zelten war, von einem Schiff geflüchtet war. Challis hielt an, stieg aus, sah in beide Richtungen die Straße entlang und entdeckte Pam Murphy und einen uniformierten Constable, die die Häuser abklapperten. Challis fiel auf, dass es in diesem Teil der Stadt nur wenige Straßenlaternen gab. Er besah sich die Apartmenthäuser. Zweigeschossig, zehn in einer Reihe, jedes mit einer kleinen, angebauten Garage, Hecken, um Privatsphäre zu schaffen, und Balkon im oberen Stockwerk, der, so schätzte er, einen Blick über den Jachthafen und die Western Port Bay hinaus zu den in der Entfernung liegenden Kaminen der Raffinerie auf der anderen Seite der Bucht bot. Kein besonders toller Blick, aber man konnte es zu Recht als Aussicht bezeichnen.
Challis ging auf die Nummer sechs zu, zog seinen Ausweis aus der Manteltasche und zeigte ihn Andy Cree, dem Constable, der die Aufgabe hatte, aufzuschreiben, welche der befugten Personen das Gebäude betraten oder verließen. Cree war ein neuer Rekrut auf dem Revier, jung, athletisch, sympathisch, stets zu einem Scherz aufgelegt. Challis war eine solche Haltung lieber als Schüchternheit, Ungeschicklichkeit oder Speichelleckerei, aber heute war Cree ein wenig lahm und hatte es nicht sonderlich eilig, die Einzelheiten festzuhalten. Challis schlug einen leichten, aber bestimmten Ton an: »Ich hab den ganzen Tag Zeit, Andy.«
Cree wurde rot. »Entschuldigung, Sir.«
»Wer ist hier? Wer ist gekommen und gegangen?«
Cree überprüfte die Liste. »Die Sanitäter haben das Opfer ins Krankenhaus gebracht. Constable Murphy klappert zusammen mit Constable Tankard die Straße ab. Die Spurensicherung ist noch nicht eingetroffen. Und schließlich wären da noch Detective Constable Sutton von der Kriminalpolizei und der Bruder des Opfers, ein gewisser …«
»Welcher Bruder?«, unterbrach ihn Challis. »Was hat der hier zu suchen? Das hier ist ein Tatort.«
Crees Gesicht zuckte nervös. »Er meinte, er wolle Waschzeug und Schlafanzug ins Krankenhaus bringen. Constable Sutton hat sein Okay gegeben, Sir.«
Challis wollte hineingehen, blieb aber noch mal stehen. »Wo wurde er gefunden?«
Neben dem Fußweg befand sich eine niedrige Hecke. Cree zeigte zu der kleinen Rasenfläche zwischen Straße und Eingangstür. »Er lag direkt dort, Sir.«
Zu beiden Seiten standen Hecken. Bei all den Sträuchern, der spärlichen Straßenbeleuchtung und der dunklen Nacht konnte man sich durchaus vorstellen, dass Roe bis Tagesanbruch weder von den Nachbarn noch von Passanten gesehen worden war.
»Und auf dem weiß angemalten Stein da ist Blut«, ergänzte Cree und wies auf einen ziemlichen Brocken, der auf dem Betonweg lag, welcher zur Tür führte. Er stammte aus der Umrandung des Rosenbeets. Challis nickte zum Dank, ging den kurzen, schmalen Weg zur offenen Haustür entlang und betrat den Flur, der in einen engen Wohn- und Essbereich mit einer Küche hinter einem Bogendurchgang führte. Dahinter war eine Tür, durch die man wohl in die Waschküche und in das Badezimmer gelangte. Schlichte, aber teure Einbauten und Möbel, wie Challis auf den ersten Blick erkannte, bevor er die einfache Treppe zum oberen Stock hinaufsah, wo er die Schlafzimmer vermutete. Und wo Stimmen laut wurden.
Challis zog sich am Treppengeländer empor, um schneller nach oben zu gelangen. Er folgte den Stimmen in ein kleines Büro an der Rückseite. Dort stand hilflos Scobie Sutton herum, während ein Mann in Jeans und T-Shirt ein Stromkabel um einen Laptop wickelte, der auf dem Schreibtisch vor einem Fenster gestanden hatte. Sutton blickte auf. »Tut mir leid, Chef …«
Der Detective wirkte wie ein Bestatter, so knochig und kantig sah er aus, ein Eindruck, den sein dunkler Anzug und seine niedergeschlagene Art noch verstärkten. Er fuchtelte matt mit den Händen herum, so als wolle er nach dem Computer greifen. Der andere Mann wich ihm aus und drehte sich zu Challis um. »Und wer zum Teufel sind Sie?«
Challis antwortete ihm kühl.
»Nun, ich bin Dirk Roe, und nur zu Ihrer Information: Mein Bruder ist gestern Nacht beinahe zu Tode geprügelt worden. Oder heute Morgen.«
Challis besah sich Roes Hände: sauber, nichts Auffälliges. Dann wandte er sich dem Gesicht des jungen Mannes zu, der die säuerliche Miene eines Menschen trug, der früher einmal bewundert worden war und nun nach dieser Bewunderung lechzte. Roe war nicht älter als fünfundzwanzig und hatte das rundliche, leicht dümmlich wirkende Aussehen eines Schuljungen, noch verstärkt durch die gegelte Igelfrisur, die schwarze Jeans, das blassgelbe Poloshirt und die Joggingschuhe, zwei fette Gummiklötze. Über seinem schwammigen Kinn klebte ein Ziegenbärtchen, an beiden Ohren baumelten Ohrringe.
Challis trat ins Zimmer und sagte: »Sie haben mein Mitgefühl, Mr. Roe, aber ich muss Sie bitten zu gehen. Das hier ist ein Tatort, und unsere Spurenfahnder waren noch nicht hier.«
»Aber Lachie ist doch draußen niedergeknüppelt worden, im Vorgarten.«
»Sein Angreifer kann ja vorher auch im Haus gewesen sein.«
»Mein Bruder kennt keine solchen Leute.«
»Was für Leute?«
»Gewalttätige Leute. Kriminelle«, antwortete Dirk Roe. Er schob sich den Laptop unter den Arm und wollte sich an Challis vorbeidrücken.
»Sir«, sagte Challis fest, »ich muss Sie bitten, den Laptop hierzulassen.«
Etwas huschte über das Gesicht des jungen Mannes. »Aber Lachie braucht ihn vielleicht. Kann sein, dass er noch einige Tage im Krankenhaus bleiben muss.«
Challis schüttelte den Kopf. »Unmöglich, leider. Auf dem Computer könnten sich wichtige Hinweise auf den Angreifer Ihres Bruder befinden.« Er hielt kurz inne. »Haben Sie daran herumgespielt?«
Dirk Roe wich seinem Blick aus. »Ich? Nein. Wieso?«
»Egal, der Computer bleibt hier.«
»Ich glaube, Sie wissen nicht, wer ich bin«, verkündete Roe.
Challis war dieses Spielchen endgültig leid. »Na gut, wer sind Sie?«, fragte er mit gepresster Stimme.
Roe baute sich auf. »Ich leite das Wahlbüro von Ollie Hindmarsh – und Sie wissen sicher, was er von der Polizei hält.«
Ollie Hindmarsh war der Oppositionsführer im Staatsparlament; sein Wahlbüro lag in der Nähe, um die Ecke auf der High Street. Hindmarsh war ein Kontroll-Freak, und seine Angriffe auf die Regierung bestanden darin, die Polizeikräfte der Korruption und der Vetternwirtschaft zu beschuldigen und zu behaupten, sie würde von Gewerkschaftsgaunern manipuliert. Die meisten Polizisten hassten den Kerl.
Challis lächelte leer. »Sie leiten sein Wahlbüro?«
»Ja.«
»Soll heißen, Sie gehen ans Telefon und lecken Briefumschläge an.«
»Also hören Sie mal! Ich …«
Challis knurrte nur: »Sir, ich muss Sie bitten, draußen zu warten. Scobie?«
Sutton machte ein leicht alarmiertes Gesicht, so als spürte er etwas mitschwingen, was er nicht deuten konnte. Er war ein Mann mit einer recht begrenzten Vorstellungsgabe, er ging regelmäßig in die Kirche, war seiner Frau treu und hatte so gut wie keine Ahnung von der menschlichen Natur. Er war kein schlechter Polizist, er war hartnäckig. Aber eigentlich auch kein guter. Er schlurfte entschuldigend vor, nahm Roe nach kurzem Handgemenge den Computer ab und fasste den Mann am Ellbogen. »Entschuldigung, Dirk.«
Challis runzelte die Stirn. Kannten sich die beiden? Er machte sich im Geiste eine Notiz, dann gingen sie alle die Treppe hinunter und betraten den Wohnbereich, als die Spurenfahnder in ihren Wegwerfoveralls und Überschuhen hereinkamen. »Na toll«, meinte einer von ihnen, »ein kontaminierter Tatort.«
»Jaja«, wiegelte Challis ab. »Sie können sich auf den Rasen vor der Eingangstür konzentrieren.«
»Und auf den blutigen Stein auf dem Weg. Was ist mit hier drinnen?«
»Fingerabdrücke, Blutspuren, Fasern, das Übliche.«
Dirk Roe wankte und stolperte ein wenig, so als würde ihm endlich aufgehen, dass seinem Bruder Gewalt angetan worden war. Scobie geleitete ihn hinaus und sagte: »Bleib nicht hier, Dirk, geh lieber ins Krankenhaus. Kannst du fahren?«
»Ich glaub schon.«
Warum war Roe nicht auf direktem Weg ins Krankenhaus gefahren, fragte sich Challis. Er gesellte sich auf dem Gehweg zu Sutton, und gemeinsam schauten sie zu, wie Roe im schwarzen Astra davonfuhr. »Scobie«, sagte Challis, »du und Pam macht das hier fertig. Ich schaue mal beim Opfer vorbei. Besprechung um zwölf.«
»Chef.«
Challis blieb kurz stehen. Andy Cree hatte seinen Platz verlassen und unterhielt sich einen halben Block weiter mit Pam Murphy. Er war einen Kopf größer als sie, lässig und zuvorkommend, und Challis konnte Pam lachen hören. Dann entdeckte sie ihn, warf ihm ein verlegenes Lächeln zu, winkte und machte sich wieder an die Arbeit. Cree kam zurück und sagte: »Entschuldigung, Sir.«
»Constable.«
Dann wandte sich Challis an Sutton. »Stell fest, ob es Aufnahmen von Überwachungskameras der örtlichen Geschäfte gibt.«
»Chef«, meinte Sutton.
4
In der Zwischenzeit war Ellen auf dem Revier in Waterloo eingetroffen, das am Kreisverkehr am oberen Ende der High Street lag, zusammen mit einer Caltex-Tankstelle, einem McDonald’s und einem Viehfutterhändler. Das Polizeigebäude selbst war niedrig, braune Ziegel und Glas inmitten einer Reihe von Eukalyptusbäumen, die ihre Rinde abwarfen, mit einem Zugang von einer kleinen Seitenstraße. Es handelte sich um ein großes Regionalrevier, das für den gesamten östlichen Bereich der Peninsula zuständig war. Hier arbeiteten uniformierte Beamte, Kriminalpolizei, Spurenfahnder, Polizeianwärter und eine Reihe von zivilen Mitarbeitern wie Büroangestellte, Kantinenpersonal und Datenspezialisten, die alle Informationen in Bezug auf gelöste und ungelöste Verbrechen und die Bewegungen und Kontakte von aktenkundigen Verbrechern auf der Halbinsel sammelten, analysierten und miteinander verknüpften.
Ellen stellte den Wagen vor dem Revier ab und betrat das Gebäude durch die Eingangshalle, wo eine Frau mittleren Alters zusah, wie der diensthabende Polizist eine eidesstattliche Erklärung bezeugte. Ellen gab ihren Zugangscode auf einem Tastenfeld ein, betrat das Gewirr von Büros und Fluren hinter dem Empfangstresen und kontrollierte ihr Postfach: ein Rundschreiben für den Polizeiball zum Jahresende, eine Erinnerung, dass sie noch zwölf Dollar in die Kaffeekasse zu zahlen hatte, und ein Exemplar der November-Nummer von Police Life. Vor Jahren hatte sich Hal mal auf der Titelseite wiedergefunden, nachdem er eine zentrale Rolle bei der Festnahme des Old-Peninsula-Highway-Killers gespielt hatte. Der Presserummel hatte ihm nicht gefallen. Er ging lieber unauffällig durchs Leben.
Arrestzellen, Befragungszimmer, Verwaltungsbüros und Kantine lagen im Erdgeschoss. Ellen ging die Treppe zum oberen Stockwerk hinauf, wo die CIU ihre Räume hatte. Daneben gab es eine Reihe von Besprechungsräumen, eine kleine Turnhalle und einen Kaffeeraum. Die Abteilung war klein, vier Detectives für die Nachtschicht, vier weitere am Tage, aber das klappte so gut wie nie, stets war einer krank, machte eine Weiterbildung oder musste vor Gericht aussagen. Wenn mehr Leute gebraucht wurden, bekamen sie Unterstützung von anderen Abteilungen der Kriminalpolizei, meist aus Mornington oder Rosebud.
Ellen setzte sich an ihren Eckschreibtisch ins geordnete Chaos des Großraumbüros der CIU und ging routinemäßig ihre Mails durch – dabei fiel ihr auf, wie verärgert sie darüber war, heute den Bürokram erledigen zu müssen. Es war toll, dass Hal wieder zurück war, aber sie hatte während seiner Abwesenheit eine große Untersuchung geleitet und sich gut geschlagen. Sie wollte raus, nicht hinter dem Schreibtisch versauern.
Allerdings war sexuelle Nötigung auch keine kleine Sache. Als Ellen keine E-Mail vom gerichtsmedizinischen Labor entdeckte, rief sie an, wies sich aus und gab die Fallnummer durch. »Sexuelle Nötigung«, gab sie das Stichwort, »Waterloo letzte Samstagnacht.«
Sie hörte das Klappern einer Tastatur am anderen Ende der Leitung, und schließlich sagte der Gerichtsmediziner: »Samen an der Kleidung des Opfers, richtig? Wir sind dabei, Sergeant Destry. DNA braucht Zeit.«
Ellen seufzte. »Ich wollte nur nachfragen«, sagte sie und beendete das Gespräch.
Sie starrte zu den Deckenleisten hinauf, ohne sie wahrzunehmen. An einem Fall von sexueller Nötigung samstagnachts war nichts Ungewöhnliches, nirgendwo auf der Welt. Doch in diesem Fall hatte es sich bei dem Opfer um eine Schulabgängerin, eine »Schoolie«, gehandelt. Sie war während der »Schoolies Week« überfallen worden, und ihr Angreifer konnte gut einer ihrer Altersgenossen gewesen sein.
Oder ein »Toolie«. Dabei handelte es sich um Ortsansässige, die die Schulabgänger ausspionierten. Meist ältere Männer, manche mit einem Vorstrafenregister: Diebstähle, Drogenhandel, sexuelle Übergriffe. Sie waren heimtückisch, wie Aasgeier, und schienen die jungen Leute für all das zu hassen, was ihnen fehlte: eine Ausbildung, die Aussicht auf einen Job, Geld, Jugend, Gesundheit, eine weiße Weste.
Waren letztes Jahr während der Abschlussfeiern »Toolies« aktiv gewesen? Waterloo war auf dieses Ereignis überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Die Polizei hatte mit drei Fällen von Rauschgiftüberdosis und zwei von Drogen in Drinks zu tun gehabt, dazu Diebstähle von Zelten, Schlaf- und Rucksäcken und einen gewalttätigen Überfall, bei dem ein Junge ohne Joggingschuhe, iPod, Handy und Brieftasche im Krankenhaus gelandet war. Die Polizisten hatten mehrere Verhaftungen wegen tätlichen Angriffs, Trunkenheit und ordnungswidrigem Verhalten und wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgenommen. Ellen hatte zudem Gerüchte aufgeschnappt, dass ein paar ortsansässige Mädchen sexuell belästigt worden seien.
Die Bevölkerung war in Aufruhr gewesen über den Lärm, die Schlägereien, die Autorennen und qualmenden Reifen an der Uferpromenade und die zugedröhnten, betrunkenen, unter Drogen stehenden oder verzweifelt weinenden jungen Leute, die durch die Straßen und Läden wanderten und bewusstlos in Lachen aus Blut, Urin oder Erbrochenem in den Vorgärten lagen. Die Straßenreinigung hatte Überstunden einlegen müssen, um Strand und Parks von Kondomen, Bierdosen, einzelnen Schuhen, Schlüpfern, selbst gebastelten Wasserpfeifen und Papiermüll zu säubern.
In vielerlei Hinsicht war allerdings gerade das Verhalten der reichen Jugendlichen am schlimmsten gewesen. Sie kamen in teuren Autos an und schmissen mit Geld nur so um sich. Sie gingen davon aus, sich damit von allem Ärger freikaufen zu können. Da sie an teure Auslandsaufenthalte gewöhnt waren, fanden sie das bescheidene, kleine Waterloo fürchterlich langweilig, und das ließen sie an den Anwohnern und den ärmeren Jugendlichen aus.
Die Stadtoberen steckten in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite verurteilten sie das schlechte Benehmen, auf der anderen schätzten sie, dass die jungen Leute bis zu 200 000 Dollar in der Stadt ließen, und keiner wollte den Jugendlichen einen Urlaub am Strand verwehren. Deshalb hatten sich Bürgermeister und Stadtrat für dieses Jahr eine Strategie zurechtgelegt. Die Gemeinde würde für Campingflächen und psychologische Betreuung sorgen, allgemeine Hinweise verbreiten. Die Polizei würde sich unter die Schoolies mischen und mit ihnen reden. Gleichzeitig wollte sie aber hart gegen Trunkenheit und Vandalismus vorgehen und Geldstrafen verhängen bei Genuss oder Besitz von Alkohol in der Öffentlichkeit und bei Lagerfeuern im Uferbereich. Auch das Campieren im Auto war untersagt.
Ellen hatte Pam Murphy als Kontaktperson ausgewählt, weil sie dachte, die junge Kollegin würde mitfühlender und verständnisvoller sein als Scobie Sutton. Sie kümmerte sich aber auch selbst um die Sache und loggte sich gerade in die Website der »Schoolies Week« ein. Erst als Murphy sie darauf aufmerksam gemacht hatte, hatte sie überhaupt von der Seite erfahren. Vielleicht wussten die Jugendlichen auch nichts davon, vielleicht war sie dürftig oder unpassend. Das wollte Ellen herausfinden.
Die Website, die das Bildungsministerium aufgeschaltet hatte, war veraltet und konzentrierte sich nur auf die traditionellen Schwerpunkte der Woche in Lorne, Portsea und Sorrento. Wir sind wohl nicht groß genug, dachte Ellen. Keine Hinweise auf die Attraktionen in und um Waterloo: das Surfgebiet am Point Leo, die Fähre nach Phillip Island, die Fahrradwege, die Irrgärten bei Shoreham und Arthur’s Seat, die Wanderwege an der Bushranger Bay und in Greens Bush, der Fußweg, der durch das Marschland in Waterloo führte, die Bootsfahrten von Tooradin aus.
Ellen ging die Liste der »hilfreichen Telefonnummern« durch. Die offenkundigsten Anlaufstellen waren vorhanden – Polizeinotruf, Feuerwehr, Rettungsdienst, ganztägige Drogen- und Alkoholberatung, Giftnotruf, Telefonberatung bei sexueller Belästigung und Selbstmordabsichten –, aber keine örtlichen Nummern. Was, wenn jemand einen Bus oder ein Taxi brauchte?
Ellen scrollte weiter. Die allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsratschläge waren einigermaßen brauchbar. Die Jugendlichen wurden darauf hingewiesen, sich regelmäßig zu Hause zu melden, aufeinander zu achten, ihre Wertsachen sicher zu verstauen und ihre Ausweise bei sich zu tragen, dazu genügend Geld – getrennt von der Brieftasche –, um telefonieren oder ein Taxi bezahlen zu können. Bei Schwierigkeiten sollten sie sich an die Polizei und die offiziellen Helfer wenden.
Ellen las weiter. Nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss schwimmen gehen. Genügend Wasser trinken. Mindestens eine ordentliche Mahlzeit am Tag zu sich nehmen. Augenmerk auf mit Alkohol oder Drogen versetzte Getränke und verdächtige Fremde richten. Nicht zu unbekannten oder angetrunkenen Fahrern ins Auto steigen. Die Freunde nicht mit Fremden mitgehen lassen, sie vor Belästigungen durch andere schützen, nicht allein ausnüchtern lassen. Vor zwei Jahren war in Portsea ein Jugendlicher an seinem eigenen Erbrochenen erstickt.
Als Nächstes die Unterkunftsmöglichkeiten. Letztes Jahr hatten ein paar Jugendliche ein Motelzimmer verwüstet und waren in der Nähe der Uferpromenade aus einer Frühstückspension geworfen worden. Ellen sah, dass manche Jugendliche auch von Vermietern übers Ohr gehauen wurden. Die Website riet, das Kleingedruckte in den Mietverträgen zu lesen – hätte sie mit achtzehn an so etwas gedacht? – und sich eine Quittung für die Kaution geben zu lassen, die sie sich sofort nach Ende des Aufenthalts zurückerstatten lassen sollten. Ellen las weiter: wie lege ich Beschwerde ein, was beinhaltet die Betriebserlaubnis einer Unterkunft und so weiter und so fort.
Ellen rieb sich die Augen. Sie hasste die Arbeit am Computer. Sie klickte sich durch weitere Links und musste einräumen, dass die Informationen hilfreich und solide waren – aber lasen die Kids sie überhaupt? Sie dachte an die örtlichen Informationen, die dringend noch ergänzt werden mussten. Zum Beispiel, wo man gefahrlos schwimmen konnte. Dass sich die Western Port Bay bei Ebbe gefährlich leerte, dass man sich auf einer Schlammbank wiederfinden und bei Flut ertrinken konnte. Die Funklöcher im Handynetz. Die Tatsachen, dass es nachts ziemlich kalt werden konnte und im November manchmal regnerisch war, dass viele Geschäfte und Restaurants in der kleinen Gemeinde Waterloo früh schlossen. Die Stadt Lorne bot ihren Schulabgängern kostenlose medizinische Versorgung und kostenlose Park-and-Ride-Möglichkeiten an. Dort hatten sie zahlreiche Helfer, die gut erkennbare orangefarbene T-Shirts trugen. Waterloo hatte nur Pam Murphy vom örtlichen Polizeirevier und eine Handvoll wohlmeinender, aber unausgebildeter Freiwilliger aus den örtlichen Kirchengemeinden zu bieten, die von einem Zufluchtsort auf einem Kirchengelände hinter der High Street aus operierten, der Chillout-Zone. Ellen hatte am Vorabend dort vorbeigeschaut und war am Ende damit beschäftigt gewesen, Pam Murphy zu helfen, Getränke und Essen an erschöpfte, einsame, gelangweilte, verwirrte oder einfach nur abgebrannte Jugendliche auszugeben.
Auch Scobie Suttons Frau Beth war dort gewesen. Murphy zufolge hatte sich Beth Sutton seit Freitag in der Chillout-Zone aufgehalten, hatte fromme Pamphlete verteilt und mit drängend monotoner Stimme auf die Jugendlichen eingeredet.
Ellen sah vom Bildschirm auf und stierte ein Loch in die Luft. Die Freiwilligen. Pam Murphy hatte ihr die Leute vom gestrigen Abend vorgestellt – sie hatte sie alle überprüft, wie sie sagte –, aber Pam konnte ja nicht überall zugleich sein. War es nicht ein Leichtes für irgendeinen Triebtäter, sich als offizieller Freiwilliger oder Streetworker auszugeben?
»Der Job wird von Tag zu Tag schwerer«, murmelte Ellen. Sie sah auf die Uhr. Die anderen müssten eigentlich bald von dem Überfall in der Trevally Street zurück sein.
5
Caz Moon war in der Trevally Street. Sie ging zur Arbeit in den Surfshop oben an der High Street, den sie leitete, HangTen. Aber wollte sie das überhaupt weiterhin tun, wollte sie in der Stadt bleiben? Caz war keine süße Surfermaus – braun gebrannt, blond, Minirock, Kaugummi im Mund. Nichts davon interessierte sie. Ihre Jeans und ihr T-Shirt waren billig, Haare und Make-up leicht auf Grufti. Sie hielt ihr Geld zusammen. Sie war einundzwanzig, schlank, fix und clever, und schon bald würde sie sich von Waterloo verabschieden. Sollten die anderen doch schwanger werden und arbeitslos bleiben.
Caz Moon war noch nicht am Tatort, konnte aber in der Entfernung bereits den Streifenwagen, die Uniformierten und das Absperrband sehen. Sie war an dem Abschnitt der Trevally Street, wo sich auf den Hund gekommene Motels an zweifelhafte Pensionen und heruntergekommene Ferienwohnungen reihten. Sie alle gingen auf das lückenhafte Parkgelände zwischen den Grillstellen und der Strandpromenade hinaus, das bis an den Mangrovensumpf reichte. Diese Woche war auf diesem Gelände eine Zeltstadt entstanden. Wacklige, grüne und blaue Nylongebilde flatterten im Wind. Niemand rührte sich. Die Kids schliefen noch ihren Rausch aus.
Dann kam Caz vor den Sea Breeze Holiday Apartments an einem roten Subaru Impreza mit Spoiler, Dachreling und Aluspezialfelgen vorbei. Sie wankte, fühlte sich plötzlich hilflos. Unerwünschte Gefühle überrollten sie und nahmen ihr für einen Augenblick die Fähigkeit, klar zu denken. Es war vor einem Jahr gewesen. Schoolies Week. Sie erinnerte sich noch an das Geräusch, das er beim Atmen gemacht hatte, und wie ihr Schlüpfer zerriss, an seine leicht gammlige, kokain- und amphetamingetränkte Haut, an den harten Sand unter ihrem Rücken, die Galle in ihrem Mund und die allwissenden Sterne oben am Himmel.
Josh, so hieß er. Eine lange Achterbahnfahrt durch die Nacht, erst der liebe Josh, dann der Verfolgungswahn, der irre Blick, mit dem er sie durchbohrte, dann wieder diese Liebenswürdigkeit. Heute wusste sie mehr, kannte diese Stimmungsschwankungen, die mit Ice einhergingen. Vielleicht hatte er sogar eine ganze Apotheke in der Tasche gehabt, denn das Nächste, woran sie sich hatte erinnern können, waren diese Benommenheit, die schweren Glieder gewesen, dann Josh, der in der tiefsten Nacht auf ihr lag. Und jetzt war er wieder mit seinem kleinen roten Auto in der Stadt.
Caz Moon schloss die Augen und zwang sich, an etwas anderes zu denken, unterdrückte ihre Wut. Sie atmete ein, atmete aus. Sie lächelte. Sie ging in ihrer geheimnisvollen Art weiter die Trevally Street entlang in Richtung Villanova Gardens.
Eine Polizistin beobachtete sie, und Caz beobachtete die Polizistin, eine junge Frau mit einem Klemmbrett in der Hand, die plötzlich darin innehielt, ergebnislos an die Türen der Nachbarschaft zu klopfen, und auf sie zukam. Ihr Gesicht wirkte so kühl, leer und teilnahmslos wie das aller Bullen.
»Hi«, sagte die Polizistin. »Ich bin Detective Constable Pam Murphy.« Sie legte den Kopf schief. »Ich hab Sie schon mal gesehen. Sie arbeiten in dem Surfshop, richtig?«
»Ich führe ihn«, antwortete Caz. Sie ergriff die Initiative und streckte ihre Hand aus. »Karen Moon, kurz Caz.«
»Hi«, sagte die Polizistin und schüttelte ihr die Hand. »Hören Sie, wir untersuchen einen ernsten Zwischenfall von letzter Nacht in der Trevally Street. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«
Caz sah an der Beamtin vorbei zu einem kräftig gebauten Streifenpolizisten hinüber, der auf der anderen Straßenseite die Türen abklapperte, dann noch weiter zu einem der Apartmenthäuser, wo ein gut aussehender Bulle gelangweilt herumstand. »Schießen Sie los.«
Dann kamen die Fragen: »Wohnen Sie in der Nähe? Nehmen Sie regelmäßig diesen Weg? Sind Sie gestern spätnachts oder heute früh hier vorbeigekommen?«
Und so weiter. Es dauerte nicht lange. Caz machte ihr bald klar, dass sie nichts gesehen oder gehört hatte. Das war die Wahrheit. Trotzdem log sie. Die Lüge bestand darin, die junge Beamtin mit dem gestählten Körper und dem prüfenden Blick nicht darüber zu informieren, dass sie letzten November vergewaltigt worden war. Nachts, an einem der Strände. Und dass sie wusste, wo der Kerl zu finden war, der das getan hatte.
Caz Moon nährte eine ganz eigene, rachsüchtige Wut.
Auch Ludmilla Wishart sah den Streifenwagen, das Absperrband und die an die Türen klopfenden Polizisten. Sie sah sie durch die Seitenscheibe ihres Golfs, als sie auf dem Weg zum Planungsamt die Trevally Street entlangfuhr. Normalerweise hätte sie wie die anderen schaulustigen Passanten hingeschaut und ihre Eindrücke später mit ihren Arbeitskolleginnen am Tisch in der Kantine ausgetauscht, aber dafür fühlte sie sich zu betäubt. Fühlte sich zu dick.
War sie fett? Ihre beste Freundin Carmen meinte: »Also Mill, wenn überhaupt, dann bist du zu dürr.« Wenn Ludmilla sich stark fühlte, glaubte sie ihr, ansonsten glaubte sie Adrian. Warum war das so wichtig für ihn? Sie wollte gut für ihn aussehen, wie man das eben einem Liebhaber oder einem Ehemann gegenüber wollte, aber für Adrian gut aussehen zu wollen, hieß, ständig auf der Hut zu sein. Es war anstrengend. Die Mühe und die Sorgen deswegen erschöpften sie. Sie ersann sich kleine Akte des Widerstands, um überhaupt weitermachen zu können. Ihre Freundschaft mit Carmen zum Beispiel, da konnte sie ganz sie selbst sein, Witze reißen, ihre Abwehrhaltung ablegen. Vor ihr nahm Adrian sich in Acht, er schien wohl zu spüren, dass Carmen ihn verachtete. Ludmilla bremste an einem Kreisverkehr und dachte über einen weiteren Widerstandsakt nach: die Personenwaage verstecken oder kaputt machen. Aber Adrian würde eine neue kaufen.
Schlechte Gefühle kamen in ihr hoch, sie fuhr weiter und bog schließlich einen halben Kilometer vom Tatort entfernt in eine Seitenstraße und bremste vor der Einfahrt zum Planungsamt Ost. Das hektische Tempo beim Bau von Wohnungen und Gewerbesiedlungen hatte in den letzten Jahren einen ungeheuren Druck auf die Planer in der Bezirksverwaltung ausgeübt. Nun kümmerten sich verschiedene voneinander unabhängige Abteilungen um die Anträge in den westlichen, östlichen und südlichen Vororten. Im Büro Ost arbeiteten mehrere Planer, Ludmilla war für Verstöße gegen die Bauordnung zuständig. Ihr Chef hieß Athol Groot. Der einzige noch freie Parkplatz war neben seinem Mercedes, einem weißen Oldtimer, und Ludmilla parkte vorsichtig, übervorsichtig, weil sie wusste, wie er reagieren würde.
Wie sie so an ihren Chef dachte, fiel ihr wieder Adrian ein, und sie blieb ein paar Minuten mit rasendem Herzschlag sitzen. Das passierte ihr häufiger, Adrian hatte etwas auszusetzen, und ihr Herz begann zu flattern. Die einzige Lösung bestand darin, in ihr Büro zu stolpern, auf dessen Tür »Ludmilla Wishart, Bauverordnungsverstöße« stand, sich auf den Boden zu legen und eine Hand aufs Herz zu legen, um das unregelmäßige Pochen unter Kontrolle zu bekommen.
Ludmilla wollte vor allem eines: kühl und beherrscht sein. Sie glaubte, diese Eigenschaft bei der jungen Polizeibeamtin in der Trevally Street bemerkt zu haben. Aber wie sollte sie das hinkriegen? Indem sie Adrian verließ, wenn es nach Carmen ging.
»Was machen Sie da?«
Mr. Groot, gedrungen und schwer, stand in ihrer Tür und trug die Art von Gesichtsausdruck zur Schau, die besagte, dass es ihm vollkommen gleichgültig war, ob sie krank war oder nicht, solange er nur nichts damit zu tun hatte.
John Tankard und Pam Murphy hatten das Abklappern der Häuser in der Trevally Street beendet, gingen zurück zu den Villanova Gardens und verglichen ihre Notizen. »Ich habe eine Zeugin gefunden, die die Aussage von Lachlan Roes Nachbarn bestätigt«, sagte Tank. »Er hat kurz nach Mitternacht zwei Männer streiten hören und einen Kerl mit Kapuzen-Shirt die Trevally Street in Richtung Bücherei davonlaufen sehen. Sein Gesicht konnte er nicht erkennen.«
Pam schnaubte. »Ein Kerl mit Kapuzen-Shirt.«
»Einen Dollar für jedes Mal, wo du das schon gehört hast, richtig?«, meinte Tank.
»Kannst du laut sagen.«
Tank stieß sie mit der Schulter an. Bis vor ein paar Wochen war sie noch seine Teamkollegin gewesen. Jetzt war sie Kriminalpolizistin, ein Ass von der CIU, und er musste sich mit Andrew Cree, diesem Idioten, als Partner herumschlagen. Doch kaum hatten sich ihre Schultern berührt, wich Pam ein wenig zur Seite. Eigentlich nichts Besonderes, doch Tank deutete das als Zurückweisung.
Cree, dieses Gottesgeschenk an die Frauen und die Polizeiarbeit, sah die beiden näher kommen. Tank wurde von allen möglichen Emotionen überrumpelt. Er wusste, dass er übergewichtig war, außer Form und bei Frauen ein hoffnungsloser Fall. Und da stand Cree, schlank, fit, selbstsicher, einen Abschluss in Geisteswissenschaften, ausgerechnet, im Gespräch nie geradeheraus, aber mit jeder Menge Andeutungen zwischen den Zeilen.
»Wie läufts, Andy?«, rief Pam mit einer Stimme, bei der Tank die Antenne ausfuhr.
»Dieser Job ist zu aufregend für mich«, antwortete Cree.
Pam lachte.
Miststück, dachte Tank.
Dann tröstete er sich mit dem Gedanken, dass er etwas wusste, wovon Pam nichts ahnte – der große Andrew Cree hatte Angst vor der Dunkelheit. Wirklich. Bevor sie bei Tagesanbruch in die Trevally Street gerufen wurden, waren Tank und Cree, die seit vier Uhr früh Dienst hatten, am Stadtrand Streife gefahren. Ringsherum war es dunkel gewesen, ihre Scheinwerfer hatten die geisterhaften Umrisse der Eukalyptusbäume erfasst, dazu die glühenden Augen von Füchsen auf der Jagd, als Tank, der an die Dunkelheit gewöhnt war, sich fragte, warum Cree mit bis an die Ohren hochgezogenen Schultern hinter dem Lenkrad saß. Plötzlich ging es ihm auf: Der Kerl hatte Angst. Der junge Andrew war in irgendeiner endlosen Reihensiedlung von Melbourne aufgewachsen, wo es niemals dunkel war und keine Schlangen oder Spinnen lauerten. Nicht wie auf den Seitenstraßen der Peninsula. Hier gibts keine Straßenlaternen, alter Kumpel, alter Kollege, alter Kamerad. Hier draußen legt sich die Dunkelheit eng um einen. Geister und Gespenster zuhauf.
»Okay, Jungs«, verkündete Pam, »wir sind hier fertig. Danke für eure Hilfe. Schnappt euch einen Kaffee und kehrt wieder an eure eigentliche Arbeit zurück.«
»Keine Ahnung, ob ich so viel Aufregung überhaupt verkrafte«, erwiderte Cree, zwinkerte ihr zu und bewegte den Mund dabei, so als wolle er sagen, dass er die Aufregung mit ihr sehr wohl verkraften würde.
Vollidiot.
6
Challis verließ die Villanova Gardens, fuhr zum Krankenhaus und begegnete einer Frau von der Spurensicherung, die zielstrebig mit mehreren braunen Papiertüten voller Beweisstücke über den Parkplatz ging, so als hielte sie mächtige Gefühle in Schach. Als sie Challis sah, blieb sie stehen. »Eine wirklich üble Geschichte, Sir.«
Challis nickte. »Mehr als ein Täter?«