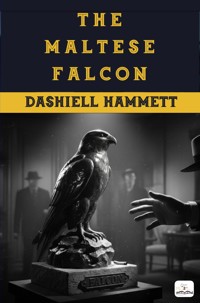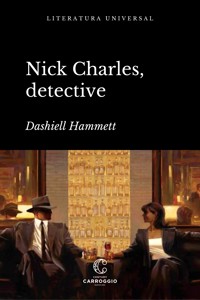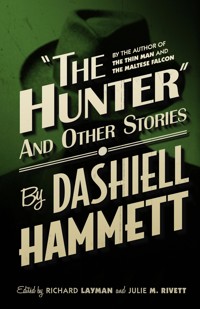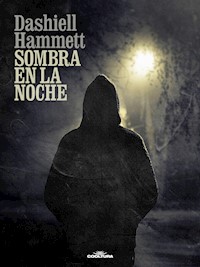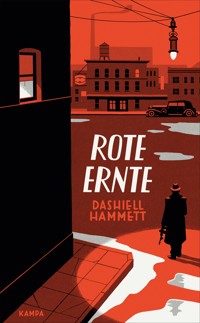
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Den Glauben an das Gute im Menschen hat der Continental Op längst verloren, und auch er selbst steht nicht immer auf der richtigen Seite des Gesetzes. San Francisco, wo seine Detektei ihren Sitz hat, ist ein moralischer Sumpf, Korruption ist an der Tagesordnung - und das gilt auch für Personville (besser bekannt als Poisonville), ein schäbiges Bergwerksstädtchen, wohin ihn sein aktueller Auftrag führt. Dort angekommen, muss er feststellen, dass sein Auftraggeber, Don Willsson, Sohn des Stadtpatriarchen, einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Und es bleibt nicht bei dieser einen Leiche. Am Ende des Romans sind 18 Menschen tot, die Erde von Poisonville blutgetränkt - und die Ordnung wiederhergestellt. Ein grandioser Albtraum von einem Krimi und zugleich ein bedeutender politischer Roman, der uns noch heute viel über Korruption, Machtmissbrauch und organisierter Kriminalität zu erzählen vermag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dashiell Hammett
Rote Ernte
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren
Kampa
Für Joseph Thompson Shaw
Kapitel IEine Frau in Grün und ein Mann in Grau
Zum ersten Mal hörte ich von Personville im Big Ship in Butte, und zwar von einem rothaarigen Typen namens Hickey Dewey, der es immer nur Poisonville nannte, aber der sagte auch nicht Zigarette, sondern Zerette, also dachte ich mir nichts dabei. Danach hörte ich Leute, die es mit ihrer Aussprache genauer nahmen, ebenfalls Poisonville sagen, sah darin aber nichts weiter als jene idiotische Art von Humor, die aus einem Professor einen Brotfresser macht. Erst als ich ein paar Jahre später nach Personville fuhr, ging mir ein Licht auf.
Von einer Telefonzelle im Bahnhof rief ich beim Herald an, verlangte Donald Willsson und sagte ihm, ich sei gerade eingetroffen.
»Kommen Sie doch heute Abend um zehn zu mir nach Hause.« Er hatte eine angenehm klare Stimme. »Die Adresse ist Mountain Boulevard 2101. Nehmen Sie die Straßenbahn, die den Broadway entlangfährt, steigen Sie an der Laurel Avenue aus und gehen Sie zwei Blocks in Richtung Westen.«
Ich sagte, das würde ich tun. Dann fuhr ich zum Great Western Hotel, stellte mein Gepäck ab und ging raus, um mir die Stadt anzusehen.
Sie war nicht schön. Die meisten ihrer Erbauer hatten etwas Pompöses erschaffen wollen. Vielleicht war ihnen das anfangs auch gelungen, aber dann hatte der gelbe Rauch der Schmelzhütten, deren Schornsteine vor dem düsteren Berg im Süden aufragten, alles mit einer gleichmäßigen Schmutzschicht überzogen. Das Ergebnis war eine hässliche Stadt mit vierzigtausend Einwohnern, die in einem hässlichen Einschnitt zwischen zwei hässlichen, vom Abraum zahlloser Minenschächte entstellten Bergen lag. Darüber hing ein schmutzig grauer Himmel, der aussah, als wäre er aus den Schornsteinen der Hüttenwerke gequollen.
Der erste Polizist, den ich sah, hatte einen Bartschatten. Beim zweiten fehlten an der abgewetzten Uniform ein paar Knöpfe. Der dritte regelte den Verkehr auf der größten Kreuzung – Broadway und Union Street – und hatte dabei eine Zigarre im Mundwinkel. Danach sah ich nicht mehr genauer hin.
Um halb zehn stieg ich am Broadway in eine Straßenbahn, folgte Donald Willssons Anweisungen und stand bald vor einem Eckhaus mit Vorgarten und Hecke.
Das Hausmädchen, das mir öffnete, sagte, Mr. Willsson sei nicht zu Hause. Während ich noch erklärte, ich sei mit ihm verabredet, kam eine schlanke Blondine von nicht ganz dreißig in einem grünen Kreppkleid hinzu. Als sie lächelte, verloren ihre blauen Augen nichts von ihrer Härte. Ich wiederholte, was ich zu dem Hausmädchen gesagt hatte.
»Mein Mann ist nicht da. Aber wenn er sich mit Ihnen verabredet hat, wird er sicher gleich kommen.«
Sie führte mich in den ersten Stock in ein in Braun und Rot gehaltenes Zimmer voller Bücher, dessen Fenster auf die Laurel Avenue gingen. Wir nahmen in Ledersesseln Platz, halb einander, halb dem Kohlenfeuer im Kamin zugewandt, und sie machte sich daran herauszufinden, was ich mit ihrem Mann zu besprechen hatte.
»Sind Sie auch aus Personville?«, fragte sie.
»Nein, aus San Francisco.«
»Aber Sie sind sicher nicht zum ersten Mal hier, oder?«
»Doch.«
»Tatsächlich? Wie gefällt Ihnen unsere Stadt?«
»Ich habe noch nicht genug davon gesehen, um das sagen zu können.« Das war gelogen. Ich hatte genug gesehen. »Ich bin erst heute Nachmittag angekommen.«
Ihre glänzenden Augen hörten auf, mich forschend zu mustern, als sie sagte: »Sie werden sehen, es ist ein trostloses Kaff.« Aber dann fuhr sie gleich fort, mich auszuhorchen. »Wahrscheinlich sind alle Bergbaustädte so. Sind Sie im Bergbau tätig?«
»Im Augenblick nicht.«
Sie sah auf die Kaminuhr und sagte: »Wie unhöflich von Donald, Sie herzubestellen und dann warten zu lassen – und das um diese Uhrzeit, lange nach Feierabend.«
Ich versicherte ihr, das sei schon in Ordnung.
»Aber vielleicht geht es ja auch gar nicht um was Geschäftliches«, bemerkte sie.
Ich sagte nichts.
Sie lachte – ein kurzes Lachen, in dem etwas Scharfes war. »Ich bin normalerweise nicht so neugierig, wie Sie jetzt wahrscheinlich denken«, sagte sie unbekümmert. »Aber Sie sind so geheimnistuerisch, dass ich gar nicht anders kann. Sie sind nicht zufällig Alkoholschmuggler, oder? Donald wechselt seine Quellen so oft.«
Ich ließ sie aus meinem Grinsen schließen, was sie wollte.
Unten läutete das Telefon. Mrs. Willsson streckte die Füße in den grünen Pantoffeln zum Kohlenfeuer und tat, als hätte sie es nicht gehört. Ich fragte mich, warum sie das für nötig hielt.
»Ich fürchte …«, setzte sie an, hielt aber inne, als das Hausmädchen in der Tür erschien und ihr sagte, sie werde am Telefon verlangt.
Sie entschuldigte sich und ging hinaus, allerdings nicht hinunter, sondern zu einem Nebenanschluss in Hörweite.
»Hier ist Mrs. Willsson … Ja … Wie bitte? … Wer? … Könnten Sie bitte lauter sprechen? … Was? … Ja … Ja … Wer ist da? … Hallo? Hallo?«
Der Hörer wurde klappernd aufgelegt. Dann erklangen im Flur Schritte – rasche Schritte.
Ich steckte mir eine Zigarette an und betrachtete die Glut, bis ich Mrs. Willsson die Treppe hinuntergehen hörte. Dann trat ich ans Fenster, schob den Vorhang ein wenig beiseite und sah hinaus auf die Laurel Avenue und die kastenförmige weiße Garage auf dieser Seite des Hauses.
Im selben Augenblick eilte eine schlanke Frau in einem dunklen Mantel und mit einem dunklen Hut vom Haus zur Garage. Es war Mrs. Willsson. Sie fuhr in einem Buick Coupé davon. Ich setzte mich wieder in den Sessel und wartete.
Es verging eine Dreiviertelstunde. Um fünf nach elf quietschten draußen Bremsen. Zwei Minuten später erschien Mrs. Willsson. Sie hatte Hut und Mantel abgelegt. Ihr Gesicht war bleich, ihre Augen waren beinahe schwarz.
»Es tut mir wirklich leid, dass Sie so lange umsonst gewartet haben«, sagte sie. Ihre schmalen Lippen zuckten. »Mein Mann wird heute nicht mehr kommen.«
Ich sagte, ich würde ihn am nächsten Morgen in der Redaktion des Herald anrufen.
Als ich ging, fragte ich mich, wieso die grüne Spitze ihres linken Pantoffels einen feuchten, dunklen Fleck hatte, bei dem es sich möglicherweise um Blut handelte.
Ich ging zum Broadway und nahm die Straßenbahn. Drei Blocks nördlich meines Hotels stieg ich aus, um zu sehen, warum sich vor einem Nebeneingang des Rathauses eine Menschenmenge versammelt hatte.
Dreißig, vierzig Männer und ein paar Frauen drängten sich auf dem Bürgersteig vor einer großen Tür, über der Polizei stand. Männer in Arbeitskleidung aus den Bergwerken und Schmelzhütten, geschniegelte Jungs aus Billardsalons und Tanzschuppen, geleckte Typen mit energischen, blassen Gesichtern, Männer mit der stumpfen Miene treu sorgender Gatten, einige ebenso stumpf und treu sorgend wirkende Frauen und ein paar Bordsteinschwalben.
Ich blieb am Rand dieser Versammlung neben einem stämmigen Mann in zerknitterten grauen Kleidern stehen. Auch sein Gesicht war irgendwie grau, sogar die dicken Lippen, obwohl er nicht viel älter als dreißig war. Sein Gesicht war breit und grob geschnitten, aber intelligent. Die rote Krawatte, die über dem grauen Flanellhemd leuchtete, war der einzige Farbfleck an ihm.
»Was ist hier los?«, fragte ich ihn.
Bevor er antwortete, musterte er mich eingehend, als wollte er sich davon überzeugen, dass die Information nicht in die falschen Hände geriet. Seine Augen waren grau wie seine Kleider, aber nicht so weich.
»Don Willsson sitzt jetzt zur Rechten Gottes, jedenfalls wenn Gott nichts gegen ein paar Einschusslöcher einzuwenden hat.«
»Wer hat ihn erschossen?«
Der graue Mann kratzte sich im Nacken und sagte: »Einer mit ’ner Kanone.«
Ich war auf Informationen aus, nicht auf witzige Bemerkungen, und hätte mein Glück bei einem anderen Schaulustigen probiert, aber die rote Krawatte hatte mein Interesse geweckt. Ich sagte: »Ich bin fremd hier. Sie müssen mir schon die ganze Geschichte erzählen – dafür sind Fremde schließlich da.«
»Der sehr ehrenwerte Mr. Donald Willsson, Herausgeber des Morning und des Evening Herald, ist vor Kurzem sehr tot in der Hurricane Street aufgefunden worden, erschossen von einem oder mehreren Unbekannten«, sagte er in einem schnellen Singsang. »Na, sind Ihre verletzten Gefühle jetzt besänftigt?«
»Danke.« Ich tippte mit dem Finger auf seine Krawatte. »Hat die was zu bedeuten? Oder tragen Sie sie einfach so?«
»Ich bin Bill Quint.«
»Ach was, tatsächlich?«, rief ich und fragte mich, woher ich den Namen kannte. »Mann, bin ich froh, Sie zu treffen!«
Ich holte das Kartenetui hervor und suchte in der Sammlung von Identitäten, die ich mir hier und da auf die eine oder andere Art zugelegt hatte, bis ich die rote Karte fand, die mich als Henry F. Neill identifizierte, Vollmatrose und Mitglied der Industrial Workers of the World. Nichts davon entsprach der Wahrheit.
Ich reichte ihm die Karte. Er studierte sorgfältig die Vorder- und Rückseite, gab sie mir zurück und musterte mich mit einem argwöhnischen Blick von Kopf bis Fuß.
»Viel toter wird er nicht mehr werden«, sagte er. »Wo müssen Sie hin?«
»Egal.«
Wir gingen die Straße entlang und bogen, ziellos, wie mir schien, ab.
»Was machen Sie hier, wenn Sie Matrose sind?«, fragte er im Plauderton.
»Wie kommen Sie darauf?«
»Steht auf Ihrer Mitgliedskarte.«
»Ich hab noch eine andere, auf der steht, dass ich Holzfäller bin«, sagte ich. »Und wenn Sie wollen, bringe ich Ihnen morgen eine von der Bergarbeitergewerkschaft.«
»Oder auch nicht. Die leite nämlich ich.«
»Und wenn Sie ein Telegramm vom Dachverband kriegen?«, fragte ich.
»Scheiß auf den Dachverband. Hier bin ich der Boss.« Er wies mit dem Kinn auf ein Restaurant und sagte: »Was trinken?«
»Immer, wenn’s geht.«
Wir gingen durch das Restaurant, eine Treppe hinauf und in einen schmalen Raum mit einer langen Theke und einer Reihe von Tischen. Bill Quint nickte, begrüßte ein paar der Männer und Frauen an den Tischen mit »Hallo« und führte mich zu einer der mit grünen Vorhängen versehenen Nischen gegenüber der Theke.
Die nächsten zwei Stunden verbrachten wir damit, Whiskey zu trinken und zu reden.
Der graue Mann fand, ich hätte kein Recht auf die Karte, die ich ihm gezeigt hatte, ebenso wenig wie auf die andere, die ich erwähnt hatte. Er fand, ich sei kein aufrechter Proletarier. Als Großmotz der IWW in Personville hielt er es für seine Pflicht, mich gründlich unter die Lupe zu nehmen, ohne sich dabei über seine eigenen radikalen Umtriebe aushorchen zu lassen.
Mir war es recht. Mich interessierte nur, was in Personville passierte, und er hatte nichts dagegen, es mir zu erzählen, wobei er allerdings immer wieder auf die Sache mit den roten Mitgliedskarten zurückkam.
Was ich aus ihm herausholte, war ungefähr das Folgende:
Seit vierzig Jahren war Elihu Willsson – der Vater des Mannes, der heute Abend umgebracht worden war – Besitzer von Personville. Es gehörte ihm mit Haut und Haaren und allem, was da kreuchte und fleuchte. Er war Präsident und Mehrheitseigner der Personville Mining Corporation und der First National Bank, er war Eigentümer des Morning Herald und des Evening Herald und mindestens Miteigentümer sämtlicher einigermaßen bedeutender Unternehmen in der Stadt. Außerdem gehörten ihm ein Senator, ein paar Abgeordnete im Repräsentantenhaus, der Gouverneur, der Bürgermeister und die meisten Abgeordneten im Staatsparlament. Elihu Willsson war Personville, er war fast der ganze Staat.
Während des Kriegs hatte die IWW – die damals im Westen in voller Blüte stand – die Arbeiterschaft der Personville Mining Corporation organisiert. Die Arbeiter waren nicht gerade verwöhnt worden. Sie nutzten ihre neue Stärke, um Forderungen zu stellen. Der alte Elihu gab ihnen, was sie verlangten, und wartete auf seine Gelegenheit.
Die kam 1921. Die Geschäfte gingen schlecht. Dem alten Elihu war es egal, ob er seine Betriebe für eine Weile schließen musste oder nicht. Er verwarf die Abmachungen, die er mit seinen Arbeitern getroffen hatte, und bot ihnen Bedingungen an wie zu Vorkriegszeiten.
Natürlich riefen sie um Hilfe. Bill Quint wurde von der IWW-Zentrale in Chicago geschickt, um Maßnahmen zu ergreifen. Er war gegen einen Streik und riet zum bewährten Mittel der Sabotage: weiter zur Arbeit gehen und den Betrieb von innen lahmlegen. Aber den Arbeitern von Personville gingen die Maßnahmen nicht weit genug. Sie wollten berühmt werden, sie wollten Geschichte schreiben.
Sie streikten.
Der Streik dauerte acht Monate. Beide Seiten mussten bluten. Die Arbeiter bluteten selbst, für den alten Elihu dagegen übernahmen das angeheuerte Mörder, Streikbrecher, Nationalgardisten und sogar Teile der Army. Als der letzte Schädel eingeschlagen und die letzte Rippe gebrochen war, glich die organisierte Arbeiterschaft von Personville einem abgebrannten Knallfrosch.
Aber der alte Elihu, sagte Bill Quint, wusste nichts von italienischer Geschichte. Er hatte zwar den Arbeitskampf gewonnen, aber die Gewalt über die Stadt und den Bundesstaat verloren. Um die Bergarbeiter klein zu halten, hatte er seinen gemieteten Schlägern freie Hand gelassen, und als der Kampf vorbei war, wurde er sie nicht mehr los. Er hatte ihnen seine Stadt übergeben und war nicht stark genug, sie ihnen wieder abzunehmen. Personville gefiel ihnen, sie beschlossen zu bleiben. Sie hatten den Streik niedergeschlagen und betrachteten die Stadt als ihren Lohn. Er konnte sich nicht offen gegen sie stellen, dazu hatten sie zu viel gegen ihn in der Hand. Er war für alles verantwortlich, was sie während des Streiks getan hatten.
Billy Quint und ich hatten inzwischen leicht einen sitzen. Er leerte sein Glas, strich sich das Haar aus der Stirn und kam zum Stand der Dinge. »Der Stärkste ist im Augenblick wahrscheinlich Pete der Finne. Das Zeug, das wir hier trinken, stammt von ihm. Dann ist da noch Lew Yard. Der hat ein Leihhaus in der Parker Street, stellt eine Menge Kautionsbürgschaften, übernimmt, hab ich gehört, was an heißer Ware anfällt, und ist ganz dicke mit Noonan, dem Polizeichef. Und dieser Max Thaler – Whisper – hat auch eine Menge Freunde. Ein kleiner, dunkler, aalglatter Typ, der irgendwas am Kehlkopf hat. Kann nicht richtig reden. Spieler. Diese drei und Noonan helfen dem alten Elihu, die Stadt zu regieren – helfen ihm mehr, als ihm lieb ist. Aber er muss mitspielen, sonst …«
»Der Typ, der vorhin umgelegt worden ist, Elihus Sohn – wo stand der?«, wollte ich wissen.
»Da, wo sein Papa ihn haben wollte – und das ist genau da, wo er jetzt ist.«
»Sie meinen, der Alte hat ihn …?«
»Kann sein, aber das meine ich nicht. Dieser Don ist hier angekommen und hat die Zeitung übernommen. Auch wenn er langsam auf sein Grab zugeht, kommt es für den alten Teufel nun mal nicht infrage, sich um irgendwas bescheißen zu lassen, ohne zurückzuschlagen. Aber bei diesen Typen muss er sich vorsehen. Also holt er seinen Jungen und dessen französische Frau aus Paris und benutzt ihn als Marionette – ein verdammt netter Vatertrick. Don startet mit seiner Zeitung eine Kampagne. Verbrechen und Korruption raus aus der Stadt. Was nichts anderes bedeutete als – Pete und Lew und Whisper raus aus der Stadt. Kapiert? Der Alte benutzt seinen Jungen, um sie rauszudrängen. Ich nehme an, sie wollten sich nicht drängen lassen.«
»Irgendwas an Ihrer Annahme scheint mir nicht ganz stimmig«, sagte ich.
»In dieser lausigen Stadt ist nichts stimmig. Haben Sie genug von dem Fusel?«
Ich sagte, das hätte ich. Wir gingen hinunter auf die Straße. Billy Quint sagte, er wohne im Miners’ Hotel in der Forest Street. Sein Heimweg führte an meinem Hotel vorbei, also gingen wir gemeinsam. Am Bordstein vor dem Great Western stand ein feister Mann, der aussah wie ein Kriminalbulle. Er unterhielt sich mit einem Mann in einem Stutz-Tourenwagen.
»Der in dem Wagen ist Whisper«, sagte Billy Quint.
Ich sah an dem feisten Mann vorbei und betrachtete Thalers Profil. Er war jung, klein und dunkel. Seine hübschen Gesichtszüge waren so regelmäßig, als käme sein Kopf frisch aus einer Gussform.
»Niedlich«, sagte ich.
»Ja«, sagte der graue Mann, »so niedlich wie Dynamit.«
Kapitel IIDer Zar von Poisonville
Der Morning Herald widmete Donald Willsson und seinem Tod zwei Seiten. Das Foto zeigte ein freundliches, intelligentes Gesicht, lockiges Haar, lächelnde Augen, einen lächelnden Mund, ein Grübchen im Kinn und eine gestreifte Krawatte.
Die Geschichte war simpel. Am Vorabend um zwanzig vor elf hatte er vier Kugeln in Bauch, Brust und Rücken bekommen. Er war sofort tot gewesen. Das Ganze war in der Hurricane Street passiert, in dem Block mit den Elfhunderter-Nummern. Anwohner hatten die Schüsse gehört und den Toten auf dem Bürgersteig liegen sehen, ein Mann und eine Frau hatten sich über ihn gebeugt. Es war zu dunkel gewesen, um irgendetwas genau erkennen zu können. Als die Ersten das Mordopfer erreicht hatten, waren der Mann und die Frau bereits verschwunden gewesen. Niemand wusste, wie sie aussahen, niemand hatte sie weggehen sehen.
Auf Willsson waren sechs Schüsse aus einer Pistole Kaliber .32 abgegeben worden. Zwei hatten ihn verfehlt und eine Hauswand getroffen. Die Polizei hatte die Flugbahn dieser Kugeln berechnet und festgestellt, dass der Schütze in einer schmalen Gasse auf der anderen Straßenseite gestanden hatte. Und das war auch schon alles.
Im Leitartikel des Morning Herald stand eine Zusammenfassung von Donald Willssons kurzem Engagement als Reformer. Der Verfasser war überzeugt, Willsson sei von Leuten umgebracht worden war, die nicht wollten, dass in Personville aufgeräumt wurde. Des Weiteren hieß es, der Polizeichef könne den Verdacht der Mittäterschaft am besten dadurch ausräumen, dass er den oder die Mörder möglichst rasch ermittelte und festnahm. Der Leitartikel war unverblümt und bitter.
Ich las ihn bei meiner zweiten Tasse Kaffee, sprang in eine Straßenbahn, stieg an der Laurel Avenue aus und ging zum Haus des Toten.
Ich war noch einen halben Block davon entfernt, als ich es mir anders überlegte und ein neues Ziel anvisierte.
Ein eher kleiner, Braun in Braun gekleideter junger Mann überquerte vor mir die Straße. Sein dunkles Profil war hübsch. Es war Max Thaler alias Whisper. Ich erreichte die Ecke Mountain Boulevard gerade noch rechtzeitig, um sein braunes Hosenbein durch die Haustür des verstorbenen Donald Willsson verschwinden zu sehen.
Ich ging zurück zum Broadway, fand einen Drugstore mit Telefonzelle, schlug im Telefonbuch Elihu Willssons Nummer nach, rief an und sagte jemandem, der behauptete, der Sekretär des Alten zu sein, ich sei auf Donald Willssons Wunsch aus San Francisco gekommen, wisse etwas über seinen Tod und wolle mit seinem Vater sprechen.
Nachdem ich das mit genügend Nachdruck vorgetragen hatte, bekam ich eine Audienz.
Der Zar von Poisonville lag, auf Kissen gestützt, im Bett, als sein Sekretär – ein schlanker, geräuschloser Mann von etwa vierzig mit scharfem Blick – mich in sein Zimmer führte.
Der Kopf des alten Mannes war klein und unter dem kurz geschnittenen weißen Haar fast kugelrund. Seine Ohren waren zu klein und lagen zu dicht am Schädel an, um diesen Eindruck zu trüben. Auch die Nase war klein und setzte die Rundung der Stirn fort. Mund und Kinn bildeten gerade Linien, den unteren Abschluss der Kugel. Ein kurzer, dicker Hals saß auf breiten, fleischigen, von einer weißen Pyjamajacke bedeckten Schultern. Einer seiner Arme lag auf der Bettdecke, ein kurzer, kompakter Arm, der in einer breiten Hand mit dicken Fingern endete. Seine Augen waren klein, blau, rund und wässrig. Sie wirkten, als würden sie hinter diesem Schleier, unter den buschigen weißen Brauen, nur darauf warten, hervorzuspringen und etwas zu packen. Er gehörte nicht zu den Männern, bei denen man sich als Taschendieb versuchen sollte, es sei denn, man war sich seiner Fähigkeiten sehr sicher.
Mit einem kurzen Rucken seines Kopfs beorderte er mich auf einen Stuhl neben dem Bett, mit einem zweiten schickte er den Sekretär hinaus. Dann sagte er: »Was haben Sie mit meinem Sohn zu tun?«
Seine Stimme war harsch. Seine Brust machte zu viel mit den Worten und sein Mund zu wenig, deswegen war er nicht besonders gut zu verstehen.
»Ich bin Detektiv der Agentur Continental, Abteilung San Francisco«, sagte ich. »Vor einigen Tagen haben wir von Ihrem Sohn einen Scheck und einen Brief erhalten, in dem er bat, ihm einen Mann zu schicken, er habe etwas zu erledigen. Dieser Mann bin ich. Gestern Abend sollte ich ihn in seinem Haus aufsuchen. Ich war da, er nicht. Als ich wieder in der Innenstadt war, erfuhr ich, dass er umgebracht worden war.«
Elihu Willsson musterte mich misstrauisch und sagte: »Und?«
»Während ich auf ihn wartete, bekam Ihre Schwiegertochter einen Anruf und verließ das Haus. Bei ihrer Rückkehr hatte sie auf dem Schuh etwas, das wie ein Blutfleck aussah, und sagte, ihr Mann werde nicht mehr kommen. Er wurde um zwanzig vor elf erschossen. Als sie rausging, war es zwanzig nach zehn. Um fünf nach elf war sie wieder da.«
Der Alte setzte sich auf und zählte auf, was die junge Mrs. Willsson seiner Meinung nach war. Als ihm die Worte dafür ausgingen, hatte er noch genug Luft, um mich anzubrüllen: »Und? Ist sie im Knast?«
Ich sagte, das glaubte ich nicht.
Dass sie nicht im Knast war, gefiel ihm nicht. Er wurde gehässig. Er schrie eine Menge Dinge, die mir nicht gefielen, und schließlich: »Worauf zum Teufel warten Sie noch?«
Ich hätte ihm am liebsten eine verpasst, lachte aber und sagte: »Auf Beweise.«
»Beweise? Wozu? Sie haben …«
»Dummes Zeug«, unterbrach ich ihn. »Warum sollte sie ihn umbringen?«
»Weil sie eine französische Hure ist! Weil sie …«
Das erschrockene Gesicht des Sekretärs erschien in der Tür.
»Raus!«, brüllte der Alte, und das Gesicht verschwand.
»Ist sie eifersüchtig?«, fragte ich, bevor er weiterschreien konnte. »Und Sie brauchen nicht zu schreien, ich kann Sie auch so hören. Seit ich Hefe esse, ist meine Schwerhörigkeit viel besser geworden.«
Er legte die Fäuste auf die Oberschenkel, die sich unter der Decke abzeichneten, und reckte das eckige Kinn.
»So alt und krank ich auch bin«, sagte er sehr überlegt, »ich hätte große Lust, aufzustehen und Sie in den Hintern zu treten.«
Ich ging nicht darauf ein, sondern wiederholte: »Ist sie eifersüchtig?«
»Ist sie«, sagte er, jetzt in normaler Lautstärke, »und herrschsüchtig und verzogen und misstrauisch und gierig und niederträchtig und skrupellos und hinterhältig und egoistisch und ein verdammtes Miststück – alles in allem ein verdammtes Miststück.«
»Hat sie Grund zur Eifersucht?«
»Das will ich hoffen«, sagte er bitter. »Dass mein Sohn ihr treu gewesen sein könnte, ist ein geradezu widerlicher Gedanke. Aber wahrscheinlich war er ihr treu. So was sah ihm ähnlich.«
»Aber Sie kennen keinen konkreten Grund, warum sie ihn getötet haben könnte?«
»Keinen konkreten Grund?« Er brüllte wieder. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass …«
»Ja, aber das ist kein Argument. Das ist nur kindisch.«
Der Alte schlug die Bettdecke zurück und wollte aufstehen. Dann überlegte er es sich anders, reckte den roten Kopf und rief: »Stanley!«
Die Tür öffnete sich, und der Sekretär glitt herein.
»Schmeißen Sie diesen Kerl raus!«, befahl sein Meister und fuchtelte mit der Faust.
Der Sekretär wandte sich zu mir.
Ich schüttelte den Kopf und sagte: »Sie werden Hilfe brauchen.«
Er runzelte die Stirn. Wir waren ungefähr gleich alt. Er war schmal, fast einen Kopf größer als ich, aber zwanzig Kilo leichter. Ein paar von meinen fünfundachtzig Kilo bestanden aus Fett, aber nicht alle. Der Sekretär trat von einem Bein aufs andere, lächelte entschuldigend und ging hinaus.
»Was ich sagen wollte«, fuhr ich fort: »Heute Morgen hatte ich vor, mit Ihrer Schwiegertochter zu sprechen, aber dann habe ich Max Thaler in ihr Haus gehen sehen, und darum habe ich meinen Besuch verschoben.«
Elihu Willsson deckte seine Beine sorgfältig wieder zu, ließ sich in die Kissen sinken, sah mit zusammengekniffenen Augen an die Decke und sagte: »Hmmm … also so ist das.«
»Soll heißen?«
»Sie hat ihn umgebracht«, sagte er im Brustton der Überzeugung. »Das soll es heißen.«
Auf dem Flur erklangen Schritte, schwerere als die des Sekretärs. Als sie vor der Tür angekommen waren, setzte ich neu an: »Sie haben Ihren Sohn benutzt, um …«
»Raus!«, schrie der Alte die Männer an, die in der Tür erschienen. »Und dass diese Tür geschlossen bleibt!« Dann funkelte er mich an und sagte: »Wozu habe ich meinen Sohn benutzt?«
»Um Thaler, Yard und den Finnen fertigzumachen.«
»Sie sind ein Lügner.«
»Die Geschichte hab ich mir nicht ausgedacht. Das pfeifen in Personville die Spatzen von den Dächern.«
»Es ist eine Lüge. Ich hab ihm die Zeitung gegeben. Was er damit gemacht hat, war seine Sache.«
»Das sollten Sie Ihren Freunden erklären. Die glauben Ihnen bestimmt.«
»Was die glauben, ist mir scheißegal! Es ist so, wie ich sage.«
»Na und? Ihr Sohn wird nicht wieder lebendig, bloß weil sein Tod ein Irrtum war – wenn er das war.«
»Diese Frau hat ihn umgebracht.«
»Vielleicht.«
»Scheiß auf Ihr ›Vielleicht‹! Sie war’s.«
»Vielleicht. Aber man muss auch andere Motive in Betracht ziehen, politische Motive. Sie können mir bestimmt sagen …«
»Ich kann Ihnen sagen, dass diese französische Hure ihn auf dem Gewissen hat und dass Sie mit Ihren idiotischen Ideen total auf dem Holzweg sind.«
»Aber man muss sie in Betracht ziehen«, beharrte ich. »Und werde wohl niemanden finden, der die politischen Hintergründe hier in Personville besser kennt als Sie. Er war Ihr Sohn. Das Mindeste, was Sie tun können –«
»Das Mindeste, was ich tun kann«, schrie er, »ist, Ihnen zu sagen, dass Sie sich nach San Francisco scheren sollen, Sie und Ihre idiotischen …«
Ich stand auf und sagte unfreundlich: »Ich wohne im Great Western Hotel. Setzen Sie sich nur mit mir in Verbindung, wenn Sie zur Abwechslung was Vernünftiges zu sagen haben.«
Ich ging hinaus und die Treppe hinunter. An ihrem Fuß erwartete mich der verlegen lächelnde Sekretär.
»Ein netter alter Widerling«, knurrte ich.
»Ein bemerkenswert vitaler Mensch«, murmelte er.
In der Redaktion des Herald trieb ich die Sekretärin des Ermordeten auf. Sie war eine zierliche Frau von neunzehn oder zwanzig mit großen kastanienbraunen Augen, hellbraunem Haar und einem blassen, hübschen Gesicht. Sie hieß Lewis.
Sie sagte, sie habe nicht gewusst, dass ihr Chef mich nach Personville geholt habe.
»Aber Mr. Willsson hat eigentlich immer alles möglichst lange für sich behalten«, erklärte sie. »Es war … Ich glaube, er hat den Leuten hier nicht ganz getraut.«
»Auch Ihnen nicht?«
Sie errötete und sagte: »Nein. Aber er war ja auch erst seit Kurzem hier und kannte keinen von uns besonders gut.«
»Das klingt nicht so, als wäre das der einzige Grund gewesen.«
»Na ja«, sagte sie und hinterließ eine Reihe von Zeigefingerabdrücken auf der polierten Schreibtischkante des Toten, vor dem sie saß, »sein Vater fand das, was er hier gemacht hat … es gefiel ihm nicht. Und da sein Vater der Eigentümer der Zeitung war, hatte Mr. Donald wohl das Gefühl, dass einige der Leute hier nicht auf seiner, sondern auf Mr. Elihus Seite standen.«
»Der Alte war gegen die Reformkampagne? Warum hat er sie dann nicht unterbunden? Immerhin gehört die Zeitung doch ihm.«
Sie beugte den Kopf und musterte ihre Fingerabdrücke. Ihre Stimme war leise. »Das ist vielleicht schwer zu verstehen, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Das letzte Mal, als Mr. Elihu krank wurde, ließ er Donald … Mr. Donald kommen. Mr. Donald hatte den größten Teil seines Lebens in Europa verbracht, müssen Sie wissen. Dr. Pride hatte Mr. Elihu gesagt, er sollte die Leitung seiner Geschäfte abgeben, deswegen hat Mr. Elihu seinem Sohn telegrafiert, dass er kommen soll. Als Mr. Donald dann hier war, konnte Mr. Elihu sich nicht entschließen, alles aufzugeben, aber er wollte, dass Mr. Donald hier blieb, also hat er ihm die Zeitung überlassen, das heißt, er hat ihn zum Herausgeber gemacht. Das hat Mr. Donald gefallen, er hatte sich schon in Paris für Journalismus interessiert. Als er die schrecklichen Zustände hier gesehen hat – in der Stadtverwaltung und so weiter –, hat er diese Reformkampagne begonnen. Er hat nicht gewusst … Er war ja noch ein Junge, als er von hier weggegangen war, und darum wusste er nicht …«
»Dass sein Vater genauso tief drinsteckt wie alle anderen«, half ich ihr.
Sie beugte sich noch ein bisschen tiefer über ihre Fingerabdrücke, widersprach mir aber nicht.
»Mr. Elihu und er hatten einen Streit. Mr. Elihu sagte, er solle aufhören, im Dreck zu wühlen, aber er wollte nicht. Vielleicht hätte er aufgehört, wenn er gewusst hätte … wenn er die ganze Wahrheit gekannt hätte. Ich glaube nicht, dass ihm je der Gedanke gekommen ist, sein Vater könnte wirklich in all das verwickelt sein. Und sein Vater hat es ihm nicht gesagt. Ich stelle mir vor, für einen Vater ist es schwer, seinem Sohn so etwas zu sagen. Er hat Mr. Donald gedroht, ihm die Zeitung wegzunehmen. Ob er das wirklich tun wollte, weiß ich nicht. Aber dann ist er wieder krank geworden, und alles ging weiter wie bisher.«
»Hat Donald Willsson Sie ins Vertrauen gezogen?«, fragte ich.
»Nein.« Das war beinahe geflüstert.
»Woher wissen Sie dann all das?«
»Ich versuche … ich versuche, Ihnen zu helfen, den Mörder zu finden«, sagte sie ernst. »Sie haben kein Recht …«
»Im Augenblick helfen Sie mir am meisten, indem Sie mir sagen, woher Sie all das wissen.«
Sie starrte auf den Tisch und kaute auf ihrer Unterlippe. Ich wartete. Schließlich sagte sie: »Mein Vater ist Mr. Willssons Sekretär.«
»Danke.«
»Aber Sie dürfen nicht denken, dass wir …«
»Das interessiert mich nicht«, versicherte ich ihr. »Was hat Willsson gestern Abend in der Hurricane Street gemacht, wenn er doch zu Hause mit mir verabredet war?«
Sie sagte, das wisse sie nicht. Ich fragte sie, ob sie gehört habe, dass er mir am Telefon gesagt hatte, ich solle ihn um zehn zu Hause besuchen. Sie sagte, das habe sie gehört.
»Was hat er danach getan? Versuchen Sie sich an alles zu erinnern, was er gesagt und getan hat zwischen diesem Telefonat und dem Zeitpunkt, als sie am Abend nach Hause gingen.«
Sie lehnte sich zurück, schloss die Augen und legte die Stirn in Falten. »Sie haben um etwa zwei Uhr angerufen – wenn Sie es waren, dem er gesagt hat, dass er um zehn zu ihm nach Hause kommen soll. Danach hat Mr. Donald ein paar Briefe diktiert, einen an eine Papierfabrik und einen an Senator Keefer, da ging es um irgendwelche Änderungen bei den Postbestimmungen, und dann … Ach, ja, er ist kurz vor drei für zwanzig Minuten ausgegangen. Und vorher hat er einen Scheck ausgestellt.«
»Für wen?«
»Ich weiß nicht, aber ich habe ihn schreiben sehen.«
»Wo ist sein Scheckheft? Hat er das immer dabei?«
»Das ist hier.« Sie sprang auf, ging um den Schreibtisch herum und wollte die oberste Schublade öffnen. »Abgeschlossen.«
Mit dem Draht einer Büroklammer und der Klinge meines Taschenmessers gelang es mir, die Schublade zu öffnen.
Die Frau nahm ein dünnes Scheckheft der First National Bank heraus. Auf dem letzten Kontrollabschnitt stand $ 5000. Sonst nichts. Kein Name. Kein Verwendungszweck.
»Er ist mit diesem Scheck rausgegangen«, sagte ich, »und war zwanzig Minuten weg? Reicht das, um zur Bank und wieder zurück zu gehen?«
»Zur Bank hätte er nicht mehr als fünf Minuten gebraucht.«
»Ist vielleicht noch irgendwas anderes passiert, bevor er den Scheck ausgestellt hat? Denken Sie nach. Irgendwelche Botschaften? Briefe? Anrufe?«
»Mal sehen.« Sie schloss wieder die Augen. »Er hat Briefe diktiert und … Ach, wie dumm von mir! Da war tatsächlich ein Anruf. Er hat gesagt: ›Ja, ich kann um zehn da sein, muss aber gleich wieder gehen.‹ Und dann noch mal: ›Also dann um zehn.‹ Sonst hat er nichts gesagt, nur ein paarmal ›Ja, ja‹.«
»War der Anrufer ein Mann oder eine Frau?«
»Das weiß ich nicht.«
»Denken Sie nach. Seine Stimme hätte anders geklungen.«
Sie dachte nach. »Dann war es eine Frau.«
»Wer von Ihnen ist abends als Erster gegangen – Sie oder er?«
»Ich. Er … Ich habe Ihnen ja gesagt, dass mein Vater Mr. Elihus Sekretär ist. Er und Mr. Donald waren am frühen Abend verabredet – es ging um die Finanzen der Zeitung. Vater kam um kurz nach fünf. Ich glaube, sie sind dann zusammen essen gegangen.«
Das war alles, was ich aus Miss Lewis herausbekommen konnte. Sie sagte, sie könne sich nicht erklären, was Willsson im Elfhunderter-Block der Hurricane Street zu erledigen gehabt hatte. Und sie gab zu, dass sie nichts über Mrs. Willsson wusste.
Wir durchsuchten den Schreibtisch, fanden aber nichts, was irgendwie erhellend gewesen wäre. Ich sprach mit den Telefonistinnen und erfuhr nichts. Ich befragte eine Stunde lang Büroboten, Lokalredakteure und dergleichen – ohne Ergebnis. Der Tote hatte, wie seine Sekretärin gesagt hatte, großes Geschick darin besessen, seine Angelegenheiten für sich zu behalten.
Kapitel IIIDinah Brand
In der First National Bank bekam ich einen Hilfskassierer namens Albury zu fassen, einen nett aussehenden, blonden jungen Mann von etwa Mitte zwanzig.
»Ja, ich habe den Scheck bestätigt«, sagte er, nachdem ich ihm erklärt hatte, worum es ging. »Er war ausgestellt auf den Namen Dinah Brand. Fünftausend Dollar.«
»Kennen Sie sie?«
»O ja, allerdings!«
»Was dagegen, mir zu verraten, was Sie über sie wissen?«
»Aber nein. Mit Vergnügen, aber ich müsste schon seit acht Minuten in einer Besprechung sein, und …«
»Wie wär’s, wenn wir heute Abend zusammen essen und Sie mir dann alles erzählen?«
»Gut«, sagte er.
»Um sieben im Great Western?«
»In Ordnung.«
»Sie können gleich zu Ihrer Besprechung, aber sagen Sie mir noch, ob die Dame hier ein Konto hat.«
»Ja, und sie hat den Scheck heute Morgen eingereicht. Die Polizei hat ihn.«
»Ach ja? Und wo wohnt sie?«
»In der Hurricane Street 1232.«
»Ah ja«, sagte ich und: »Bis heute Abend«, und ging hinaus.
Meine nächste Station war das Büro des Polizeichefs im Rathaus.
Noonan, der Chief, war ein dicker Mann mit funkelnden grünlichen Augen in einem runden, jovialen Gesicht. Als ich ihm sagte, was mich in seine Stadt gebracht hatte, schien er sich zu freuen. Er bot mir seine Hand, eine Zigarre und einen Sessel an.
»Tja«, sagte er, als wir es uns bequem gemacht hatten, »dann sagen Sie mir doch mal, wer’s Ihrer Meinung nach war.«
»Das Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben.«
»Bei uns beiden«, sagte er heiter und stieß eine dicke Rauchwolke aus. »Nur so – was vermuten Sie?«
»Ich bin im Vermuten nicht besonders gut, erst recht wenn ich die Fakten nicht kenne.«
»Die Fakten kann ich Ihnen ganz schnell geben«, sagte er. »Willsson hat gestern kurz vor Schalterschluss in der Bank einen Scheck über fünf Riesen für Dinah Brand bestätigen lassen. Gestern Nacht wurde er nicht mal einen Block von ihrem Haus entfernt mit einer .32er erschossen. Anwohner, die die Schüsse gehört hatten, haben einen Mann und eine Frau gesehen, die sich über den Toten gebeugt haben. Und heute Morgen in aller Frühe kreuzt Dinah Brand in besagter Bank auf und reicht besagten Scheck ein. Also?«
»Wer ist diese Dinah Brand?«
Der Chief streifte die Asche mitten auf dem Schreibtisch ab, schwenkte die Zigarre in seiner dicken Hand und sagte: »Eine Nachtschwalbe, wie man so schön sagt, eine Deluxe-Schnepfe, eine Edelnutte.«
»Haben Sie sie schon vernommen?«
»Nein. Vorher gibt’s noch ein paar Dinge zu klären. Wir behalten sie im Auge und warten. Aber das muss unter uns bleiben.«
»Ja. Und jetzt ich«, sagte ich und erzählte ihm, was ich gesehen und gehört hatte, als ich in der vergangenen Nacht auf Willsson gewartet hatte.
Als ich geendet hatte, spitzte der Chief die dicken Lippen, pfiff leise und rief: »Das sind interessante Informationen, Mann! Da war also Blut an ihrem Schuh? Und sie hat gesagt, ihr Mann würde nicht mehr kommen?«
»So sah es jedenfalls aus«, beantwortete ich die erste Frage, und auf die zweite sagte ich: »Ja.«
»Haben Sie seitdem mit ihr gesprochen?«, fragte er.
»Nein. Das wollte ich heute Morgen tun, aber ein junger Bursche namens Thaler ging vor mir ins Haus, darum habe ich meinen Besuch verschoben.«
»Ist nicht wahr!« Seine grünlichen Augen funkelten vergnügt. »Wollen Sie damit sagen, dass Whisper bei ihr war?«
»Ja.«
Er warf die Zigarre auf den Boden, stand auf, pflanzte die Hände auf die Schreibtischplatte und beugte sich zu mir vor. Er verströmte Entzücken aus allen Poren.
»Gute Arbeit, Mann«, schnurrte er. »Dinah Brand ist die Braut von diesem Whisper. Lassen Sie uns doch mal mit der Witwe plaudern.«
Vor Mrs. Willssons Haus stiegen wir aus dem Wagen des Polizeichefs. Der Chief blieb einen Augenblick mit dem Fuß auf der untersten Stufe stehen und betrachtete den Trauerflor, der über der Glocke hing. Dann sagte er: »Tja, was sein muss, muss sein«, und wir gingen die Treppe hinauf.
Mrs. Willsson empfing uns nicht gern, aber sie empfing uns, wie es die meisten Leute tun, wenn der Polizeichef darauf besteht – und der bestand darauf. Wir wurden in die Bibliothek im ersten Stock geführt, wo Donald Willssons Witwe uns erwartete. Sie trug Schwarz. Ihre blauen Augen blickten frostig.
Noonan und ich sprachen ihr unser Beileid aus. Dann sagte er: »Wir wollen Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, wohin Sie gestern Abend gegangen sind.«
Sie sah mich unfreundlich an, wandte sich wieder zum Chief, runzelte die Stirn und sagte voller Entrüstung: »Dürfte ich wohl erfahren, warum ich auf diese Weise befragt werde?«
Ich überlegte, wie oft ich diese Frage, Wort für Wort und in genau demselben Ton, schon gehört hatte, doch der Chief ging darüber hinweg und fuhr liebenswürdig fort: »Und dann war da was mit einem Fleck auf Ihrem Schuh. Auf dem rechten – vielleicht war’s auch der linke. Auf einem von beiden jedenfalls.«
Ein Muskel an ihrer Oberlippe begann zu zucken.
»War sonst noch etwas?«, fragte mich der Chief, doch bevor ich antworten konnte, schnalzte er mit der Zunge und wandte sein freundliches Gesicht Mrs. Willsson zu. »Das hätte ich fast vergessen. Es geht um die Frage, wie