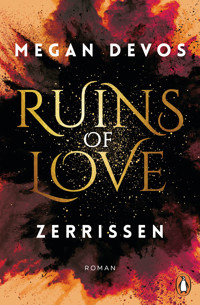9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Grace & Hayden
- Sprache: Deutsch
Wenn nicht nur deine Welt in Flammen steht – sondern auch dein Herz
»Alles Gute in meinem Leben, nach dem ich mich so sehr sehnte, zog noch einmal vor meinem inneren Auge vorüber. Ich sah Blackwing vor mir und die Menschen dort: Dax, Kit, Docc, Maisie, Malin, Leutie. Hayden. Ich konnte kaum etwas sehen und war kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Wäre ich noch Herrin meiner Sinne gewesen, hätte ich die schnellen Schritte gehört, die auf mich zukamen. Wäre ich aufmerksamer gewesen, hätte ich mich versteckt. Ich presste die Lider zu, bereitete mich auf den Todesstoß vor. ›Grace?‹ Beim Klang der Stimme riss ich die Augen auf, und atmete schmerzhaft ein. Das war unmöglich.«
Das große Finale der süchtig machenden Lovestory von Grace und Hayden!
Dramatisch und prickelnd – lies auch die weiteren Bände der Reihe und lass dich gefangen nehmen von einer schicksalhaften Liebe:
1. »Ruins of Love – Gefangen«
2. »Ruins of Love – Gespalten«
3. »Ruins of Love – Zerrissen«
4. »Ruins of Love – Vereint«
Du bist hier genau richtig, wenn du auf diese Tropes stehst:
• Enemies to Lovers
• Forced Proximity
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Verlieben und Verschlingen: Die süchtig machende Lovestory von Grace und Hayden in vier mitreißenden Bänden!
Wenn nicht nur deine Welt in Flammen steht – sondern auch dein Herz
Erschüttert von den traumatischen Erlebnissen, findet Grace nach dem beendeten Krieg zwischen Blackwing und Greystone Trost und Geborgenheit in Haydens Armen. In Blackwing sind die beiden zunächst sicher – doch kaum hat Hayden einen Waffenstillstand mit den Überlebenden aus Greystone geschlossen, werden sie von anderen Feinden bedroht. Die Brutes, vor denen auf Streifzügen in die zerstörte Stadt niemand sicher ist, greifen immer häufiger und brutaler an. Grace weiß, dass sie nicht ruhen werden, bis sie haben, was sie wollen – nämlich sie selbst. Als Hayden davon erfährt, kann sie ihn nicht von seinem Vorhaben abhalten: Er zieht los, um den blutrünstigen Klan ein für alle Mal zu vernichten, und Grace folgt ihm – bis die Hölle losbricht und Grace plötzlich in allergrößter Gefahr schwebt. Während ihre Welt in Flammen steht, kämpft Grace bis zum bitteren Ende um Hayden, der alles für sie ist: ihr Leben, ihre Liebe, ihre Bestimmung.
Dramatisch und prickelnd – lies auch die weiteren Bände der Reihe und lass dich gefangen nehmen von einer schicksalhaften Liebe:
1. Ruins of Love – Gefangen
2. Ruins of Love – Gespalten
3. Ruins of Love – Zerrissen
4. Ruins of Love – Vereint
MEGANDEVOS arbeitet als Operationsschwester und lebt in South Dakota. Das Schreiben ist schon immer ihre größte Leidenschaft. Ihre vierbändige Serie Ruins of Love ist eine Wattpad-Sensation: Weltweit sind Millionen von Lesern süchtig nach der dramatisch-prickelnden Liebesgeschichte von Grace und Hayden.
Megan DeVos
RuinsofLove
Vereint
Aus dem Englischen von Nicole Hölsken
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Annihilation bei Orion Books, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2019 der Originalausgabe by Megan DeVos
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion/Lektorat: Christiane Sipeer
Umschlagmotiv- und -gestaltung: www.buerosued.de
Satz: MR
ISBN 978-3-641-26388-1V002
www.penguin-verlag.de
Für meine Mutter, die das hier nie gelesen hat, aber dennoch immer an mich glaubte.
Kapitel 1
Gefahr
Grace
Ein ohrenbetäubender Knall zerriss die Luft im gleichen Augenblick, da mein Finger den Abzug betätigte und eine Kugel aus meiner Waffe schleuderte. Die Zeit schien angehalten. Wie angewurzelt stand ich da, immer noch aufrecht, obwohl ich innerlich zusammenbrach.
Ich wusste, dass es unmöglich war, dennoch hätte ich schwören können, dass ich sah, wie die Kugel die Luft durchpflügte. Ich konnte den Blick nicht von ihr losreißen, gleichzeitig fasziniert und entsetzt, während der Abstand zwischen ihr und der Waffe immer größer wurde. Ich hatte ein seltsames Surren in den Ohren, das alles andere übertönte, ein merkwürdiger, dumpfer Laut, der in meinem Hirn widerhallte, als die Kugel ihr Ziel erreichte.
Eigentlich hätte ich hören müssen, wie die Kugel auf eine menschliche Brust traf. Es hätte laut, nass, schmerzhaft klingen müssen. Das Zerreißen von Fleisch, das Hervorsprudeln von Blut, vielleicht auch das Knacken von ein oder zwei gebrochenen Knochen.
Das Summen in meinen Ohren jedoch wurde lauter, drohte mich völlig zu lähmen und mich in den Staub hinabzudrücken.
Obwohl meine Ohren nichts hören konnten, konnten meine Augen sehen. Starr vor Entsetzen beobachtete ich, wie die Kugel sein Shirt durchdrang, seine Haut, seine Muskeln. Sie traf ihn an der tödlichsten Stelle, direkt über dem Herzen, bevor sie sich auf den Weg zum Herzen selbst machte. Ein Schaudern erfasste mich, als das Loch sich sofort mit Blut füllte, das sein Shirt durchtränkte und auf den Boden tropfte. Er fiel auf die Knie, und sein Gesicht wurde von Sekunde zu Sekunde bleicher.
Leere, leblose Augen schienen ihren Blick in mich hineinzubohren. Sein Körper verharrte einen Moment, ohne vornüberzukippen. Mir drehte sich der Magen um. Wie gern hätte ich die Augen abgewandt, aber es wollte mir einfach nicht gelingen. Dieser winzige Bruchteil einer Sekunde endete, als sein Körper nach vorn fiel und mit einem lauten Rums auf der Erde landete. Staub erhob sich in die Luft und mischte sich mit dem Rauch, der einem die Sicht vernebelte. Unheilverkündender Dunst um seine Gestalt zeugte von der grauenhaften Tat, die ich soeben begangen hatte.
Seine Brust regte sich nicht mehr, als er mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag. Die Blutlache unter ihm wuchs sekündlich. Es gab kein Zurück mehr.
Ich wusste, was ich getan hatte.
Jonah war tot. Einfach so.
Ich schnappte nach Luft, atmete Rauch und Staub ein, konnte mich aber noch immer nicht bewegen. Meine Muskeln waren wie erstarrt. Jeder Schlag meines Herzens sandte Dolche durch meine Adern, die meine Haut durchschnitten, mich überall durchbohrten, bis ich nicht mehr war als eine blutige, zerfleischte Masse.
Ich konnte meine Augen nicht von Jonah abwenden. Das tiefe Rot des Blutes schien sich in mein Hirn einzubrennen, und der starke Kontrast zu seinem schnell erbleichenden Körper machte das Bild umso drastischer. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber das war auch gar nicht notwendig; der letzte stumm bittende Blick, den er mir zugeworfen hatte, gefolgt von dem leeren, leblosen, als er zu Boden fiel, würde mich nie mehr loslassen. Ich würde ihn nie vergessen.
Doch dann drängte sich ein anderes Bild in den Vordergrund. Das Bild verfaulter Leiber, einige zerstückelt, einige verwest, in einer Ecke auf einen Haufen geworfen wie Lumpen. Ich sah Hände, die von Armen abgetrennt und mit Nägeln an die Wand geheftet worden waren. Und die drohenden, in Blut geschriebenen Worte an der Wand, die mich verfolgten. Vor meinen Augen hatte sich Jonah in einen von ihnen verwandelt. Die quälenden Bilder, die mein Verstand mir vorgaukelte, sollten mich für meine Untat büßen lassen.
Ich hatte meinen eigenen Bruder getötet.
Doch immer noch konnte ich mich nicht bewegen, obwohl ich spürte, wie ein Beben meinen gesamten Körper erfasste. Meine Hände zitterten, dennoch konnte ich weder die Waffe senken noch die Arme bewegen. Ich konnte immer noch nichts hören, obwohl die Welt um mich herum wahrscheinlich von chaotischem Lärm erfüllt war. Ich konnte nichts sehen außer diesem beklemmenden Nebel und dem Blut um Jonahs leblosen Körper. Ich konnte den Blick einfach nicht losreißen. Galle stieg mir in die Kehle, denn nun revoltierte auch mein Magen, aber ich schaffte es nicht einmal, mich vornüberzubeugen und zu erbrechen.
Ich spürte, wie mein Bewusstsein sich vor der Außenwelt abschottete, um mich vor der Erkenntnis meiner eigenen Untat zu schützen. Nun zitterten meine Hände so heftig, dass ich glaubte, meine Waffe gleich fallen zu lassen. Meine Beine waren so schwach, dass sie jeden Augenblick nachzugeben drohten. Schmerzhaft durchschnitt die Luft meine Lungen, und mein Herz pochte entweder wie rasend oder gar nicht.
Ich konnte es nicht auseinanderhalten.
Gerade als ich jegliche Hoffnung aufgeben und mich der entsetzlichen Qual hingeben wollte, die mich zu überwältigen drohte, tauchte eine Gestalt aus der Wolke aus Staub und Rauch auf. Eine vertraute Hand umfasste die meine und nahm mir die Waffe ab. Er verwob seine langen Finger mit meinen und zog an meinem Arm, um mich so schnell wie möglich vom sichtbaren Beweis dessen, was ich getan hatte, fortzubringen.
Die Hitze seiner Berührung riss mich aus meiner Erstarrung, und so plötzlich, als habe jemand mich aus einem Vakuum geholt, konnte ich wieder hören und nahm die Laute um mich herum wahr. Meine Füße schienen am Boden festzukleben, als meine Sinne ihre Arbeit wieder aufnahmen. Er versuchte, mich fortzuzerren, aber ich stand unter Schock und rührte mich nicht. Seine Lippen bewegten sich, und ich hörte seine Stimme.
Hayden.
»Wir müssen hier weg, Grace.«
Es klang drängend und entschlossen, und offensichtlich bemühte er sich, um meinetwillen so ruhig wie möglich zu bleiben. Trotzdem war der verzweifelte Wunsch, uns von hier fortzuschaffen, mehr als offensichtlich.
»Grace, komm schon, beweg dich«, mahnte er und zerrte erneut an meinem Arm. Doch ich starrte ihn nur an. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. In meinem Kopf herrschte undurchdringlicher Nebel – entweder durch zu viele Gedanken oder zu wenige.
Ich konnte mich nicht regen, obwohl ich jetzt den erbarmungslosen Lärm um uns herum durchaus wahrnahm. Schüsse, Schreie, Kampfgeräusche, Feuer und vieles mehr nahm mich von allen Seiten in Beschlag. Es war hundertmal lauter als die seltsame surrende Stille von vor wenigen Sekunden.
»Mein Gott«, murmelte Hayden leise.
Blicklos sah ich, wie er sich unsere beiden Waffen hinten in den Hosenbund stopfte und in die Hocke ging. Mir blieb gar nicht genug Zeit, um mir darüber klar zu werden, was er vorhatte, da spürte ich schon seine Arme um mich, und er hob mich hoch. Er legte meine Beine über seinen Unterarm, schlang meine Arme um seinen Hals, hielt mich fest an seiner Brust und fing an zu rennen.
Er bewegte sich verzweifelt schnell, denn offensichtlich schwebten wir noch immer in großer Gefahr. Doch ich konnte immer noch nicht reagieren. Jeder seiner Schritte rüttelte meinen Körper durch, und der emotionale Schmerz ging in körperlichen über. Es fühlte sich beinahe so an, als sei ich verletzt.
»Halt dich fest, Grace«, befahl er so ruhig wie möglich.
Es gelang mir, meine Arme etwas fester um seinen Hals zu schlingen, aber es reichte nicht. Ich rutschte ein wenig herunter, während er mit mir auf den Armen so schnell wie möglich weiterrannte. Als ein schrilles Pfeifen nur wenige Zentimeter über unseren Köpfen ertönte, wurde mir mit einem Mal klar, wie real die Gefahr tatsächlich war. Ich sog scharf den Atem ein und blinzelte heftig, versuchte zum ersten Mal, seit ich den Abzug betätigt hatte, einen klaren Gedanken zu fassen.
»Lass mich runter«, keuchte ich.
Hayden seufzte erleichtert. Sicher nicht, weil er mich jetzt nicht mehr würde tragen müssen, sondern weil meine Benommenheit gewichen war. Er stellte mich so schnell und sanft wie möglich auf die Füße. Dann nahm er meine Hand und zog mich weiter, sprintete los, und endlich gehorchten mir auch meine Beine wieder. Er zerrte eine Waffe aus dem Hosenbund und gab sie mir. Die andere nahm er selbst.
Wieder eine surrende Kugel, die uns um ein Haar verfehlte, als wir die Straße entlanghasteten, die mit mehr Schutt und Hindernissen übersät war als zuvor. Mir drehte sich vor Entsetzen der Magen um, als ich bemerkte, dass Hayden und ich die Einzigen waren, die hier entlang flohen.
»Wo sind …«
»Runter!«, schrie Hayden und riss mich zu Boden.
Er hatte sich gerade über mich geworfen, seine Brust an meinem Rücken, als ein weiteres schrilles Pfeifen über uns ertönte. Wie zuvor folgte dem beinahe sofort ein ohrenbetäubendes Dröhnen, als etwas auf die Trümmer vor uns traf. Die Explosion spie Feuer und Schutt in die Luft.
Anscheinend war den Brutes die Munition für ihre Bazooka immer noch nicht ausgegangen.
Ich hustete und prustete ein paar Mal, versuchte, mir den Schmutz aus den Augen zu wischen. Hayden hatte sich etwas schneller erholt und verschwendete keine Zeit, um mich wieder auf die Füße zu zerren.
»Komm schon!«, drängte er und warf einen flüchtigen Blick über die Schulter.
Wieder sprinteten wir los. Aufgrund der neuerlichen Explosion war die Luft sogar noch undurchdringlicher als zuvor, sodass es noch schwerer war, etwas zu sehen oder zu atmen. Ich zerrte mein Shirt hoch und hielt es mir als Atemschutz vor die Nase, aber das Tanktop bot nur wenig Schutz. Hayden packte meine Hand fester denn je, während er mich durch das Kriegsgetümmel führte, Schutthaufen und schwerem Beschuss mit jedem Schritt aufs Neue auswich. Schüsse hallten wider, Kugeln surrten an uns vorbei, aber der vermehrte Rauch und Staub gab uns die dringend notwendige Deckung.
Wir rannten, und ich fragte mich verzweifelt, wo Kit und Dax waren, brachte aber nicht den Mut auf, um nachzufragen und es herauszufinden. Wir rannten eine gefühlte Ewigkeit. Der Beschuss wollte nicht aufhören, und der alles bedeckende Staub war erbarmungslos. Ich wollte gerade vorschlagen, unsere Strategie zu ändern, als ich nicht weit vor uns das Quietschen von Reifen vernahm.
»Da«, rief Hayden und erhöhte sein Tempo.
Hinter uns hörte ich die gedämpften Schreie der Brutes und derjenigen, die von Jonahs Anhängern übrig sein mochten. Sie verfolgten uns, aber das vertraute Rumpeln des Motors war näher, rief mich durch den Nebel hindurch zu sich. Schließlich konnte ich die vagen Umrisse des Jeeps erkennen, obwohl man unmöglich sagen konnte, wer darin saß.
»Sind das unsere Leute?«, fragte ich und musste wieder husten, als ich mit verengten Augen das Fahrzeug musterte.
»Keine Ahnung«, bekannte Hayden barsch.
Wir rannten weiter und gelangten endlich zu dem Auto. Mein Herz drohte meine Brust zu sprengen, als ich versuchte, den Fahrer zu identifizieren. Was, wenn im Wagen keiner unserer Freunde saß, sondern Feinde, die nur darauf warteten, uns zu töten?
Aber meine Angst legte sich, als ich Kit am Steuer entdeckte. Erleichtert seufzte ich auf. Er winkte uns hektisch heran. Dax allerdings war nirgends zu sehen.
Hayden und ich kamen so ruckartig an der Wagentür zum Stehen, dass die Erde unter unseren Füßen in die Höhe stieb. Er riss die Tür auf und warf mich förmlich hinein. Dann folgte er mir und beugte sich sofort zwischen die Sitze, um Kit Befehle zuzurufen.
»Los, los!«, schrie er. »Wir müssen Dax suchen!«
»Keine Ahnung, wo er ist«, rief Kit hastig. Seine Stimme klang angespannt.
Vor lauter Entsetzen sank mir das Herz wie ein Felsbrocken in die Kniekehlen. Dax durfte einfach nicht tot sein! Er hatte schon so viel überlebt; es kam mir undenkbar vor, dass er diesem Inferno jetzt nicht entkommen sein sollte.
»Er muss noch irgendwo da draußen sein«, rief ich und schüttelte entschlossen den Kopf. »Wir werden ihn finden.«
Hayden warf mir einen besorgten Blick über die Schulter hinweg zu und legte mir die Hand auf den Schenkel, drückte ihn, als klammere er sich an die Hoffnung, dass ich Recht hatte.
»Los, suchen wir nach ihm«, befahl Hayden. »Fahr!«
Kit gehorchte sofort und trat das Gaspedal durch, sodass der Jeep mit qualmenden Reifen voranpreschte. Als Kit das Fahrzeug wendete, prallte Haydens Schulter hart gegen meine, bevor er sich wieder aufrichten konnte.
»Macht euch schussbereit«, riet Kit finster und verengte die Augen, um die Straße vor uns besser erkennen zu können.
Ich nickte einmal kurz, obwohl er mich nicht sehen konnte, und öffnete das Magazin meiner Waffe, um meine Munition zu checken. Dabei wusste ich genau, dass nur eine Kugel fehlte. Ich hatte nur einmal geschossen, und diese Kugel steckte nun in Jonahs Brust.
Beinahe auf der Stelle waren wir wieder von Gewehrfeuer umringt, und das vertraute metallische Knirschen zeigte an, dass die Kugeln zwar uns verfehlten, aber den Jeep durchlöcherten.
»Dax!«, schrie Hayden und beugte sich aus dem Fenster, bevor er einen Schuss in den Rauch abgab.
Kit hupte und rief ebenfalls Dax’ Namen. Der Lärm, den wir machten, würde nur noch mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen, aber das war uns gleichgültig. Wir mussten unseren Freund einfach finden!
»Dax!«
Wieder und wieder riefen wir seinen Namen. So schnell er konnte, manövrierte Kit den Jeep über das Gelände, knapp vorbei an Gebäuden, Schutthaufen und Schlaglöchern. Wieder und wieder feuerten Hayden und ich quasi ins Nichts. Wir waren den Blicken genauso verborgen wie unsere Feinde, allerdings waren wir im Gegensatz zu ihnen herumbrüllend und in einem lärmenden Jeep unterwegs.
»Dax!«
Meine Stimme klang ängstlich und frustriert.
Aufmerksam spähte ich in den Dunst und lauschte auf jede Art von Antwort, aber das Chaos um uns herum schien alles zu verschlingen.
Womöglich würden wir ihn nicht finden, dachte ich, aber dann drängte ich meine Angst zurück, lud meine Waffe erneut und feuerte wieder. Neben mir schien auch Hayden immer besorgter, und ich bemerkte, wie er trotz seines sonstigen Widerwillens gegen das Töten, immer häufiger abdrückte.
»Wo zum Teufel bist du?«, murmelte er ungeduldig und wippte vor Nervosität unaufhörlich mit dem Knie auf und ab. »Dax, Herrgott nochmal!«, brüllte Hayden. In seine Verzweiflung mischte sich Wut.
»Ich kann ihn nirgends entdecken«, bekannte Kit angespannt, das Gesicht verzerrt vor Sorge. Zum gefühlt hundertsten Mal riss er den Jeep herum, und noch mehr Kugeln surrten an uns vorbei.
»Wir können ihn doch hier nicht zurücklassen«, blaffte Hayden wütend.
»Das hab ich ja auch gar nicht gesagt …«
»Aber du wolltest …«
»Nein, ich …« Doch plötzlich erklang eine andere Stimme, und zaghaft keimte Hoffnung in mir auf.
»Hier drüben!«
»Dax?!«, schrie Hayden und spitzte die Ohren, denn auch er hatte den Ruf gehört.
»Ich bin hier!«
Er war es tatsächlich! Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich seine Stimme erkannte.
Dax.
»Ich seh ihn!«, schrie ich, beugte mich mit einem Mal vor und deutete geradeaus.
Er war nicht mehr als ein Schemen, aber dennoch hatte ich ihn in etwa sechs Meter Entfernung erspäht. Er winkte mit den Armen und hustete inmitten von Rauch und Staub. Kitt erhöhte das Tempo sogar noch mehr, dann trat er so kräftig auf die Bremse, dass Hayden und ich erst gegen die Rücklehnen der Vordersitze prallten und sofort wieder zurückgeschleudert wurden.
»Versuch doch wenigstens, uns nicht umzubringen«, blaffte Hayden erneut. Offensichtlich stand er immer noch unter Strom.
Ich hatte kaum Zeit, um seine Worte zu erfassen, da sah ich, wie Dax so schnell wie möglich auf uns zukam. Er hinkte, und aus irgendeiner Wunde floss eine erschreckende Menge Blut. Er langte an der Tür an und machte sich ungeschickt am Griff zu schaffen, bevor Hayden sich hinüberbeugte und sie aufstieß. Dax zuckte zusammen, als er einstieg, zog die Tür hinter sich zu, und weniger als eine Sekunde später trat Kit wieder aufs Gaspedal und preschte erneut los.
Als ich sah, wie erschreckend blass Dax war, war es mit meiner Erleichterung auch schon wieder vorbei. Keine Spur von seinem üblichen Lächeln oder seiner guten Laune; sein Gesicht war schmerzverzerrt.
»Was ist passiert?«, verlangte Hayden zu wissen und beugte sich vor, um ihn genauer in Augenschein zu nehmen.
Mit den Augen folgte ich der Blutspur bis hin zu seinem linken Arm und registrierte ein blutiges Stück Stoff, das um die Hand gewickelt war – oder um das, was sich sonst noch darunter verbergen mochte.
Dax gab keine Antwort, sondern lehnte nur den Kopf gegen die Kopfstütze und atmete scharf aus, die Augen fest geschlossen. Sein Atem ging zittrig und ungleichmäßig, aber wenigstens war er am Leben. Kit warf ihm über die Mittelkonsole hinweg einen besorgten Blick zu. Erleichtert registrierte ich, dass die Schüsse und das Geschrei immer leiser wurden. Wir waren dem Chaos endlich entkommen.
»Dax!«, zischte Hayden, frustriert, weil er keine Antwort bekam. Ich warf ihm einen schnellen Blick zu. Auch er war voller Sorge und Furcht. Dann sah ich Dax wieder an.
»Verdammte Brutes, Kumpel«, murmelte der und verzog schmerzerfüllt das Gesicht, als der Jeep durch ein Schlagloch fuhr.
Erneut musterte ich das Stück Stoff, das er um das Ende seines Arms gewickelt hatte, und sofort standen mir die gleichen entsetzlichen Bilder vor Augen wie zuvor.
Verwesende Hände, die man an die Wand genagelt hatte.
Abgetrennte Gliedmaßen mit zerfetzten Stumpen.
Diebe.
Diebe.
Diebe.
Ich presste die Lider zu und holte tief Luft. Das Entsetzen drohte mich zu überwältigen. Meine Alpträume und die Wirklichkeit schienen vor meinen Augen miteinander zu verschmelzen. Ich konnte nichts dagegen tun.
»Grace.«
Beim Klang von Haydens Stimme öffnete ich ruckartig die Augen. Ich blinzelte ein paar Mal und sah, dass er mich eindringlich musterte. Erneut spürte ich die Hitze seiner Hand auf meinem Bein. Er strich mit dem Daumen über meinen Oberschenkel, dann drückte er zu. Er runzelte die Augenbrauen, und sein Gesicht war voller Sorge.
»Ist schon gut«, formte er mit den Lippen und nickte mir langsam und beruhigend zu. Zittrig erwiderte ich die Geste und versuchte, mich zusammenzureißen.
Wieder zwang ich mich, mir Dax näher anzusehen und mich auf meine medizinische Ausbildung zu besinnen.
»Dax, was ist geschehen?«, fragte ich so ruhig wie möglich.
Wieder gab er keine Antwort, öffnete aber endlich die Augen und hob den Kopf. Mit etwas unsicherer Hand wickelte er den provisorischen Verband von seinem linken Arm ab. Wie gelähmt vor Entsetzen sah ich zu, wie eine blutdurchtränkte Schicht nach der anderen heruntergeschält wurde. Ich war fest davon überzeugt, darunter einen Armstumpf sehen zu müssen.
Aber statt des schockierenden Anblicks, den ich erwartet hatte, sah ich eine übel zugerichtete, blutige Hand. Sein kleiner Finger und der Ringfinger waren verschwunden, abgetrennt durch eine offensichtlich besonders scharfe Klinge, und sein Mittelfinger blutete stark, aber der Rest war noch intakt.
»Ach du Scheiße …«, murmelte Hayden bei diesem Anblick, und vor Schreck blieb ihm der Mund offen stehen.
»Da sagst du was«, stieß Dax bitter hervor. Er machte eine kleine Pause, dann fuhr er fort. »Immerhin war es nicht meine Haupthand.«
Ich keuchte vor Erleichterung. Dax hatte zwei Finger verloren und humpelte, aber anscheinend gab es keine weitere ernsthafte Verletzung oder Blutung. Und wenn er jetzt schon wieder Witze machte, wagte ich zu hoffen, dass er wieder werden würde.
»Zwei vollständige Hände brauchst du sowieso nicht, Kumpel«, meinte Kit leichthin. Offensichtlich beruhigte Dax’ Verhalten auch ihn.
»Nur meine gute alte rechte«, meinte Dax und wedelte matt vor seinem Schritt herum. Ich stöhnte, als mir klar wurde, was er meinte.
»Gütiger Gott, Dax, du bist vor ein paar Minuten verletzt worden und machst schon wieder Witze«, sagte ich.
Überrascht stellte ich fest, dass ich darüber grinsen konnte, aber meine Belustigung währte nicht lang, und schon drückte mich die kalte, schwere Realität unserer Erlebnisse wieder nieder. Ich ließ mich zurücksinken und stieß den bislang tiefsten Seufzer aus. Nun, da ich wusste, dass Dax nicht sterben würde, schloss ich wieder die Augen.
Wir hatten überlebt, aber ein Mensch war gestorben.
Jonah.
Nach ein paar Sekunden spürte ich, wie Hayden sich neben mir bewegte. Er legte mir den Arm um die Schultern und zog mich auf seinen Schoß. Dort, auf dem Rücksitz des Jeeps, rollte ich mich zusammen, barg das Gesicht an seiner Brust, während er mich so dicht wie möglich in seinen starken Armen hielt. Ich spürte die Hitze seiner Lippen an meinem Ohr und hörte das leise Flüstern seiner Stimme.
»Ich liebe dich, Bär.«
Ich spürte, wie ich zu zittern begann, als mir die Realität der ganzen Situation wieder zu Bewusstsein kam. Meine Kehle brannte, und meine Augen wurden heiß, aber es wollten keine Tränen kommen. Instinktiv legte ich Hayden die Arme um die Brust, umarmte ihn fest, während er mich sicher hielt.
»Schon gut, alles wird gut«, murmelte er, immer weiter, obwohl ich keine Antwort herausbrachte.
Er streichelte mich überall, tröstete und beruhigte mich. Selbst als Kit über eine Unebenheit auf der Straße fuhr, hielt Hayden mich ganz fest, beschützte mich auf jede erdenkliche Weise. Ich krallte die Finger in den mittlerweile zerfetzten Stoff seines Shirts in dem verzweifelten Versuch, ihn dichter an mich zu ziehen und in seiner tröstlichen Wärme zu versinken.
»Ich bin so stolz auf dich, Grace.«
Ich biss mir auf die Unterlippe und holte zittrig Atem. Nun brannten mir die Tränen doch hinter den Augen. Seine Worte waren gedämpft, nur so laut, dass ich – und nur ich – sie hören konnte. Leise und unaufhörlich redete er auf mich ein, obwohl ich keine Antwort gab. Er ließ mich auf der gesamten Fahrt nicht los, wollte mich wohl über das hinwegtrösten, was ich getan hatte.
»Du bist so stark, Bär.«
Jedes seiner Worte lockte die Tränen immer dichter und dichter an die Oberfläche. Ein einzelnes ersticktes Schluchzen entrang sich mir, dann gab ich nach. Ich weinte seltsam stumm. Trotzdem waren die Tränen nicht minder schmerzhaft und schienen mich von innen heraus zu verbrennen. Hayden hielt mich sogar noch fester, als er bemerkte, dass ich endlich losgelassen hatte. Auch jetzt hörte er nicht auf, zärtlich auf mich einzureden.
»Ich liebe dich so sehr.«
Es war endlich aus und vorbei.
Ich war stark genug gewesen, um es letztlich zu tun, aber noch nie war ich mir schwächer vorgekommen als in diesem Augenblick.
Kapitel 2
Masochismus
Hayden
Ich hielt Grace auf meinem Schoß fest. Sie umarmte mich und barg das Gesicht, so gut es ging, an meiner Brust. Mein Shirt war nass von ihren warmen, stummen Tränen. Ich sprach leise und unaufhörlich auf sie ein, war mir aber nicht sicher, ob sie nicht viel zu verstört war, um mich zu verstehen. Ich hätte ihr keinen Vorwurf daraus machen können. Wahrscheinlich war dies die schwerste Entscheidung ihres Lebens gewesen.
Nie hatte ich mich unzulänglicher gefühlt als in diesem Moment. Wie sollte ich sie nur trösten?
»Alles ist gut, Süße«, flüsterte ich erneut. Unsicher bewegte ich die Lippen an ihrem Ohr und presste sie noch dichter an mich.
Ich streichelte sie am ganzen Körper, legte den Kopf in die Kuhle zwischen ihrer Schulter und ihrem Hals, um sie so gut wie möglich vor der Außenwelt abzuschirmen. Wie sehr wünschte ich mir, sie einfach schnell ins Camp und in unsere Hütte zurückzubringen! Ich wusste, dass sie sich noch zu beherrschen versuchte, dass sie gegen den kompletten Zusammenbruch ankämpfte, der sich sicherlich in ihrem Innern anbahnte, und ich wusste, sie würde ihn erst zulassen, wenn wir allein waren.
In meinen Armen kam sie mir so zerbrechlich vor, als ob jede Erschütterung des Jeeps sie vollends zu zerbrechen drohte. Ich konnte ihren Schmerz beinahe fühlen. Er sickerte aus ihrer Haut, drang mir in die Poren und setzte sich tief in meinen Knochen fest.
Im Auto herrschte Schweigen, während Kit nach Blackwing zurückraste. Dax war vollauf damit beschäftigt, den Schmerz in seiner Hand auszublenden. Sein halbherziger Versuch, einen Witz zu machen, war der einzige geblieben. Kit konzentrierte sich auf die Straße, fuhr, so schnell es möglich war, ohne uns alle in Gefahr zu bringen.
Ich presste die Lippen an Graces Schläfe, als ich spürte, wie der Jeep über unbefestigte Wege fuhr. Wir hatten also endlich den Wald erreicht, der das Camp umgab. Bald würden wir wieder zu Hause sein, und ich konnte sie in die Einsamkeit unserer Hütte bringen. Dax stieß auf dem Vordersitz ein leises Zischen aus, als Kit über ein paar Grasbüschel holperte. Grace bewegte sich kaum, denn ich hielt sie fest und federte jegliche Erschütterung ab. Schließlich spürte ich, wie Kit langsamer fuhr, dann stehenblieb und den Motor ausschaltete.
Ich stieß einen erleichterten Seufzer aus, setzte mich auf und blinzelte. Eine recht große Menschenmenge hatte sich um den Jeep versammelt. Ihre vertrauten Gesichter blickten besorgt drein. Wahrscheinlich fragten sie sich, wer von uns wohlbehalten zurückgekehrt sein mochte. Wie immer wartete auch Docc dort, die Miene ruhig und konzentriert. Kaum war Kit ausgestiegen, eilte auch schon Malin zu ihm heran. Er schloss sie sofort in die Arme und verharrte eine ganze Weile so.
Als Dax keine Anstalten machte, den Jeep zu verlassen, kam Docc zum Auto, Leutie dicht auf den Fersen. Sie wirkte erleichtert, als sie feststellte, dass wir alle zurückgekommen waren. Aber da Dax sich kaum bewegte und Grace sich auf meinem Schoß zusammengerollt hatte, zog sie doch ein besorgtes Gesicht. Sie schien zunächst hin- und hergerissen, wen sie als Erstes begrüßen sollte, öffnete dann aber überraschend zuerst die hintere Tür. Grace und ich saßen noch immer auf dem Rücksitz.
Leuties Blick huschte kurz zu Dax auf dem Vordersitz, dem Docc nun heraushalf.
»O mein Gott, geht es ihr gut?«, fragte sie dann aber besorgt.
Merkwürdige Frage. Natürlich nicht. Es ging ihr nicht gut. Andererseits war mir selbstverständlich klar, dass Leutie dies auf ihren physischen Zustand bezog. Körperlich war sie abgesehen von ein paar Kratzern und blauen Flecken in Ordnung.
Grace schniefte an meiner Brust, gab aber keine Antwort. Ich vermutete, dass sie wieder in jenen tranceartigen Schockzustand von vorhin zurück verfallen war.
»Sie hat es getan«, antwortete ich, Leuties erste Frage ignorierend.
»Oh, Grace …«, sagte Leutie leise, mitfühlend und traurig.
Sie trat einen Schritt zurück, als ich ihr mit einem Kopfnicken bedeutete, uns Platz zu machen. Langsam und vorsichtig verlagerte ich unser Gewicht, stellte die Füße auf den Boden und stieg mit Grace auf dem Arm aus dem Wagen. Ich trug sie genau wie zuvor – die Beine über meinem Arm, ihre Arme um meinen Nacken – und machte ein paar Schritte. Sie hatte das Gesicht an meinem Nacken vergraben, versteckte sich vor der Außenwelt. Mit einem schnellen Blick über die Schulter überzeugte ich mich davon, dass Docc Dax stützte und zur Krankenstation führte und dass Kit sich von Malin gelöst hatte, um ihm zu helfen.
»Schau doch mal, ob du ihnen helfen kannst, Leutie«, sagte ich zu ihr. Meine Stimme war ausdruckslos. Ich brachte es nicht über mich, meinen normalen Befehlston anzuschlagen.
»Okay«, antwortete sie und nickte kurz. Unsicher blieb sie stehen und machte noch einmal den Mund auf. Doch dann klappte sie ihn wieder zu. Ihr Blick huschte zu Grace in meinen Armen hinüber. Offensichtlich wusste sie nicht, was sie sagen sollte. »Grace, ich bin da, wenn du reden willst, okay?«
Wieder antwortete Grace auf meinem Arm nicht.
»Danke, Leutie«, sagte ich also an ihrer Stelle. Sie nickte wieder, warf einen letzten traurigen Blick auf Graces niedergeschlagene Gestalt, dann eilte sie Docc, Dax und Kit hinterher.
Ohne das Wort noch an irgendjemanden sonst zu richten, ging ich so schnell wie möglich, ohne sie zu sehr durchzuschütteln, zu unserer Hütte. Erleichtert stellte ich fest, dass Grace meinen Nacken fester umfasste. Sie hatte immer noch nichts gesagt, aber diese kleine Geste sagte mir, dass sie zumindest noch ansprechbar war und mich hören würde.
»Wir gehen jetzt nach Hause, Grace«, flüsterte ich ihr zu. Ein unmerkliches Nicken. Das Einzige, was ich jetzt tun konnte, war, unaufhörlich beruhigend auf sie einzureden. »Bald sind wir allein. Es dauert nicht mehr lange«, murmelte ich.
Auf dem Weg kamen wir an ein paar Leuten vorbei, die Graces zusammengekauerte Gestalt erst verwirrt, dann mitfühlend musterten. Obwohl wir niemanden in unseren Plan eingeweiht hatten, hatte sich die Nachricht von unserer Exkursion in Blackwing anscheinend wie ein Lauffeuer verbreitet.
Spätestens jetzt würde jeder Campbewohner sie vorbehaltslos als eine der unsrigen respektieren. Immerhin hatte sie das größte Opfer von allen gebracht. Wieder war ich ungeheuer stolz, dass sie mein war.
Dieses starke, entschlossene und absolut selbstlose Geschöpf gehörte mir, genau wie ich ihr gehörte.
»Ich liebe dich, Grace«, flüsterte ich, und mir schnürte sich die Kehle zu, so bewegt war ich.
Wieder drückte sie ganz leicht meinen Nacken. Ich wusste, dass sie wahrscheinlich eine ganze Weile nichts sagen würde. Immerhin hatte ich selbst wegen Jett ebenfalls gerade eine furchtbare Trauerphase hinter mir, deshalb verstand ich, obwohl zwischen beiden Fällen natürlich ein himmelweiter Unterschied bestand. Es war niemals leicht, jemanden zu verlieren, aber hinter Graces Verlust steckte noch viel mehr, denn sie hatte ihn selbst verursacht.
Endlich waren wir an unserer Hütte angelangt. Vorsichtig trug ich sie durch die Tür und schloss sie hinter mir. Sanft legte ich sie auf unser Bett. Die Matratze senkte sich unter ihrem Gewicht, und ich kniete vor ihr nieder, um sie näher zu betrachten.
Ihr Gesicht war ausdruckslos und leer, und ihre Augen waren trocken, obwohl sie zuvor geweint hatte. Sie blickten ins Leere, auf irgendeinen Punkt zwischen uns, als brächte sie es nicht fertig, mich anzusehen. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, und sie atmete langsam und gleichmäßig. Ihre Haut war fahl. Langsam ließ ich die Finger über ihre Wange gleiten, dann schob ich sie unter ihr Kinn.
»Grace«, flüsterte ich leise und zwang sie, mich anzusehen. Sie blinzelte einmal, tat aber sonst nichts. Bei diesem Anblick tat mir das Herz weh. Sie war wie betäubt und vollkommen gebrochen.
»Baby, sieh mich an«, fuhr ich so sanft wie möglich fort. Wieder ein Blinzeln, dann schaffte sie es, mir in die Augen zu blicken. Langsam ließ ich den Daumen über ihr Kinn gleiten. »Ich weiß, dass du verletzt bist, und ich verstehe vollkommen, dass es eine Weile dauern wird, bis du darüber hinweg bist, aber du sollst wissen, dass du es tun musstest. Es musste so kommen, auch wenn du das vielleicht jetzt nicht so sehen kannst. Du hast Hunderten von Menschen das Leben gerettet, Grace. Hunderten. Und ich könnte dich momentan gar nicht mehr lieben, als ich es schon tue.«
Ich merkte, dass ich emotional wurde, und meine Kehle brannte bei meinen Worten. Aber ich meinte jedes einzelne Wort ernst und wusste, dass sie es hören musste. Sie war dabei, sich ganz und gar vor der Welt abzuschotten. Schon bald würde sie sich womöglich nur noch mit Mühe daran erinnern können, warum es überhaupt nötig gewesen war. Niemals durfte ich es so weit kommen lassen, dass sie etwas bereute, das dem Wohl aller diente, wie jeder wusste.
Sie holte zittrig Luft und schien die Intensität des Augenblicks kurz selbst zu spüren, denn ihr betäubter, leerer Blick war mit einem Mal aufmerksam. Sie hing mir an den Lippen.
»Du musst jetzt nichts sagen, okay? Du warst für mich da, und jetzt werde ich für dich da sein. Lass mich einfach nur für dich sorgen.«
Sie nickte schwach und biss sich auf die Unterlippe. Ich versuchte, ihr ermutigend zuzulächeln, aber es misslang. Also gab ich auf und streichelte sie nur, schob ihr eine lose Haarsträhne hinters Ohr. Erst da bemerkte ich die Blutspritzer auf ihren Wangen und den Bluterguss an ihrem Kinn. Die Blutung hatte bereits aufgehört, aber offensichtlich hatte sie doch ein paar Verletzungen davongetragen.
»Komm, wir machen dich sauber«, murmelte ich leise. Wieder nickte sie beinahe unmerklich.
Ich stellte mich vor sie hin und ergriff ihre Hand, zog sie auf die Füße. Sie ließ sich von mir ins Bad führen, wo es gerade hell genug war, dass ich sehen konnte, was ich tat, aber dennoch dunkel genug, um beruhigend zu wirken. Wieder sah ich sie an und legte ihr die Hände auf die Hüften; sie ließ mich nicht aus den Augen, beobachtete jede meiner Bewegungen.
Ich schob die Finger unter den Saum ihres Shirts und spürte die Wärme ihrer Haut, als ich es nach oben schob.
»Arme hoch«, befahl ich leise.
Sie gehorchte und hob die Arme über den Kopf, sodass ich ihr das Shirt vorsichtig ausziehen konnte. Jeder Zentimeter ihrer Haut trug Spuren eines Kampfes. Fast über ihre gesamte linke Seite zog sich die lange, zerklüftete Narbe, die sie sich vor einer gefühlten Ewigkeit eingehandelt hatte, als sie sich die Rippe gebrochen hatte. Außerdem gab es da die Narbe direkt über ihrem Herzen.
Ohne nachzudenken, neigte ich den Kopf und presste die Lippen sacht auf die raue Erhebung ihrer Haut. Ich ließ den Kuss geradezu in die Narbe einsickern, bevor ich mich weiter nach unten bewegte. Wieder und wieder presste ich den Mund auf die unebenen Stellen und Narben. Am Hüftknochen angelangt, küsste ich sie ein letztes Mal, dann richtete ich mich wieder vor ihr auf. Ihre Augen waren geschlossen, und eine einzelne Träne beschrieb einen feuchten Pfad über ihre Wange. Ihr Schmerz war förmlich greifbar. Ich wünschte mir inständig, dass sie die Wärme meiner Liebe spürte, und merkte, wie wunderschön sie für mich war. Mir war klar, dass sie im Augenblick nichts davon wahrnahm, aber sie hatte es so sehr verdient.
Ich seufzte, kam mir unzulänglich und ihrer unwürdig vor. Ich zeichnete mit den Fingern ihre Hüften nach und begann, ihre Shorts zu öffnen, um sie sodann gleichzeitig mit ihrer Unterhose zu Boden gleiten zu lassen. Ihre Augen waren nach wie vor geschlossen. Sie regte sich noch nicht einmal, um ihre Klamotten mit dem Fuß wegzuschieben.
Nun stand sie vor mir, nackt, zerbrochen, verletzlich. Wieder spürte ich ihren Schmerz, als durchtose er meinen eigenen Körper, als verbrenne er mich von innen heraus – eine unauslöschliche, sengende Qual. Schnell entledigte ich mich meiner eigenen Kleider, warf sie beiseite und umfing erneut ihre Hüften. Langsam schob ich sie unter die Dusche, wo sie endlich die Augen öffnete, obwohl sie weiterhin schwieg.
Als ich die Dusche einschaltete, reagierte sie kaum. Sofort ergoss sich das kalte Wasser über uns, durchtränkte unsere Haut und wusch einen Teil des dunkelroten Blutes von Graces Körper. Ich löste die Hand von ihrer Hüfte, um es fortzuwischen, sodass weinrote Rinnsale von ihr herabtropften und im Abfluss verschwanden. Sie stand ganz still da, reagierte nicht im Mindesten, während ich sie langsam und bedächtig wusch und sie von jeglichem Rest Schmutz und Blut befreite, ohne ihr wehzutun.
Auch der Schmutz, der an mir haftete, wurde davongespült, und schon bald waren wir sauber. Die Luft um uns herum schien elektrisch aufgeladen von unausgesprochenen Worten. Sie schienen mit dem Wasser von oben auf uns niederzuprasseln und uns niederzudrücken. Ich wusste, dass der Strahl gleich versiegen würde, trotzdem konnte ich mich einfach noch nicht von ihr lösen. Ihre wunderschönen grünen Augen sahen unverwandt in die meinen. Sie stand nur wenige Zentimeter von mir entfernt und ließ zu, dass ich sanft ihre Haut liebkoste. Sie machte keinerlei Anstalten, mich ihrerseits zu berühren oder sonst irgendetwas zu unternehmen, schien immer noch zu betäubt zu sein, um zu reagieren.
Als die Dusche stotternd versiegte, seufzte ich leise und trat einen Schritt zurück, um mir zwei Handtücher zu schnappen. Geschwind wickelte ich mir meines um die Hüfte, dann schlang ich ihr das zweite um die Schultern, hüllte sie darin ein. Sanft ließ ich die Hände über sie hinweggleiten, trocknete ihre Haut, so gut es ging. Als ich mit meinem Werk zufrieden war, nahm ich sie wieder an die Hand und führte sie in unser Zimmer zurück. Sie ließ sich von mir zum Bett hinziehen, wo ich mich von ihr löste, um ein paar Kleider aus der Kommode zu nehmen.
Nun wiederholte sich das Ganze, nur umgekehrt. Ich zog sie an. Schweigend gehorchte sie meinen geflüsterten Anweisungen, hob die Arme und Füße, wenn ich es wollte, ohne auch nur ein Wort von sich zu geben. Als wir beide trocken und bettfertig waren, seufzte ich erleichtert. Endlich. Jetzt würde ich sie im Arm halten können, wie ich es ersehnte, seit das alles passiert war.
»Komm schon, Bär«, beruhigte ich sie und schob sie sanft aufs Bett.
Ich schlug die Decke zurück und ließ sie darunterkriechen. Dann folgte ich ihr. Sie drehte sich zu mir um, und ich zog die Decke über uns, schottete uns von der Außenwelt ab. Ich spürte die Hitze ihres Körpers, den Schmerz, den sie ausstrahlte, ihre Betäubung, ihre Leere.
Ich schlang den Arm um sie und zog sie an meine Brust, schob dann den anderen unter ihren Kopf, um sie ganz festhalten zu können. Ihre Hände ruhten leicht auf meiner Brust, und wieder blickte sie ins Leere. Langsam beugte ich mich vor und gab ihr einen Kuss auf die Schläfe, ließ die Lippen ein paar Augenblicke dort verharren.
»Weißt du noch, was du mir mal gesagt hast?«, fragte ich.
Eine kleine Welle der Erleichterung durchflutete mich, als sie mir kurz in die Augen sah und mich auch wieder wahrzunehmen schien. Sie schien ein wenig verwirrt zu sein, also sprach ich weiter.
»Als Jett starb … Weißt du noch, was du da sagtest?«, fragte ich leise. Sie beobachtete mich schweigend, wartete darauf, dass ich weitersprach. Ich holte tief Luft.
»Du sagtest, dass man es spüren muss, um sich mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen. Nur dann kann man es hinter sich lassen«, erläuterte ich. Sie sah zwischen meinen Augen hin und her, plötzlich wieder ganz bei mir. »Es tut weh, aber das ist okay, denn so schlimm wird der Schmerz nicht ewig sein.«
Sie verzog das Gesicht und schluckte einmal. Ihr Kinn zitterte leicht.
»Und ich weiß, dass es nicht das Gleiche ist. Es ist nicht annähernd das Gleiche. Aber ich weiß, dass es irgendwann wieder gut wird. Und im Augenblick, da es dir schlecht geht, hast du mich.«
Eine stumme Träne rann aus ihrem Auge, bahnte sich den Weg über ihre Schläfe und verschwand in ihrem Haar. Ich rückte noch näher an sie heran.
Wieder eine kleine Woge der Erleichterung, als sie sich ebenfalls bewegte und mir die Arme um den Nacken legte und mich umarmte. Automatisch zog ich sie ganz fest an mich. Ich spürte die Hitze ihrer Tränen an meinem Hals, als sie endlich wieder weinte, und ich spürte, wie ihr Körper unter jedem mühsamen Atemzug erzitterte.
»Gut so, Grace«, raunte ich ihr ins Ohr. Wieder strich ich ihr unermüdlich über den Rücken. »Lass es raus. Bei mir kannst du es herauslassen.«
Es war, als hätten meine Worte die unsichtbare Mauer zwischen ihr und ihren Gefühlen niedergerissen, denn kaum hatte sie sie vernommen, erklang ein ersticktes Schluchzen, und ihr ganzer Körper zuckte krampfartig. Ich schloss die Augen und umfing sie noch inniger, erleichtert, dass sie endlich vollkommen zusammenbrach. Sie musste erst in das dunkelste, schmerzhafteste Loch der Verzweiflung fallen, bevor sie wieder herauskriechen konnte. Das wusste ich aus Erfahrung.
Ich hatte es nur dank ihr verstanden.
Ihr Keuchen und Schluchzen hallten in der Hütte wider, legten sich auf meine Haut, gingen mir durch Mark und Bein. Ihre ganze Gestalt bebte, und mein Hals war von ihren Tränen ganz nass. Ich hielt sie unermüdlich fest, streichelte sie, raunte ihr beruhigende Worte ins Ohr. So gern ich ihr diesen Schmerz genommen hätte, ich wusste, dass ich es nicht konnte; sie musste ihn spüren, um darüber hinwegzukommen, und das tat sie jetzt definitiv.
Keine Ahnung, wie oft ich ihr versicherte, dass ich sie liebte, wie stark sie war, wie stolz ich war. Sie hatte seit unserer Ankunft immer noch kein Wort gesagt, aber das spielte keine Rolle. Es reichte, dass sie mich hörte. Sie klammerte sich an mich, und ich hielt sie fest. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis sie sich schließlich genug entspannte, um wieder in unsere ursprüngliche Position zurückzukehren.
Ihre Augen waren rot und geschwollen, was ihr Grün noch stärker zur Geltung brachte und sie förmlich leuchten ließ.
»Ich wünschte, ich hätte es an deiner Stelle tun können«, flüsterte ich.
Sie schüttelte den Kopf und schloss einen Augenblick lang die Augen. Dann sah sie mich wieder an. Sie schien beinahe mit mir zu verschmelzen.
»Ich wünschte, ich könnte das an deiner Stelle empfinden. Dir diese Schmerzen nehmen.«
Wieder schüttelte sie den Kopf. Sie hatte die Augenbrauen tief über den Augen herabgesenkt, aber selbst jetzt noch war sie schön.
»Ich wünschte, ich könnte es«, wiederholte ich beinahe tonlos.
Sie seufzte tief und legte mir überraschend die Hand aufs Gesicht, ließ die Finger sacht an meinem Kinn entlanggleiten und vergrub sie dann in meinem Haar. Und noch überraschter war ich, als sie ihre Lippen auf meine presste, sie dort verharren ließ, als ob der Druck unseres Kusses ihr wieder neues Leben einhauchen könne. Als es vorbei war, spürte ich jenes Flattern im Bauch, und mein Herz pochte heftig, genau wie damals, als ich sie zum ersten Mal geküsst hatte.
»Ich liebe dich, Hayden«, flüsterte sie.
Sie sah mir fest in die Augen und biss sich auf die Unterlippe, kämpfte gegen die Tränen an, die sich schon wieder ankündigten. Sie nickte noch einmal kurz, als wolle sie ihre Worte unterstreichen.
Endlich hatte sie ihr Schweigen gebrochen. Ich atmete erleichtert auf.
»Gott, ich liebe dich auch, Grace«, antwortete ich ernst. »So sehr, dass es wehtut.«
»Ich weiß, wie es dir jetzt geht«, antwortete sie. Ihre Hand lag immer noch an meinem Kinn.
»Aber dein Schmerz ist gerade ein anderer«, sagte ich, so leichtfertig, wie es ging.
»Stimmt, aber glaub es mir trotzdem: Ich weiß, wie du dich fühlst«, versicherte sie mir. »So empfinde ich ständig. Ich liebe dich so, dass es wehtut.«
Ich legte den Arm um sie, wollte sie unbedingt ganz nah bei mir spüren.
»Wir sind ganz schöne Masochisten, stimmt’s?«, murmelte ich und erlaubte mir ein winziges Grinsen. Der Versuch eines Lächelns fühlte sich merkwürdig an. Sie schwieg ein paar Sekunden lang, senkte kurz die Lider, bevor sie mir wieder in die Augen sah. Ein ganz schwaches Lächeln, das beinahe ihre Augen erreicht hätte.
»Ja«, stimmte sie mir leise zu. »Aber die beste Art von Masochisten.«
Kapitel 3
Linderung
Hayden
Fünf Tage zogen ins Land, bis ich Grace wieder einmal richtig lächeln sah.
Fünf Tage, in denen ich sie im Arm hielt, sie tröstete, sie, so gut es ging, beruhigte.
Fünf Tage, in denen sie sich zumindest so weit erholte, um sich für ein paar flüchtige Augenblicke von dem Gedanken an das Geschehene freimachen zu können.
Es geschah eines Morgens, als wir im Bett lagen, länger dort herumfaulenzten, als wir sollten, weil ich mich einfach nicht von ihr losreißen konnte. Ihr Rücken lag dicht an meiner Brust, und ihr Kopf ruhte auf meinem Arm, während ich mich an sie schmiegte. Wir waren beide wach, eingehüllt in einträchtiges Schweigen. Ich spürte ihre sanften Fingerspitzen, die mir wieder und wieder über den Unterarm strichen, so federleicht, dass ich eine Gänsehaut bekam.
Offensichtlich belastete sie das Geschehene nach wie vor, und ihre Gedanken kreisten auch weiterhin nur um ihre Erinnerungen, trotzdem schien es ihr langsam besser zu gehen. Auf mehr wagte ich nicht zu hoffen.
»Hey«, raunte sie mir leise zu und wandte den Kopf zu mir um. Erfreut bemerkte ich, dass ihre Augen zum ersten Mal seit Tagen nicht verschleiert waren, als könne sie mich endlich wieder richtig ansehen.
»Hi«, antwortete ich mit sanftem Lächeln.
»Ich habe nachgedacht«, begann sie langsam.
»O nein«, witzelte ich leichthin in der Hoffnung, ihr ein Lächeln zu entlocken.
Und tatsächlich sah ich, wie sich ihre Mundwinkel ganz leicht nach oben verzogen, obwohl es nicht jenes strahlende, atemberaubende Lächeln war, nach dem ich mich so sehr sehnte.
»Ich glaube, heute mache ich es«, sagte sie ernsthaft.
Ich wusste sofort, was sie meinte. In den fünf Tagen, seit ich sie in unsere Hütte zurückgetragen hatte, hatte sie sie kein einziges Mal verlassen. Unser Essen hatte man uns gebracht. Allerdings hatte ich sie ohnehin nicht dazu bewegen können, allzu viel zu sich zu nehmen. Ihre Augen waren von dunklen Ringen umrahmt, und ihr Gesicht war ein wenig kantiger als sonst. Sie stand selten vom Bett auf, aber wenn doch, fiel auf, wie schwach sie war.
»Meinst du?«, fragte ich hoffnungsfroh. Ich verstand sie zwar, aber dennoch war es mir verhasst, sie so lethargisch zu erleben.
»Ja«, bestätigte sie nickend. »Höchste Zeit, ein bisschen frische Luft zu schnappen, nicht wahr?«
»Kann jedenfalls nicht schaden«, stimmte ich zu und versuchte, nicht zu eifrig zu klingen. »Frische Luft, etwas zu essen …«
»Immer langsam«, sagte sie. Diesmal schenkte sie mir ein echtes Grinsen; ich war so froh, dass es ihre Augen erreichte, die mich aus ein paar Zentimeter Entfernung anfunkelten.
Ihr erstes richtiges Lächeln seit über fünf Tagen, so wunderschön wie eh und je.
Ich erwiderte es und zuckte mit den Schultern.
»Du weißt, dass ich Recht habe«, antwortete ich sanft. Ich fuhr mit dem Daumen über ihren Hüftknochen, der mehr als sonst vorzustehen schien. Sie war ziemlich abgemagert, und das machte mir Sorgen.
»Ich weiß«, stimmte sie leise zu. »Wie wär’s, wenn wir beide etwas essen und dann Dax besuchen würden?«
Was für eine Erleichterung! Das war ein Riesenschritt für sie, und ich freute mich, dass sie sich stark genug fühlte, um ihn zu wagen. Ich war seit unserer Rückkehr nur von ihrer Seite gewichen, um für ein paar Minuten nach Dax zu sehen. Alles andere konnte warten.
»Klingt toll.«
Sie lächelte mir wieder kurz zu, dann nickte sie entschlossen. Ich drückte sie noch einmal.
Nachdem wir angezogen waren, machten wir uns auf den Weg zum Speisesaal. Drinnen angekommen, wandten sämtliche Anwesenden die Köpfe. Die Situation erinnerte an den Tag ihrer Ankunft. Auch damals hatte sie jeder angestarrt, wohin wir auch gingen. Doch heute las ich in den Blicken der Menschen nicht Groll und Misstrauen, sondern Bewunderung und Ehrfurcht. Wieder erfasste mich eine Woge des Stolzes.
Grace sah sich um und bemerkte natürlich, dass sie angestarrt wurde. Die Aufmerksamkeit war ihr offensichtlich peinlich, also ergriff ich ihre Hand, um sie so schnell wie möglich zu Maisies Essensausgabe hinüberzuziehen.
»Komm«, raunte ich ihr leise zu.
Sie gehorchte und folgte mir willig. Anscheinend ging den Kantinenbesuchern jetzt erst auf, dass sie uns unwillkürlich angestarrt hatten, denn sie senkten allesamt den Blick und widmeten sich wieder ihren vorherigen Aktivitäten. Erneut erhob sich das gewohnte leise Schwatzen im Raum. Maisie, die dabei war, sich langsam von ihrer eigenen Trauer zu erholen, empfing uns mit herzlichem Lächeln auf den Lippen.
»Hayden«, begrüßte sie mich mit einem Kopfnicken, bevor sie sich an Grace wandte. Ich erwiderte das Nicken.
»Grace«, fuhr sie mit Wärme fort. »Ich habe gehört, was du tun musstest. Und ich weiß, du hattest jede Menge Gründe dafür, von denen Jett nur einer war, aber … danke für alles. Dein Opfer bedeutet mir viel.«
Graces Augen schimmerten feucht, aber sie blinzelte die Tränen fort. Ich war hin- und hergerissen zwischen Dankbarkeit für Maisies freundliche Worte und Ärger darüber, dass sie die Ereignisse so schnell schon angesprochen hatte. Immerhin hatte Grace es gerade erst geschafft, unsere Hütte zu verlassen.
Grace räusperte sich und nickte kurz. »Natürlich.«
Mehr brachte sie nicht über die Lippen, aber Maisie verstand. Sie lächelte nochmals herzlich, dann reichte sie erst ihr, dann mir einen Teller. Meine Portion erwies sich als erheblich kleiner als ihre. Offenbar war ich nicht der Einzige, der bemerkt hatte, wie sehr sie abgenommen hatte. Ich murmelte ein leises »Dankeschön«, dann führte ich Grace zu einem Tisch, wo wir gegenüber voneinander Platz nahmen.
Grace ergriff ihre Gabel und stocherte in ihrem Essen herum, schob es langsam auf dem Teller hin und her. Sie sah nach unten, und es verging eine Weile, bis sie bemerkte, dass ich sie beobachtete. Sie warf mir einen schuldbewussten Blick und ein verlegenes Lächeln zu, bevor sie sich einen Bissen in den Mund schob, als könne sie Gedanken lesen. Ich grinste befriedigt, als sie noch eine Gabel voll aß, und machte mich dann über meine eigene Mahlzeit her.
Eine Weile saßen wir so in einträchtigem Schweigen beieinander. Nachdem sie ein Drittel ihrer Portion verputzt hatte, stellte sie mir eine Frage.
»Wieso wissen alle Bescheid?«, fragte sie mit gedämpfter Stimme und sah sich kurz um. »Anscheinend sind alle eingeweiht …«
»Kit hat es bei unserer Rückkehr verkündet«, antwortete ich. »Und Docc hat ein paar Leute von unserem Vorhaben in Kenntnis gesetzt, als wir abfuhren. Gerüchte verbreiten sich hier schnell, insbesondere etwas Derartiges …«
Ich zuckte mit den Schultern. Ihre Miene war unergründlich.
»Ist es denn in Ordnung für dich, wenn alle es wissen?«, fragte ich.
»Ich glaube schon«, antwortete sie. »Ich weiß es nicht genau. Denken sie denn jetzt nicht alle schlecht von mir? Halten mich für irgend so ein … keine Ahnung … herzloses Monster oder so?«
»Grace, nein«, rief ich sofort und schüttelte den Kopf. Ich hatte mir schon so etwas gedacht. Vielleicht bis du ihm ähnlicher, als ich dachte, hatte Shaw damals gesagt. Insbesondere nach dieser Bemerkung mochte sie sich fragen, wie alle anderen ihr Verhalten bewerteten. »Ich verspreche dir, dass niemand so denkt. Sie wissen, wie schwer es für dich war, und respektieren dich dafür. Außerdem wissen sie, dass deine Tat wahrscheinlich vielen Menschen das Leben gerettet hat. Eins kannst du mir glauben: Ihnen ist bewusst, was du getan hast und was es bedeutet.«
Sie schniefte einmal kurz und nickte. Dann schob sie wieder das Essen auf dem Teller hin und her, ohne noch etwas davon anzurühren.
»Vertraust du mir denn nicht?«, hakte ich nach und senkte den Kopf, damit sie mir in die Augen sehen musste. Sie warf mir einen kurzen Blick zu.
»Natürlich«, antwortete sie automatisch.
»Und glaubst du meinen Worten denn auch?«, fragte ich sanft und zog eine Augenbraue hoch. Sie schwieg eine Weile und musterte mich eindringlich.
»Ja«, versicherte sie schließlich.
»Gut«, sagte ich nur. »Isst du jetzt bitte weiter?«
»Okay, okay.« Sie grinste schwach. Dann gehorchte sie und führte erneut die Gabel zum Mund.
Ich hatte meine Mahlzeit inzwischen beendet und wartete geduldig darauf, dass Grace ebenfalls fertig wurde, wobei ich sie zärtlich beobachtete. Hin und wieder lenkte irgendetwas sie ab, dann stieß ich ihre Hand an und blickte bedeutungsvoll auf den Teller hinab. Dann grinste sie wieder schuldbewusst und aß weiter. So ging es eine ganze Weile, aber mehr als etwas über die Hälfte ihrer Portion brachte sie nicht runter. Sie schob den Teller fort.
»Ich kann nicht mehr«, sagte sie, schüttelte den Kopf und lehnte sich zurück. »Ich bin voll.«
»Wirklich?«, fragte ich skeptisch und sah sie mit hochgezogener Augenbraue an.
»Ja, versprochen«, versicherte sie ernsthaft. »Pappsatt.«
Ich seufzte leise und nickte. Sie hielt mir ihre Gabel hin, damit ich ihre Reste vertilgte. Nur ungern gestand ich mir ein, dass ich immer noch Hunger hatte, und angesichts unserer schwindenden Vorräte wollte ich auf keinen Fall Essen wegwerfen. Also verschlang ich ihre Portion mit ein paar großen Bissen. Sie lächelte zufrieden. Dann standen wir auf, um unsere Teller zurückzubringen.
»Sollen wir jetzt Dax besuchen?«, fragte sie. Ihre Stimme klang leichter als seit Tagen, und ich musste unwillkürlich lächeln.
»Machen wir.«
Wir winkten Maisie zum Abschied zu, und wieder waren aller Augen auf uns gerichtet. Grace bemühte sich, sie zu ignorieren, und schon waren wir draußen und auf dem Weg zur Krankenstation. Es war ein bewölkter, schwüler Tag, und schnell fühlte meine Haut sich unangenehm klebrig an. Ein sanfter Wind fuhr durch das Camp und wehte mir das Haar aus dem Nacken, bot eine gewisse Erleichterung.
Nach wenigen Minuten waren wir an der Krankenstation angelangt.
Sie wurde sofort wieder ernst, als sie das dunkle Gebäude betrat. Drinnen war es ebenfalls schwül, aber immerhin etwas weniger drückend als draußen.
Ich sah Kit, Leutie und Malin, die sich um das Bett scharten, das mutmaßlich Dax gehörte. Docc saß, wie ich bemerkte, an seinem Schreibtisch auf der anderen Seite des Zimmers, wohin Shaws Bett geschoben worden war, um Dax ein wenig Platz zu machen. Shaw schien zu schlafen und sah immer noch ziemlich ramponiert aus, nachdem ich ihn so zugerichtet hatte.
Als Dax’ Besucher uns bemerkten, ließen sie uns sogleich ans Bett. Dax saß aufrecht da, die linke Hand verhüllt von einer sauberen weißen Bandage, den rechten Knöchel in einem dicken Stützverband. Ein paar Platzwunden und Hämatome bedeckten seine Haut, aber er war wach und dem breiten Grinsen auf seinem Gesicht zufolge ausgesprochen munter.
»Ach, kommst du mich auch mal besuchen?«, sagte er gut gelaunt und grinste Grace an. Ich selbst war jetzt zum dritten Mal seit unserer Rückkehr bei ihm, Grace aber war noch nie da gewesen.
»Ich hatte viel um die Ohren«, antwortete sie mit leichtem Lächeln und einem Kopfschütteln. »Wie ich sehe, geht es dir schon besser.«
»Ja, ich werde es überleben«, sagte er mit sorglosem Achselzucken. »Docc hat mich ganz gut wieder zusammengeflickt.«
»Was ist denn überhaupt passiert?«, fragte sie neugierig.
»Die verdammten Brutes haben versucht, mir die Hand abzuhacken. Wollten sie wahrscheinlich ihrer Sammlung hinzufügen. Irgend so ein Riesenkerl hielt mich am Boden, aber ich konnte ihn abschütteln – nicht schnell genug, um dem Messer zu entgehen, aber genug, um zumindest den Großteil meiner Hand zu behalten. Die sind echt krass gestört, sag ich dir.«
»Mein Gott«, murmelte ich und sah zu Grace hinüber. Sie schluckte schwer. Sie litt jetzt schon unter Alpträumen über diesen Ort, und ich hoffte, Dax’ Schilderung würde es nicht noch verschlimmern.
»Hab mir dabei das Bein verstaucht, aber Docc meint, dass es sicher bald wieder okay ist«, schloss Dax mit einem Achselzucken.
»Es geht dir also gut?«, fragte Grace vorsichtig optimistisch.
»Oh, ja, so leicht kriegst du mich nicht los«, antwortete Dax mit breitem Grinsen.
Alle lachten. Erst da bemerkte ich, dass Leutie dicht an seinem Bett stand und die Hand auf die Matratze gelegt hatte. Kit und Malin befanden sich – Schulter an Schulter – auf der gegenüberliegenden Seite. Malin kam mir ernster vor als sonst, was mich daran erinnerte, dass sie in der gleichen Nacht, in der Jett gestorben war, auch ihren Vater verloren hatte.
»Das freut mich«, sagte Grace mit verhaltenem Grinsen. Ich griff instinktiv nach ihrer Hand und drückte sie sanft. Sie sah mich an und warf mir ein winziges, etwas trauriges Lächeln zu.
»Wie geht es dir?« fragte Leutie nun. Grace seufzte tief und zuckte unverbindlich mit den Schultern.
»Ganz gut, glaube ich«, antwortete sie aufrichtig. Aller Augen ruhten auf ihr.
»Willst du reden?«, fragte Leutie sanft.
»Ach, na ja.« Grace blinzelte, als hätte sie noch nicht darüber nachgedacht. »Nein, schon gut …«
»Das solltest du aber«, riet ich ihr liebevoll. »Vielleicht brauchst du noch jemand anderen als mich.«
Sie sah mich an und runzelte die Stirn. Sosehr ich mir wünschte, derjenige zu sein, der ihr über all das hinweghalf, so nützlich konnte es sein, wenn sie mit jemandem darüber sprach, der ihren Bruder ein Leben lang gekannt hatte. Wenn sie diese Geschichte dadurch schneller verarbeitete, wollte ich gern zurücktreten und darauf verzichten, der Einzige für sie zu sein, wie ich es mir selbstsüchtigerweise eigentlich wünschte.
»Wirklich«, versicherte ich und nickte bekräftigend.
»Na gut«, antwortete sie langsam, als sei sie nicht sicher, dass ich es ernst meinte.
Ich drückte ihr nochmals die Hand und gab ihr einen Wangenkuss. »Dann los.«
»Ach, wie süß«, meinte Dax sarkastisch.
»Sei du mal ganz still«, sagte ich schnell und deutete auf ihn.
Dax öffnete den Mund und klappte ihn wieder zu. Ein verschlagenes Grinsen huschte über sein Gesicht. »Na gut, hast Recht.«
»Bereit, Grace?«, fragte Leutie ruhig.
»Hmm-mhmm«, erwiderte sie und nickte.
»Ich komme später noch mal vorbei«, raunte Leutie Dax zu. Er nickte und schenkte ihr ein so herzliches Lächeln, wie ich es schon seit langem nicht mehr bei ihm gesehen hatte.
»Bis bald also«, murmelte Grace mir zu. Dann drückte sie ein letztes Mal meine Hand und löste sich von mir. Ich nickte.
Grace und Leutie wollten gerade gehen, als Malin sie aufhielt.
»Habt ihr, äh, habt ihr was dagegen, wenn ich mitkomme? Ich will euch nicht stören, aber es wäre schön … na ja, einfach nur zu reden, wisst ihr?«
Sofort huschten meine Augen zu Kit hinüber, der ein wenig verwirrt und schuldbewusst wirkte. Malin mied seinen Blick, sondern sah Grace und Leutie nur bittend an.
»Klar, natürlich kannst du mitkommen«, antwortete Grace freundlich. Auch sie wirkte irritiert, hatte sich aber schon bald wieder gefangen. Mir wurde ein wenig mulmig zumute bei der Vorstellung, dass die beiden miteinander reden würden, aber ich schüttelte das Gefühl ab.
»Frauengespräche, cool«, witzelte Dax, was ihm ein nervöses Glucksen von Kit einbrachte. Anscheinend hatte er ebenfalls Bedenken.
»Ja, toll«, meinte Kit sarkastisch und schmunzelte.
Ich lachte leise und zog einen Stuhl heran, um mich neben Dax zu setzen.
»Nun, nun, da die Frauen weg sind …« Ich sprach nicht weiter, sondern grinste. »Schauen wir uns doch mal an, was von deiner Hand übrig ist.«
»Du willst den blutigen Stumpf sehen?«, erkundigte sich Dax stolz. »Ist ziemlich schaurig. Ich warne dich.«
Ich gluckste. »Ich werd’s überleben.«
Dax warf mir einen skeptischen Blick zu und begann, den Verband abzuwickeln. Ich versuchte, das unbehagliche Gefühl in der Magengrube zu ignorieren. Ich wollte, dass es Grace bald wieder besser ging. Wenn das hier also helfen konnte, umso besser. Sie brauchte außer mir unbedingt auch noch andere Menschen, auf die sie sich stützen konnte. Immerhin konnte mir jederzeit etwas zustoßen. Ich freute mich für sie, dass sie sich so langsam ihren eigenen Kreis aufzubauen schien.
Grace
Es fühlte sich seltsam an, von Hayden getrennt zu sein, nachdem ich so viel Zeit mit ihm allein verbracht hatte. Es wäre gelogen gewesen, zu behaupten, dass ich nicht etwas nervös war. Ich fühlte mich so schwach und anfällig, als hätte mich das, was ich getan hatte, mitten entzweigebrochen, und ich befürchtete, ohne ihn und seine ständigen beruhigenden Worte vollkommen zu zerfallen. Andererseits wäre es natürlich unpraktisch gewesen, zu jeder Tages- und Nachtzeit nur mit ihm zusammen zu sein, und mir war klar, dass ich den Heilungsprozess selbst einleiten musste.
Leutie, Malin und ich machten uns auf den Weg zur äußeren Campgrenze, liefen ohne bestimmtes Ziel, bis wir auf zwei Bänke stießen. Auf der einen Seite standen Bäume daneben, auf der anderen befanden sich Hütten. Ich setzte mich auf eine der Bänke und überließ Leutie und Malin die andere. Wie ungewohnt es war, nur mit Frauen zusammen zu sein, da ich sonst meist nur von Männern umgeben war.
»Also«, sagte ich etwas verlegen. Malin machte sich am Saum ihrer Shorts zu schaffen und sah zu Boden, während Leutie mir ein sanftes Lächeln zuwarf.
»Wie geht es dir?«, fragte sie mitfühlend.
»Gut«, antwortete ich, ohne lange nachzudenken.
Sie sah mich zweifelnd an. »Wirklich?«
Ich seufzte. »Nein, nicht wirklich. Aber immerhin besser.«
»Wahrscheinlich hat Hayden dir das bereits gesagt, aber … du hast das Richtige getan«, versicherte Leutie mir mit aufrichtigem Blick. »Ich habe immerhin bis vor kurzem in Greystone gelebt, insofern kann ich es beurteilen. Es war das einzig Richtige.«