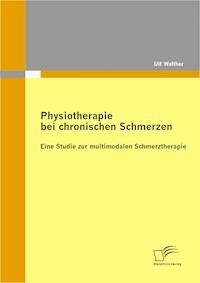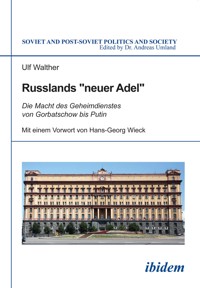
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Bildung
- Serie: Soviet and Post-Soviet Politics and Society
- Sprache: Deutsch
Im Zuge des Zusammenbruchs des kommunistischen Herrschaftssystems und des damit verbundenen Auflösungsprozesses der UdSSR wurde nach dem Putsch im August 1991 auch die Abwicklung des sowjetischen Geheimdienstes KGB beschlossen. Zwar erfolgte eine Entflechtung der alten Strukturen des Staatssicherheitsapparats, nicht aber die Abschaffung des Geheimdienstwesens an sich. Vielmehr wurden Maßnahmen zu seiner Reorganisation eingeleitet. Damit ergab sich die Problematik der Kontinuität alter KGB-Strukturen sowie tschekistischer Denkmuster, Normen und Verhaltensweisen in den russischen Sicherheitsorganen, insbesondere im Nachfolgedienst FSB, die sich später als schwerwiegende Hypothek für den postsowjetischen Transformationsprozess erweisen sollte. Nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in deren Rechtsnachfolger Russland gab und gibt es Hinweise auf verschiedenste Formen der Durchdringung von und der Einflussnahme auf Politik und Gesellschaft durch die Staatssicherheitsorgane. Daraus lassen sich wiederum Rückschlüsse auf die Kontrolle und damit auf die Autonomie der Geheimdienste ziehen. Ulf Walther fasst in seinem vorliegenden Buch die Ergebnisse seiner mehrjährigen intensiven Forschungsarbeiten sowie von Recherchen und Interviews vor Ort zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach dem Macht- und Gestaltungspotenzial der Intelligence Community seit dem Machtantritt Gorbatschows bis in die Gegenwart hinein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 808
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
1. Einleitung
2. Geheimdienst und politisches Regime
2.1. Begriffsdefinitionen
2.2. Die Organisation von Geheimdiensten
2.3. Die Durchdringung von Staat und Gesellschaft: der geheimdienstliche Aufklärungsprozess
2.4. Der Geheimdienst im Spannungsfeld von Effizienz und Legitimität
2.5. Geheimdienstliche Autonomie und das Konzept von Kontrolle und Aufsicht
3. Die Entwicklung des KGB/FSB von Gorbatschow bis Putin
3.1. Die Tradition des Tschekismus
3.2. Das KGB im sowjetischen Machtgefüge
3.3. Gorbatschows Reformpolitik und die Positionierung des KGB
3.4. Der Augustputsch 1991 und die Konsequenzen für das KGB
3.5. Die KGB-Nachfolgerorgane in Russland
4. Die Durchdringung der staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen
4.1. Aktivitäten gegen die Gesellschaft und ihre Organisationsformen
4.1.1. Repression von Einzelpersonen und Personengruppen
4.1.2. Restriktionen gegen Organisationen
4.1.3. Sprengstoffanschläge
4.1.4. Außergerichtliche Tötungen
4.2. Der Geheimdienst und die öffentliche Meinung
4.2.1. Restriktionen gegen die Medien
4.2.2. Methoden und Inhalte der Öffentlichkeitsarbeit des Geheimdienstes
4.3. Interferenzen der Justiz durch den Geheimdienst
4.4. „Ehemalige“ Geheimdienstkader in politischen Ämtern und Führungspositionen
4.4.1. Präsident, Ministerpräsident und nachgeordnete Exekutivorgane
4.4.2. Legislative und andere, der Exekutive nicht zugehörige Staatsorgane
4.5. Die Mitwirkung des Geheimdienstes an der Gesetzgebung
4.6. Der Geheimdienst als administrative Ressource vor und während der Wahlen
4.7. Informelle Machtstrukturen im Umfeld des Präsidenten
5. Die geheimdienstliche Autonomie: Ausgestaltung des Kontroll- und Aufsichtssystems
5.1. Rechtliche Grundlagen für die Geheimdienste und ihre Kontrolle
5.2. Die UdSSR
5.2.1. Der Übergang von der Parteiherrschaft zum Präsidialsystem
5.2.2. Der Oberste Sowjet im Machtgefüge der UdSSR
5.3. Die Untersuchungskommissionen des Augustputsches 1991
5.4. Die Russländische Föderation
5.4.1. Die Kontrolle des Geheimdienstes im Superpräsidentialismus
5.4.2. Der Bedeutungsverlust des Parlaments
5.5. Geheimdienstintern
5.6. (General-)Prokuratura und Geheimdienst
5.7. Die (Verfassungs-)Gerichtsbarkeit
5.8. Ansätze einer gesellschaftlichen Kontrolle
5.9. Die mediale Öffentlichkeit
6. Fazit
7. Die jüngsten Entwicklungen in Russland: Der ewige Putin?
Anhang
Quellen- und Literaturverzeichnis
Monografien
Sammelbände
Fachzeitschriften
Zeitungsartikel
Internetquellen
Interviews
Sonstige Quellen
Soviet and Post-Soviet Politics and Society (SPPS) Vol. 124
ISSN1614-3515
General Editor:Andreas Umland,Kyiv-Mohyla Academy,[email protected]
Commissioning Editor:Max Jakob Horstmann,London,[email protected]
Editorial COMMITTEE*
DOMESTIC & COMPARATIVE POLITICS
Prof.Ellen Bos,Andrássy University of Budapest
Dr.Ingmar Bredies,FH Bund, Brühl
Dr.Andrey Kazantsev,MGIMO (U) MID RF, Moscow
Dr.Heiko Pleines, University of Bremen
Prof.Richard Sakwa,University of Kent at Canterbury
Dr.Sarah Whitmore,Oxford Brookes University
Dr.Harald Wydra,University of Cambridge
SOCIETY, CLASS & ETHNICITY
Col.David Glantz,“Journal of Slavic Military Studies”
Dr.Marlène Laruelle,George Washington University
Dr.Stephen Shulman,Southern Illinois University
Prof.Stefan Troebst,University of Leipzig
POLITICAL ECONOMY & PUBLIC POLICY
Prof. em.Marshall Goldman,Wellesley College, Mass.
Dr.Andreas Goldthau,CentralEuropeanUniversity
Dr.Robert Kravchuk,University of North Carolina
Dr.David Lane,University of Cambridge
Dr.Carol Leonard, University of Oxford
Dr.Maria Popova,McGillUniversity, Montreal
FOREIGN POLICY & INTERNATIONAL AFFAIRS
Dr.Peter Duncan,University College London
Dr.Taras Kuzio,JohnsHopkinsUniversity
Prof.Gerhard Mangott,University of Innsbruck
Dr.Diana Schmidt-Pfister,University of Konstanz
Dr.Lisbeth Tarlow,Harvard University, Cambridge
Dr.Christian Wipperfürth,N-Ost Network, Berlin
Dr.William Zimmerman,University of Michigan
HISTORY, CULTURE & THOUGHT
Dr.Catherine Andreyev,University of Oxford
Prof.Mark Bassin,Södertörn University
Prof.Karsten Brüggemann,Tallinn University
Dr.Alexander Etkind,University of Cambridge
Dr.Gasan Gusejnov,Moscow State University
Prof. em.Walter Laqueur,Georgetown University
Prof.Leonid Luks,Catholic University of Eichstaett
Dr.Olga Malinova,Russian Academy of Sciences
Prof.Andrei Rogatchevski,University of Tromsø
Dr.Mark Tauger,West Virginia University
Dr.Stefan Wiederkehr,BBAW, Berlin
Advisory Board*
Prof.Dominique Arel,UniversityofOttawa
Prof.Jörg Baberowski,HumboldtUniversityofBerlin
Prof.Margarita Balmaceda,Seton Hall University
Dr.John Barber,UniversityofCambridge
Prof.Timm Beichelt,EuropeanUniversityViadrina
Dr.Katrin Boeckh,UniversityofMunich
Prof. em.Archie Brown,University of Oxford
Dr.Vyacheslav Bryukhovetsky,Kyiv-MohylaAcademy
Prof.Timothy Colton,Harvard University, Cambridge
Prof.Paul D’Anieri,University of Florida
Dr.Heike Dörrenbächer,DGO, Berlin
Dr.John Dunlop,HooverInstitution,Stanford,California
Dr.Sabine Fischer,SWP, Berlin
Dr.Geir Flikke,NUPI, Oslo
Prof.David Galbreath,University of Aberdeen
Prof.Alexander Galkin,Russian Academy of Sciences
Prof.Frank Golczewski,University of Hamburg
Dr.Nikolas Gvosdev,NavalWarCollege,Newport,RI
Prof.Mark von Hagen,Arizona State University
Dr.Guido Hausmann,University of Freiburg i.Br.
Prof.Dale Herspring,Kansas State University
Dr.Stefani Hoffman,Hebrew University of Jerusalem
Prof.Mikhail Ilyin,MGIMO (U) MID RF, Moscow
Prof.Vladimir Kantor,Higher School of Economics
Dr.Ivan Katchanovski,University of Ottawa
Prof. em.Andrzej Korbonski,University of California
Dr.Iris Kempe, “Caucasus Analytical Digest”
Prof.Herbert Küpper,Institut für Ostrecht Regensburg
Dr.Rainer Lindner,CEEER, Berlin
Dr.Vladimir Malakhov,Russian Academy of Sciences
Dr.Luke March,University of Edinburgh
Prof.Michael McFaul, US Embassy at Moscow
Prof.Birgit Menzel,University of Mainz-Germersheim
Prof.Valery Mikhailenko,The Urals State University
Prof.Emil Pain,Higher School of Economics, Moscow
Dr.Oleg Podvintsev,Russian Academy of Sciences
Prof.Olga Popova,St. PetersburgStateUniversity
Dr.Alex Pravda,UniversityofOxford
Dr.Erik van Ree,UniversityofAmsterdam
Dr.Joachim Rogall,Robert Bosch FoundationStuttgart
Prof.Peter Rutland,Wesleyan University, Middletown
Prof.Marat Salikov,The Urals State Law Academy
Dr.Gwendolyn Sasse,UniversityofOxford
Prof.Jutta Scherrer,EHESS, Paris
Prof.Robert Service,UniversityofOxford
Mr.James Sherr,RIIAChathamHouseLondon
Dr.Oxana Shevel,TuftsUniversity,Medford
Prof.Eberhard Schneider,University of Siegen
Prof.Olexander Shnyrkov,ShevchenkoUniversity, Kyiv
Prof.Hans-Henning Schröder,SWP,Berlin
Prof.Yuri Shapoval,Ukrainian Academy of Sciences
Prof.Viktor Shnirelman,RussianAcademy of Sciences
Dr.Lisa Sundstrom, University of British Columbia
Dr.Philip Walters,“Religion, State and Society”, OxfordProf.Zenon Wasyliw,Ithaca College, New York State
Dr.Lucan Way,University of Toronto
Dr.Markus Wehner,“Frankfurter Allgemeine Zeitung”
Dr.Andrew Wilson,University College London
Prof.Jan Zielonka,University of Oxford
Prof.Andrei Zorin,University of Oxford
*While the Editorial Committee and Advisory Board support the General Editor in the choice and improvement of manuscripts for publication, responsibility for remaining errors and misinterpretations in the series’ volumes lies with the books’ authors.
Soviet and Post-Soviet Politics and Society (SPPS)
ISSN1614-3515
Founded in 2004 and refereed since 2007, SPPSmakes available affordable English-, German-, and Russian-language studies on the history of the countries of the former Soviet bloc from the late Tsarist period to today.It publishes between 5 and 20 volumes per yearand focuses on issues in transitions to and from democracysuch as economic crisis, identity formation, civil society development, and constitutional reform in CEE and the NIS. SPPS also aims tohighlight so far understudied themes in East European studies such as right-wing radicalism, religious life, higher education, or human rights protection.The authors and titles of all previously published volumes are listed at the end of this book. For a full description of the series and reviews of its books, see
www.ibidem-verlag.de/red/spps.
Editorial correspondence & manuscriptsshould be sent to: Dr. Andreas Umland, DAAD, German Embassy, vul. Bohdana Khmelnitskoho 25, UA-01901Kyiv,Ukraine. e-mail:[email protected]
Business correspondence & review copy requestsshould be sent to:ibidemPress, Leuschnerstr. 40,30457 Hannover, Germany; tel.: +49 511 2622200; fax: +49 511 2622201;[email protected].
Authors, reviewers, referees, and editorsfor (as well as all other persons sympathetic to) SPPS are invited to join its networks atwww.facebook.com/group.php?gid=52638198614
www.linkedin.com/groups?about=&gid=103012www.xing.com/net/spps-ibidem-verlag/
Recent Volumes
116Valerio Trabandt
Neue Nachbarn, gute Nachbarschaft?
Die EU als internationaler Akteur am Beispiel ihrerDemokratieförderung in Belarus und der Ukraine 2004-2009
Mit einem Vorwort von Jutta Joachim
ISBN978-3-8382-0437-6
117Fabian Pfeiffer
Estlands Außen- und Sicherheitspolitik I
Der estnische Atlantizismus nach der wiedererlangten Unabhängigkeit 1991-2004
Mit einem Vorwort von Helmut Hubel
ISBN 978-3-8382-0127-6
118Jana Podßuweit
Estlands Außen- und Sicherheitspolitik II
Handlungsoptionen eines Kleinstaates im Rahmen seiner EU-Mitgliedschaft (2004-2008)
Mit einem Vorwort von Helmut Hubel
ISBN 978-3-8382-0440-6
119Karin Pointner
Estlands Außen- und Sicherheitspolitik III
Eine gedächtnispolitische Analyse estnischer Entwicklungskooperation 2006-2010
Mit einem Vorwort von Karin Liebhart
ISBN 978-3-8382-0435-2
120Ruslana Vovk
Die Offenheit der ukrainischen Verfassungfür das Völkerrecht und die europäische Integration
Mit einem Vorwort von Alexander Blankenagel
ISBN 978-3-8382-0481-9
121Mykhaylo Banakh
Die Relevanz der Zivilgesellschaft bei den postkommunistischen Transformationsprozessen in mittel- und osteuropäischen Ländern
Das Beispiel der spät- und postsowjetischen Ukraine 1986-2009
Mit einem Vorwort von Gerhard Simon
ISBN 978-3-8382-0499-4
122 Michael Moser
Language Policy and the Discourse on Languages in Ukraine under President Viktor Yanukovych (25 February 2010–28 October 2012)
ISBN 978-3-8382-0497-0 (Paperback edition)
ISBN 978-3-8382-0507-6 (Hardcover edition)
123 Nicole Krome
Russischer Netzwerkkapitalismus
Restrukturierungsprozesse in der Russischen Föderation am Beispiel des Luftfahrtunternehmens "Aviastar"
Mit einem Vorwort von Petra Stykow
ISBN 978-3-8382-0534-2
Russlands „neuer Adel“
Die Macht des Geheimdienstes
ibidem-Verlag
Stuttgart
Abkürzungsverzeichnis
ABOPAkademija problem besopasnosti, oborony i prawoporjadka (Akademie für die Probleme der Sicherheit, Verteidigung und Rechtsstaatlichkeit)
AFBAgentstwo federalnoj besopasnosti (Agentur für Föderale Sicherheit)
ANBOPAkademija nazionalnoj besopasnosti, oborony i prawoporjadka (Akademie für nationale Sicherheit, Verteidigung und Rechtsstaatlichkeit)
ANRIAllianz unabhängiger russischer Verlage
APSApparat prikomandirowannych sotrudnikow(Apparat zugeteilter Offiziere)
ASRCAgentura.Ru Studies and Research Centre
ATZAntiterroristitscheskij zentr (Antiterroristisches Zentrum)
BfVBundesamt für Verfassungsschutz
BNDBundesnachrichtendienst
BRDBundesrepublik Deutschland
BSTMBjuro spezialnych technitscheskich meroprijatij (Büro für besondere technische Maßnahmen)
CIACentral Intelligence Agency
CPJCommittee to Protect Journalists
ČSFRTschechoslowakische Föderative Republik
DDRDeutsche Demokratische Republik
DOIDepartment operatiwnoj informazii(Abteilung für Operative Informationen)
DRDejstwujuschtschego reserwa (Funktionsreserve)
EGMREuropäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EuGHEuropäischer Gerichtshof
FAPSIFederalnoje agentstwo prawitelstwennoj swjasi i informazii(Föderale Agentur für Regierungsfernmeldewesen und Information)
FBIFederal Bureau of Investigation
FPSFederalnaja pogranitschnaja sluschba (Föderaler Grenzdienst)
FSBFederalnaja sluschba besopasnosti (Föderaler Sicherheitsdienst)
FSKFederalnaja sluschba kontrraswedki (Föderaler Dienst für Spionageabwehr)
FSKNFederalnaja sluschba po kontrolju sa oborotom narkotikow(Föderaler Dienst zur Kontrolle des Drogenhandels)
FSNPFederalnaja sluschba nalogowoj polizii (Föderaler Dienst der Steuerpolizei)
FSOFederalnaja sluschba ochrany (Föderaler Schutzdienst)
FSRFederalnaja sluschba rassledowanij (Föderaler Untersuchungsdienst)
G-8Gremium der größten Industrienationen der Welt
GAS WyboryGosudarstwennaja awtomatisirowannaja sistema RF „Wybory“ (Staatliches Automatisiertes System RF „Wybory“)
GDGeheimdienst
GFSGosudarstwennaja feld-jegerskaja sluschba (Staatlicher Kurierdienst)
GKTschPGosudarstwennyj komitet po tschreswytschajnomu poloscheniju (Staatliches Komitee für den Ausnahmezustand)
GlawlitGlawnoje uprawlenije po ochranjegosudarstwennych tajn w petschati (Hauptverwaltung zum Schutz von Staatsgeheimnissen in der Presse)
GOGeschäftsordnung
GPSGlobal Positioning System
GPUGosudarstwenno-prawowoje uprawlenije (Verwaltung Staat und Recht)
GRUGlawnoje raswedywatelnoje uprawlenije (Hauptverwaltung für Aufklärung, Militärgeheimdienst der RF)
GUBSGlawnoje uprawlenije besopasnosti swjasi (Informationsgewinnung)
GULagGlawnoje uprawlenijelagerej (Hauptverwaltung Lager)
GUOGlawnoje uprawlenije ochrany (Hauptschutzdirektorat)
GURRSSGlawnoje uprawlenije radioėlektronnoj raswedki sredstw swjasi (Informationsgewinnung)
GUSGemeinschaft Unabhängiger Staaten (Sodruschestwo Nesawisimych Gosudarstw, SNG)
GUSBGlawnoje uprawlenije sobstwennoj besopasnosti (Hauptverwaltung Eigene Sicherheit)
GUSPGlawnoje uprawlenije spezialnych programm Presidenta RF (Hauptverwaltung für Spezialprogramme des Präsidenten der RF)
HUMINTHuman Intelligence (Erkenntnisgewinnung aus menschlichen Quellen)
HVHauptverwaltung
HVAHauptverwaltung Aufklärung
KGBKomitet gosudarstwennoj besopasnosti (Komitee für Staatssicherheit)
KOGGKomitetpo ochrana gosudarstwennoj granizy (Komitee für den Schutz der Staatsgrenze)
KPKommunistische Partei
KPdSUKommunistische Partei der Sowjetunion (Kommunistitscheskaja partija Sowjetskogo Sojusa, KPSS)
KPRFKommunistitscheskaja partija Rossijskoj Federazii (Kommunistische Partei der RF)
KPSKomitet prawitelstwennoj swjasi (Komitee für Regierungsnachrichtenwesen)
KSZEKonferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
LDPRLiberalno-demokratitscheskaja partija Rossii (Liberaldemokratische Partei Russlands)
MBRFMinisterstwo besopasnosti Rossijskoj Federazii (Sicherheitsministerium der RF)
MBWDMinisterstwo besopasnosti i wnutrennich del (Sicherheits- und Innenministerium)
MGBMinisterstwo gosudarstwennoj besopasnosti (Ministerium für Staatssicherheit)
MIDMinisterstwo inostrannych del (Außenministerium)
MKTAMeschdunarodnaja kontrterroristitscheskaja treningowaja assoziazija (Internationale Vereinigung für Antiterror-Training)
MO RFMinisterstwo oborony RF (Verteidigungsministerium)
MSBMeschrespublikanskaja sluschba besopasnosti (Interrepublikanischer Sicherheitsdienst)
MTschSMinisterstwo Rossijskoj Federazii po delam graschdanskoj oborony, tschreswytschajnnym situazijam i likwidazii posledstwij stichijnych bedstwij (Ministerium für Angelegenheiten der Zivilverteidigung, Ausnahmezustände und der Beseitigung der Folgen von Naturkatastrophen)
MURMoskowskijugolownyj rosysk (Moskauer Kriminalpolizei)
MWDMinisterstwo wnutrennich del (Innenministerium)
NASANational Aeronautics and Space Administration
NATONorth-Atlantic Treaty Organization
NBPNazional-bolschewistskaja partija (Nationalbolschewistische Partei)
NDNachrichtendienst
NGONichtregierungsorganisation
NIIARNautschno-issledowatelskij institut atomnych reaktorow(Atomforschungszentrum)
NKWDNarodnyj komissariat wnutrennich del (Volkskommissariat für innere Angelegenheiten)
NPANesawisimaja psichiatritscheskaja assoziazija (Unabhängige Psychiatrische Vereinigung)
NPRFNarodnaja partija Rossijskoj Federazii (Volkspartei der RF)
NRANowaja rewoljuzionnaja alternatiwa (Neue Revolutionäre Alternative)
NSUNationalsozialistischer Untergrund
NTVRussischer TV-Sender
OGFObedinennyj graschdanskij front (Vereinigte Bürgerfront)
OGPUObedinennoje gosudarstwennoje polititscheskoje uprawlenije (Vereinigte staatliche politische Verwaltung)
OKO GBObschtschestwennyj komitet obespetschenija gosudarstwennogo besopasnosti (Gesellschaftliches Komitee für die Gewährleistung der Staatssicherheit)
OMONOtrjad milizii osobogo nasnatschenija (Spezialeinheit der russischen Polizei)
OPOrganisowannaja prestupnost(Organisiertes Verbrechen)
ORTObschtschestwennoje rossijskoje telewidenie (Russischer TV-Sender)
PGUPerwoje glawnoje uprawlenije (Erste Hauptverwaltung)
PRPublic Relations
PRSPartija russkogo sobora (Partei der russischen Versammlung)
RANRossijskaja akademija nauk (Russische Akademie der Wissenschaften)
RFRossijskaja Federazija (Russländische Föderation)
RGANIRossijskij gosudarstwennyj archiw nowejschej istorii (Russisches Staatsarchiv für neueste Geschichte)
RNSRusskij nazionalnyj sobor (Russische Nationalversammlung)
ROGReporter ohne Grenzen
ROIIPRossijskij obschtschestwennyj institut isbiratelnogo prawa (Russisches Gesellschaftliches Institut für Wahlrecht)
RPRRespublikanskaja partija Rossii (Republikanische Partei Russlands)
RSFSRRossijskaja Sowjetskaja Federatiwnaja Sozialistitscheskaja Respublika (Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik)
RTRRossijskoje telewidenie i radio (Russischer TV-Sender)
RUBOPRegionalnoje uprawlenije po borbje s organisowannoj prestupnostju(Regionalverwaltung für die Bekämpfung organisierter Kriminalität)
SATOEigenname einer Frauenorganisation
SBPSluschba besopasnosti Presidenta (Präsidialer Sicherheitsdienst)
SIGINTSignals Intelligence (Fernmelde- und elektronische Aufklärung)
SIRCSecurity Intelligence Review Committee
SKSledowatelnyj Komitet (Ermittlungskomitee)
SORMSistema operatiwno-rosysknych meroprijatij(System für operative Aufklärungsmaßnahmen)
SPSSojus prawych sil (Union rechter Kräfte)
SSRSowjetskaja Sozialistitscheskaja Respublika (Sozialistische Sowjetrepublik)
SSSISluschba spezialnoj swjasi i informazii (Regierungsfernmeldewesen)
StGBStrafgesetzbuch
StPOStrafprozessordnung
STsch KGBSpezialnye tschasti wojsk KGB (Spezialeinheiten des KGB)
SUSowjetunion
SWRSluschba Wneschnej raswedki (Föderaler Auslandsnachrichtendienst)
UdSSRUnion der Sozialistischen Sowjetrepubliken (Sojus Sowjetskich Sozialistitscheskich Respublik, SSSR)
UEBUprawlenije ekonomitscheskoj besopasnosti (Verwaltung für Wirtschaftliche Sicherheit)
U-HaftUntersuchungshaft
UKBUprawlenije konstituzionnoj besopasnosti (Verwaltung für Verfassungssicherheit)
UKGBUprawlenije KGB (Verwaltung KGB)
UPSUprawlenije prawitelstwennoj swjasi (Verwaltung Regierungsnachrichtenwesen)
USAUnited States of America
WGTRKWsjerossijskaja gosudarstwennaja televisionnaja i radioweschtschatelnaja kompanija (Allrussische Staatliche Fernseh- und Rundfunkanstalt)
WGUWtoroje Glawnoje Uprawlenije (Zweite Hauptverwaltung)
WTBWneschtorgbank (Außenhandelsbank)
WTschKWsjerossijskaja tschreswytschajnaja komissija po borbje s kontrrewoljuziej i sabotaschem (Allrussische Außerordentliche Kommission für den Kampf gegen Konterrevolution und Sabotage)
ZIK RFZentralnaja isbiratelnaja komissija RF (Zentrale Wahlkommission der RF)
ZKZentralkomitee (der KPdSU), (Zentralnyj komitet)
Vorwort
Ulf Walther untersucht in seiner zunächst im Frühjahr 2013 als Dissertation an der Humboldt-Universität zu Berlin vorgelegten Arbeit „Russlands gescheiterte Transformation. Die Macht des Geheimdienstes KGB/FSB von Gorbatschow bis Putin“ Kontinuität und Wandel der Rolle des zentralen Geheimdienstes in der ausgehenden Phase des Sowjetreiches und in der von inneren Wirren bestimmten Phase der Herausbildung des Machtapparates der Russischen Föderation bis zum Jahre 2008. Die Entwicklung bis zur Gegenwart ist Gegenstand eines eigenen Kapitels „Die jüngsten Entwicklungen in Russland: Der ewige Putin?“ Der „Erfolg“ dieses Systems beruht auf der Solidarität der an der Macht beteiligten Kräfte am Erhalt dieser Konstellation und des von dem System Putin „garantierten“ Rentensystems für die Nutznießer aus dem Kreis der Machtelite und der sozialen Absicherung der Rentner und Arbeitslosen. Der Geheimdienst sichert das System gegen die politischen und gesellschaftlichen Unruhefaktoren, die sich in der russischen Zivilgesellschaft immer wieder entwickeln, aber auchin dem Jahrhunderte alten Streben der ethnischen Minderheiten nach noch größerer Selbstbestimmung gegenüber der zentralistischen Machtzentrale Russlands.
Seine Arbeit stellt eine wissenschaftliche Untersuchung der von Oppositionspolitikern in Russland vertretenen Auffassung dar, dass der Geheimdienst FSB heute einflussreicher ist als das KGB zu Zeiten der Sowjetunion. Wladimir Ryschkow, Geschichtsprofessor aus dem Altai-Gebiet (Jahrgang 1966) und führendes Mitglied der in den achtziger Jahren unter dem Namen „Republikanische Partei“ gegründeten ersten sozialdemokratischen Partei, stellt fest: „In der Sowjetzeit kontrollierte die Partei das KGB. Heutzutage ist das KGB (FSB) selbst die Macht. Das KGB (FSB) ist selbst wie eine politische Partei und das KGB selbst kontrolliert viele Positionen in Politik und Wirtschaft des heutigen Russlands“.
Das aus sowjetischer Zeit für den Geheimdienst benutzte geläufige Kürzel KGB (Komitee für Staatssicherheit) wird im allgemeinen Sprachgebrauch weiter als Bezeichnung für die russischen Geheimdienste verwendet. Die offizielle Bezeichnung für den geheimen Inlandsdienst ist indessen heute „FSB – Föderaler Sicherheitsdienst“ und „SWR“ für den Auslandsgeheimdienst.
Die Arbeit belegt durch Auswertung veröffentlichten Materials und durch Befragung von Zeitzeugen die Annahme, dass die Einleitung der Reformen unter Andropowund Gorbatschowauf die kritische Beurteilung der wirtschaftlichenLage und wirtschaftlichen Perspektiven der Sowjetunion und des sowjetischen Vorfelds zurückging. Geheimdienst, Partei und Regierung befürchteten eine Verschlechterung der internationalen Position der Sowjetunion vor allem gegenüber den USA. Die Einleitung demokratischer Reformprozesse führte, wie Ulf Walther feststellen konnte, zu Spannungen zwischen Gorbatschowund den Geheimdiensten, die sich in dem Putschversuch vom 21. August 1991 entluden, mit dem die Umwandlung des sowjetischen Zentralstaates in eine Union oder Föderation der bisherigen Teilrepubliken aufgehalten und zurückgeschraubt werden sollte. Die Putschisten wurden von ihren Organisationen fallen gelassen, die sich an dem Übergang der Macht von den zentralen Organen auf die zur Selbstständigkeit drängenden Teilrepubliken beteiligten, vor allem in der von Boris Jelzingeführten Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik. Die „Loyalität“ zu der bislang alles entscheidenden Kommunistischen Partei mutierte zur Loyalitätfür die „neue Staatsgewalt“, vor allem in Russland, wo Jelzindie Kommunistische Partei verbot und damit zur Auflösung zwang. Dem Auflösungsprozess, der auch vor dem zentralen KGB keinen Halt machte, folgten in verschiedenen Schritten die Zersplitterung und Neugründung der Dienste in Russland und anderen Republiken – begleitet von der Übernahme eines großen Teils der Mitarbeiter des zentralen Geheimdienstes. Nach den Forschungsergebnissen von Ulf Walther hat die Wiedergeburt eines starken geheimdienstlichen Machtapparats bereits unter Boris Jelzinkonkrete Formen angenommen.
Die Rückkehr in eine zentrale Funktion zur Sicherung und Steuerung des Staates ist dannmit der Übernahme des russischen Präsidentenamtes durch Wladimir Putinim Jahre 1999/2000 die logische Folge dessen, was sich unter Jelzinbereits abzeichnete. Der FSB ist zu einem auch der Kontrolle durch die Judikative entzogenen Hauptinstrument des autoritären Regierungssystems Putingeworden. Die Wiederaufnahme des Transformationsprozesses zu einer rechtsstaatlich verankerten pluralistischen Demokratie scheint in weite Ferne gerückt zu sein.
Ulf Walther stützte sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit bei der theoretischen Durchdringung des Untersuchungsgegenstandes auf das Theorie-Konzept des britischen Politologen Peter Gill („Policing Politics“, 1994). Das von Gill entwickelte „Gore-Tex-Staat“-Modell ordnet die Geheimdienste in Staatsstrukturen nach dem Grad ihrer Autonomie und nach dem Grad ihrer Fähigkeit zur Durchdringung der staatlichen Einrichtungen. Auf eine Darstellung der in der Dissertation in umfassender Weise untersuchten undweiter entwickelten wissenschaftlichen Diskussion über Theorie-Modelle von Geheimdiensten wird unter Verweis auf die Dissertation selbst verzichtet.
Ulf Walther untersucht im Rahmen des Gill-Modells die Beziehungen des Geheimdienstes zu staatlichen Strukturen und gesellschaftlichen Kräften unter unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Naturgemäß bleibt das komparative Element in der Arbeit im Allgemeinen und verzichtet auf vergleichende Untersuchungen zwischen rechtsstaatlich abgesicherten Geheimdiensten in pluralistischen Demokratien und Geheimdiensten in autoritären staatlichen Strukturen – Bedingungen, wie sie heute weitgehend in Russland gegeben sind.
Es ist verdienstvoll, dass mit dieser Arbeit die wissenschaftliche Befassung deutscher akademischer Forschungs- und Lehranstalten mit Themen der Geheimdienste – sei es in politikwissenschaftlicher, sei es in historischer Dimension–einen informativen und analytisch interessanten Anstoß erhalten hat. Der Verfasser ist nicht der Versuchung erlegen, die formal-demokratischen Ansätze des heutigen russischen Staates als Grundlage wirksamer politischer Kontrolle durch die parlamentarischen Gremien eines pluralistisch-demokratischen Systems zu präsentieren bzw. zu interpretieren. Das ist angesichts der kontroversen öffentlichen Diskussion über die demokratische Relevanz des Transformationsprozesses in Russland sehr verdienstvoll. Ulf Walther hat den politischen Wissenschaften mit seiner Arbeit auch ein gegenüber dem bekannten „Gore-Tex-Modell“ modifiziertes System zur theoretischen Durchdringung des Spannungsverhältnisses zwischen Staat/Gesellschaft einerseits und Geheimdiensten andererseits vorgestellt, das der weiteren Analyse bedarf.
Die Arbeit verdeutlicht die Bedeutung des KGB bei der Entwicklung der Reformansätze in der sowjetischen Führung in den achtziger Jahren – die letztlich das kommunistische Lehrgebäude zugunsten eines stabilen und daher autoritär verfassten russischen Staates opferte. Die Entwicklung eines demokratisch verfassten und gelebten Staates, wie er von der Zivilgesellschaft in Russland angestrebt und gefordert wird, stellt für den heute bestehenden Geheimdienst eine existentielle Bedrohung dar.
Berlin, November 2013
Dr. Hans-Georg Wieck
Botschafter a.D., BND-Präsident a.D.
1.Einleitung
„Heute ist das KGB politisch einflussreicher als in der Sowjetzeit. In der Sowjetzeit kontrollierte die Partei das KGB. Heutzutage ist das KGB selbst die Macht. Das KGB ist selbst wie eine politische Partei und das KGB selbst kontrolliert viele Positionen in Politik und Wirtschaft des heutigen Russlands.“[1]
Die Annahme, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Ost-West-Konflikts die Bedeutung der geheimen staatlichen Nachrichtendienste abnehmen würde, hat sich als falsch erwiesen. Die internationale Staatengemeinschaft sah sich zunehmend gezwungen, die geheimdienstlichen Anforderungsprofile an die komplexe und komplizierte internationale Lage anzupassen. Die Aktionsräume für neue vielfältige Bedrohungsszenarien haben sich erweitert. Die neue Qualität von Gefährdungspotenzialen wie internationaler Terrorismus, Proliferation und transnationale organisierte Kriminalität („Gefährdungstriopol“) hat einen Bedeutungszuwachs der geheimdienstlichen Aufklärung nach sich gezogen.[2]Sie ist auch eine Folge des Niedergangs des sowjetkommunistischen Regimes und der daraus resultierenden Instabilität in den letzten Jahren der Existenz der Sowjetunion und in den postsowjetischen Transformationsstaaten. Die politischen Systeme dieser Transformationsstaaten sind von schwachen politischen Institutionen und einer starken Abhängigkeit von Einzelakteuren und Machtgruppen geprägt, woraus wiederum Konflikte um Machtverteilung und Besitzstandswahrung resultieren. Vor diesem Hintergrund rückt der größte Nachfolgestaat und zugleich Rechtsnachfolger der Sowjetunion, die Russländische Föderation, in den Fokus der Betrachtung. Die russischen Geheimdienste als ein Bestandteil der so genanntensilowiki, derMächtigen, verdienen dabei besondere Berücksichtigung.[3]
Im Zuge des Zusammenbruchs des kommunistischen Herrschaftssystems und des damit verbundenen Auflösungsprozesses der Sowjetunion wurde im September 1991 auch die Abwicklung des Geheimdienstes KGB(Komitet Gosudarstwennoj Besopasnostiunistischen totalitären Einparteienherrschaft war. Bereits 1990 kam es im Rahmen von Michail Gorbatschows Reformpolitik zur Aufhebung des Machtmonopols der KPdSU, und nach dem von konservativen Eliten aus dem Partei- und Sicherheitsapparat initiierten, jedoch gescheiterten Putsch im August 1991 erfolgte die Entflechtung der alten Strukturen des Geheimdienstapparats, nicht aber die Abschaffung des Geheimdienstwesens an sich. Vielmehr wurden Maßnahmen zu seiner Reorganisation eingeleitet. Damit wurde die Problematik der Kontinuität alter Denkmuster, Normen und Verhaltensweisen des sowjetischen Geheimdienstwesens im postsowjetischen Russland aufgeworfen, schien doch eine Radikalreform aufgrund eines befürchteten Verlusts an Professionalität bei der geheimdienstlichen Aufgabenerfüllung sowie wegen politischer Risiken durch mögliche Racheakte entlassener KGB-Kader, die im Untergrund für den staatlichen Machtapparat gefährliche Verbindungen hätten eingehen können, auszuscheiden. Damit wird die Frage aufgeworfen, in welchem Ausmaß sich diese Kontinuität als schwerwiegende Hypothek für den Transformationsprozess erwiesen hat?
Die Problematik der Kontinuität alter KGB-Strukturen sowie der tschekistischen Ideologie und Verhaltensweisen in den neuen Sicherheitsorganen blieb nicht ohne Auswirkung auf das Verhältnis von Geheimdienst, Politik und Gesellschaft.[4]Nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in deren Rechtsnachfolger Russland gab beziehungsweise gibt es Hinweise auf verschiedenste Formen der Durchdringung von und der Einflussnahme auf Politik und Gesellschaft durch die Staatssicherheitsorgane.[5]Etwa ab der Jahrtausendwende strebte diese Kohorte dersilowikivermehrt bis in die höchsten Staatsämter und gelangte mit Wladimir Putineiner ihrer Vertreter sogar in das Amt des Staatspräsidenten. Unter der Präsidentschaft des ehemaligen KGB-Offiziers und FSB-Direktors erfolgte ab dem Jahr 2000 eine Rezentralisierung mehrerer staatlicher Sicherheitsorgane.[6]Damit hatte insbesondere der FSB wieder an Akteursqualität gewonnen, und die russische Staatssicherheit kam dem Zuschnitt des ehemaligen Mammutapparats des KGB wieder sehr nahe.
Die vielfältigen Verflechtungen vor allem des FSB mit den staats- und gesellschaftspolitischen Strukturen werfen die Frage auf, wie es um die Kontrolle und damit um die Autonomie der russischen Geheimdienste in einem Staat bestellt ist, in dem laut Verfassung der Präsident omnipotent, der Regierungschef vom Parlament praktisch unabhängig und das Zwei-Kammer-Parlament fast bedeutungslos sind. Das schwach ausgeprägte politische Institutionsgeflecht lenkt die Aufmerksamkeit darauf, wie sich diese Verflechtungen auf die Entwicklung des Kontroll- und Aufsichtssystems ausgewirkt haben.
Den konzeptionellen Dimensionen von Durchdringung und Autonomie beziehungsweise Kontrolle kommt eine Schlüsselrolle zu im Hinblick auf die entscheidende Fragestellung nach der Macht- und Gestaltungshoheit, die der GeheimdienstKGB/FSB im sowjetischen und im postsowjetisch-russischen Transformationsprozessbesaß. Erkenntnisse daraus ermöglichen weitergehende Aussagen über Kausalzusammenhänge für das Gelingen oder Scheitern von politischen Demokratisierungsprozessen in Transformationsgesellschaften.
Autonomieumfasst die Beziehung zwischen Geheimdienst und Staat und behandelt die Frage, in welchem Ausmaß die Geheimdienste in ihren Aktivitäten unabhängig von externen Einflüssen sind. Kontrollieren die staatlichen Gewalten den Geheimdienst oder agiert er weitgehend autonom bezüglich seiner Ziele und seiner Methoden der Informationsbeschaffung für Aufklärung und Abwehr?Der Grad der Durchdringung von Staat und Gesellschaft definiert sich über die Fähigkeit der Geheimdienste, in einemvorgegebenen Gesetzes- und RegulierungsrahmenInformationen zu beschaffen und Einfluss auszuüben.[7]
Die Aufarbeitung der Rolle der Geheimdienste im spätsowjetischen und postsowjetisch-russischen Transformationsprozess wurde außerhalb Russlands allenfalls angestoßen. In Russland selbst steckt sie nach wie vor in den Kinderschuhen. Das liegt vor allem im fehlenden Willen der politischen Machtelite, eine Aufarbeitung zuzulassen oder gar zu unterstützen, und aus dem daraus resultierenden schwierigen Zugang zu den Geheimdienstarchiven. Eine umfassende und systematische Beleuchtung der Rolle von KGB/FSB in den politischen und gesellschaftlichen Umwälzungsprozessen vor und nach 1991 ist bislang weitestgehend ein Desiderat geblieben. Politischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen liegen nicht selten Erkenntnisse aus geheimdienstlicher Tätigkeit zugrunde. Diese können eine genaue Beurteilung der Lage in einem Land ermöglichen. Sie können politisches Handeln beeinflussen, im schlimmsten Fall auch manipulieren. Besonders prekär kann ein solches Handeln für die Entwicklung von Staaten in der Transformation sein. Daher kommt der Untersuchung des Ausmaßes der geheimdienstlichen Macht eine besondere Bedeutung für die Transformationsforschung zu.
Die Macht der russischen Geheimdienste ist auch für die internationalen Beziehungen von Relevanz. So bestehen zwischen den Geheimdiensten verschiedener Staaten unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit, deren Notwendigkeit angesichts der qualitativen Zunahme des eingangs erwähnten Gefährdungstriopols offensichtlich ist. Erst die gemeinsame geheimdienstliche Aufklärung und ein intensiver internationaler Erfahrungsaustausch über die gewonnenen Erkenntnisse schaffen den Raum für adäquate politische Maßnahmen.[8]Dazu aber bedarf es einer Vertrauen schaffenden Basis zwischen den Staaten und ihren Geheimdiensten. Eine funktionierende parlamentarische und rechtsstaatliche Kontrolle der Geheimdienste wäre eine solche Basis. Eine erneute Machtanhäufung, das Unterlaufen geltender Gesetze, die Penetration politischer Institutionen und eine zunehmende Verflechtung der Geheimdienste mit zivilgesellschaftlichen Lebensbereichen bilden keine Grundlage für eine dauerhafte internationale Kooperation.
2.Geheimdienst und politisches Regime
2.1.Begriffsdefinitionen
Der Begriff Nachrichtendienst, dessen staatliche Dimension – im Gegensatz zu Nachrichtenagenturen – hier thematisiert werden soll und der in dieser Hinsicht auch unter den Synonymen Geheimdienst[9]und geheimer Nachrichtendienst bekannt ist, bezeichnet Behörden, die „regelmäßig organisatorisch eng an die politische Führung eines Landes gebunden, politisch bedeutsame Nachrichten beschaffen, auswerten und weitergeben sowie gegebenenfalls zur Störung und Beeinflussung politischer Gegner im In- oder Ausland Handlungen vornehmen, wobei sie grundsätzlich ein Höchstmaß der Geheimhaltung ihrer Aktivitäten beachten, da sonst ihr Zweck, die Beobachtung und Beeinflussung politischer Gegner, von vornherein in Frage gestellt wäre“.[10]Im Gegensatz zu diesem weit gefassten Begriff obliegt dem Nachrichtendienst im engeren Sinn lediglich die Beschaffung und Auswertung von Nachrichten.
Vom Nachrichtendienst grundsätzlich zu unterscheiden ist die Geheimpolizei. Diese ist ein besonders in autokratisch verfassten Staaten anzutreffendes Organ der Exekutive, in dem sich die staatsanwaltschaftlichen Befugnisse sowie die exekutiven Befugnisse von Polizei – wie zum Beispiel das Festnahmerecht, Befugnisse zur Durchsuchung, Schusswaffengebrauch oder die Anwendung von unmittelbarem Zwang[11]–mit den Informationsmöglichkeiten eines Geheimdienstes vereinen. Die üblicherweise außerhalb der rechtsstaatlichen Kontrolle stehende Geheimpolizei wird in der Regel mit der Aufgabe der Verfolgung politischer Gegner beziehungsweise „Staatsfeinden“ betraut und greift dabei häufig auf Methoden der Gewaltanwendung gegen Menschen zurück.[12]
Eine im englischsprachigen Raum übliche Bezeichnung für geheimdienstliche Tätigkeiten istIntelligence. Dieser Ausdruck bezeichnet sowohl den Prozess als auch das Ergebnis „einer bürokratischen Koordination, um der politischen Führung […] auf der Basis öffentlich zugänglicher oder erst erschlossener Informationen Kenntnis von Vorgängen und den möglichen Folgen eigenen und fremden Verhaltens zu vermitteln, die von Bedeutung für die Realisierung der vorherrschenden gesellschaftlichen Werte und die Erreichung der entsprechend definierten Ziele sind sowie andere Akteure davon abzuhalten, Kenntnis über die eigene Informationsgewinnung und Interessenumsetzung zu erlangen, wo dies nach Willen der politischen Führung verweigert werden soll“.[13]Dennoch muss konstatiert werden, dass sämtliche Versuche gescheitert sind, dem englischen BegriffIntelligenceeine zufrieden stellende deutschsprachige Entsprechung hinzuzufügen.[14]
Die geheimdienstliche Aufklärung befasst sich mit der Beschaffung beziehungsweise Sammlung von Informationen. Die Grenzen zur Spionage sind dabei fließend. Der Begriff der Spionage bezeichnet das heimliche Auskundschaften von politischen, wirtschaftlichen, militärischen und wissenschaftlichen Informationen aus oder über einen fremden Staat. Sie hat ihren Ursprung vor mehreren Jahrtausenden in der Antike und entwickelte sich in Europa und Asien.[15]Geht es um das Eindringen in fremde Geheimdienste beziehungsweise in Sicherheitsbehörden eines anderen Staats mit dem Ziel, Strukturen, Methoden, Mittel und Absichten dieser Behörden zu erkunden oder sie sogar zu steuern, so spricht man von Gegenspionage. Diese ist nicht zu verwechseln mit der Spionageabwehr, die sich mit der Erkennung, Abwendung und Verfolgung gegnerischer Spionage befasst. Als Spionageabwehr wird auch die Organisationseinheit in einem Geheimdienst bezeichnet, die die entsprechenden Maßnahmen durchführt.[16]
Von der Durchführung so genannter „aktiver Maßnahmen“ (beziehungsweise „verdeckter Operationen“) sind die Geheimdienste in liberaldemokratischen Systemen in der Regel ausgeschlossen. Gleichwohl werden sie in der amerikanischen Literatur undIntelligence-Praxis vorwiegend als ein selbstverständliches beziehungsweise konstitutives Element angesehen.[17]Dahinter verbergen sich solche Tätigkeiten, die nicht primär der Erlangung von Informationen dienen, zum Beispiel Sabotage und Gewalt gegen Menschen.[18]Damit wird „aktiv“ in die inneren Verhältnisse andererStaaten eingegriffen, was völkerrechtlich eine illegale Form der Intervention darstellt.
2.2.Die Organisation von Geheimdiensten
In der Frage der Trennung von Inlands- und Auslandsgeheimdiensten existieren unterschiedliche Ansichten. Befürworter einer Trennung argumentieren, dass Auslandsgeheimdienste mit langfristigen und weniger spezifischen Bedrohungsszenarien befasst sind und zudem im Ausland in einem anderen rechtlichen Kontext operieren. Sie brechen gewissermaßen vorsätzlich das Recht anderer Staaten, während Inlandsgeheimdienste auf die Verteidigung des Rechtssystems ihres Landes hinarbeiten. Außerdem sehen sie eine höhere Wahrscheinlichkeit des Machtmissbrauchs, wenn ein Dienst sowohl in- als auch ausländische Bedrohungen abdeckt. Gegner der Trennung führen hingegen an, dass sich in- und ausländische Bedrohungen nicht eindeutig trennen lassen. Zudem gibt es Bedrohungen, die nicht aus dem Ausland stammen, die jedoch vom Ausland genutzt werden, beispielsweise zum Zweck der Beeinflussung oder Subversion inländischer politischer Gruppierungen (foreign influence).[19]
Unterschiedliche Ansichten gibt es in einigen Staaten auch in der Frage der Trennung von Inlandsgeheimdienst und Polizei. Unter Berücksichtigung der innerstaatlichen Bedrohungslagen besteht der wesentliche Unterschied zwischen Inlandsgeheimdienst und Polizei in ihren Zielvorgaben: während die polizeiliche Arbeit auf eine strafrechtliche Verfolgung und Verurteilung der Täter abzielt, stehen beim Inlandsgeheimdienst Informationsbeschaffung und Aufklärungsarbeit im Mittelpunkt. Sollte eine geheimdienstliche Operation in strafrechtlicher Verfolgung enden, ist dies ein Indikator für einen operativen Fehlschlag.
Es gibt gewichtige Argumente für eine Trennung von Inlandsgeheimdienst und Polizei. Das gewichtigste Argument zielt darauf ab, dass Geheimdienste mit polizeilichen Vollmachten die Möglichkeit zur Anwendung repressiver Maßnahmen haben und damit die Gesellschaft tiefer durchdringen können. Außerdem sehen Befürworter in einer Trennung Vorteile zum einen bei der Rekrutierung aus einer breiteren Auswahl besser ausgebildeter Personen und zum anderen hinsichtlich eines auf Mitbestimmung ausgerichteten Managements. Zudem benötigen die Dienste Leitung und Kontrolle durch die Exekutive in einem Ausmaß, das für die Polizei ungeeignet ist.[20]
Allerdings gibt es auch Argumente, die gegen eine Trennung sprechen. Laut Gill institutionalisiert eine Trennung das Konzept der politischen Überwachung (political policing) und begünstigt die Ausdehnung eines starken bürokratischen Interesses selbst dann, wenn die Bedrohung vorbei ist. Außerdem könnte eine Trennung des geheimdienstlichen „Kopfs“ vom exekutiven „Arm“ organisatorische Schwierigkeiten verursachen, nämlich dann, wenn die Polizei, die auf die Aufklärungsergebnisse der Dienste angewiesen ist, diesen nicht vertraut und eigene Strukturen der Informationsbeschaffung entwickelt.[21]
Besondere Aufmerksamkeit ist der Tatsache zu schenken, dass es sich bei Geheimdiensten nicht zwingend um homogene Organisationen handelt.[22]So besteht die Möglichkeit von Konflikten zwischen Interessengruppen innerhalb eines Dienstes ebenso wie zwischen verschiedenen Diensten. Probleme wie Kompetenzstreitigkeiten und geringe oder überhaupt keine Koordination sind gewichtige Argumente zumindest für eine Verringerung der Anzahl verschiedener Dienste.
2.3.Die Durchdringung von Staat und Gesellschaft: der geheimdienstliche Aufklärungsprozess
Der geheimdienstliche Aufklärungsprozess im Hinblick auf die Durchdringung des politischen und öffentlichen Raums besteht aus insgesamt fünf Elementen: Programmierung/Planung, Beschaffung, Aufbereitung und Auswertung, Verteilung sowie Gegenspionage/Spionageabwehr.
Programmierung/Planung (Planning/Direction) umfasst alle Maßnahmen zur Fixierung desIntelligence-Bedarfs in Form von Aufklärungsforderungen. Sie beruht im Wesentlichen auf der Steuerung durch die entsprechenden politischen Entscheidungsorgane.[23]Im Rahmen dieser Stufe müssen die Entscheidungen bezüglich der Zielgruppenerfassung (Targeting) getroffen werden. Damit ist jener Personenkreis gemeint, der eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt. Die Praktiken der Zielgruppenerfassung können einer adäquaten Kontrolle zugeführt werden, indem man zwischen verschiedenenTargeting-Ebenen unterscheidet und ihnen entsprechend gestaffelte Autorisierungsebenen zur Seite stellt. Ein eindeutiges Mandat für die Sicherheitsaufklärung zu erteilen, ist allerdings nicht möglich.
Im geheimdienstlichen Aufklärungsprozess kommt der Informationsbeschaffung (Collection) eine entscheidende Bedeutung zu. In dieser Phasewerden durch verschiedene Beschaffungsformen Rohdaten gesammelt. Hinsichtlich der Beschaffungstechniken hat die kanadische McDonald-Kommission folgende richtungweisende Grundsätze für die Verwendung und Begrenzung von Beschaffungstechniken erarbeitet:[24]
·Es darf keine Verstöße gegen das Strafrecht geben. Wenn bestimmte Techniken, deren Anwendung einen Verstoß gegen geltendes Strafrecht darstellen würde, aus Gründen der nationalen Sicherheit notwendig wären, dann müsste die Gesetzeslage geändert werden, um beides in Einklang zu bringen.
·Die angewandten investigativen Mittel sollten der Bedrohung und der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens angemessen sein.
·Die Notwendigkeit, selbst rechtlich abgesicherte Techniken der Informationsbeschaffung zu verwenden, bedarf der Abwägung mit den möglicherweise entstehenden Schäden, die bei den bürgerlichen Freiheiten verursacht werden könnten.
·Je zudringlicher die Techniken sind, desto höher sollte die sie bewilligende Autorität sein. In einigen Fällen genügt die Autorisierung innerhalb der Dienste, in anderen Fällen bedarf es einer externen Autorisierung, zum Beispiel durch die Judikative.
·Mit Ausnahme von Notfällen sollten weniger zudringliche Techniken vor stärker penetranten Techniken verwendet werden.
Den weitaus größten Teil ihrer Informationen erhalten Geheimdienste aus offenen Quellen. Darüber hinaus werden Informationen aus Dokumenten und Erkenntnissen anderer staatlicher Behörden bezogen. Informanten kommen bei der Beschaffung mittels verdeckter Methoden zum Einsatz. Heimliche Zugänge und Einbrüche, das Abfangen von Nachrichten sowie die elektronische Überwachung sind weitere Varianten.[25]
Auf die Beschaffung erfolgt die Aufbereitung (Processing) und Analyse (Analysis/Production) desInformationsmaterials. Die Aufbereitung enthält alle Tätigkeiten zur Umwandlung der beschafften Daten in Formen, welche die Auswertung ermöglichen beziehungsweise erleichtern.[26]Unter dem Begriff werden vorwiegend technische Prozesse subsumiert wie das Transkribieren von Bandaufzeichnungen aus der Telefonüberwachung, die Archivierung oder Wiederherstellung von Material. Die Übersetzung von Dokumenten und die Interpretation von Fotografien gehören zu den evaluativen Prozessen.[27]Bevor die Informationen an den „Kunden“ weitergegeben werden können, müssen sie zunächst analysiert werden und ihre Präsentation vorbereitet werden. Die Auswertung bezieht sich auf die Herstellung der eigentlichenIntelligence-Informationen durch Integration, Bewertung und Analyse der verfügbaren Daten.[28]Eine Schlüsselrolle kommt der Analyse bei der Extrahierung von Desinformationen zu, die das Ziel haben, die Dienste in die Irre zu führen.[29]
Der nächste Schritt bezieht sich auf die Verteilung (Dissemination) der analysierten Informationen an die Abnehmer durch bestimmte Formen der Berichterstattung. DieIntelligence-Produkte können dabei auch eine Art Währung darstellen. Geheimdienste interagieren mit potentiellen Informanten oder anderen Diensten, indem sie ihre Informationen als „Hebel“ verwenden, um andere zu erhalten.[30]Ein gewichtiger Grund für diese Weitergabepolitik liegt häufig darin, dass jedes ausführende Organ es bevorzugt, eigene Informanten zu haben. Ein anderer, an Bedeutung gewinnender Einflussfaktor sind die Kontakte zwischen staatlichen Behörden und dem Privatsektor, insbesondere zwischen Staatsbeamten und ihren früheren Kollegen, die nun im privaten Sicherheitssektor tätig sind.[31]
Bei der Gegenspionage (Counterintelligence)/Spionageabwehr (Counterespionage) (englischer Sammelbegriff:Countering) handelt es sich um jenen Bereich, der Staat und Gesellschaft am stärksten durchdringt. Dazu können bereits Überwachungsmethoden gezählt werden, über welche die Zielpersonen in Kenntnis gesetzt werden, um somit geplante Aktivitäten schon im Vorfeld zu stören. Die Methoden reichen von der Diskreditierung über die Diffamierung von Personen bis hin zur gezielten Unterwanderung von Zielgruppen durch verdeckte Ermittler. Einen Extremfall stellt die gezielte Ermordung dar. Einige Autoren betrachten die Gegenspionage als einen Bestandteil der Spionageabwehr.[32]Eine gleichrangige Einteilung beider Begriffe in eine „passive“, inlandsbezogene Spionageabwehr und eine „aktive“, bei den gegnerischenIntelligence-Organisationen greifende Gegenspionage ist unbrauchbar, da die Aktivitäten der Gegenspionage „widelyin nature and purpose“ sind: „from aggressive to strictly defensive, from the collection of information to its protection“.[33]
2.4.Der Geheimdienst im Spannungsfeld von Effizienz und Legitimität
Die Kontrolle der Geheimdienste bezieht sich auf sämtliche Institutionen sowohl des Staates als auch des öffentlichen Lebens, die zu dieser Kontrolle beitragen. Dazu gehören neben dem Parlament das Gerichtswesen, die Rechnungshöfe, die Medien, die Wissenschaft und insbesondere die Exekutive in Form der Regierung, der Ministerien sowie der Administrationen der Staats- und Regierungschefs.[34]Im 19. Jahrhundert kam es zu einer Professionalisierung der Arbeit der Geheimdienste, die bereits damals einer exekutiven Kontrolle durch Polizeichefs, Innenminister, Kriegs- und Marineminister unterworfen waren. Diese wiederum waren den Parlamenten, sofern es sie schon gab, verantwortlich, die für die Gesetzgebung und die Staatshaushalte zuständig waren.[35]Eine demokratische, insbesondere parlamentarische Kontrolle der Dienste hatte sich erst spät im 20. Jahrhundert herausgebildet, hervorgerufen zum einen durch eine tiefe Vertrauenskrise gegenüber den für die Sicherheitsfragen zuständigen Politikern und Staatsorganen, zum anderen durch die Professionalisierung der Kommunikationstechnologien sowie den aufkommenden Ost-West-Konflikt.[36]Unter parlamentarischer Kontrolle versteht man in demokratisch verfassten Staaten spezielle institutionelle oder durch besondere Anhörungs- und Genehmigungsvorbehalte ausgestaltete Mechanismen. Damit eng verbunden ist die Problematik der Verantwortlichkeit der Exekutive für das Handeln der Geheimdienste, die durch die Weitergabe von Informationen an ein spezielles parlamentarisches Gremium geteilt werden soll. Darüber hinaus besteht der Widerspruch zwischen dem allumfassenden Informationsrecht des Parlaments zur geheimen Arbeit der Dienste.[37]Nach Auffassung des Historikers Wolfgang Krieger ist eine demokratische Kontrolle mit folgenden vier Grundsätzen verknüpft:[38]
·Geheimdienste müssen dem Allgemeinwohl verpflichtet sein und dürfen nicht für die Interessen und Ziele einzelner Politiker oder Gruppierungen missbraucht werden.
·Eine Einschränkung der Bürgerrechte darf nur in begrenztem Umfang und nur soweit unbedingt nötig erfolgen.
·Die Geheimdienstarbeit muss effizient gestaltet sein und durch die Parlamente im Rahmen ihrer Gesetzgebungskompetenzen und Haushaltshoheit überwacht werden.
·Es besteht ein unauflöslicher Gegensatz zwischen der geheimdienstlichen Effizienz und der demokratischen Notwendigkeit einer strikten Begrenzung der Staatsmacht. Die damit verbundenen unausweichlichen und unbequemen Kompromisse erfordern öffentliche Debatten unter Beteiligung von Presse, Wissenschaft und Gesellschaft, da eine auf sich gestellte parlamentarische Kontrolle nicht funktioniert beziehungsweise nicht ausreichend ist.
Die Gesetzgebung beziehungsweise das Potenzial und die Grenzen von Gesetzgebung bei der Kontrolle der Dienste, die zum einen hinsichtlich der Informationsbeschaffung als Grundlage für die Ergreifung von Abwehrmaßnahmen eine Rolle spielt und zum anderen bei der Überwachung selbst ausgeübt wird, sind wichtige Einflussgrößen, die im Hinblick auf geheimdienstliche Prozesse von Bedeutung sind.[39]Für eine Kontrolle der Dienste ist es zunächst wichtig, dass eine gesetzliche Bevollmächtigung für die geheimdienstliche Arbeit besteht. Geheimdienste operieren auf gesetzlichen und somit legalen Grundlagen. Diese erhöhen ihre Legitimität und stellen geheimdienstliche Operationen auf eine rechtliche Basis, die sonst rechtswidrig wären. Die Formulierung gesetzlicher Grundlagen kann unterschiedliche Ursachen haben. So schuf der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit dem schwedischen Leander-Fall einen Präzedenzfall und entschied, dass jeder Staatsbürger die Möglichkeit haben muss, einen Entschädigungsanspruch für begangenes Unrecht durch Geheimdienste geltend machen zu können. In verschiedenen Ländern beschleunigten gerichtliche und legislative Untersuchungen der Aktivitäten der Geheimdienste eine entsprechende Gesetzgebung.[40]Gesetzgebung kann allerdings nicht auf direktem Weg in die Organisationspraxis umgesetzt werden. Mit anderen Worten, ein eingeschränktes rechtliches Mandat stellt noch keine ausreichende Bedingung für die geheimdienstliche Kontrolle und für die Einschränkung von Machtmissbrauch durch die Dienste dar. Jedoch ist es ein unersetzliches Kriterium für eine realistische Einschätzung der Effektivität der Dienste, für die Herausbildung eines selbst beschränkten Handelns seitens der Verantwortlichen und für die Schaffung einer Grundlage, auf dereffektive Aufsichtsverfahren entwickelt werden können. Darüber hinaus bedingt eine funktionierende Kontrolle eine Analyse der Bedrohungen und potenziellen Schäden für die (nationale) Sicherheit und öffentliche Ordnung, beispielsweise in Form von Terrorismus, Subversion, Spionage oder Sabotage, um so das Unmögliche zu vermeiden, nämlich einen Zustand „absoluter“ Sicherheit zu erzeugen.[41]
Die geheimdienstliche Gesetzgebung sieht sich grundsätzlich mit folgender, scheinbar unauflöslichen Schwierigkeit konfrontiert: Entweder sind die gesetzlichen Grundlagen sehr detailliert formuliert, um den Spielraum der vom Gesetz Betroffenen zu minimieren. Eine solch detaillierte Regelung würde jedoch keinen funktionsfähigen Arbeitsrahmen für die Dienste darstellen. Allgemeine Mandate zum „Schutz“ der nationalen Sicherheit bieten hingegen keine Absicherung gegen Machtmissbrauch. Ein allgemein gehaltenes Statut würde wiederum zu viele Schlupflöcher schaffen und die Grundlage für eine operationale Erstarkung der Dienste bereitstellen.[42]
2.5.Geheimdienstliche Autonomie und das Konzept von Kontrolle und Aufsicht
Der Aspekt der ministeriellen Kontrolle bezieht sich auf das Ausmaß, in dem ein Geheimdienst von der politischen oder ministeriellen Lenkung durch die Regierung unabhängig ist. Bezüglich der ministeriellen Kontrolle können zwei gefährliche Entwicklungen unterschieden werden: entweder gibt es einen Mangel an Kontrolle oder es gibt eine ministerielle Steuerung im Interesse der regierenden Partei.[43]So kann die Exekutive die Geheimdienste missbrauchen, indem sie diese als Mittel für die Verfolgung partei- beziehungsweise machtstrategischer Interessen einsetztund zum Beispiel Informationen über unliebsame politische Gegner sammelt. Grundlage einer solchen Konstellation könnte ein unklares Mandat für die Geheimdienste sein. Eine funktionierende ministerielle Kontrolle wird vor allem durch zwei Faktoren erschwert: das Prinzip „Kenntnis nur wenn nötig“ (need to know) und die Doktrin des „plausiblen Dementis“ (plausible deniability). „Kenntnis nur wenn nötig“ ist ein grundlegendes Organisationsprinzip, das den Grundsatz der internen Abschottung ausdrückt. Demnach soll jeder Mitarbeiter nur das wissen, was er für seine Aufgabenerledigung benötigt.[44]Ziel ist es, die Möglichkeit einzuschränken, dass operative Informationen durchsickern und dadurch Operationen oder Quellen kompromittiert werden. Diese Problematik besteht innerhalb der Geheimdienste, insbesondere aber gegenüber Außenstehenden.[45]Das „plausible Dementi“ bringt zum Ausdruck, dass „eine Regierung eine offenbar gewordene Handlung eines Geheimdienstes als ihr nicht zuzurechnen bezeichnet. Soweit ein Geheimdienst unter diesen Kautelen handelt, verlässt er sich regelmäßig darauf, dass seine Mitarbeiter nicht zur Verantwortung gezogen, sondern still aus der Schusslinie genommen werden.“[46]Üblicherweise erfolgt ein solches Dementi vor dem Hintergrund geheimdienstlicher Operationen, die mit illegalen Verhaltensweisen oder politischer Verlegenheit verbunden sind. Wird eine Operation öffentlich bekannt, ist es erforderlich, dass Minister imstande sind, jede Kenntnis über die Operation so zu dementieren, dass sie ihre Glaubwürdigkeit behalten. Kritiker argumentieren, dass diese Doktrin die Erfindung falscher Informationen, die für andere Regierungsorgane, für die Gerichte und die Öffentlichkeit akzeptabel sind, geradezu fördert.[47]Im günstigsten Fall besteht eine tatsächliche Unkenntnis der Minister über diese Operationen sowie eine rechtliche Absicherung dieses „Prinzips“. Es gibt immer wieder Situationen politischer Dringlichkeiten, die zu ministerieller Unkenntnis nachrichtendienstlicher Operationen führen. Es sind jedoch Bedenken angebracht, ob dies der beste Weg ist sicherzustellen, dass die Regierungsbedürfnisse bezüglich der Sicherheitsaufklärung erfüllt werden oder dass die Geheimdienste nicht in unakzeptable und unnötige Operationen eingeschaltet sind.[48]
Um Aussagen über die Macht von Geheimdiensten machen zu können, sind detaillierte Kenntnisse über ihre Budgets und Personalausstattungennotwendig, welche die Geheimdienste in der Regel nicht öffentlich preisgeben, da diese Informationen somit auch ihren Zielgruppen zugänglich gemacht würden. Daraus ergibt sich die Frage, in welchem Ausmaß die Personalausstattung und ihre interne Verteilung eine realistische Bewertung der Bedrohungen für die nationale Sicherheit reflektieren beziehungsweise eine auf Missallokation von Ressourcen basierende Fehlwahrnehmung widerspiegeln. Letzteres kann eine mangelnde Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen eingebildeten und realen Bedrohungen oder schlichtweg eine Folge von Manipulation bedeuten. Spiegelt die Rekrutierung des Geheimdienstes die Dominanz einer bestimmten Klientel wider, besteht die Gefahr der Steuerung des Geheimdienstes im Sinne eines Ministers oder einer regierenden Partei. Deshalb ist es wichtig, dass Rekrutierungsprozesse nicht durch Patronage beeinflusst werden, sondern auf unpersönlichen und kompetitiven Ausbildungskriterien beruhen.[49]
Innerhalb der Geheimdienste existieren Phänomene, für die die Dienste anfällig sind, insbesondere im Bereich der Organisationskultur. Dazu zählen Leistungs- und Persönlichkeitsbeschränkungen einzelner Mitarbeiter.[50]Als problematisch könnte sich eine von den Mitarbeitern selbst auferlegte Konformität angesichts einer in der Organisation wahrgenommenen „dominanten Ideologie“ erweisen.[51]Eine solche Konformität kann allerdings auch von oben auferlegt sein.[52]Gruppendenken ist ein weiterer Prozess, gegenüber dem Geheimdienste anfällig sind:
„Je mehr Kameradschaft und Corpsgeist es zwischen den Mitgliedern einer politikgestaltenden Eigengruppe gibt, desto größer ist die Gefahr, dass unabhängiges kritisches Denken durch Gruppendenken ersetzt wird, das wahrscheinlich in irrationalen und entmenschlichten Handlungen resultiert, die gegen Fremdgruppen gerichtet sind.“[53]
In der Debatte über die Aufsichtsmechanismen von Geheimdiensten lassen sich zwei Argumentationslinien verfolgen. So steht für einige Betrachter lediglich die Frage einer Verbesserung von Effizienz und Effektivität der Dienste im Mittelpunkt, während für andere Aufsicht zunächst einmal eine Rückversicherung für die Öffentlichkeit gegen Machtmissbrauch durch die Dienste darstellt:[54]
„Die Erfahrung hat gezeigt, dass ohne ein robustes System unabhängiger Aufsicht das System für Missbrauch weit geöffnet ist. Geheimdienste sind unfähig, der Versuchung zu widerstehen, sich in Aktivitäten zu ergehen, die keinen Platz in einer Demokratie haben.“[55]
Die Etablierung von Aufsichtsmechanismen kann allerdings auch zum Problem werden, nämlich dann, wenn sie lediglich eine symbolische Rückversicherung darstellen und eine Regierung damit lediglich aufzeigen will, dass sie gewisse Problembereiche nun unter Kontrolle hat.[56]Nichtfunktionierende Aufsichtsstrukturen können schlimmere Auswirkungen nach sich ziehen als überhaupt keine Strukturen, denn sie würden eine weitere innerstaatliche Ebene darstellen, die einer demokratischen Durchdringung widersteht.
Die Kontrollinstitutionen müssen einen ausreichenden Zugang zu den geheimdienstlichen Informationen haben, um stichhaltige Beurteilungen darüber abgeben zu können, ob die gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen eingehalten werden. Die Aufsichtsgremien auf den Ebenen der Exekutive und der anderen staatlichen Bereiche außerhalb der Exekutive müssen vollständigen Zugang zu Akten und Agenten der Geheimdienste haben sowie den politischen Willen, diesen auch zu nutzen. In der Praxis wird keines der Gremien in sämtliche geheimdienstlichen Informationen einsehen, jedoch muss grundsätzlich die Möglichkeit dazu bestehen.[57]
Geheimdienste verfügen über interne Prüfungsstellen. Darüber hinaus existieren informelle Mechanismen für die „interne Aufsicht“. Die so genanntenwhistleblowers(Zuträgervon als geheim klassifizierten Informationen) sind Mitarbeiter der Geheimdienste, die Informationen über geheime Vorgänge preisgeben, welche ihrer Ansicht nach gegen öffentliche Interessen verstoßen. Die Problematik deswhistleblowingbedarf einer Betrachtung unter dem Aspekt der Freiheit der Informationsgesetzgebung, falls es eine solche überhaupt gibt, sowie dahingehend, dass Mitarbeiter von Geheimdiensten zunächst Staatsbürger und in zweiter Linie Arbeitnehmer sind.[58]
Im Rahmen der Exekutive gibt es die ministerielle „Aufsicht“. Zumeist handelt es sich dabei um den Justizminister oder den Innenminister. In einem parlamentarischen System beruht die ministerielle Verantwortung auf der Idee einer administrativen Hierarchie, in der untergeordnete Beamte die „Werkzeuge“ eines Ministers sind und deshalb sich nicht selbst verantwortlich gegenüber sein sollten, entsprechend dem Grundsatz, dass ein und dieselbe Institution nicht für Aufsicht und Kontrolle verantwortlich sein sollte.[59]Da von den zuständigen Ministern der zeitliche Aufwand, der für die Kontrolle geheimdienstlicher Operationen notwendig ist, oftmals nicht erbracht werden kann und um sie diesbezüglich zu entlasten, wurden für sie in einigen Ländern entsprechende Aufsichtskapazitäten bereitgestellt, was die ministerielle Verantwortlichkeit gegenüber den Parlamenten jedoch nicht einschränkt.[60]
Die Aufsichtsmechanismen innerhalb der Exekutivebene bedürfen einer externen Unterstützung, da einerseits Geheimdienste die Minister als eine Bedrohung ihrer Autonomie ansehen könnten, andererseits Minister wiederum entscheiden könnten, dass sie nicht wissen möchten, was die Geheimdienste genau tun. Zu den externen Aufsichtsstrukturen zählen zunächst die staatlichen Organe, die sich außerhalb der Exekutive befinden: die Legislativorgane, die Justiz und in Einzelfällen spezielle Prüfungsgremien mit hybridem Charakter. Ein parlamentarisches Aufsichtsorgan könnte ein spezieller parteiübergreifender Ausschuss sein, der sich ausschließlich mit Fragen der Sicherheit und der geheimdienstliche Aufklärung befasst und dem Entscheidungsbefugnisse im Hinblick auf das geheimdienstliche Budget zustehen, der Untersuchungen durchführen darf und Empfehlungen abgibt oder Richtlinien für geheimdienstliche Aktivitäten entwirft.[61]Eine Trennung von Kontrolle und Aufsicht ist damit jedoch nicht automatisch verbunden. In dem Fall, dass der Ausschuss über Kontrollfunktionen verfügt, könnte diese Situation in der Frage der Verantwortlichkeit zu Irritationen mit dem zuständigen Minister über die allgemeine Kontrolle der Geheimdienste führen. In dem Ausmaß, in dem der Ausschuss in die Arbeit der Geheimdienste verwickelt wird, kann die Fähigkeit zu einer unabhängigen externen Beurteilung der Geheimdienste beeinträchtigt werden. Generell jedoch sind parlamentarische Ausschüsse wichtige Symbole demokratischer Kontrolle. Sie dürfen allerdings nicht zu einer bloßen Dekoration verkommen, da sie so lediglich eine weitere Hülle für die Legitimation geheimdienstlicher Operationen darstellen würden. Deshalb sind Rekrutierungsprozessen, Befugnissen und Ressourcen parlamentarischer Ausschüsse besondere Beachtung zu schenken. Können sie nicht mit adäquaten Ressourcen ausgestattet werden, müsste die Einrichtung von speziellen Prüfungsgremien in Betracht gezogen werden, die dann den parlamentarischen Ausschüssen Bericht erstatten.[62]
Richter und Gerichte sind mit Entscheidungsprozessen zu Aktivitäten der Geheimdienste befasst, die Urteile zum Beispiel zur Pressefreiheit nach sich ziehen oder im Rahmen von Strafrechtsprozessen ausgesprochen werden, in denen geheimdienstliche Operationen und Fragen der nationalen Sicherheit Verhandlungsgegenstand sind. Sie werden nur auf Anrufung tätig und verkörpern keine „beständige, ultimative Eingriffsgrundlage“. Richterliche Entscheidungen spielen auch eine Rolle bei der Gewährung von Vollmachten für das Abhören von Telefonaten.[63]
Im gesellschaftlichen Diskurs werden geheimdienstliche Belange kaum diskutiert, da der Staat bemühtist, die sensiblen Informationen diskret zu behandeln und das öffentliche Leben zudem von der geheimdienstlichen Arbeit kaum beeinflusst wird. Trotzdem ist Öffentlichkeit eine bedeutende Waffe im Ringen um Kontrolle von Beamtenapparaten.[64]In einem demokratischen System werden Militär und Sicherheitsbehörden durch Zivilisten kontrolliert, die wiederum Gegenstand der Kontrolle durch demokratische Institutionen sind. Auf der Ebene der Öffentlichkeit gehören organisierte Interessengruppen und politische Parteien zu diesen Institutionen. Sie haben allerdings nur geringe Möglichkeiten, die staatlichen Ebenen zu durchdringen. Dies wird bereits dann deutlich, wenn es um die Aufarbeitung der Geschichte von Geheimdiensten geht und teilweise sogar der Wissenschaft kaum Zugang zu den historischen Akten gewährt wird. Oftmals wird die geheimdienstliche Arbeit erst dann Gegenstand der gesellschaftlichen Debatte, wenn Informationen über Fehlleistungen der Geheimdienste an die Öffentlichkeit gelangen, in deren Folge es oftmals zur Einrichtung von Untersuchungsausschüssen kommt. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen waren oftmals Anstoß für die Schaffung von Kontroll- und Aufsichtsmechanismen.
3.Die Entwicklung des KGB/FSB von Gorbatschowbis Putin
3.1.Die Tradition des Tschekismus
Die Tscheka war der erste Staatssicherheitsdienst der Sowjetkommunisten. Sie wurde nicht durch ein Gesetz, sondern lediglich durch ein Dekret desSownarkom(Rat der Volkskommissare) „Über die Gründung eines Organs der Diktatur des Proletariats zum Schutz der Staatssicherheit“ am 20.Dezember 1917 geschaffen.[65]Bereits die Bezeichnung „Tscheka“ deutet auf eine Gründung im Ausnahmezustand und deren Tätigkeit außerhalb eines Verfassungsrahmens hin.[66]Die Tscheka war ein wichtiges Instrument des leninistischen Regimes zur Bekämpfung seiner politischen und militärischen Gegner sowie von denjenigen, die privatwirtschaftlich tätig waren. Diese Gegner wurden in der Regel beschuldigt, feindliche Agenten, Spione und konterrevolutionäre Agitatoren zu sein, wobei die Definitionshoheit bei jedem einzelnen Tschekisten lag. Sie wurden willkürlich verhaftet und ermordet, wie aus einem Befehl der Tscheka an die lokalen Revolutionskomitees vom Februar 1918 hervorgeht.[67]Für die Öffentlichkeit blieben Zweck und Machtfülle der Organisation zunächst unklar. Spätestens ab September 1918 nach Bekanntgabe der Verordnung „Über den roten Terror“ wurde ihre Aufgabe, die Ausrottung tatsächlicher und vermeintlicher Regimegegner, deutlich. Die bis 1922 bestehende Tscheka erhielt weitreichende Befugnisse, gegen alle Verdächtigen vorzugehen ohne eine Offenlegung ihres Vorgehens oder unabhängige Gerichtsverhandlungen.[68]Ihrer Terrorwelle fielen mindestens 50.000 Menschen zum Opfer.[69]
Der Begründer und erste Leiter der Tscheka, Feliks E. Dserschinskij, sah in der Tscheka nicht nur ein Instrument zur Konsolidierung der Revolution, sondern auch zur rücksichtslosen Revanche an den Feinden der Revolution, wenn er sagte:
„Wir repräsentieren in uns selbst den organisierten Terror – das muss sehr klargesagt werden.“[70]
Mit Hilfe der Tscheka gelang es den neuen Machthabern, die alten Institutionen zu zerstören oder dem neuen Regime zu unterwerfen und neue Institutionen aufzubauen, die unter der Kontrolle der kommunistischen Partei standen. Die bolschewistische Nomenklatura kontrollierte bald alle Lebensbereiche vom Bildungswesen bis zur Arbeitswelt, von der Lebensmittelzuteilung bis zum Gesundheits- und Wohnungsbauwesen. Indem die Tschekisten die Bevölkerung durchdrangen und ein umfangreiches Spitzelsystem aufbauten, gelang es ihnen, persönliche Beziehungsgeflechte in der Gesellschaft zu zerstören und den dafür benötigten Gehorsam der Öffentlichkeit gegenüber der Partei zu befördern.[71]Die dadurch entstandene Vermischung des Tschekismus mit den gesellschaftlichen Strukturen analysierte der Geheimdienstexperte J. Michael Waller:
„Wo Tschekismus aufhörte, ein bloßes Hilfsmittel zu sein und ein Motor für die kommunistische Macht wurde, ist schwer zu bestimmen. Er war zuerst ein Erzeuger und dann ein Produkt der Gesellschaft, die er durch Zwang und Angst geschaffen hatte. Er griff auf die gesamte Bevölkerung über, zwang die Menschen, von unten zu dienen und lenkte ihre Lebensbahnen von oben und lenkte sogar die Partei selbst. Er schuf eine Gesellschaftvon Kollaborateuren.“[72]
Die Suche nach internen wie externen Feinden blieb ein konstantes Charakteristikum des sowjetischen Regimes und zugleich Rechtfertigungsgrundlage für die Existenz eines großen und mächtigen Sicherheitsapparats.[73]Dieser Sicherheitsapparat entwickelte eine eigene mythologische Verklärung des Tschekismus und seines berühmtesten Repräsentanten, FeliksE. Dserschinskij. Beispielhaft dafür war die 1964 einsetzende und bis weit in die 1980er Jahre hineinreichende Öffentlichkeitsarbeit des KGB zur Aufwertung des schlechten Images der Tscheka in der Gesellschaft. So wurden allein bis 1972 über 2.000 Titel zur „glorreichen Tradition“ des Tschekismus verfasst, Schriftsteller- und Filmwettbewerbe folgten.[74]Dieser Kult überdauerte die Sowjetunion und reicht bis in das postsowjetische Russland hinein, wie der Reformer und letzte KGB-Vorsitzende, WadimBakatin, feststellte:
„Auf jene Zeit der revolutionären Willkür geht die spezifische Ideologie des ‚Tschekismus‘zurück, die durch die nachfolgenden Generationen von Parteiideologen und Publizisten gehegt und gepflegt wurde, weil es sich mit ihrer ‚kriminell-patriotischen‘Romantik gut schmarotzen ließ. Diese Ideologie bewies eine größere Zählebigkeit als die Strukturen, die sie hervorgebracht hatten.“[75]
Aus dertschekistischenDienstauffassung heraus entstand eine Tradition, die durch Mythenbildung und Imagekampagnen innerhalb der Staatssicherheit und auch in der Bevölkerung Wurzeln fasste und weit über die Sowjetzeit hinaus fortgeführt wurde. Der Erfolg dieser Öffentlichkeitsarbeit war in den Ergebnissen diverser Meinungsumfragen ablesbar. In Bevölke