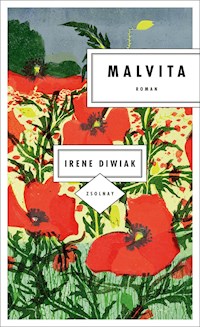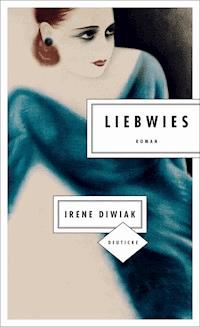9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von einer wahren Freundschaft in Zeiten des Krieges
München, 1941. Die zwei Studenten Hans und Alex scheint auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu verbinden – bis sie eines Tages den Wehrsport schwänzen, um über Kunst und Literatur zu diskutieren anstatt Appell zu stehen. Von da an entwickelt sich zwischen den beiden eine tiefe Freundschaft und Hans wird gern gesehener Gast auf Alex' Debattierpartys. Doch ihr ständiger Alltagsbegleiter ist der Krieg. Und immer stärker brodelt in ihnen der Wunsch, ihre Stimme dagegen zu erheben. Aber ihr Vorhaben ist gefährlich. Vor allem als Hans‘ jüngere Schwester Sophie nach München zieht, die unter keinen Umständen von ihrem Plan erfahren darf …
Irene Diwiak erzählt von einer wahren Freundschaft, von der wir noch nie auf diese Weise gelesen haben. Eine Geschichte der »Weißen Rose«, die nicht von ihrem Ende handelt, sondern von ihrem ganz besonderen Anfang – ergreifend, klug und nahbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Irene Diwiak, geboren 1991 in Graz, wuchs in der Steiermark auf. Für ihre literarischen Texte sowie ihre Theaterstücke wurde sie schon vielfach ausgezeichnet. Ihr Debütroman Liebwies (2017) stand bereits auf der Shortlist für den Debütpreis des Österreichischen Buchpreises. Drei Jahre später folgte ihr zweiter Roman Malvita. Bei C.Bertelsmann hat sie nun eine neue Verlagsheimat gefunden.
»Irene Diwiak schreibt klug, humorvoll und stark. Das mag böse wirken, denn sie löst in keiner Sekunde den Blick von der enormen Eitelkeit des Menschen und enthüllt damit die Brutalität des Banalen.« Marija Bakker, WDR5, über »Liebwies«
»Ab und zu gibt es dann doch diese jungen Autorinnen, die richtig Freude daran haben, sich wilde Geschichten auszudenken.« Andrea Diener, FAZ, über »Liebwies«
»Irene Diwiaks erstaunlich facettenreicher Erstlingsroman erzählt von Geltungssucht, Eitelkeit und falscher Gier nach Ruhm und Erfolg.« Dorothea Hußlein, BR Klassik, über »Liebwies«
www.cbertelsmann.de
Irene Diwiak
Sag Alex, er soll nicht auf mich warten
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2023 C.Bertelsmann
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagabbildung: © Arcangel/Rekha Arcangel;
© shutterstock/Penpitcha Pensiri; Olga Pink
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28676-7V002
www.cbertelsmann.de
18. Februar 1943.
Jetzt haben sie zwei verhaftet, ein Mädel und einen jungen Mann, Genaues weiß man nicht. Nicht wirklich verhaftet, es ist nur der Hausmeister, der sie an den Ärmeln hält, der kleine Wicht ganz groß, sogar das Mädel überragt ihn, kann man das Verhaftung nennen? Hat was mit den Papieren zu tun. Nicht mit ihren Papieren, du Dummkopf, mit dem Papier im Lichthof unten. Könnten auch Butterbrotpapiere sein, Papier ist Papier, da muss ein Hausmeister schon durchgreifen, für was hat man ihn denn. Hast du eines aufgehoben? Ich auch nicht, bin ja nicht lebensmüde. Ist eben doch noch etwas anderes als Butterbrotpapier. Schlimm ist das aber schon, und das gerade jetzt, wo uns Stalingrad noch so im Magen liegt, da sollte man auf Erbauung setzen und nicht auf Zersetzung bauen. Kopf hoch, Kameraden! Kopf hoch, Mädel! Ist ja nichts bewiesen noch. Der Kerl schaut mir verdächtig aus, der hat so etwas Verschlagenes an sich, aber dieses Mäuschen doch nicht, Augen wie Haselnüsse. Hast du’s gelesen? Ich auch nicht, aber Frauen schreiben so was nicht, na also. Hält der sie dennoch vehement am Ärmel festgekrallt, sieht die etwa aus, als wollte sie türmen? Auch Hausmeister irren einmal, sind auch nur Übermenschen. Und wenn’s doch sie war, die die Blätter in den Lichthof gestoßen hat, dann war es eben nur ein Versehen. Und wenn’s doch Absicht gewesen ist, dann hat sie’s eben nicht gelesen. Hast du’s etwa gelesen? Na siehst du, ich auch nicht. Könnte auch Butterbrotpapier gewesen sein. Ist nur leider eben kein Butterbrotpapier. Ist die Polizei jetzt endlich eingetroffen? Gut so, muss man aufklären, die Sache, Worten werden Taten folgen, haben wir Deutsche denn nicht schon genug Probleme? He du da, hüte deine Zunge, sonst kannst du gleich mitgehen mit den beiden und ab aufs Revier und rein in die Zelle. Ich glaube ja immer noch, dass sich das aufklären wird. Den Burschen kenn ich doch vom Sehen her, der ist Mediziner, und bei der Wehrmacht ist er auch. Alle sind bei der Wehrmacht, aber manche sabotieren und treiben Meuterei, das sind die Schlimmsten. Und was soll das heißen, der ist Mediziner? Was hat der Eid auf den Hippokrates mit dem Eid auf den Führer zu tun? Weniger als nichts, sage ich. Und ich sage: Bubenstreich, Jugendsünde, reine Dummheit. Das wird sich aufklären. Ach was, die zwei sehen wir nicht mehr wieder. Studienverweis? Mindestens. Die haben nichts zu tun damit, das steht fest, seht doch, wie gefasst die sind, die lassen sich nicht abführen, die marschieren ganz brav, wenn auch nicht unbedingt im Stechschritt, so doch festen Schrittes, geht denn einer so brav mit, der schuldig ist? Unschuldig sind sie vielleicht, aber wiedersehen werden wir sie trotzdem nicht mehr. Ach was. Beinahe sehen die ja fröhlich aus, ernst schon, aber irgendwie auch erleichtert. Marsch, marsch, und ein paar Uniformierte sammeln inzwischen die corpi delicti ein. Corpora, corpora, die Mehrzahl dekliniert auf -ora, konsonantisches Neutrum, Herr Kommilitone! Mir doch egal, die Butterbrotpapiere eben, weg damit und weiter wie zuvor. Weiter zur nächsten Lehrveranstaltung, hier gibt es nichts zu sehen, bald geht’s an die Front, da werdet ihr erst gaffen! Marsch, marsch!
Aber auf einmal bleibt der junge Mann stehen, die halbe Aula ist schon durchschritten, das Mädel schaut mit großen Augen. Widerstand gegen die Staatsgewalt, jetzt also doch?
Über die Schulter hinweg ruft er, irgendjemandem oder uns allen zu: »Sag Alex, er soll nicht auf mich warten!«, dann wird er unsanft weitergetrieben, marsch, marsch, und ratlos bleiben wir Kommilitoninnen, wir Kommilitonen zurück.
Sommer 1941.
Seltsam, denkt Hans, vor nicht allzu langer Zeit wäre ihm ein Tag wie dieser noch als ideal erschienen. Das frühe Aufstehen in der Kaserne, traute Kameradschaft, sich waschen aus eisernen Schüsseln, einer neben dem anderen, auch das ist Vagabundentum. Das Anziehen der Uniform und die Hoffnung auf eine bessere irgendwann, auf Rang und Namen. In Stille beten während des Frühstücks, schlechter Kaffee und trockenes Brot, auch das ist Fasten. Dem Herrn für alles danken und um einiges bitten, dann ab in die Universität und den Vormittag in geistiger Betriebsamkeit verbringen. Hans hat mehr Fächer belegt als alle, die er kennt. Der Mensch besteht ja nicht aus Haut, Knochen und Blut allein, da reicht die Medizin nicht aus, um den Menschen als Ganzes zu erfassen. Am liebsten sitzt Hans bei den Philosophen im Vorlesungssaal. Dem Führer ist es schnurzegal, ob man etwas lernt oder nicht, solange man nur ja pünktlich zur Wehrsportübung erscheint, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper und so weiter. Körperliche Ertüchtigung an der frischen Luft wie früher mit den Jungens in Ulm. Abends dann an ein Mädel schreiben, irgendeines. Patriotische Lieder singen. Keine Zeit für Trübsal.
Wie sich ein Mensch verändern kann, und dabei sind nur wenige Jahre vergangen.
Hans tritt in die Pedale. Jedes Mal kostet es ihn ein wenig mehr Mühe, das Fahrrad ist alt, er muss bald ein neues kaufen, und würde er nicht jede Reichsmark, die ihm in die Finger kommt, beim Buchhändler auf dem Tresen liegen lassen, hätte er das Geld sicher schon beisammen. Aber gerade die philosophischen Werke sind so unglaublich teuer und so wahnsinnig interessant, da muss er eben noch etwas länger auf dem alten Drahtesel hocken. Wenn man nur mehr Zeit zum Lesen hätte und der Staat einem nicht ständig im Nacken säße.
In der Ferne hört Hans Kirchenglocken, ein einzelner harter Schlag, die Mittagsstunde ist vorüber. Er tritt fester in die Pedale, immer fester, das Fahrrad scheint davon aber unberührt, es wird nicht schneller. Er fragt sich, ob es technisch möglich ist, dass sein eigener Widerwillen sich auf die Räder unter ihm überträgt und ihn ausbremst. Technisch vielleicht nicht, möglich ist es trotzdem. Ein paar Mädchen grüßen und winken lauthals vom gegenüberliegenden Gehweg herüber, Hans dreht sich nach ihnen um, nein, die kennt er nicht, kommt dabei ein wenig ins Wanken und fährt fast einen Zeitungsstand nieder. Was grüßen die so? Ach ja, er trägt die Uniform. Dumme Puten, wegen denen wäre er fast hingefallen. Sind aber noch ganz jung und im festen Glauben, ein jeder Soldat ist ein Held oder zumindest ein toller Hecht. Dumme Puten und dummer Zeitungsstand, der ihnen das mit seinen fetten Schlagzeilen und den feschen Kerlen auf den Frontseiten überhaupt erst eingebläut hat. »Unsere glorreiche Wehrmacht im Osten«, »unsere glorreiche Wehrmacht im Westen«, unsere glorreiche Wehrmacht hier und dort und überall. Und ein winzig kleiner Teil dieser Wehrmacht wäre jetzt beinahe höchstpersönlich in den Zeitungsstand hineingekracht. Die Mädchen auf der anderen Seite drüben kichern nicht einmal, die sind einfach weitergegangen. Doch kein so toller Hecht. Der Standbesitzer schimpft, einen Stapel Zeitungen hat Hans bei seinem Manöver vom Verkaufstisch gefegt. Der Völkische Beobachter, ausgerechnet. Sollen die Blätter ruhig liegen bleiben im Dreck, Hans ist ohnehin knapp dran. Zu spät bei der Wehrsportübung erscheinen, das ist ganz und gar undeutsches Verhalten, das wird streng geahndet. Der Zeitungsmann schwingt noch kurz und eher komisch als bedrohlich die Faust über dem Kopf, wie ein gehörnter Ehemann im Bühnenschwank, aber die Mühe, das lahmende Fahrrad zu verfolgen, macht er sich dann doch nicht. Der Völkische Beobachter ist diese Anstrengung nicht wert, da scheint er vielleicht gar nicht so anders zu denken als Hans.
Natürlich hätte Hans es sich auch leichter machen können. Die anderen aus seiner Kompanie rauchen jetzt im Kasernenhof, der vor dem Krieg noch ein Schulhof gewesen ist, gerade ihre letzten Zigaretten und machen sich dann in aller Gemütlichkeit auf den kurzen Weg zum Sportplatz hinüber. Hans aber ist über Mittag nicht wie alle anderen in die Kaserne ins Westend zurückgekehrt. Für sein Studentenzimmer zahlt er trotz vorgeschriebener Kasernierung immer noch Miete, irgendwo muss man ja die vielen Bücher unterbringen und zwischendurch auch sich selbst, wenn man es sonst nicht mehr aushält. In seinem Zimmer hat er wenigstens Ruhe, und durch das Fenster kann er in den Blumengarten der Nachbarin blicken. Es blüht jetzt nicht mehr allzu viel, aber herrlich grün ist es doch, und außerdem genießt Hans jeden Augenblick, der ihm nicht von oben vorgeschrieben wird. Und zur Strafe dafür kommt er jetzt ordentlich ins Schwitzen. Unerhört gutes Wetter eigentlich für Zeiten wie diese. Als würde die Sonne alles billigen, was auf der Erde so passiert. Na, wenigstens kann sie nichts dafür.
Hans lässt das Fahrrad achtlos in die Büsche fallen nahe des Kasernentors. Wenn’s ihm gestohlen wird, ist es ein kleiner Verlust verglichen mit dem Disziplinarverfahren, das ihn mit großer Sicherheit sein nächstes freies Wochenende kostet. Bei dieser Wetterlage muss man auf den Jochberg rauf oder an den Starnberger See, man darf seine Zeit nicht einfach in der dunklen Kaserne versitzen, das darf man seiner Seele nicht antun.
Als Hans am Sportplatz ankommt, steht noch niemand in Habachtstellung, kein bellendes Kommando durchschneidet die schwüle Sommerluft, er hat es geschafft, er ist pünktlich. Noch ist da kein Heer, noch ist da nur ein Haufen junger Leute. Ein Schulhof wie früher, allerdings mit sehr großen Kindern, deren Mütter sie zufällig alle gleich angezogen haben. Die einen plaudern und lachen, die anderen kicken eine Dose hin und her, ein paar Übermotivierte messen sich im Armdrücken und machen Liegestütz um die Wette, nur wenige stehen etwas abseits und wirken in der Masse so verloren wie er selbst. Allzu lang kann Hans allerdings nicht verschnaufen, da wird schon zum Appell gebrüllt. Auf der Stelle werden die Studenten zu Soldaten, stehen stramm. Wenn wir sonst schon nichts lernen in dieser Welt, uns in schnurgeraden Linien aufstellen können wir sekundenschnell. Wer weiß, wann man’s noch brauchen kann. Der Kommandant kontrolliert die Anwesenheiten von A bis Z, bis zum S ist es lang. Was man Zeit vertun kann.
Aberer? – Jawohl! Achleitner? Jawohl! – Biedermann? Jawohl!
Was man Jugend verschwenden kann.
Scholl? – Jawoll!
Was für ein dummer Reim, und nie schafft er es, das »o« im »Jawohl« ordentlich zu dehnen, um diesen Kalauer zu umgehen, das hat er sich doch vorgenommen. Auch egal. Weiterstehen und starren bis Z.
Als endlich der letzte Name aufgerufen und die Gruppeneinteilung für die geplante Übung erfolgt ist, machen sich alle wie befohlen auf zu ihren Abschnitten. Hans’ Nebenmann jedoch, Hans hat ihn bisher kaum wahrgenommen, schert aus. Geht einfach weg. Und keiner sonst scheint etwas zu bemerken, jetzt, wo alles in Bewegung ist, geht der einfach auf das Waldstück zu, übersteigt die niedrige Sportplatzumzäunung mühelos mit seinen langen Beinen und verschwindet dahinter mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre es der Kommandant höchstpersönlich gewesen, der ihm dieses Davonstehlen aufgetragen hat. Hans denkt nach. Denunzieren? Wozu? Um dem System zu dienen? Dass ich nicht lache. In Ruhe lassen? Das wäre möglich, aber dann gewinnt doch die Neugier. Eben hätte er noch bereitwillig sein Fahrrad geopfert, um einer möglichen Strafe zu entgehen, jetzt riskiert er eine viel höhere ohne jeden Grund. Blickt sich noch einmal um, alle scheinen beschäftigt, keiner aufmerksam, auch der Kommandant nicht. Hans holt noch einmal tief Luft und marschiert dem anderen hinterher, über das Zäunchen in den Wald hinein, in die Freiheit.
Da sitzt er schon, der lange Kerl, im Schatten eines Baumes, Hans den Rücken zugekehrt. Weit ist er ja nicht gewandert, gerade dem Sichtfeld des Sportplatzes entschwunden hat er sich schon niedergelassen auf seiner Uniformjacke, die wie eine Picknickdecke auf dem Waldboden ausgebreitet liegt. Da kauert er jetzt im Ruderhemd, Hans kann es nicht genau erkennen: Liest er? Komischer Kauz. Vorsicht sieht anders aus. Wahrscheinlich blättert er in einem dieser Schundhefte, die sie in der Kaserne so gerne herumreichen, reine Papierverschwendung, wenn man Hans fragt. Nerven hat der schon, den Wehrsport zu schwänzen für so einen Mist, und doch, Hans tritt näher. Das trockene Geäst knirscht ein wenig unter seinen Stiefeln, der andere scheint ihn nicht zu hören und blättert unverdrossen weiter. Über dessen Schulter hinweg kann Hans jetzt endlich erkennen, was er liest. Kein Heft ist es, sondern ein Buch, und was für eines, ein prächtiger Bildband. Die auf den Fotos Dargestellten tragen zwar wie erwartet alle keine Kleider, aber das müssen sie auch nicht, sie sind aus Stein.
Rodin!, ruft Hans erstaunt.
Der andere zuckt erschrocken zusammen, geräuschvoll fällt ihm das Buch aus der Hand. Er muss Hans für einen Vorgesetzten halten oder sonst einen, der ihm wegen dieser Sache Ärger machen kann. Er rappelt sich auf und versucht gleichzeitig, die Jacke wieder anzuziehen, und versucht gleichzeitig, zu salutieren, und versucht gleichzeitig, eine Entschuldigung hervorzubringen, und versucht gleichzeitig, das alles mit einer gewissen Lässigkeit zu tun, als wolle er sagen: Komm schon, Kamerad, mach mir wegen dieser Lappalie kein Drama. Hans kann nicht anders. Er lacht los. Da weiß der andere: Drama wird es mit dem keines geben.
Kampfgeschrei dringt vom Sportplatz her, eins zwo drei los, der andere lacht jetzt auch, hängt nur mit einem Arm im Ärmel seiner Jacke drin, noch dazu im falschen.
Sie haben vielleicht Nerven, mich so zu erschrecken, sagt er, na, da haben Sie Glück gehabt, dass ich nur das Buch hab fallen lassen und nicht die gute Flasche.
Jetzt erst bemerkt Hans die dunkelgrüne Weinflasche im Moos.
Ja, um die wäre es schade gewesen, sagt er, aber um den Rodin auch.
Ein Buch zerbricht ja nicht, erwidert der andere, ich heiße übrigens Alexander Schmorell. Wenn Sie wollen, trinken wir auf der Stelle Bruderschaft, dann bin ich nämlich nur noch der Alex, das ist kürzer.
Hans, sagt Hans und streckt ihm die Hand hin: Kürzer geht es nicht mehr.
Und mit Nachnamen?
Scholl.
Hans Scholl, wiederholt Alex und schüttelt ungläubig den Kopf, kürzer geht es ja wirklich nicht mehr.
Dann bückt er sich nach der Flasche und zieht den Korken heraus.
Sommer 1941.
Es wird ein Ritual. Sie kommen am Sportplatz an, beide immer fast zu spät, auch Alex verbringt so viel Zeit wie möglich fernab der Kaserne, pfeift auf die Vorschriften und schläft meistens sogar zu Hause. Sie werfen die Fahrräder ins Gebüsch, laufen durchs Kasernentor und schaffen es gerade noch rechtzeitig zum Appell. Manchmal kommt es aber auch vor, dass Alex viel zu spät dran ist, dann muss Hans zwei Mal hintereinander sein ungeliebtes »Jawoll« abfeuern, zuerst bei »Schmorell«, gleich darauf wieder bei »Scholl«. Das ist natürlich schrecklich riskant, aber erstaunlicherweise funktioniert es jedes Mal. Überhaupt wundert sich Hans darüber, was alles möglich ist, wie leicht sich die straffe deutsche Organisation hintergehen lässt, vermutlich, weil niemand damit rechnet, dass jemand so etwas überhaupt versuchen könnte. Bis der Kommandant bei Z ist, hat es dann auch Alex immer schon geschafft, reiht sich unauffällig irgendwo auf der Seite ein und steht dafür ganz besonders brav stramm, eine schwarze Aktentasche unterm Arm, halb hinter seinem Rücken verborgen, er hat schon einige Routine darin, sie zu verstecken. Wenn es dann zur Gruppeneinteilung für die Übungen geht, marschieren zwei Soldaten zielsicher quer über den Platz und übersteigen in militärischer Synchronität das Zäunchen Richtung Wald. Sollte sie jemals jemand dabei beobachtet haben, so muss der Zeuge davon ausgegangen sein, dass diese Abweichung vom Üblichen schon irgendwie seine Richtigkeit hat, gemeldet werden sie nie.
Im Schutz der Bäume entledigen sie sich ihrer Uniformjacken, Alex zieht eine frische Flasche Wein aus der Aktentasche, und die Bücher, man sehe und staune, was alles in so eine Tasche passt, sogar der Rodin-Ziegel geht hinein mit ein wenig Pressen. Hans will Zigaretten beisteuern, aber Alex hat immer eine Pfeife im Mund, sogar dann, wenn ihm der Tabak gerade ausgegangen ist.
Es ist doch schön, sie immer wieder zu den Lippen zu führen wie die alten Dichter und Denker, sagt er, Hans solle es auch einmal versuchen, es lebt sich gleich ganz anders.
Nein du, lass mal, entgegnet Hans, da bleib ich lieber bei den Zigaretten und dem echten Rauch. Willst du auch eine?
Alex zuckt mit den Schultern: Na, zwischendurch kann eine Zigarette nicht schaden. Auch wenn sie ein bisschen banal ist.
Dann rauchen sie und trinken und blättern, Alex’ Bücher handeln alle von Kunst.
Rodin ist der Beste, sagt er, und die Bildhauerei überhaupt das Spannendste.
Er selbst versucht sich ebenfalls in der Kunst, im Moment noch bei Privatlehrern und in Kursen, schwer zu sagen, ob einmal mehr daraus wird, schön wäre es schon. Ansonsten ist er Mediziner wie Hans, nur weniger fleißig, und wenn eine Vorlesung nicht allerdringlichste Anwesenheit erfordert, geht er gleich gar nicht hin.
Rodins Werke habe ich gesehen in Paris, sagt Hans.
Du warst in Paris?
Ja. Westfeldzug.
Hans hat nicht viel anderes zu tun gehabt dort: Die Franzosen haben sich nicht gerade gewehrt, sind eher abwartend um ihre Besatzer herumgeschlichen, während die Deutschen sich die besten Häuser und die teuersten Stücke unter den Nagel gerissen haben, Hans ist ganz schlecht geworden vor Scham für seine Landsleute. Da ist er in die Hauptstadt gefahren und dort ins Museum gegangen. Endlich hat sich der teure Fotoapparat auch einmal bezahlt gemacht, denn im Lazarett, wo er seinen manchmal furchtbaren, manchmal furchtbar langweiligen Dienst verrichtete, gab es zwar vieles zu sehen, nichts aber zu fotografieren. Schlimm genug, alles Elend während der Arbeit vor Augen zu haben, in seiner Freizeit hat Hans das Schöne gesucht. Wo die Fotos jetzt wohl sind? Müssen eigentlich noch bei den Eltern zu Hause herumliegen, sie sollen sie ihm bei Gelegenheit schicken, oder Alex kommt in den Ferien einmal mit nach Ulm, das wäre überhaupt eine gute Idee.
Westfeldzug, wiederholt Alex, da war ich auch dabei, aber nicht in Paris, leider.
Er seufzt und nimmt einen großen Schluck Wein: Was glaubst du, wann werden die uns wieder verschicken, und wohin?
An so einem Nachmittag können sie zu zweit schon einmal eine ganze Flasche versaufen, da müssen sie gut aufpassen, dass sie den Ruf zum Schlussappell nicht versäumen und sich dann auch nichts anmerken lassen von ihrem kleinen Rausch. Alex sagt, weil er in Russland geboren worden ist, vertrage er ganz besonders viel, aber so ganz stimmt das nicht, manchmal schwankt er schon ganz schön benebelt über den Sportplatz.
Als sie den dicken Rodin durchhaben und auch die kleineren Bücher und Hefte zur Bildhauerei, meint Hans, jetzt sei er einmal dran. Er kauft sich ebenfalls eine Aktentasche (neues Fahrrad, warte noch ein wenig) und steckt dort seine Philosophen hinein: Nietzsche in der Gesamtausgabe. Strahlend legt er die Bücher vor Alex hin.
Na, was sagst du?
Da werden wir eine Zeit lang dran zu knabbern haben, sagt Alex und rümpft die Nase.
Natürlich, antwortet Hans, aber es ist lohnende Lektüre.
Ich weiß nicht, sagt Alex, Philosophie …
Er zuckt mit den Schultern und kaut ein bisschen an dem Mundstück seiner Pfeife herum: Es gibt einen Gott, oder, und was braucht man mehr?
Hans fällt es schwer, sich seine Entrüstung nicht allzu sehr anmerken zu lassen, etwas ins Stammeln kommt er dennoch:
Aber … Nietzsche … was er sagt über die heutige Kultur … Form ohne Inhalt … und über den freien Menschen und …
Mag sein, sagt Alex, lies du deinen Nietzsche, und ich lese etwas, das mir gefällt.
So machen sie es dann auch, aber so ganz will Hans das nicht auf sich sitzen lassen. Er ist doch ein verständiger Mann, dieser Alex, warum sträubt er sich so gegen die höchste Form des Denkens?
Beim nächsten Mal kommt Hans wieder mit seiner Aktentasche an, ein einziges Buch liegt darin. Alex streckt sich lang auf dem Waldboden aus und blickt neugierig zu Hans hinauf.
Na, versuchst du’s wieder mit der Philosophie?
Aber Hans schmunzelt nur ein bisschen, dann zieht er das Buch hervor. Alex reißt die Augen auf.
Noch nie haben die beiden über Politik gesprochen. Stumm sind sie darauf übereingekommen, dass es absolut in Ordnung ist, jede Woche den Wehrsport zu schwänzen, ob aus reiner Trägheit oder anderen Gründen, das ist zwischen ihnen nicht ausgemacht.
Am 1. April 1924 hatte ich, auf Grund des Urteilsspruches des Münchner Volksgerichts von diesem Tage, meine Festungshaft zu Landsberg am Lech anzutreten.
Hans liest mit fester Stimme vor. Überspringt die elendslange Widmung, liest weiter über Hitlers Elternhaus, oder besser gesagt seine Forderung, Deutschösterreich mit dem Altreich zu vereinen: Der Pflug ist dann das Schwert, und aus den Tränen des Krieges erwächst für die Nachwelt das tägliche Brot.
Alex schaut ihn immer noch mit großen Augen an.
Na, was ist es jetzt, fragt Hans plötzlich und blickt vom Buch auf: Ist es jetzt ein Pflug oder ein Schwert, oder steht hier eine Metapher für eine Metapher, und seit wann wächst Brot wie Gemüse aus der Erde, pardon, aus den Tränen?
Alex’ angespanntes Gesicht lockert sich, er zieht die Lippen zu einem breiten Grinsen auseinander.
Nein warte, ruft Hans, da gibt es noch sehr viel Komisches …
Er überblättert ein paar Seiten: Hier zum Beispiel, im vonStrahlen deutschen Märtyrertums goldenen Innstädtchen ist er geboren, hört, hört, deutsches Märtyrertum also färbt ganze Städte ein, oder meiner Meinung nach besonders gelungen: Als der Dreizehnjährige aber siebzehn Jahre alt geworden ist, na, das schafft auch nur der Vater unseres Führers, als Dreizehnjähriger siebzehn Jahre alt zu werden, oder das …
Er blättert, aber Alex ist schon in ein lautes Lachen ausgebrochen, hält ihm bebend die Weinflasche hin: Da, bitte, trink und hör auf zu lesen, das hält man ja im Kopf nicht aus.
Dabei bin ich bei seinen politischen Abhandlungen noch gar nicht angekommen, protestiert Hans, zuerst müssen wir noch lesen, wie unser Führer für jeden einzelnen Beruf, in dem er sich versuchte, schlicht und einfach zu talentiert gewesen ist und so dann eben wohl oder übel unser Führer hat werden müssen …
Sie machen sich ein Spiel daraus, reichen das Buch hin und her, schlagen es auf und lesen laut vor, auf jeder Seite findet sich ein verunstalteter Satz, ein unpassender Vergleich, eine schiefe Metapher. Sie lesen einander Satzschlangen mit unendlich vielen Beistrichen vor und komisch umständliche Konstruktionen: Wie wäre Schiller aufgeflammt, wie würde sich Goethe empört abgewendet haben! Das denken sie auch bei diesem Machwerk, nur, dass Schiller sich gleich in spontaner Selbstverbrennung übt und Goethe gar ein Futur II im Konjunktiv bemüht, das ist dann doch etwas übertrieben. So viel Unsinn muss man mit Wein runterspülen, und das tun sie dann auch, auf jeden Satz einen Schluck, um nicht vollends zu verblöden.
Aber da sind auch Sätze, die lesen sie nicht, nicht laut, überfliegen sie stumm. Sätze, die einen schalen Geschmack auf ihren Zungen hinterlassen. Nichts lesen Hans und Alex vor über die Rasse, die Auslöschung des Judentums, das werte und das unwerte Leben. Noch nicht, nicht heute wollen sie darüber sprechen. Heute wollen sie ausgelassen sein und den Umstand begießen, dass sie sich gefunden haben. Sie lachen gegen die Sorgen an und gegen die Angst, die einen lähmen kann, wenn man nicht zu zweit ist.
1917–1921.
Im selben Jahr, in dem Alexander Schmorell in Orenburg am Ural geboren wird, bricht in Russland die Revolution aus.
Der Vater Hugo entstammt einer deutschen Familie, die sich schon vor Langem im Zarenreich niedergelassen und ein kleines Vermögen erwirtschaftet hat: Pelzhandel, Wagenbau, ein dampfbetriebenes Sägewerk, die Familie ist weitverzweigt und vielseitig begabt.
Die Mutter Natalija ist Russin, Tochter eines Priesters und bildhübsch, so zumindest wird Alex sich später an sie erinnern.
Sie sind ein ungewöhnliches Paar. Die Deutschen bleiben sonst eher unter sich, die Russen trauen ihnen nicht so recht, Vermögen ist ja nicht alles. Aber Natalija und Hugo blasen alle Zweifel in den Wind, sie haben sich gefunden, und dabei bleibt es, im Glauben und in der Liebe muss man stur sein, sagt Natalija. Sie heiraten nach orthodoxem Ritus in einer prächtigen Kirche, und Hunderte Heilige blicken von ihren goldenen Ikonen stolz auf sie hinunter.
Hugo ist weder Händler noch Handwerker, sondern Arzt. Er leitet ein Krankenhaus für Deutsche und Österreicher. Früher war er an der Universitätsklinik in Moskau, aber dort will man seit Kriegsausbruch keine Deutschen mehr haben, der Krieg hat die Deutschen nicht nur verdächtig gemacht, sondern zu Feinden. Als »Zivilkriegsgefangenen« hat man Hugo nach Orenburg geschickt, und Natalija ist ihm gefolgt. Das deutsche Krankenhaus dort ist wie alle Krankenhäuser ein Lazarett, die Betten voll belegt mit angeschossenen, mit halb zerfetzten Soldaten, und im Delirium fantasieren alle von Deutschland. Hugo versucht, nicht hinzuhören und fragt sich doch immer öfter, was werden soll, was nur werden soll mit diesem Land und mit ihnen.
Zu Hause aber herrscht uneingeschränkt Natalija und somit Russland: In jeder Ecke ein Diwan oder ein Samowar, prächtige Ikonen an den Wänden, von jedem Fenstersims blickt gütig mindestens eine Matrjoschka herab. Im Musikzimmer sitzt Natalija häufig am Klavier und spielt die Katinka und andere Lieder, auch als sie schwanger wird, spielt sie noch, sodass das Ungeborene zuallererst russische Volksweisen hört und nicht den Lärm des Krieges.
Was wird werden, fragt Hugo immer öfter, jeden Tag sieht die Lage bedrohlicher aus, von den alteingesessenen Deutschen ziehen immer mehr fort. Die alte Heimat lockt verheißungsvoll, die Worte der Auswanderer unterscheiden sich kaum von den Fieberwahnreden der Sterbenden, wieder versucht Hugo, nicht zuzuhören. Aber doch denkt er jetzt manches Mal ans Auswandern. Erst, als die Zeitungen die Abdankung des Zaren verkünden, wagt er es, vor Natalija diese Gedanken auszusprechen. Natalija reagiert, wie er es sich erwartet hat: Sie lacht ihm ins Gesicht. Sie sei eine russische Birke, sagt sie, fest im Permafrostboden verwurzelt, da gebe es kein Fortkommen, und ihr Kind komme hier auf die Welt.
Aber die Politik, entgegnet Hugo, die Revolution, der Zar ist abgesetzt, in der Stadt wird geschossen, in der Provinz lynchen die Bauern ihre Gutsherren, und Deutsche werden nach Sibirien verbannt, ob ihr das wirklich egal sei.
Egal nicht, erwidert Natalija, aber man müsse immer auf Gott vertrauen, und damit ist das Thema für sie erledigt.
Im September kommt ein Bub auf die Welt und heißt Alexander, wie sein Großvater mütterlicherseits, aber auch wie Puschkin. Ein Vorfahre väterlicherseits soll den Wagen gebaut haben, mit dem jener Alexander Puschkin, der russischste aller russischen Dichter, zu seinem letzten, weil tödlichen Duell aufgebrochen ist. Das ist eine Familienlegende, nicht verifizierbar, aber man erzählt sie sich immer wieder gern: So eng ist man einst mit der Geschichte dieses großen Landes verflochten gewesen, so unsanft stößt sie einen nun aus.
Die Geburt verläuft gut, das Kind ist gesund, auch Natalija erholt sich schnell. Einige Tage lang geht Hugo ganz auf im neuen Familienidyll, die Schreie seines Neugeborenen lassen ihn die Schreie der Patienten vergessen, aber nur kurz. Dann beginnen seine Gedanken nämlich wieder mehr und mehr um die Außenwelt zu kreisen: In Petrograd haben Bewaffnete die Regierung abgesetzt, die Bolschewiken übernehmen die Macht, man spricht von Bürgerkrieg.
Petrograd ist weit weg, sagt Natalija.
Man muss nur auf Gott vertrauen, wenn die deutschen Klagen zu laut in seinen Ohren klingen, versucht Hugo, sich diese russischen Worte in Erinnerung zu rufen, manchmal gelingt es ihm.
Eine junge, dicke Russin zieht bei ihnen ein, bisher ist sie Haushaltshilfe bei einem von Hugos Verwandten gewesen, nun soll sie Natalija mit dem Kindchen helfen. Die Russin schläft auf einem Diwan an Natalijas Seite, daneben die Wiege mit dem kleinen Alexander, den sie nur »Schurik« nennt, eine jener Koseformen, deren phonetische Metamorphose nur ein Russe nachvollziehen kann. Und die Kinderfrau selbst heißt für die ganze Familie bald nur noch Njanja.
Eines Tages beginnt Natalija plötzlich über Kopfschmerzen zu klagen. Hugo bringt ihr Pulver aus der Klinik mit, und Njanja kocht Tee aus geheimnisvollen Wurzeln, es hilft nichts. Später tut Natalija der Bauch weh, am nächsten Tag liegt sie mit hohem Fieber darnieder und kann nicht mehr aufstehen. Njanja pflegt sie mit Wickeln und Kräutern, nach kurzer Zeit aber geht sie dazu über, Tag und Nacht zu beten, mit beiden Händen Schurik an die Brust gedrückt, die Ikone der Gottesmutter immer fest im Blick. Wenn Natalija im Fieberwahn nach ihrem Kind schreit, darf Njanja es ihr nicht geben, das hat Hugo so verordnet. Er kennt die Krankheit, alle Krankheiten kennt er. Eine Epidemie nach der anderen schwappt über das Land, und die Ärzte können nicht mehr dagegen tun als die einfachen Mägde. Bete, Njanja, bete für uns. Zwei Wochen später ist Natalija tot. Ein schwarzer Wagen kommt angerollt, vorangespannt ist ein einziger magerer Gaul.
Man holt gar nicht mehr alle Toten, erzählen die Bestatter, die im Kampf Gefallenen zum Beispiel lässt man einfach in den Straßenrinnen liegen.
Gut ist’s nicht, sagt der eine, denn wenn der Sommer kommt, hat man wieder neue Seuchen am Hals, und alles beginnt von vorne, aber was soll man machen.
Dann tragen sie auf einer Bahre die Verstorbene hinaus, die noch ganz lebendig aussieht, und auch von Verwesungsgeruch keine Spur. Viel mehr liegt ein zarter Blütenduft in der Luft, wird Njanja später erzählen, so ist es, wenn Heilige sterben, und sie weint nicht mehr, sondern ist ganz still vor Ehrfurcht. Auch Hugo schweigt, und sogar Schurik ist ganz leise, obwohl er noch gar nichts verstehen kann, so glaubt zumindest Njanja.
Alle Freunde, die wenigen, die noch geblieben sind, sind sicher, dass Hugo jetzt gehen wird, dass ihn jetzt nichts mehr in Russland hält. Aber nach kurzer Trauerzeit sieht man ihn schon wieder frühmorgens durch die Straßen eilen, auf seinem Weg zum Krankenhaus. Jetzt kommen auch hier die Verletzten von den Straßenkämpfen in die Klinik, nicht mehr nur Deutsche, alles ist in Auflösung, die ganze Weltordnung durcheinandergeschmissen. Zu Hause erklingt keine Klaviermusik mehr, sondern Njanjas Gesang mit tiefer, kräftiger Stimme. Hugo ist stiller geworden, ernster, aber keinesfalls verzweifelt, eher sogar noch gefasster: Er fragt nicht mehr, was sein wird, über Politik redet er kaum noch, übers Auswandern kein Wort. Jeden Abend pilgert er mit Njanja und dem Kind gemeinsam zu dem kleinen Friedhof hinüber, pflegt Natalijas Grab mit Blumen und Kerzen, Njanja betet und singt. Es sind die ersten bleibenden, wenn auch noch zarten Erinnerungen, die Alex in seinem Leben macht: dichter Schnee und Menschen wie Bären, riesige Fellmützen, kehlige Laute, der Geruch von Sauerkraut und schwarzem Tee aus Fensterritzen, Marktstände und Pferdewagen, Straßenlärm, die Ruhe des Friedhofs, Njanja warm und weich, die Stimme kräftig, Natalija, für immer verstummt.
Als Hugo eines Abends sein Büro verlassen will, wartet vor der Tür bereits eine junge Krankenschwester. Er kennt sie natürlich, Tausende Male hat er ihr schon Befehle zugebellt: Skalpell!, Verbandszeug!, Zange!, jetzt ist es ihm peinlich, dass ihm ihr Name nicht einfällt. Sie sagt etwas von Halsschmerzen.
Wenn Herr Doktor vielleicht …? Nur zur Sicherheit …?
Sie spricht deutsch. Fast alle Krankenschwestern hier sind höhere Töchter von deutschen Bierbrauern oder Kunstwarenhändlern, in Russland alteingesessen und doch stolz auf ihre Herkunftskultur. Wäre kein Krieg, würde sie vermutlich in einer warmen Stube Goethe-Zitate auf Tücher sticken, statt in der Klinik Wunden zu nähen.
Hugo lässt sie eintreten, sie nimmt auf seinem Schreibtischstuhl Platz und öffnet weit den Mund, keine Entzündungen im Rachenbereich, das sieht er schon von Weitem. Trotzdem leuchtet er mit einer Lampe hinein, gepflegte Zähne, überhaupt ein sehr ansprechendes Äußeres, und weil sie Natalija dabei nicht im Geringsten ähnlich sieht, kann er ihren Anblick ertragen.
Da ist nichts Ungewöhnliches zu sehen, sagt er und legt die Lampe weg, aber wenn die Schmerzen schlimmer werden, empfehle er lange Fußmärsche in freier Natur. Die Krankenschwester lächelt dankbar und schaut ihm dabei zum ersten Mal direkt in die Augen: Wollen Herr Doktor mich vielleicht dabei begleiten?
In dem Moment fällt ihm auch ihr Name wieder ein: Elisabeth Hoffmann. Von da an unternimmt Hugo jeden Abend zwei Spaziergänge, einen mit Njanja und Schurik zu Natalijas Grab, später einen zweiten mit Fräulein Hoffmann in die Wälder. Sie ist sehr gut erzogen, redet nicht viel, weiß aber alles, Freundinnen und Verwandte schreiben ihr täglich aus allen Teilen des Reiches, schlimm sieht es aus überall. Anders als Natalija ist sie immer sehr bedacht, sie spricht und bewegt sich langsam, vorsichtig setzt sie Fuß vor Fuß, um in der Unebenheit nicht zu fallen. Ihren Halsschmerzen muss ein langer Prozess des Nachdenkens und Planens vorausgegangen sein, vermutet Hugo. Bei der Arbeit ist sie fleißig und zuverlässig. Oft spricht sie von Deutschland. Einmal nimmt er, während sie so spazieren gehen, ihre Hand in die seine, sie wird ein bisschen rot und lächelt. Dass er sie liebt, aber eben auf eine so andere Weise als Natalija, macht es für ihn erträglich.
Elisabeth und Hugo heiraten in einer kleinen, bescheidenen Zeremonie, viel ist nicht mehr da, was man auftischen könnte, viele sind nicht mehr da, die ihnen gratulieren.
Njanja nimmt es Hugo etwas übel, dass er sich so schnell wieder in die festen Hände einer Frau begeben hat, noch dazu in die einer Katholikin. Und dass Schurik eine Mutter braucht, lässt sie als Argument nicht gelten.
Ich bin ja da, sagt sie.
Und wenn ich nach Deutschland gehe?, fragt Hugo. Das erste Mal seit Langem spricht er davon.
Dann bin ich auch da, sagt sie.
Aber Elisabeth ist sehr geschickt im Umgang mit Njanja, sie lässt der Dicken im Großen und Ganzen ihren Willen und mischt sich bei der Kindererziehung nicht ein. Nur manchmal, wenn Njanja gerade nicht im Zimmer ist, drückt sie Schurik heimlich an sich und flüstert ihm ein paar deutsche Worte ins Ohr, zumindest die Sprache soll er doch lernen.
Nach einigen Wochen Ehe sitzt Elisabeth dann blass und blümerant in ihrem Sessel und kaut eine Scheibe hartes Brot, etwas anderes verträgt sie nicht mehr.
Du weißt, was das bedeutet, Hugo.
Und draußen übernehmen die Bolschewiken immer mehr Macht, und immer mehr Weißgardisten schleppen sich in die Klinik, Demokraten und Monarchisten bunt gemischt, sonst können sie einander nicht ausstehen und Deutsche noch weniger, aber angesichts der bösen Lage kämpfen sie Schulter an Schulter und tragen gemeinsam ihre eitrigen Wunden zum deutschen Doktor.
Du weißt, was das heißt, Hugo, hier ist keine Zukunft mehr für die Kinder.
Und bald darauf macht Hugo sich ein letztes Mal auf den Weg zu seiner Natalija. In seiner Jackentasche trägt er bereits die erforderlichen Ausreisepapiere. Elisabeth und er selbst sind immer deutsche Staatsbürger geblieben, dadurch ist auch Schurik offiziell als Deutscher geboren, da dürfte die Aus- und Einreise nicht allzu schwierig werden. Bei Njanja sieht die Sache anders aus, er wird sie als Gattin eines verstorbenen Verwandten ausgeben müssen, auch dafür hat er die nötigen Papiere, ob’s die Grenzsoldaten schlucken, das wird man sehen.
Ab jetzt heißt du Franziska, Njanja, hörst du, Franziska Schmorell.
Njanja zuckt mit den Schultern. Soll man sie nennen, wie man will, sie wird doch immer die Alte bleiben, und Russin.
Elisabeth hat das Nötigste in einen Koffer gestopft, mehr können sie nicht mitnehmen. Njanja holt den Samowar aus ihrer Kammer, der muss mit, sie besitzt ja sonst nichts, den und ihre Heiligenbilder. Das wenige Gepäck steht abfahrbereit im Vorraum, gedankenverloren wandeln die Erwachsenen noch ein letztes Mal durch die hohen, trauten Räume, nur so wenig können sie mitnehmen, den Rest werden wohl oder übel bald die Bolschewiken holen. Schurik tappt hinter ihnen her, sein Blick wandert nervös von einem zum anderen, Abschied ist ein großes Wort für ein so kleines Kind. Ein letztes Mal betrachtet Hugo das Klavier, an dem Natalija gespielt hat, das Bett, in dem sie starb. Dann drückt er Elisabeths Hand, und sie machen sich alle vier auf den Weg.
So jedenfalls erzählt Alex die Geschichte.
Sommer 1941.
Alex lebt immer noch bei seinen Eltern, oder, wie er gerne präzisiert, bei seinem Vater und seiner Stiefmutter. Die Villa der Schmorells ist eindrucksvoll elegant, davor hockt auf einer Gartenbank ein etwa sechzehnjähriges Mädchen und liest. Das muss Natascha sein, denkt Hans, Alex’ Halbschwester, von der hat er ihm schon einmal erzählt. Und einen Halbbruder soll es auch noch geben, nur ein wenig jünger als Alex und momentan irgendwo zum Kriegsdienst eingezogen. Viel mehr weiß Hans nicht über diese Familie, denn wenn Alex von seiner Kindheit erzählt, kommt er selten weiter als bis zur Flucht, seine Geschichte endet an der russischen Grenze.
Als Hans näherkommt, blickt Natascha von ihrem Buch auf und grüßt ihn erst auf Russisch, dann scheint ein Schalter in ihr umzukippen, mit entschuldigendem Lächeln sagt sie in breitem Bayrisch: »Gehn’s nur rein, die andren sind alle schon drin.«
Die anderen – Hans hat gedacht, es sind nur ein paar Freunde –, die anderen, das sind dreißig oder vierzig Personen, die sich da im Wohnzimmer drängen. Manche von ihnen sitzen um einen großen Tisch herum, der sich zu biegen droht unter gefüllten Eiern und Honigkuchen und Gläsern mit Eingemachtem. Andere knautschen in Polstermöbeln, dazwischen stehen die Restlichen in Grüppchen, alle in angeregte Gespräche vertieft. Oben an der Decke sammelt sich grau der Zigarettennebel, darunter ist alles bunt, die Möbel, die Tapeten und die Kleider der Frauen, Gläser klirren, der Samowar blubbert behaglich. Und alle hier scheinen Russen zu sein oder Künstler oder beides, Hans kommt sich ein wenig fehl am Platz vor in seinem guten, hellen Sommeranzug, blickt sich Hilfe suchend nach Alex um, wo ist der denn bloß? Eine blonde Dame kommt auf ihn zu, in ihren Händen ein Tablett, darauf viele kleine Gläser gefüllt mit klarer Flüssigkeit und ein Teller saurer Gurken.
Sie müssen ein Freund von Schurik sein, sagt sie ohne zu lächeln und drückt Hans ein Glas in die Hand.
Von wem?, fragt Hans.
Von Alex, verbessert sie sich. Nehmen Sie ruhig!
Sie weist mit dem Kinn auf die Gurken: In Russland muss man beim Wodkatrinken immer auch einen Bissen essen, das gehört einfach dazu!
Hans hat saure Gurken bisher nur mit Brot oder im Salat gegessen, will die Dame aber nicht enttäuschen. Der Wodka brennt seine Kehle hinunter, die Gurke prickelt auf der Zunge.
Sie kennen Schurik … Alex … vom Sport, oder nicht?, fragt die Dame in höflichem Tonfall, ihr Blick aber bleibt unverändert streng.
Hans muss ein wenig grinsen, na, wenn man das Sport nennen will, antwortet aber brav: Vom Militärsport, gleiche Studentenkompanie, wir studieren aber auch miteinander, sind uns im Hörsaal nur irgendwie nie über den Weg gelaufen.
Aha, aha, die Dame nickt, Alex geht ja auch nicht allzu oft hin, nicht wahr?
Hans weiß nicht, was er darauf sagen soll, welche Antwort sie sich erwartet, und zuckt einfach mit den Schultern.
Was aus dem Jungen einmal werden soll, murmelt die Dame und schielt währenddessen schon zum großen Tisch hinüber, wo der Berg gefüllter Eier auf ein alarmierend kleines Häufchen zusammengeschrumpft ist.
Wo Njanja bloß steckt, murmelt sie, dann fragt sie geistesabwesend: Wollen Sie Tee?
Hans will die Dame nicht länger aufhalten, aber ohne seine Antwort abzuwarten, sagt sie: Ich bringe Ihnen Tee!, und verschwindet in der Menge.
Hans bleibt zurück, wieder ein bisschen verloren. Um ihn herum wird russisch gesprochen, er hört sich die fremden Laute an wie ein Konzert. Mitreißend sind die Reden überall, crescendo, forte, fortissimo, eine stark geschminkte Frau schlägt mit der Faust auf einen Beistelltisch, alle Gläser darauf wackeln, eines fällt um. Dort wird gelacht, hier und da verschwörerisch gemurmelt, das Murmeln bildet den Kontrapunkt, auch Deutsches ist darunter, Hans kann es aber nicht verstehen, egal, wie angestrengt er auch lauscht.
Bitte schön, der Tee!
Es ist nicht die Dame von vorhin, die Hans die dampfende Tasse überreicht, sondern Alex. Er strahlt über das ganze Gesicht, trägt eine weite, weiße Bluse und das Haar ziemlich ungekämmt, sieht aus, als wäre er eben noch durch die asiatische Steppe geritten und nur aus Versehen hier mitten in München gelandet. Hans nimmt dankend die Tasse entgegen.
Ist heiß, warnt Alex, aber es lohnt sich!
Heiß ist der Tee tatsächlich und unvergleichlich stark, auf eine wohltuende Weise bitter wie teurer Tabak, auch ein bisschen süß. Hans zieht anerkennend die Augenbrauen hoch.
Das ist echter russischer Tee aus einem echt russischen Samowar, sagt Alex, daran liegt’s.
Du hast mich aber warten lassen, beschwert sich Hans, eigentlich im Spaß und doch ein bisschen vorwurfsvoll: Deine Mutter hat mich ganz schön streng gemustert.
Ach, meine Stiefmutter, sagt Alex und verdreht die Augen. Im Moment kann ich es ihr einfach nicht recht machen, und alles, was ich mag, lehnt sie von vornherein ab. Und jeden, den ich mag. Nimm’s nicht persönlich. Und jetzt komm mit!
Fröhlich schiebt Alex sich durch die Menschenmenge, wirft dorthin ein russisches, dahin ein deutsches Wort, einmal zeigt er auf einen älteren Herrn, der mit einigen anderen Männern ins Gespräch vertieft ist: Das ist mein Vater, aber ich muss dir zuerst noch wen anderes vorstellen!
Hans weiß, dass Alex’ Vater ein angesehener Orthopäde mit eigener Praxis ist, und hat sich immer gewundert, wie Alex bei dem familiären Hintergrund so wenig medizinischen Ehrgeiz aufbringen kann. Andererseits, Hans’ Vater betreut Treuhandfonds und er selbst schafft es nicht, auch nur einen Pfennig zur Seite zu legen.
So ist das manchmal mit Vätern und Söhnen, denkt Hans und folgt Alex an der diskutierenden Herrenrunde und den reich bestückten Bücherregalen vorbei in ein Hinterzimmer hinein, da ist es ruhiger. Ein Studierzimmer vielleicht, an der Wand hängt eine große Karte von Russland, als es noch Zarenreich war, um einen Schreibtisch herum sitzen junge Menschen und spielen Karten.
Im Schaukelstuhl vor dem Kamin hockt jedoch einer allein und raucht Pfeife, auf den gehen sie zu.
Das ist Christel, das ist Hans, macht Alex die beiden miteinander bekannt und schiebt, nun ganz Salonière, einen zweiten Sessel heran, damit auch Hans vor dem Kamin sitzen kann, er selbst schwingt sich auf die gepolsterte Armlehne.
Hans hält Christel die Hand hin: Hans Scholl, Student der Medizin.
Dieser Christel ist ihm auf Anhieb sympathisch, vor allem, weil er ebenfalls im biederen Anzug gekommen ist. Dabei wirkt er aber keinesfalls verloren, sondern eher wie ein Hausherr, als wäre er Alex’ Vater, trotz seines jugendlichen Gesichts.
Christel lächelt und drückt fest zu: Christoph Probst, auch Student der Medizin.
Ah, dann kennst du Alex wohl vom Studium … sagt Hans, aber Alex lacht und Christel schüttelt den Kopf: Wir sind schon in der Schule in einer Klasse gewesen. Ich habe eine Klasse übersprungen und er eine wiederholt. Glücklicherweise. Ich war eben ein Streber und er hat sich nie gut Autoritäten unterordnen können. So, würde ich sagen, hat jeder auf den anderen einen guten Einfluss ausgeübt.
Alex nickt zustimmend und lacht erneut. Dann springt er auf die Beine, durch das veränderte Gewichtsverhältnis gerät der ganze Sessel samt Hans darin ins Wackeln, und verlässt federnden Schrittes das Zimmer. Christel und Hans blicken ihm hinterher, Hans etwas überraschter als Christel.
Alex scheint mir heute noch übermütiger zu sein als sonst, murmelt Hans.
Christel stößt seufzend einen Rauchring aus.
Ich weiß auch den Grund dafür, sagt er dann.
Ein Mädchen?, fragt Hans und wundert sich, dass er mit Alex eigentlich noch nie über dieses Thema gesprochen hat, nicht einmal nach einer ganzen Flasche Wein. Es wäre ihm wohl irgendwie banal vorgekommen, oder aber, und das ist der wahrscheinlichere Grund: Er selbst hätte da nicht allzu viel erzählen wollen. Lisa, ach, Lisa ist schon fast gar nicht mehr wahr, dann das Geplänkel mit Ute, aber sie ist ja doch zu jung gewesen, mit Erika hat er es von Anfang an nie ernst gemeint, zuletzt die Skitouren mit Rose, an Rose schreibt er noch hin und wieder Briefe, aber dann ist sie ja doch immer mehr gute Freundin als Geliebte gewesen. Jetzt scheint ihm, als wäre das alles überhaupt nichts Richtiges gewesen, nicht mehr als eine Pose, wie Rauchen ohne Tabak. Und dann fühlt er ein Stechen in sich, eine Sehnsucht und irgendwie auch eine Eifersucht, dass Alex eine gefunden hat, die ihn so springen und grinsen lässt.
Hans zündet sich noch eine Zigarette an und nimmt einen tiefen Zug.
Nicht irgendein Mädchen ist es, das Alex so glücklich macht, sagt Christel und seufzt abermals, sondern ausgerechnet meine große Schwester.
Darüber scheinst du allerdings nicht allzu glücklich zu sein, stellt Hans fest.
Christel stößt noch einen Rauchring aus, größer als der vorige.
Ich kenne die beiden doch, sagt er, sie sind von allen Menschen auf der Welt die beiden, die ich am allerbesten kenne. Und gerade darum weiß ich auch, dass es nicht funktionieren wird. Nicht auf Dauer.
In diesem Moment aber kommt Alex zurück und Christel räuspert sich wie zum Zeichen, dass nun das Thema gewechselt werden muss, Hans hätte das auch sonst verstanden. Alex hüpft jetzt weniger, weil er drei randvolle Wodkagläser in den Händen balanciert, unter seinem Arm klemmt noch ein Gurkenglas. Sein Mund ist ungewöhnlich groß für seine sonst eher feinen Züge, besonders, wenn er sich freut, es ist ein ganz und gar einnehmendes Lächeln.
Wir müssen ja noch anstoßen, sagt Alex grinsend und verteilt die Gläser. Auf Mischas ersten Geburtstag!
Mischa?, fragt Hans.
Mein Sohn, antwortet Christel, Michael heißt er eigentlich, aber Alex hat erzählt, dass die Russen Mischa sagen, das gefällt uns noch besser.
Hans rechnet nach. Christel muss zwei Jahre jünger sein als Alex, das heißt ein Jahr jünger als er selbst. Einundzwanzig. Natürlich, man kann mit einundzwanzig schon Vater sein. Hans für seinen Teil kann es sich nur überhaupt nicht vorstellen, und das liegt nicht nur an der dazu unbedingt notwendigen Geliebten. Womöglich ist es ja die Vaterschaft, die dieses Ernsthafte, Gemessene in Christels junges Gesicht gezeichnet hat. Vielleicht ist es aber auch schon immer da gewesen. Eigentlich sind Christel und Alex komplette Gegenteile, denkt Hans, der Besonnene und der Traumtänzer, und welche Rolle er selbst in diesem Trio einnimmt, ob er überhaupt eine einnimmt, das vermag er noch nicht ganz zu sagen.
So stoßen sie also an auf Mischas Geburtstag und Alex lässt sich wieder auf Hans’ Sessellehne nieder.
Ein echter Russe zerschlägt hinterher das Glas, erzählt er, aber meine Stiefmutter hat das verboten.
Aus gutem Grund, fügt Christel hinzu, aber Alex zieht trotzdem eine Grimasse. Dann fischt er eine Gurke aus dem Gurkenglas und beißt ihr trotzig den Kopf ab. Hans und Christel lachen, davon angespornt springt Alex wieder auf und kommt diesmal gleich mit einer ganzen Flasche Wodka zurück.
Nachdem viele weitere Gläser geleert, zahllose Gurken verschlungen und sämtliche russischen sowie deutschen Gebräuche und Eigenheiten ausgiebig verglichen und besprochen worden sind, schlägt Christel sich auf die Oberschenkel.
Genug für heute, sagt er, Mischa schreit die ganze Nacht und ich komm morgen nicht aus den Federn.
Er steht auf, streicht sich die Hose glatt und reicht Hans die Hand zum Abschied: Wir müssen uns bald einmal wiedersehen, dann diskutieren wir über Nietzsche. Ja, ja, Alex hat mir davon erzählt.
Sie begleiten Christel noch ins Wohnzimmer hinüber, wo es sich schon ordentlich gelichtet hat, nichtsdestoweniger ist es gleich laut und verraucht wie vorher. Alex’ Stiefmutter kommt zum wer weiß wie vielten Mal mit einem Teller Eier aus der Küche gewuselt. Als sie Christel auf sich zukommen sieht, lächelt sie ein warmes, sogar mütterliches Lächeln, das Hans ihrer Physiognomie niemals zugetraut hätte: Lass dich bald wieder bei uns sehen, lieber Christel!
Und in einem sehr viel kühleren Tonfall fügt sie hinzu: Und Grüße an die Frau Schwester.
Er solle ihre Ablehnung nicht persönlich nehmen, hat Alex gesagt, na, Hans wird’s versuchen.
Alex steht jetzt neben ihm und blickt Christel hinterher, der durch die Haustür in die Nacht hinaus verschwindet, starrt verträumt die zufallende Tür an.
Angeli kommt wirklich nach München zurück, murmelt er mit glänzenden Augen, ich kann es noch gar nicht glauben.
Dann erst scheint ihm Hans’ Anwesenheit wieder einzufallen, munter wendet er sich zu ihm um: Willst du meinen gipsernen Beethovenkopf sehen? Ich hab ihn selbst gemacht!
Das will Hans sehr gern und Alex hebt die Büste von einem der Bücherregale herunter, einige der Bücher fallen um, Alex scheint’s egal zu sein, so viele Bücher, alle in kyrillischer Schrift.
Ich muss Russisch lernen, denkt Hans plötzlich, ich muss alles hier verstehen können, ich muss alles verstehen.
Alex wiegt den Gipskopf ein wenig in den Händen und kneift kritisch die Augen zusammen: Ich hatte ihn besser in Erinnerung. Na, vielleicht wird trotzdem einmal etwas aus mir.
Dann grinst er. Hans betrachtet die Büste eingehend. Er findet sie gut, ein bisschen sorgfältiger hätte man wohl arbeiten können, aber andererseits, das macht die ganze Kunst ja aus, das Element des Zufälligen, des Instinktiven. Hans denkt an die unzähligen Gedichte, die er in seiner Jugend geschrieben hat, als er noch dachte, er könnte einmal Schriftsteller werden. Als er noch dachte, Worte würden irgendetwas bewegen, und zum zweiten Mal an diesem Tag beneidet er Alex mit einem fast schon stechenden Schmerz.
Hast du Hunger?, fragt Alex.
So sitzen sie schließlich mit den letzten Verbliebenen um den großen Tisch herum und stopfen sich gefüllte Eier in den Mund. Dabei lauschen sie einer Diskussion zweier älterer Herrn, zu Hans’ Glück sprechen sie Deutsch, es geht um die Bibel und jenes Pauluswort, das die politische Ordnung als gottgegeben bezeichnet. Nun streiten sie, ob das für das heutige Russland auch so gelte, und wenn nein, wie das dann im Deutschen Reich aussehe und was das für die Menschen bedeute. Hans spürt, wie seine Wangen zu glühen beginnen, er will etwas sagen, wagt es nicht, außerdem ist da noch etwas Ei zwischen seinen Zähnen. Da aber mischt sich auch schon Alex’ Stiefmutter dazwischen, fängt doch tatsächlich mit dem Wetter an, ob es morgen wohl regnet?, und will noch jemand Kuchen, will noch jemand Brot?
Alex’ Vater, der mit am Tisch sitzt und bisher nur schweigend zugehört hat, sekundiert ihr sofort: Es riecht schon nach Regen, oder nicht?, damit ist jede Tiefgründigkeit beendet.
Sie ist immer so vorsichtig, flüstert Alex, dabei weiß sie doch, dass hier keine Denunzianten sind, weil mein Vater nur Verlässliche einlädt. Ich übrigens auch. Und was sagst du eigentlich dazu?
Wozu?, fragt Hans.
Na, zu der göttlichen Ordnung und all dem.
Hans zuckt mit den Schultern: Schwieriger Fall. Einerseits stimmt es natürlich, und alles Weltgeschehen folgt Gottes Plan, auf uns unbegreiflichen Wegen. Dann aber hat man ja doch auch einen freien Willen und dadurch immer die Möglichkeit, einzugreifen in das Rad der Geschichte.
Alex nickt nachdenklich. Plötzlich springt er auf und läuft zum Klavier in der Ecke. Hans hat es bisher nicht für ein Instrument, sondern für eine Art Altar gehalten, so viele Heiligenbilder stehen darauf. Und mittendrin lehnt die Fotografie einer hübschen jungen Frau, der Frisur und Mode nach wohl Anfang des Jahrhunderts aufgenommen: die verstorbene Mutter.
Alex beginnt, Klavier zu spielen, und das überraschend gut, wenn man den vorangegangenen Alkoholgenuss bedenkt, die flotte Musik übertönt mit Leichtigkeit die diskutierenden Stimmen, alle drehen ihre Köpfe zu ihm hin. Das Lied ist russisch, und jeder hier scheint es zu kennen, jeder außer Hans. Alex singt mit klarer und kräftiger Stimme, die anderen steigen im Refrain mit ein, ebenfalls kräftig, nicht mehr ganz so klar. Schließlich grölt auch Hans mit, obwohl er den Text nicht kann und nicht einmal die Sprache, und als das Lied zu Ende ist, spielt Alex das nächste, und Hans singt und singt die unbekannten Lieder, bis sie ihm nicht mehr unbekannt sind, und hat schon so ein Gefühl dabei, dass er sie eines Tages brauchen können wird.
Sommer 1941.
Gerade als Hans denkt, ein Mädel wäre gut, irgendein Mädel, lernt er Traute kennen.
Das geschieht während der Pause von den Brandenburgischen Konzerten, als Alex und er sich im Foyer am Buffet anstellen für ein Schinkenbrötchen und Wein. Auf klassische Musik haben sie sich einigen können, die lieben sie beide, und auch die Literatur. Alex hat ihm Die Brüder Karamasow geliehen, das Buch liegt jetzt zu Hause auf dem Schreibtisch, Hans hat ein wenig reingeblättert und weiß noch nicht, was er davon halten soll. Im Gegenzug hat er Alex die Buddenbrooks gebracht, das gleicht sich aus, seitenzahlmäßig. Auch in der Musik bevorzugt Alex eigentlich die Russen, aber er verehrt Bach und Beethoven, das ist doch etwas ganz anderes als die Marschmusik aus dem Volksempfänger.
Hans hat Alex während der ersten Hälfte des Konzerts beobachtet, wie er dasaß mit geschlossenen Augen und leicht mit der Hand mitwippte, als wäre er selbst ein Instrument, ganz ins Orchester verwoben. Auch Hans fühlte sich von der Musik vollständig eingenommen, wenn auch vielleicht auf eine andere Art als Alex, Hans wurde nicht zum Teil der Töne, viel eher schien es ihm, die Töne wären ein Teil von ihm, als käme alles von innen heraus, fast wie ein Gefühl.
Ganz aufgewühlt ist er noch, als der Pausenapplaus schon längst verklungen ist und er sich am Buffet einreiht. Alex steht direkt vor ihm, seine Finger tanzen noch ein wenig wie vorhin, während er im Portemonnaie wühlt. Da kommt eine große Brünette auf sie zu, Hans glaubt erst, sie will nur vorbei, macht schon einen Schritt rückwärts, um sie durchzulassen, da ruft sie plötzlich: Alex, bist du’s?
Und Alex schrickt ein bisschen hoch aus seinem träumerischen Kramen, beinahe fällt ihm das Portemonnaie hinunter. Konzentriert kneift er die Augen zusammen, Hans kann gut erkennen, wie es dahinter arbeitet, wer ist das bloß, dann sagt Alex mehr fragend als wissend: Trude?
Traute, sagt die Brünette, aber ist nicht so schlimm, wir haben uns ja nur kurz unterhalten damals.
Traute, richtig! Alex schlägt sich mit der flachen Hand an die Stirn, dann ist er aber schon dran mit dem Bestellen und kann nicht länger mit ihr plaudern. Traute lächelt Hans an, zeigt ihm ihre milchweißen, schnurgeraden Zähne.
Und Sie sind …?, fragt sie freundlich.
Scholl, Hans Scholl, sagt Hans und merkt sofort, wie übertrieben förmlich er klingt, schüttelt ihr auch noch geschäftig die Hand, das macht es schlimmer, sie scheint’s nicht zu stören, sie nickt ihm zu.