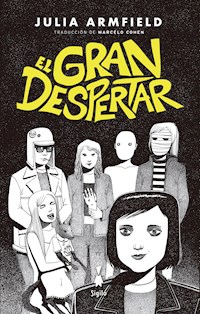Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kommode Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie verändern sich die Körper der Frauen? Das Wesen? Die Wahrnehmung? In den neun lebhaft erzählten Geschichten geschehen seltsame Dinge. Sie erinnern manchmal an asiatische Geistergeschichten, obwohl keine Geister erscheinen. Schauer und Schauder sind stilistische Eigenschaften, die Julia Armfield gerne und gekonnt in ihre Texte einbaut. Die Kombination aus unheimlichen Geschehnissen und poetischer Sprache erzeugt Bilder, die unter die Haut gehen. Und stark sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Armfield
Salzsirenen
Originaltitel: Salt Slow
Copyright © Julia Armfield 2019
Julia ArmfieldSalzsirenen
©2025 by Kommode Verlag, Zürich
1. Auflage
Übersetzung: Hannah Pöhlmann, planet-neun.de
Lektorat: Uta Rüenauver und Claudia Schlottmann
Korrektorat: Patrick Schär, torat.ch
Titelbild, Gestaltung und Satz: Anneka Beatty
Druck: Beltz Grafische Betriebe
ISBN 978-3-905574-62-3
Verlag
Kommode Verlag
Stampfenbachstrasse 32, CH-8006 Zürich
o41 79 246 59 14
www.kommode-verlag.ch/produktsicherheit
Produktsicherheit
Verantwortliche Person gemäss EU-Verordnung
2023/988 (GPSR):
GVA Gemeinsame Verlagsauslieferung Göttingen
GmbH & Co. KG
Postfach 2021, D-37010 Göttingen
o49 551 384 200 0
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Julia Armfield
Salzsirenen
Aus dem Englischen von Hannah Pöhlmann
Für Mum, Dad und Nick, tentakulös.
schwer zu erinnern dass deine Rippen am Rückgrat hängen
bevor die Kälte in deiner Brust nach der Wirbelsäule greift
Kaveh Akbar1
1Kaveh Akbar (2021): Den Wolf einen Wolf nennen. Hanser Berlin, zweisprachige Ausgabe, Übersetzung von Jürgen Brôcan.
INHALT
GOTTESANBETERIN
DAS GROSSE ERWACHEN
DIE SAMMLERSTÜCKE
EINSTMALS WILD
STOPFT EUREN FREUNDINNEN WACHS IN DIE OHREN
GRANIT
STRANDUNG
KASSANDRA DANACH
SALZWIND
DANKSAGUNG
GOTTESANBETERIN
Ich habe die Haut meiner Großmutter. Problemhaut. Meine Mutter kauft mir Hamamelis, Calendula, Aloe vera und behauptet, sie kenne eine Frau, die jeden Morgen Kollagen in ihren Tee rührt.
»Das sind halt deine Gene«, sagt sie. »Hör auf, daran herumzufummeln.«
Die Haut meiner Mutter spannt sich über ihre Gesichtsknochen wie glänzende Farbe, frisch aus der Palette gegossen. Wenn sie einen Finger in ihre Wange dippt, erwarte ich fast, dass er nass wird.
Unsere Badezimmerregale sind ein Cremespenderfriedhof – ausrangierte Tiegel und Pumpfläschchen, an Hälsen und Düsen verstopft, Salben, die zwei Wochen lang benutzt und dann stehen gelassen wurden. Meine Mutter geht in die Apotheke und kauft spezielle Peelinginstrumente, Gesichtsmasken und Tinkturen. Unsere Nachbarin, Mrs Weir, ist Avon-Beraterin; ich muss einen ganzen Nachmittag lang ertragen, wie sie mich am Küchentisch mit Honigcreme einreibt und mir dabei fröhlich versichert, dass es brennen soll.
»Das ist schon komisch, oder?«, sagt sie zu meiner Mutter. »Nicht richtig Ekzem, aber auch nicht richtig Akne. Schuppenflechte oder Weißfleckenkrankheit oder irgendwas anderes. Sieht so ähnlich aus wie damals, als mein Jonathan im Il Mare eine allergische Reaktion auf die Muscheln hatte und sein Magen ausgepumpt werden musste. Oder – verdammt noch mal – wie heißt diese Krankheit, wenn man schwarze Stellen bekommt –«
»Es ist erblich«, sagt meine Mutter, sie hat sich zwei unterschiedliche Farben auf die Augenlider aufgetragen und betrachtet jetzt ihre Erscheinung in Mrs Weirs Schminkspiegel. »Schwierige Pubertät.«
»– Wie heißt das noch gleich?« Mrs Weir plappert vor sich hin, öffnet den Verschluss einer Cremetube, als würde sie jemandem den Hals umdrehen. »Diese armen Leute in den Filmen mit der Haut? Ihr wisst schon, die mit den Glocken?«
»Ich glaube, Sie meinen Lepra«, sage ich und greife nach einem Tiegel mit schimmerndem Make-up. Mrs Weir reißt ihn mir aus der Hand.
»Das nicht, Süße, das ist nicht deine Farbe. Weißt du was, ich habe da was für dich, richtig tolles Zeug, das ist eigentlich für Dehnungsstreifen gedacht, aber du könntest das auch zum Abdecken benutzen. Schau mal her. Brandopfer schwören darauf, siehst du.«
Am Ende kauft meine Mutter zwei verschiedene Lidschatten und verbringt den Abend damit, mich zu schminken. Ich sitze still, während sie mir ein Paar Wangenknochen hinzaubert, dunkles Gel über meine Schläfen streicht, Karminrot auf meine Lippen. Ihr Porzellan-Concealer fließt samtig auf ihre Fingerspitzen, und sie trägt ihn portionsweise auf meine Wangen auf, verteilt ihn mit kreisenden Bewegungen. Meine Haut schält sich und bleibt in den Borsten ihres Makeup-Pinsels hängen, unter dem Puder sehe ich aus wie Baby Jane. Glättende weiße Paste über etwas Kränklichem, Krustenbildung in meinen Mundwinkeln.
»Mrs Weirs Mann hat keine Allergie gegen Schalentiere«, sagt meine Mutter später in geheimniskrämerischem Ton, während sie meine spärlichen Augenbrauen mit einem weichen Stift nachzeichnet. »Sondern eine Allergie gegen plappernde alte Weiber, das trifft es eher. Eine Allergie gegen schlechte Gesellschaft.«
Triumphierend hebt sie den Stift in die Höhe. »Tada. Bereit für den roten Teppich.«
Ich drehe meinen Kopf, um in ihren Kompaktspiegel zu schauen, und verstreue Konfetti von mir selbst auf dem Boden.
o
In der katholischen Schule bringen sie uns das Beten bei und schlagen uns mit einem Holzlineal auf die Rückseite der Beine, damit wir uns nicht auf die Fersen setzen. Wir tragen beige Strumpfhosen und Wollröcke in vierfarbigem Karomuster, flechten unsere Haare zu Zöpfen und sprechen in Zimmerlautstärke. Nach der Morgenandacht sitzen wir zusammen auf den schwitzenden Heizkörpern, trinken Kantinenkaffee aus Styroporbechern und warten darauf, dass der Unterricht beginnt.
Wegen meiner OP-Handschuhe und den Ringen um meine Augen und Nasenlöcher werde ich Die Mumie genannt, aber der Spott ist eher harmlos und überwiegend liebevoll gemeint. Als katholische Mädchen sind wir alle ein wenig linkisch, eine Art von Mädchen, die durch zu viel Untätigkeit und zu wenig Kontakt mit Jungs träge und seltsam geworden sind. Meine Haut, so hässlich sie in letzter Zeit aussieht, ist nur Ausdruck dieses kollektiven Defekts. Wir sind alle eigenartig, zottelhaarig und verschwitzt in unseren Wollblazern und riechen stark danach, wie Mädchen riechen, wenn sie abgeschnitten von Männergesellschaft sind.
Unsere Gespräche in den Pausen zwischen Messe und Unterricht sind lange, genüssliche Schleifen aus Selbsthass. Das ist Girltalk – ein vertrautes Bindungsritual. Wir sind alle überzeugt davon, dass wir zu dick, zu klein, zu hässlich sind; wir wetteifern mit olympischer Leidenschaft um jeden Titel, jede Selbstkritik muss die vorherige toppen.
»Ich kann nicht glauben, wie viele Kartoffeln ich zu Mittag gegessen habe – man sollte mir das Maul zuschnüren. Einfach meine Arme am Körper festbinden.«
»Du bist verrückt, du wiegst doch gar nichts. Wenn hier jemand ein Magenband braucht, dann ich.«
»Haltet bloß die Klappe, ihr seid beide wunderschön. Ich habe riesige Poren, so richtig unnatürlich riesig. Meine Haut ist wie die Mondoberfläche.«
»Nicht so schlimm wie meine. Ich habe so viele Mitesser, dass ich mich frage, warum ich noch nicht zum Pestarzt gekarrt wurde.«
»Ihr werdet lachen, aber ich hasse meine Zehen.«
»Meine sind schlimmer. Ich schwöre, an manchen Tagen denke ich, ich hätte Schwimmhäute.«
»Nicht so schlimm wie meine Haare.«
»Oder meine.«
»Und meine auch.«
Wir laben uns an diesem krassen Gerede, diesem bösen Wettkampf – lieben uns für alles, was wir hassen können. Meine Haut wird so zu einer Art Trumpf, die Fetzen, die mich unter meinem Pullover plagen, sind eine Karte, die ich immer ausspielen kann.
»Wenigstens verliert ihr alle nicht so viel Haut wie ich.«
Es ist eine unschlagbare Karte, unüberbietbar. Sie nicken mir zu, beugen sich meinem Sieg.
o
Ich träume in Häutungen – verbringe meine Nächte tief versunken in Meeren von Zähnen und Fingernägeln, dem Ersticken an abgeworfener, körperlos zurückgelassener Haut. Unablässiges Greifen und Verlieren, Fangen von Dingen, die in meinen Händen zu Wasser werden. Meine Matratze hat einen Gummiüberzug zum Schutz vor Wundliegen und Infektionen, und mein Schlaf hat etwas von diesem Rutschigen angenommen. Morgens untersucht mich meine Mutter mit einem antiseptischen Tupfer, zupft mir wenig zimperlich Hautreste von den Schultern.
»Du hast dich gekratzt«, sagt sie manchmal und streicht Gelée royal über die Spuren auf meinem Rücken.
»Nicht absichtlich«, antworte ich dann und erlaube ihr, mir wie üblich die Hände zu verbinden, denn die Mumifizierung ist sowohl Schutz vor Versuchung als auch Schutz für meine Handflächen.
o
In der Schule schauen wir Videos über unsere sich verändernden Körper – zensierte Gesundheits- und Präventionsfilme aus den 1970er-Jahren mit vielen abstrakten Metaphern und wenig Biologie. Uns werden Ausschnitte auf dem Overhead-Projektor vorgespielt, abrupte Szenenwechsel und verschwommene Diagramme, unsympathische Männerstimmen, die Sachen wie Trieb und Menstruation und Übergang zur reproduktiven Phase mit besonderer Betonung aussprechen.
Wir sind vierzehn, einige von uns fünfzehn, und wir verbringen die Mittagspausen damit, unsere Notizen über Bluten und Küssen und andere ähnliche Verbrechen zu vergleichen. Wir essen Kantinenhackbraten mit aufgesperrten Walfangmündern, brechen in kreischendes Gelächter aus, das mit Hustenanfällen und ausgespuckten Brotbrocken endet. So abgeschottet wir auch sind, wir haben Jungen gesehen, sie beobachtet oder im Vorbeigehen gestreift. Geschichten über die Freunde von Brüdern und die Jungs, die die Autos unserer Väter reparieren, wandern von einer zur andern; erfundene Rendezvous, eingesogener Benzingeruch, Deo in einer silbernen Spraydose.
Mittwochs spielen wir Hockey auf dem Platz hinter der Kapelle. Unsere Sportkleidung ist in jeder Hinsicht prüde, erlaubt uns aber die Art von Begutachtung, die uns unsere Schuluniform verwehrt. An den kargen, farblosen Herbstmorgen beurteilen wir Sitz und Fall von Aertex-T-Shirts, werfen Blicke auf Beine, die oberhalb des Sockenrands rasiert und am Knie schorfig sind. Mädchen, die wir seit dem Kindergarten kennen, sind mit einem Mal fremd, tieferstimmig und weicherknochig unter der Oberfläche, Fremdkörper mit ihren plötzlichen Hüften und Taillen.
Ich habe ein Schreiben von meiner Mutter und ein weiteres von meinem Arzt, dass ich von den Spielen befreit bin, werde aber trotzdem im Namen der Guten Frischen Luft mit nach draußen geschleppt, aber wenigstens bleibt mir das Spektakel mit der Sportkleidung erspart. Mit weißem Atem stehe ich am Seitenstreifen und wärme meine bandagierten Hände in den Achselhöhlen, als ich unter meinem Blazer eine leichte, aber zweifelsfreie Aufspaltung in meinem Rückengewebe spüre. Manchmal bekomme ich die Aufgabe, nach dem Spiel die Mannschaftsleibchen einzusammeln, dann werfe ich sie mir über als zusätzlichen Schutz vor dem Frösteln.
Danach, in den Umkleidekabinen, reichen Mädchen Tampons hin und her wie geliehene Zigaretten. Der Geruch von Haarspray und feuchter Fugenmasse vermischt sich mit den Ausdünstungen von altem Blut. Vollständig angezogen sitze ich in der Nähe der Tür und beteilige mich an lustlosen Gesprächen. Als die Tampons in meiner Ecke ankommen, gebe ich sie einfach weiter.
Ich blute zwar, aber es gibt einen Unterschied in der Farbe und der Konsistenz, einen Unterschied im Ziehen und Schaben in meinem Becken. Ich habe überlegt, ob ich nach einem unserer Gesundheits- und Präventionsvideos danach frage, obwohl das normalerweise keine Veranstaltungen sind, in denen viel Raum für Fragen ist.
o
Meine Großmutter war ein Partygirl, behauptet meine Mutter. Das erzählt sie mir, während sie mein Haar bürstet und die Strähnen, die dabei ausfallen, in ihrer Schürzentasche verschwinden lässt.
»Sie war ziemlich wild«, sagt sie und klopft mir mit dem Bürstengriff auf den Rücken, damit ich mich gerade hinsetze. »Manchmal kam sie erst nachts um drei oder vier nach Hause, und ich saß da mit meinen neun Jahren und wartete.«
Sie spricht ohne Groll, teilt einfach eine Tatsache mit. Im Spiegelschrank beobachte ich, wie sie eine ausgefallene Haarsträhne für einen Moment an meine Kopfhaut drückt, als hoffe sie, sie würde sich wieder befestigen lassen.
»Wo war denn Großvater, wenn das passiert ist?«, frage ich, obwohl ich die Antwort schon kenne. Das Herbeten dieser Geschichte ist mir vertraut.
»Dein Großvater war zu der Zeit nicht mehr da«, sagt sie und spielt das Spiel mit. »Halt den Kopf gerade. Sitz nicht so krumm.«
Abends lesen wir zusammen, obwohl ich alt genug bin, um allein zu lesen, und meine Mutter nur wenig Geduld bei Literatur hat. Meistens suche ich griechische Sagen oder Gruselgeschichten aus, Erzählungen, die weniger als vierzehn Seiten lang sind und in brutalen Lehren gipfeln. Ich lese laut vor und lasse sie mich unterbrechen, wenn sie möchte – Geschichten von Schwänen und Spinnen, Lorbeerbäumen, Narzissen, Mädchen, die von hinterhältigen Rivalinnen in Ungeheuer verwandelt werden.
o
In der Schule lernen wir Der Floh auswendig und kichern über den Subtext. Wir lernen Hauptstädte und schriftliches Dividieren und die Namen der Heiligen in der Reihenfolge, in der sie bei Teufelsaustreibungen genannt werden. In Biologie pflanzen wir Brunnenkresse in Joghurtbecher und stellen sie auf die Fensterbänke im Labor. Bei zu viel Sonnenlicht werden sie braun und wir müssen sie wegwerfen.
An manchen Tagen nutze ich meine Haut zu meinem Vorteil, schwänze Mathe, lege mich ins Krankenzimmer und klage über wunde Arme und pochende Schmerzen. Beim ersten Mal bestand die Krankenschwester darauf, mich in Augenschein zu nehmen, zog ungefragt meinen Pullover am Rücken hoch und die Bluse aus meinem Rock. Was sie sah, reichte aus, um sie zu überzeugen, und von nun an wurden alle meine Besuche im Krankenzimmer ohne weitere Untersuchung akzeptiert. Meine Freundinnen kommen mich dann zum Mittagessen abholen, sobald Mathe vorbei ist. Sie kichern hinter vorgehaltener Hand, wenn ich von meinem Krankenbett hüpfe und der Krankenschwester sage, dass es mir jetzt schon viel besser gehe.
Donnerstagmorgens gehen wir zur Messe, holen heimlich Karottenkuchen aus dem Schulranzen und versuchen, dem Weihrauch auszuweichen, der während der Gebete aus dem Gefäß geschwenkt wird. Die Predigten sind eine schleppende, monotone Angelegenheit, verschwefelt mit Worten wie Absolution, Blasphemie, göttlich. Nach der Messe spielen wir mit unseren Rosenkränzen Klick-Klack, lassen im Hof die Perlen gegeneinanderschlagen, bis die Nonnen uns dabei erwischen.
o
Die Zähne sind ein Problem. Das Sprechen wird schwieriger, als ich meine Zähne verliere, was in der Woche meines fünfzehnten Geburtstags sukzessive geschieht – zunächst fallen nur die Backenzähne aus, was zumindest bei flüchtiger Betrachtung weniger auffällig ist als das Ausdünnen meiner Haare. Ich reihe sie auf dem Küchentisch meiner Mutter auf, die PVC-Tischdecke zeigt in einer Art von fröhlichem Kitsch Bilder des letzten Abendmahls. Sie begutachtet die Zähne mit forensischer Genauigkeit und holt mir dann ein Glas Wasser, in das sie eine Portion Kochsalz löffelt und zügig umrührt, bis es sich auflöst.
»Gurgeln«, sagt sie, reicht mir das Glas und wischt die Zähne vom Tisch in ihre Handfläche. Ich tue, was sie sagt, dabei taucht vage die Erinnerung auf, wie ich mit dem Mund voller Apfel meinen ersten Milchzahn verschluckte – und meine Mutter fragte, ob mir jetzt vielleicht Zähne auf der Magenwand wachsen, wie eine aufkeimende Saat.
Ich spucke das Wasser in die Küchenspüle, meine Mutter holt Mandelcreme aus ihrer Handtasche und streicht sie abwesend auf meine Finger und meinen Nasenrücken.
»Alles gut, mit dir ist alles richtig.«
Nachts schlafe ich geschreddert und zerfleddert ein, meine Träume sind durchschossen von Schmerzensschreien, raue Scharten wie schlechte Perlen an einem Rosenkranz. Frühmorgens, wenn es noch dunkel ist, wache ich auf und betrachte mein Gesicht im Spiegelschrank. Unter der weißen Haut meiner Stirn wirkt es, als lägen meine Augen weiter auseinander als zuvor.
o
Jungs kommen so unvermeidlich wie die Flut. Der Bruder von jemandem schmeißt eine Party, der Cousin von jemandem stellt sich vor, und schon haben die Mädchen Nummern in ihren Handys und Orte, an die sie sich schleichen können, die Röcke in der Taille umgeschlagen, damit sie nur noch bis zu den Knien reichen.
In den Wochen vor der Fastenzeit dreht sich alles um Jungs – um ihr kreisendes, simples Gerede und die hundert Bedeutungen, die man aus der Art, wie sie ihren Kaugummi kauen, ableiten kann. Mit von Muffins vollgeschmierten Mündern verpflichten wir uns im Streben danach, begehrt zu werden, zu unmöglichen Diäten. Wir wiederholen die Namen von Jungen, als riefen wir die Heiligen an, rollen unsere Zungen um die, die uns am besten gefallen.
»Wenn ich vor der Party dreieinhalb Kilo abnehme, gefalle ich Adam Tait vielleicht.«
»Was ist mit Toby Thorpe – habt ihr gehört, ob Toby Thorpe da sein wird?«
»Jetzt mal im Ernst: Hattet ihr den Eindruck, dass Luke Minors letztes Wochenende beim Bowling zu mir rübergeschaut hat oder nur zum Spiegel hinter mir?«
»Ich habe nicht darauf geachtet. Ich finde Sam Taylor gut.«
Ich höre diesen Gesprächen mit den Fingern im Mund zu, die Nägel fast bis zum Knöchel heruntergekaut. Meine Handschuhe habe ich ausgezogen, meine Beine liegen zappelig auf dem Heizkörper und scheinen ohne Vorwarnung alle zehn bis fünfzehn Minuten einzuschlafen. Die Dinge in meiner Umgebung lenken mich mehr ab als sonst: der Schwarm von Staubmotten, der Teppichboden, der die Wände hochkriecht.
»Weißt du was, ich habe gehört, wie Mark Kemper Toby Thorpe gesagt hat, dass er dich interessant findet.«
Es dauert einen Moment, bis ich begreife, dass dieser letzte Satz an mich gerichtet ist. Ich hebe meine Hand, die so entzündet ist, als stünde sie in Flammen, und synchron dazu eine Augenbraue.
»Verzieh dein Gesicht, wie du willst«, werde ich ermahnt. »Ich wiederhole nur, was ich gehört habe.«
o
Auf der Anrichte in der Küche stehen Bilder von meiner Großmutter. Die Haut wie Gespinst, die Augen wie etwas Festgetackertes.
Meine Mutter behauptet, ich hätte die Gene meiner Großmutter, dass sie irgendwann zu uns allen gelangen würden. Sie sagt, dass ich von den Leuten mehr Zuneigung erfahre, als sie jemals bekommen hätte.
»Deine Großmutter war eine Partylöwin«, sagt sie, obwohl sie normalerweise den Ausdruck Partygirl benutzt. »Sie ist nachts mit Gläsern nach Hause gekommen, die sie in Weinbars gestohlen hat, mit Bierdeckeln und kistenweise Donuts. Sie hat Männer mitgebracht, die ich nicht mochte.«
»Wo war denn Großvater, wenn das passiert ist?«, frage ich mechanisch.
»Dein Großvater war zu der Zeit nicht mehr da«, antwortet sie, wie immer, ihre Stimme klingt wie brechende Finger in einer zugeschlagenen Tür.
Sie zeigt mir Fotos in ihrem Album mit dem grünen Velours-Einband. Meine Großmutter mit einer Lametta-Perücke in kahl werdenden Samtstiefeln. Ein Hochzeitsfoto mit Weingläsern, die Lippen rot wie etwas zu Tode Gekautes. Ihre Zähne, so behauptet meine Mutter, waren Porzellanimplantate, eine Information, die ich ihr übel nehme, seit ich mich in den letzten Wochen mit sechs Kunstharzzähnen auf einem Metallbogen in meinem Mund begnügen muss.
»Sie hätte dich gemocht, da bin ich mir sicher«, sagt meine Mutter, als sei es nicht allgemein zu erwarten, dass Leute ihre Enkelkinder zumindest tolerieren.
o
Am Aschermittwoch laufen wir den ganzen Tag mit einem silbernen Placken auf der Stirn durch die Schule. Tauchen unsere Finger in das Taufbecken am Eingang der Kapelle und lassen das Weihwasser über unsere Fingerknöchel rinnen, was entweder trocknet und Spuren auf der Haut hinterlässt oder wir lecken es gedankenverloren von den Handflächen.
Für Samstag ist eine Party geplant, die Einladungen sind mit Glitzerstift auf bunte Kärtchen gekritzelt: Kommt zum Anti-Fasten-Fest – Mädchen willkommen, Jungen erwünscht.
In den Badezimmern zupfen sich die Mädchen die Augenbrauen kahl und fantasieren über die Wochenenderoberungen.
»Ich schwöre bei Gott, ich habe seit Februar nichts gegessen – Adam Tait weiß nicht, wie ihm geschieht.«
»Du bist doch bekloppt. Glaubst du, dass Toby Thorpe kommt?«
»Ich weiß nicht mal, wer das ist.«
Ich sitze auf dem Waschbecken in der Ecke und lasse meine Freundinnen ihr Make-up an mir testen, obwohl sich die Haut unter meiner Uniform stückweise löst und meine Mutter mich mit Verbandsrollen umwickelt hat, damit die wichtigsten Teile von mir an Ort und Stelle bleiben.
»Ich werde mit Luke Minors schlafen«, kreischt jemand, ein Lärm, der von den Fliesen widerhallt. »Es ist mir egal, ich werde es tun. Ich schwöre, ich werde es tun.«
Wir sind hemmungslos vor Hunger, vor Verlangen, vor jahreszeitlicher Bußfertigkeit. Wir lachen wie Hyänen, unsere Köpfe stoßen aus unseren Körpern hervor.
o
Bevor ich am Samstag zu der Party aufbreche, kämmt meine Mutter eine Perücke, die sie in einer Hutschachtel aufbewahrt hat: dunkel gelocktes Nylon mit einem entflammbar-Warnhinweis, den sie vom Scheitel abschneidet. Sie richtet mein Gesicht mit Lippenstift und schwarzem Kajal her, heftet kunstvoll Klebestreifen unter die Perücke, damit meine Augen auf einer Linie bleiben.
»Tada. Bereit für den roten Teppich«, sagt sie.
Die Party ereignet sich wie eine Plage – ein Gewimmel in den Ecken eines fremden Hauses. Wir kommen mit Autos und Fahrgemeinschaften, werden von Eltern mit strengen Nachhausekommzeiten und keiner Ahnung, was zu erwarten ist, hingebracht. Das Haus gehört dem Freund eines Bruders und ist mit leuchtenden Lampions geschmückt, ausstaffiert mit Aschenbechern und Plastikschüsseln mit Chips.
Ich spüre, wie etwas zwischen meinen Knochen vorgeht, mein Blick verschwimmt und verdoppelt sich. Ich tanze mit meinen Freundinnen und achte nicht auf das Reißen und Splittern unter meinem Kleid.
Jungen taumeln und schwappen um uns herum wie klirrende Eiswürfel, mit jedem Lied schmelzen sie ein Stück näher an uns heran. Adam Tait schwitzt durch sein T-Shirt und spricht mit einem Mädchen, das ich kenne, dessen Name mir aber nicht einfällt. Als das Lied wieder wechselt, zieht er sie aus dem Gedränge, und ich frage mich, woher ich sie kenne und warum meine Finger jetzt länger aussehen als gerade eben. Ich denke an meine Großmutter, wie sie ihre Hochzeit in vollen Zügen genoss, und trinke alles, was mir angeboten wird. Die Musik ist leuchtend grün, leuchtend weiß, elektrisch. Ein Mädchen ext einen Becher Wein, kreischt »Unchristlich!« und fällt gackernd zu Boden.
Jungen schleichen mit Mädchen davon, und ich merke, wie sehr meine Perücke juckt, wie stark mein Verlangen ist, sie abzunehmen. Auf meiner Zunge sammelt sich etwas Dickes und Flüssiges, mein Blick verdreifacht, vervierfacht sich im schummrigen Licht.
Neben mir redet eine Freundin auf mich ein, Silben, die keinen Sinn ergeben und mich zum Lachen bringen und meine Arme in einer Bewegung zucken lassen, die seltsam unfreiwillig erscheint.
»Was?« Ich spreche zu laut, sie schüttelt den Kopf und zeigt über meine Schulter auf einen Jungen, der in der Ecke tanzt.
»Mark Kemper.«
»Wer?«
»Mark Kemper. Der, der Toby Thorpe gesagt hat, dass er dich interessant findet.«
In der Küche trinken Mädchen Bier aus Pappbechern und diskutieren lauthals. Eine hat den Freund einer anderen geküsst, und ein Streit bahnt sich an. Beim Kühlschrank trinkt eine Gruppe Mädchen mit Kruzifixen im Partnerlook Whiskey, ein Mädchen mit Lametta im Haar hat sich unter dem Frühstückstisch zum Schlafen hingelegt.
Ich kaue an meinen Fingerspitzen und frage mich, wann sich der Geschmack von Salz in etwas Herberes verwandelt hat. Jemand reicht mir ein Bier, ich trinke es und drücke mich dankbar an die Körper ringsum. Unter meinem Kleid brodelt meine Haut. Meine Beine fühlen sich an, als wären sie entzweigebrochen, frei beweglich – ein Aufspreizen und Verrutschen, als würden meine Knochen aus ihren vorgesehenen Positionen springen.
»Da ist er wieder, guck mal.« Jemand stößt mich von hinten an, deutet mit dem Kopf in Richtung des Jungen, der mir in die Küche gefolgt zu sein scheint.
Vor der Party hat meine Mutter mir Fotos von sich selbst in meinem Alter gezeigt – blinzelnder Strich in der Landschaft, mit strahlender Haut und seltsam jungenhaft.
»Ich war dir ähnlicher, als du vielleicht denkst«, hat sie gesagt und Polaroids, aufgefächert wie Spielkarten, auf den Küchentisch gelegt. »Ich war auch eine Spätzünderin. Das liegt in der Familie.«
Sie hat mir Bilder von ihrer Hochzeit gezeigt. Ein verschwommener Bräutigam, eine Braut mit bis zum Fleisch runtergekauten Fingernägeln.
Ich verlasse die Küche wieder, gehe durch Türen und Flure und finde den Weg zurück zur tanzenden Horde. Mädchen greifen zur Begrüßung nach meinen Armen, schreien auf und ziehen mich zu sich. Ich spüre, wie sich meine Haut unter ihren Händen auflöst, und frage mich, ob ich vielleicht versuchen sollte, die abgefallenen Teile von mir vom Boden aufzusammeln.
Wir tanzen voller Lebenslust, schreien so, wie wir es aus Erleichterung am Ende der Messe tun. Ein Mädchen kneift mir zum Spaß in die Nase, ein anderes zieht an meiner Perücke. Wir umstehen und umkreisen und umfassen einander, umschlingen uns mit Armen und Beinen. Aus der Ferne sehe ich den Jungen, wie er sich durch die Menge auf mich zubewegt – eine ausdrucksleere Gestalt, die ich nur durch das Flüstern in meinem Ohr bemerke.
»Mark Kemper.«
»Guck mal – er kommt hierher.«
»Er hat allen gesagt, dass er dich gut findet – ich schwöre beim Heiligen Felix.«
Er ergreift meine Hand mit einer Kraft, auf die ich nicht vorbereitet bin, sagt seinen Namen mit einer Stimme, die mich von der Gruppe wegreißt. Er sagt ihn noch einmal, aber die Musik scheint lauter zu werden, und ich bin mir meiner Haut sehr bewusst. Er zieht mich mit sich, tanzt bereits, und ich habe keine andere Wahl, als mitzumachen, ein pochendes Gefühl von etwas Zerrissenem oder Zerbrochenem schneidet meine Wirbelsäule hinunter, während sich das Gewirr von Mädchen um mich herum auflöst und Platz macht. Ich lasse ihn mit mir tanzen, mein Mund überschwemmt von etwas, das sich wie Speichel anfühlt, sein Körper wie der Ruck vor einem Zusammenstoß.
»Ich habe dich schon mal gesehen«, sagt er in mein Ohr, und ich bin mir nicht sicher, wie lange er schon spricht oder ob das zu einem längeren Satz gehört. »Du fällst auf, weißt du. Du bist nicht wie andere Mädchen.«
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, denn es ist unbestreitbar wahr, aber es fühlt sich überhaupt nicht wie ein Kompliment an. Er sagt wieder seinen Namen. Mir schwirrt der Kopf, und ich denke an meine Mutter; eine Verfinsterung, ein knackendes Geräusch, das von mir zu kommen scheint.
Ich merke, dass er mich einen Flur entlangführt, obwohl ich keine Ahnung habe, wann wir die Tanzfläche verlassen haben oder wie er mich überredet hat mitzukommen. In Ecken und Nischen und hinter Türen sehe ich ineinander verschlungene Mädchen und Jungen, seltsame Umklammerungen im Halbdunkel, zu Paaren verwobene Silhouetten. Gierig ergreift er meine Hände, und mir fällt auf, wie klein seine Handflächen sind, aber das liegt vielleicht nur daran, dass sich meine Finger jetzt so unnatürlich gestreckt anfühlen. Es prickelt unter meinen Kleidern, meine Arme und Beine kribbeln wie in einem Ameisenhaufen, zucken unwillkürlich wie in den Sekunden vor dem Einschlafen.
»Ich wusste doch, dass du es willst«, sagt er, und ich merke, dass ich so stark auf meiner Unterlippe herumgekaut habe, dass sie eingerissen ist. Ich greife fester nach seiner Hand, schmecke das Blut auf meinen Lippen.
Er zieht mich in einen leeren Raum – ein Badezimmer mit einem großen Spiegel –, und ich begreife, dass er mich küssen wird, eine Sekunde bevor er es tut. Im Spiegel sehe ich meine Reaktion, die blasse, umgekehrte Version meiner selbst in poliertem Glas. Ich falle auseinander, mein Kopf taumelt beim Einsturz, und ich verstehe auf einmal, was meine Mutter mit »Spätzünderin« meinte – ein Erwachsenwerden, das ganz anders ist als das, das meine Klassenkameradinnen durchlebt haben.
Meine Haut beginnt mit der Schwere bloßer Erleichterung von meinen Knochen zu gleiten, und die Hülle darunter ist so ähnlich wie die meiner Mutter; die harte, bleiche Oberfläche makelloser Kälte. Meine Zähne fallen aus, meine Perücke rutscht herunter, und ich bin etwas ganz anderes. Eine jähe Bewegung des Unterkiefers und des gekrümmten Halses, die Augen gleiten an die Seiten, lange Hände nach unten gestreckt wie in umgekehrter Gebetshaltung. Ich denke wieder an meine Großmutter, an die Abwesenheit eines Großvaters, an den unbekannten, verwischt-verschwommenen Bräutigam meiner Mutter. Ich drehe meinen Kopf zu dem Jungen, spüre von so etwas wie Flügeln ein Scharren in meinem Rücken. Ich strecke meine Arme und richte mich ein wenig auf, während der letzte Rest meiner Haut unbeachtet auf dem Badezimmerboden landet.
Es ist möglich, dass der Junge etwas sagt, vielleicht schreit er. Mein Mund ist voller Vorfreude weit geöffnet. Nicht aufs Küssen, sondern auf etwas, das mehr meinen Genen entspricht.
DAS GROSSE ERWACHEN
Als ich siebenundzwanzig war, trat mein Schlaf aus mir heraus wie ein Fahrgast aus einem Zug, sah sich einige Sekunden in meinem Zimmer um und setzte sich dann auf den Stuhl neben meinem Bett. Das war, bevor sie so häufig wurden, die schattenartigen Schläfe in Fluren und Küchen, bevor die Massenbewegung so viele Menschen zu ungewissen Nachtstunden wachhielt. In jenen Tagen war es noch überraschend, man richtete sich im Bett auf und erblickte den silbernen, dürren Schlaf in seiner lässigen Haltung. Die Menschen riefen sich an, entschuldigten sich für den Anruf zu später Stunde und fragten ihre Freunde, ob auch sie einen ungebetenen Gast bei sich hätten.
Jeder Schlaf war groß und dünn, doch darüber hinaus gab es nur wenige gemeinsame Merkmale. Alle machten unterschiedliche Erfahrungen – ein Mädchen, das ich kannte, beklagte sich darüber, dass ihr Schlaf ununterbrochen auf ihrer Kommode saß, summte und die Füße baumeln ließ, jemand anderes erzählte, sein Schlaf würde mit den Fingern an seinen Waden entlangstreichen und Pfefferminzeis in Waffeln verlangen. Paare und Wohngemeinschaften traf es am härtesten – die Schläfe waren in Gruppen schlimmer, da sie dazu neigten, sich gegenseitig anzustacheln. In meinem Haus hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass das Paar im Dachgeschoss seine Schläfe in separaten Badezimmern einsperrte, um sie daran zu hindern, sich zu prügeln. Ein Mann, den ich vage aus dem Büro kannte, erzählte mir im Vorbeigehen, sein Schlaf und der seines Partners würden unaufhörlich aufeinander einschlagen und die bengalische Katze des Nachbarn mit zerknülltem Papier bewerfen. Mein Schlaf hatte niemanden, mit dem er sich hätte streiten können, und war daher meist damit beschäftigt, meine persönlichen Gegenstände durchzuwühlen, alte Fotos, Inbusschlüssel und ausgediente Handys hervorzuziehen und wie Schätze am Fußende meines Bettes aufzureihen.
Am Anfang wussten wir nicht, was genau vor sich ging. Viele Leute glaubten, sie würden einen Geist sehen. Eines Nachts Mitte Juli weckte eine Frau aus meinem Haus mit ihren Schreien den ganzen siebten Stock. Es war zwei Uhr früh, des Sommers dunkler Rachen. Ein schlapper Trupp von Nachbarn versammelte sich im Hausflur und wurde in Schlafanzug und Morgenmantel in ihre Wohnung gewunken. Wir gingen von Zimmer zu Zimmer, Fremde trotz unserer täglichen Nähe, und nahmen verstohlen Notiz von ihrer Einrichtung und ihrer schlampigen Haushaltsführung, den Müslischalen auf dem Couchtisch, dem speckigen Roman auf dem Bett. Wir fanden ihren Schlaf im Schlafzimmer, wegen der offenen