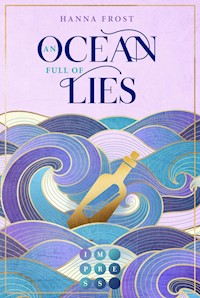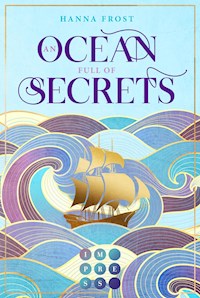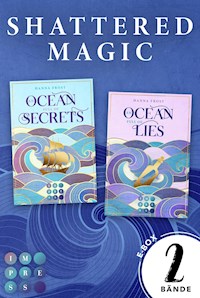
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Beschütze, was du liebst** Diese E-Box enthält zwei atemberaubende Fantasy-Liebesgeschichten voll dunkler Geheimnisse, göttlicher Gefühle und dem stürmischen Ozean. An Ocean Full of Secrets (Shattered Magic 1) Ruhig, friedlich und vom Ozean umgeben – Bells Heimat könnte idyllischer nicht sein. Das ändert sich jedoch schlagartig, als ein attraktiver Fremder auf der Insel auftaucht und sich als Halbgott zu erkennen gibt. Als dieser verlangt der arrogante Neo, dass aus jeder Familie ein Sohn Teil seiner Schiffs-Crew wird. Nur so kann die Prophezeiung, die die Rückkehr der verbannten Götter besagt, vereitelt werden. Bell, die um jeden Preis verhindern will, dass ihr Bruder seine hochschwangere Frau verlassen muss, schlüpft heimlich in dessen Kleider und schleicht sich an Bord des Schiffes. Nicht ahnend, dass sie damit nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz aufs Spiel setzt … An Ocean Full of Lies (Shattered Magic 1) Niemals hätte sich Bell vorstellen können, einmal ihre geliebte Heimatinsel hinter sich zu lassen. Doch um ihre Familie zu beschützen, ist sie dem geheimnisvollen Neo auf sein Schiff gefolgt. Und auch wenn der Halbgott einen immer größeren Sog auf sie ausübt, bleibt ihr Ziel unvergessen: die Rückkehr der Götter zu verhindern. Das jedoch wird mit jeder zurückgelegten Seemeile immer schwieriger, denn in den Tiefen des Ozeans lauert ein mächtiger Feind. Bell, die schon bald nicht mehr weiß, wem sie in dem göttlichen Spiel um die Herrschaft der Welt vertrauen kann, muss sich entscheiden, für was es sich zu kämpfen lohnt – für ihre Bestimmung oder ihr Herz … Bist du bereit, alles hinter dir zu lassen und dich auf ein knisterndes Abenteuer voller Gefahren, Intrigen und Liebe einzulassen? //Dies ist der Sammelband der göttlich-romantischen Dilogie »Shattered Magic«. Alle Bände der Buchreihe bei Impress: -- An Ocean Full of Secrets (Shattered Magic 1) -- An Ocean Full of Lies (Shattered Magic 2)// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
www.impressbooks.deDie Macht der Gefühle
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2022 Text © Hanna Frost, 2022 Lektorat: Julia Feldbaum Coverbild und Covergestaltung: Formlabor, unter Verwendung mehrer Motive von shutterstock.com/ © vectortwins / © aleksm / © serazetdinov ISBN 978-3-646-60976-9www.impressbooks.de
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Hanna Frost
An Ocean Full of Secrets (Shattered Magic 1)
**Stelle dich deinem wahren Schicksal**
Ruhig, friedlich und vom Ozean umgeben – Bells Heimat könnte idyllischer nicht sein. Das ändert sich jedoch schlagartig, als ein attraktiver Fremder auf der Insel auftaucht und sich als Halbgott zu erkennen gibt. Und als dieser verlangt der arrogante Neo von den Bewohnern das Undenkbare: Jede Familie mit mehr als einem Sohn muss einen davon entbehren, damit dieser Teil seiner Schiffs-Crew wird. Nur so kann die Prophezeiung, welche die Rückkehr der verbannten Götter besagt, vereitelt werden. Bell, die um jeden Preis verhindern will, dass ihr ältester Bruder seine hochschwangere Frau verlassen muss, schlüpft heimlich in dessen Kleider und schleicht sich an Bord des Schiffes. Nicht ahnend, dass sie damit nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz aufs Spiel setzt …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© privat
Hanna Frost wurde 2001 geboren und kann sich rückblickend an keine Nacht erinnern, in der sie nicht heimlich gelesen oder geschrieben hat. Mit 14 Jahren gründete sie ihren eigenen Literaturblog, fünf Jahre später schrieb sie ihr Debüt. Wenn sie nicht gerade an neuen Geschichten tüftelt oder in Tagträumen versinkt, verbringt sie gern Zeit mit ihrem Hund, plant ihre Reise ins All oder widmet sich ihrem Studium – übrigens in genau dieser Reihenfolge.
Wenn kein Wind in die Segel bläst, müssen wir eben rudern.
Altes Seemannssprichwort
Prolog
Das Tosen der Wellen war ohrenbetäubend. Erbarmungslos schlugen die Wassermassen gegen die Felsen der Brandung und zerschellten an ihnen in unzählige Tröpfchen, die das Licht des Mondes brachen und wie glitzernde Kristalle zurück auf die Schwärze der See hinabrieselten. Narius stand einige Meter vom Ufer entfernt hüfttief im Wasser und beobachtete das Spiel der Naturgewalten. Die zwei flossenartigen Auswüchse an den Seiten seines Kopfes zitterten im Wind, während er seine pupillenlosen Augen starr auf das Meer richtete. Ihr Ausdruck zeigte die gleiche Form von Desinteresse, die sich auch in seiner Miene widerspiegelte. Lediglich die mit Schwimmhäuten überzogenen Finger, die unruhig auf seinen verschränkten Unterarmen herumwanderten, gaben Aufschluss über seine wahre Stimmung – über den Orkan, der in seinem Inneren wütete.
Als der Wind die Richtung änderte, vernahm Narius mit einem Mal laute Schreie hinter sich. Seine bläulichen Lippen formten ein breites Grinsen, welches seine spitzen Zähne offenbarte, die in zwei Reihen hintereinanderstanden. Er drehte den Kopf über seine Schulter und richtete den Blick auf einen blonden Mann, der rücklings am Strand lag. Seine Arme und Beine waren weit von seinem Körper abgespreizt und an den Gelenken mit wuchtigen Metallhaken im feinen Sand verankert. Zufrieden beobachtete Narius, wie das schmerzverzerrte Gesicht des Gefangenen kurzzeitig unter einer Welle begraben wurde, die bis auf den Strand spülte. Für einen Moment verstummte das Wehklagen, doch kaum zog sich das Wasser zurück und gab das Gesicht des Blonden wieder frei, drangen erneut Schreie aus dessen Kehle hervor. Es war lang her, dass Narius Laute aus dem Mund eines Menschen gehört hatte, die den Rufen eines sterbenden Tieres ähnelten. Sein Grinsen wurde noch breiter – wie sehr hatte er dieses Geräusch doch vermisst!
Beschwingt watete er durch die hohen Wellen, die ihm keinerlei Probleme bereiteten. Kaum hatte Narius den Gefangenen erreicht, beugte er sich langsam zu ihm hinab und beäugte ihn wie ein Raubvogel eine Maus. Als er seine Lippen öffnete und sprach, wohnte seiner Stimme die gleiche Kraft inne, mit der die Wellen an den Klippen zerschlugen. »Wo ist es?«
»I…ich weiß ni–« Erneut verschluckte die See das Gesicht des Blonden und zwang ihn kurzzeitig zum Schweigen.
»Du weißt es nicht, obwohl ich dir in meiner grenzenlosen Gutherzigkeit mehrere Stunden zum Nachdenken schenkte, anstatt dich auf der Stelle zu ertränken?«
Narius genoss den Anblick der vor Panik geweiteten Augen, als das Gesicht wieder zum Vorschein kam. Er saugte die Angst seines Opfers so gierig auf, als wäre er eine Mücke auf der Suche nach Blut. »Welch ein Jammer!«, höhnte er, wohlwissend, dass seine Worte näher an der Realität lagen, als ihm lieb war. Dieses Verhör dauerte zu lang – viel zu lang. Die Zeit rann ihm wie feiner Sand durch die schuppigen Finger. Wenn er seinem Feind zuvorkommen wollte, musste er sich beeilen. »Ich frage dich ein allerletztes Mal, Sterblicher: Wo liegt es versteckt?«
Hustend schüttelte der Blonde den Kopf. Algen und Haarsträhnen klebten auf seiner nassen Stirn und seine Haut war mittlerweile so schrumpelig, dass sein Gesicht aussah wie ein aufgeweichter Pilz.
Wütend biss Narius seine spitzen Zähne aufeinander. Langsam dämmerte ihm, dass sein Gefangener vielleicht wirklich so ahnungslos war, wie er vorgab zu sein. Erfahrungsgemäß ertrugen die wenigsten Menschen diese Art Folter länger als eine Stunde, der blonde Kerl hingegen lag bereits die halbe Nacht lang in der Kälte des Ozeans.
Resigniert seufzend richtete sich Narius wieder zu seiner vollständigen Größe auf und gestikulierte mit einer Hand in der Luft herum, wobei die feinen Schwimmflossen zwischen seinen Fingern leicht im Wind erzitterten. Sofort lösten sich zwei dürre Gestalten aus dem Schatten der Nacht und folgten dem Wink ihres Meisters.
»Gebt ihm Brot«, wies Narius sie schroff an und wandte sich von seinem Gefangenen ab, »die Kreaturen des Meeres werden beleidigt sein, wenn wir ihnen nur diesen Hungerhaken zum Fraß vorwerfen. Vielleicht zeigen sie etwas Nachsicht, wenn der Kerl wenigstens mit gefülltem Magen untergeht.«
Für einen quälend langen Moment war nur das Rauschen der stürmischen See zu hören. Erst als sich Narius bereits mehrere Schritte entfernt hatte, vernahm er das Klirren der Fesseln seines Gefangenen, als dieser sich ein letztes Mal aufbäumte.
»Nein, das könnt Ihr nicht tun!«
»O doch, Menschlein – und wie ich das kann.« Während er tiefer ins Meer watete, kehrte das abscheuliche Grinsen auf Narius’ Lippen zurück. »Grüß die Haie von mir, Sterblicher.«
Kapitel 1
»Was, glaubst du, verbirgt sich hinter dem Horizont?«, fragte mich Leah, während sie mit zusammengekniffenen Augen auf das schier unendlich wirkende Meer hinausstarrte.
Ich versuchte es ihr gleichzutun, doch das grelle Licht der Mittagssonne brach sich so heftig auf dem himmelblauen Wasser, dass meine Augen sofort anfingen zu brennen. Obwohl ich sie mit einer Hand abschirmte, wurde der Tränenschleier immer dichter. Seufzend ließ ich sie wieder sinken und griff nach dem dunklen Flechtkorb, der neben mir im Sand stand.
»Keine Ahnung«, antwortete ich schulterzuckend, während ich über den warmen Strand stapfte, »aber ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht wissen. Hier auf unserer Insel haben wir doch alles, was wir zum Glücklichsein brauchen. Warum sehnst du dich dennoch nach dem Unbekannten?«
»Weil ich mich nicht damit abfinden kann, dass mein Leben scheinbar nur diese verschlafene Insel zu bieten hat.«
Leahs Stimme klang gleichgültig, doch ich wusste um die tiefere Bedeutung, die sich hinter ihren Worten versteckte. In all den Jahren hatte sie nie verstanden, weshalb sie die Ruhe und Gemächlichkeit unserer Insel schätzen sollte. Stattdessen hing sie ständig ihren absurden Tagträumen nach, in denen sie entweder auf einem Piratenschiff anheuerte oder mit einem zufällig vorbeikommenden Seefahrer durchbrannte.
Als ich mich nach ihr umdrehte, blies mir der Wind mein langes Haar ins Gesicht. Zwar versuchte ich die feinen weißblonden Strähnen wieder hinter meine Ohren zu kämmen, doch schon bei der nächsten Meeresbrise wehten sie mir erneut vor die Augen. Lachend griff Leah in mein Haar und wickelte es um ihr Handgelenk. »Vielleicht solltest du darüber nachdenken, dir diesen Teppich endlich abzuschneiden.«
»Teppich?«, wiederholte ich gekränkt und verschränkte die Arme vor der Brust. »Also, erstens ist mein Haar sehr gepflegt, zweitens stört es mich normalerweise nicht und –«
»Und drittens würde dir deine Mutter niemals erlauben deine schöne Haarpracht abzuschneiden«, beendete Leah meine Erklärung, die ich ihr gegenüber erstaunlich oft ausführen musste. »Versteh mich nicht falsch, Bell, ich mag deine Haare auch sehr gern, aber sie sind einfach unpraktisch. Mittlerweile reichen sie dir ja schon fast bis zur Hüfte!«
Ich spürte, wie Leah meine aufgerollten Haare mit einem Band in meinem Nacken zusammenknotete und dann von mir abließ. Zwar zog das Gewicht des Dutts so schwer an meiner Kopfhaut, dass ich meinen Kopf am liebsten in den Nacken gelegt hätte, aber immerhin konnte ich nun wieder uneingeschränkt sehen. »Danke, Leah.«
»Keine Ursache. Komm, wir sehen nach, ob Flynn auch schon so viele Muscheln gesammelt hat wie wir.«
Ehe ich etwas erwidern konnte, griff Leah nach meiner freien Hand und zog mich hinter sich her. Cremeweiße Sandkörner flogen uns wild um die Knöchel und ich spürte bereits jetzt den Anflug eines leichten Ziehens in meinen Unterschenkeln. Obwohl ich einen Großteil meines siebzehnjährigen Lebens auf dieser Insel verbracht hatte, würden sich meine Muskeln wohl nie an den anstrengenden Gang durch den Sand gewöhnen, der so weich war, dass ich andauernd wegsackte und Mühe hatte, mein Gleichgewicht zu halten. Als Leah nach einer Weile langsamer wurde, entwich mir ein erleichtertes Seufzen. Wir gingen noch einige Schritte, ehe wir vor einer meterhohen Steinwand haltmachten. Sie gehörte zum Fuß des einzigen Berges unserer Insel und teilte diesen Strandabschnitt in zwei Teile.
Wie von selbst fiel mein Blick auf das geräumige Loch, das im Stein klaffte und die Sicht auf die versteckte Bucht freigab, die man sonst nur vom Meer aus erreichen konnte.
Gemeinsam gingen Leah und ich darauf zu. Wir wollten gerade hindurchklettern, als mich ein dumpfes Geräusch aufschrecken ließ. Ich fuhr so ruckartig auf, dass ich mir prompt den Hals verrenkte. Und Leahs Kichern trug nicht gerade dazu bei, dass ich mich besser fühlte.
»Ach, Bell, das war doch nur ein kleiner Stein, der von der Klippe abgebrochen ist. Sei doch nicht immer so schreckhaft! Was soll uns hier schon zustoßen?«
Noch während ich mich zu ihr umdrehte, hoben sich bereits meine Augenbrauen. Diesen besserwisserischen Gesichtsausdruck hatte ich mir wohl über die Jahre hinweg von meiner Mutter abgeschaut. Kurz runzelte Leah die Stirn, doch dann hellte sich ihr Gesicht schlagartig auf. »Jetzt sag bloß nicht, dass du dich immer noch vor Gestaltwandlern fürchtest!«
»Immer noch?«, wiederholte ich stutzig und kletterte durch das Loch im Stein. »Wieso sollte ich jemals aufhören mich vor ihnen zu fürchten?«
»Hm, lass mich kurz überlegen … vielleicht, weil sie nur Geschöpfe aus den Schauermärchen deiner Großmutter sind?« Leahs Stimme klang, als läge diese Antwort auf der Hand, doch mich konnten ihre Worte trotzdem nicht überzeugen.
»Das sind keine Fantasiewesen, Gestaltwandler gibt es wirklich – und sie sind verdammt gefährlich!« Schon allein bei dem Gedanken an Großmutters Geschichten breitete sich eine Gänsehaut auf meinen Armen aus. Im Gegensatz zu Leah und den anderen Inselbewohnern schien ich jedoch die Einzige zu sein, die den Worten meiner Großmutter Glauben schenkte. Ich hatte mich größtenteils damit abgefunden, doch manchmal wünschte ich, Leah würde die Sache wenigstens etwas ernster nehmen. Sollten wir eines Tages von den blutrünstigen Kreaturen des Meeres überfallen werden, würde ich uns wohl kaum allein verteidigen können.
Doch wie immer, wenn dieses Thema zwischen uns zur Sprache kam, machte sie nur eine abwertende Handbewegung und kletterte hinter mir her. Anstatt vergeblich zu versuchen ihr die Gefahr deutlich zu machen, schob ich den Zwischenfall widerwillig beiseite und lief stattdessen weiter in die kleine Bucht hinein. Schon bald spürte ich das kühle Wasser unter meinen nackten Füßen. Als eine seichte Welle bis über meine Knie schwappte, formten sich meine Lippen wie von selbst zu einem zufriedenen Lächeln. Obwohl ich nicht viele Orte abseits unserer Insel kannte, war ich mir in Momenten wie diesem hier sicher, dass es dort draußen unmöglich etwas Schöneres geben konnte als unsere Heimat. Nichts auf der Welt könnte mich mit mehr Glücksgefühlen überhäufen als eine kühle Meeresbrise, die meine Nasenspitze umspielte, während der weiche Sand zwischen meinen Zehen hindurchgespült wurde und sich das Kreischen der Möwen mit dem Rauschen der Wellen vermischte. Ich liebte dieses Gefühl, das so unbeschreiblich war, dass ich es niemals in Worte fassen könnte. Es überschwemmte meinen Körper mit Ruhe und ließ mein Herz vor Zufriedenheit überquellen. Ich hätte nicht dankbarer dafür sein können, ausgerechnet auf diesem Fleckchen Erde leben zu dürfen. Und die Freude darüber verschlang mich an manchen Tagen wie das Meer die Sonnenstrahlen.
»Da sind ja meine beiden Herzensdamen!«, riss mich eine wohlbekannte Stimme plötzlich aus meinen Gedanken.
Leah und ich drehten uns gleichzeitig zu Flynn um, der nur wenige Schritte neben uns knietief im Wasser stand. Seine nussbraunen Augen, die exakt die gleiche Form hatten wie die von Leah, funkelten fast so hell wie die Meeresoberfläche. In seiner Hand hielt er einen Flechtkorb, der meinem zum Verwechseln ähnlich sah.
»Und, wie viele Muscheln hast du gefunden?«, fragte Leah herausfordernd und verschränkte ihre Arme provokativ vor der Brust.
»Auf jeden Fall mehr als ihr, würde ich behaupten«, erwiderte ihr Bruder lachend und fuhr sich durch das sonnengeküsste dunkelblonde Haar.
Ich konnte förmlich dabei zusehen, wie Leahs Lächeln verblasste.
»Pff, du hast bestimmt geschummelt!«, murmelte sie pikiert.
»Wie denn?«, flötete Flynn und streckte uns grinsend seinen Korb entgegen, der bis zum Rand mit schimmernden Muscheln gefüllt war.
»Keine Ahnung. Vielleicht hast du deinen Korb bis zur Hälfte mit Sand beladen und nur ein paar Muscheln oben draufgetan, um deinen Betrug zu verbergen.«
Kichernd beugte ich mich näher an ihr Ohr heran. »Vielleicht hat er aber auch einfach gewonnen, Leah.«
»Kann gar nicht sein«, brummte sie so beleidigt, dass es mir schwerfiel, mein aufsteigendes Lachen zu unterdrücken. Amüsiert wechselten Flynn und ich einen kurzen Blick. Wir beide wussten, dass es in dieser Welt kaum etwas gab, das seine Zwillingsschwester mehr erzürnte, als gegen ihn zu verlieren. Der ständige Wettbewerb zwischen den beiden ließ mich jedes Mal aufs Neue schätzen, wie gut ich mich mit meinen eigenen Geschwistern verstand. Ich wusste nicht, ob es daran lag, dass meine zwei Brüder und ich jeweils mehrere Jahre auseinander waren, aber in unserer Familie hielten wir zusammen und halfen einander, anstatt wie Leah und Flynn nur nach der nächsten Gelegenheit Ausschau zu halten, um zu streiten.
Mit einem zufriedenen Grinsen auf den Lippen überbrückte Flynn den Abstand zwischen uns. Da er einen Kopf größer war als seine Schwester, die mich ihrerseits bereits ein wenig überragte, musste ich meinen Kopf in den Nacken legen, um ihm weiterhin in die Augen sehen zu können.
»Ich glaube dir«, versuchte ich die Situation zu schlichten, erntete jedoch nur ein abwertendes Schnaufen von Leah.
»Du bist viel zu gutgläubig, Bell. Kein Wunder, dass die Leute ihre Probleme ständig auf dich abwälzen.«
»Das stimmt doch gar nicht!«, widersprach ich heftig, doch ausgerechnet Flynn fiel mir eiskalt in den Rücken.
»Und ob das stimmt! Wieso würden wir sonst Muscheln sammeln, anstatt uns einen gemütlichen Nachmittag am Strand zu machen? Du hast Bea nur versprochen dich morgen um die Knirpse zu kümmern und mit ihnen Muschelketten zu basteln, weil du keinen Gefallen ausschlagen kannst.«
»Das ist nicht wahr«, verteidigte ich mich, »Bea hat morgen viel zu tun, darum nehme ich ihr die Kinder gern ab!«
»Viel zu tun?«, wiederholte Leah kichernd. »Sie hat für morgen Nachmittag einen großen Tisch bei unserem Vater gebucht und unserer Mutter aufgetragen Wein und Küchlein für sie und ihre Freundinnen vorzubereiten. Klingt nicht so, als hätte sie sonderlich harte Arbeit zu verrichten, findest du nicht?«
Irritiert riss ich die Augen auf. Bea war doch eine erwachsene Frau, welchen Grund hätte sie meine Gutmütigkeit so schamlos auszunutzen?
»Bea missbraucht deine Hilfsbereitschaft genauso wie Björn, um dessen Schafe du dich mehr kümmerst als er selbst«, stach Leah erneut in die Wunde. »Ich habe ihn letzte Woche nur ein einziges Mal auf der Weide gesehen. Wie oft warst du bei den Tieren?«
»Zwei- bis dreimal am Tag«, nuschelte ich und senkte verlegen meinen Kopf. »Ich gehe anderen Menschen eben gern zur Hand, das ist doch nichts Schlechtes …«
»Grundsätzlich nicht. Aber du bist nicht nur hilfsbereit, sondern auch viel zu gutgläubig. Egoistische Menschen wie Bea sind Gift für so naive Wesen wie dich.«
»Nun tust du Bea und mir aber wirklich Unrecht, Leah!«, empörte ich mich und stemmte meine Hände in die Hüften, um meinen Worten mehr Ausdruck zu verleihen. »Wir sind als kleine Inselgemeinschaft nun mal darauf angewiesen, dass wir aufeinander achtgeben und einander helfen.«
Leahs Lippen formten sich zu einem verständnisvollen Lächeln. »Da hast du natürlich recht, Bell. Und sollte jemand versuchen dich böswillig übers Ohr zu hauen, werden Flynn und ich dich schon vor deiner Gutgläubigkeit beschützen.«
»Das stimmt«, pflichtete Flynn ihr bei und hob den Korb mit seinen gesammelten Muscheln an. »Deswegen helfen wir dir auch gern mit deinen Vorbereitungen für morgen. Also, Bell, was meinst du – reichen die Muscheln aus oder wollen wir noch ein paar Meter den Strand entlangspazieren?«
Nachdenklich betrachtete ich unsere Ausbeute und neigte den Kopf. »Ich denke, wir sollten sicherheitshalber noch ein paar Muscheln sammeln. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Kinder unsere Materialien zerstören. Weißt du noch, wie Lori das Perlenglas ausgekippt hat und wir stundenlang über den Fußboden gerobbt sind, um alles wieder aufzusammeln?«
»Oh, erinnere mich bitte nicht daran!«, stöhnte Leah und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Meine Knie tun immer noch weh!«
»Gut, dann lasst uns noch ein paar Schritte gehen«, entschied Flynn und drehte sich um, um wieder zum Land zurückzukehren. »Diese Bucht ist so schön, hier kann man gar nicht lang genug verweilen.«
Leah und ich nickten zustimmend und folgten ihm durch die sanften Wellen. Der Sand unter meinen Füßen fühlte sich dabei genauso warm an wie das Wasser an meinen Unterschenkeln.
Als wir den Strand erreicht hatten und gemächlich daran entlangschlenderten, nahmen mich Flynn und Leah zwischen sich, als wäre ich ihre kleine Schwester, auf die sie achtgeben müssten. Unwillkürlich dachte ich daran zurück, wie Bea einst gesagt hatte, dass wir drei durchaus als Geschwister durchgehen könnten. Zwar unterschied ich mich äußerlich durch meine grünen Augen und mein weißblondes Haar von den Zwillingen, aber dass wir uns in Sprache und Mimik ähnelten, ließ sich nicht leugnen. Dies war jedoch wenig verwunderlich, schließlich waren wir gemeinsam auf diesem verschlafenen Stück Land mitten im Nirgendwo aufgewachsen. Mein älterer Bruder Phil und ich hatten uns nach unserer Ankunft auf der Insel schnell mit den Geschwistern angefreundet, was wohl auch daran gelegen hatte, dass Leah und Flynn die einzigen Bewohner in unserem Alter waren. Auch heute noch war ich der festen Überzeugung, dass diese Freundschaft das Beste war, was mir passieren konnte.
»Autsch!«, fluchte Leah plötzlich neben mir und riss mich aus meinen Erinnerungen.
Überrascht blieb ich stehen und schaute zu ihr hinüber. »Alles in Ordnung?«
»Nein, irgendetwas hat sich in meinen Fuß gebohrt«, beschwerte sie sich und deutete auf den Sand vor unseren Füßen. Rasch bückte ich mich und tastete behutsam den Boden ab. Wir mussten diesen Gegenstand unbedingt finden, ehe sich jemand ernsthaft daran verletzen konnte. Ich erinnerte mich noch lebhaft daran, wie ich vor ein paar Jahren auf eine Glasscherbe getreten war und Flynn mich zu meinem Elternhaus hatte tragen müssen, weil ich vor Schmerzen nicht einmal mehr einen einzigen Schritt hatte gehen können.
Plötzlich fühlte ich eine kühle, glatte Oberfläche unter meinem Zeigefinger. Behutsam umfasste ich den Gegenstand und zog ihn aus dem weichen Sand. Als ich erkannte, was ich da in meiner Hand hielt, wäre mir vor Erstaunen beinahe die Luft weggeblieben.
»Ist da etwas drin?«, fragte Flynn aufgeregt und beugte sich zu meinem Fundstück hinab, das ich wie ein rohes Ei in den Händen hielt. Behutsam drehte ich die kleine Glasflasche, die erstaunlich schwer auf meiner Handfläche lag, und betrachtete ihr Inneres. Wenn ich zwischen den ausgetrockneten Algenresten hindurchsah, konnte ich tatsächlich etwas erkennen.
»Das sieht aus wie eine Papierrolle«, mutmaßte Leah. »Sie scheint sogar trocken zu sein … Ob das eine Schatzkarte ist?«
Kopfschüttelnd machte ich mich an dem Korken zu schaffen, der felsenfest im Flaschenhals steckte. »Hast du mir nicht gerade noch unterstellt, dass ich diejenige mit der blühenden Fantasie sei?«, fragte ich spöttisch, worauf Leah nur schmunzelnd mit den Augen rollte.
»Im Gegensatz zu deinen Gestaltwandlern und Seeungeheuern gibt es Schatzkarten wirklich.«
»Da dieser Schatz aber garantiert nicht auf unserer Insel liegt, hilft sie dir trotzdem nicht weiter.«
»Wieso nicht?«, mischte sich Flynn ein und klopfte mir leicht auf die Schulter. »Wenn der Schatz woanders vergraben wurde, machen wir uns eben auf die Suche! Das ist bestimmt ein Wink der Götter, damit du endlich mal aus deinem Kokon ausbrechen und die Welt entdecken kannst, Bell!«
»Pff, na sicherlich«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, doch das abenteuerliche Leuchten in Flynns Augen erinnerte mich daran, wie dickköpfig die Zwillinge sein konnten. Ihnen würde ich sogar zutrauen, dass sie alle Palmen unserer Insel fällten, um daraus ein Floß zu bauen und das Meer zu bereisen. Allerdings konnte ich mir genauso gut vorstellen, wie das Konstrukt bereits beim ersten Wellengang wieder in seine Einzelteile zerfallen würde, weil handwerkliches Geschick noch nie zu den Stärken der beiden gehört hatte …
»Hey, Träumerchen, jetzt mach doch endlich mal die Flasche auf!«, wies Flynn mich ungeduldig an.
Erschrocken blinzelte ich zu ihm auf, während das Floß vor meinem inneren Auge im Meer versank. Flynn stieß ein belustigtes Schnauben aus, ehe er nach der Flasche griff und sie mir aus der Hand nahm. Meine Tagträume waren für ihn nichts Neues. Schon als Kind hatte er mich oft davor bewahrt, gedankenverloren gegen eine Palme zu laufen.
Ein leises »Plopp« lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf unser Fundstück. Mit angehaltenem Atem beobachtete ich, wie Flynn ein dünnes Papier aus dem Gefäß zog und es behutsam auseinanderrollte. Die Flasche warf er währenddessen achtlos in den Sand. Schnaufend bückte ich mich danach und legte sie zu den Muscheln in seinem Korb. Dachte Flynn denn gar nicht an die spielenden Kinder oder die Tiere, die sich vielleicht an dieser Flasche verletzen würden, wenn er sie einfach hier liegen ließ?
»Was steht denn nun da?«, fragte Leah ungeduldig, während sie versuchte einen Blick auf das Papier zu erhaschen. »Keine Ahnung, die Schrift ist noch krakeliger als deine«, erwiderte Fynn feixend.
Als ich die Angriffslust in Leahs Augen bemerkte, griff ich rasch selbst nach dem Papier, ehe die Situation in einem Streit enden könnte. Gedanklich bedankte ich mich einmal mehr bei meiner Mutter, dass sie mich und meine Geschwister zu einer so harmonischen Familie erzogen hatte – den ständigen Kleinkrieg im Haus von Leahs und Flynns Familie würde ich nicht aushalten.
Während meine Fingerspitzen behutsam über das raue Papier strichen, wurde mir flau im Magen. Flynn hatte recht, die Worte waren furchtbar unsauber auf das Pergament gekritzelt worden. An einigen Stellen hatte der Verfasser sogar so fest mit der Tintenfeder aufgedrückt, dass das Papier eingerissen war. Während ich die verschmierten Buchstaben in meinem Kopf zu Wörtern zusammensetzte, wurde mein Mund mit jeder Sekunde trockener. Dann begann ich zu lesen: »Ich glaube, dass ich nun weiß, wo Nummer eins versteckt liegt. N ahnt nichts. Die nötigen Informationen habe ich dem Boten übergeben, sie werden dich bald erreichen. Die Bezahlung bitte wie immer am vereinbarten Ort hinterlegen. Melde mich wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Bis dann –« Ich geriet ins Stocken. »Das letzte Wort kann ich leider nicht lesen.«
»Also doch ein Schatz!«, quiekte Leah und klatschte begeistert in die Hände. »Komm, Flynn, wir fragen Vater, ob wir uns seinen Spaten ausleihen dürfen.«
»Die genannte Bezahlung könnte überall liegen«, wandte ich in der Hoffnung ein, Leahs Tatendrang auszubremsen. »Die Flasche wurde sicherlich angespült, wer weiß, von wo aus sie ursprünglich abgeschickt wurde. Außerdem wissen wir nicht, wie alt diese Nachricht ist. Bestimmt wurde der Schatz schon längst ausgegraben.«
»Jetzt sei doch nicht so eine Spielverderberin!«, forderte Leah genauso quengelig wie mein jüngerer Bruder Mino, wenn Mutter ihn abends ins Bett schickte.
»Deine Logik geht ausnahmsweise nicht auf, Bell«, pflichtete Flynn seiner Schwester überraschend bei. »Wieso sollte irgendwer eine Nachricht, die eindeutig an jemand Bestimmten adressiert ist, einfach ins Meer werfen und darauf hoffen, dass sie ankommt? Das macht doch keinen Sinn! Die Wahrscheinlichkeit, dass die Flasche im Meer verloren geht und ihren Adressaten niemals erreicht, liegt doch praktisch bei hundert Prozent! Ich vermute eher, dass der Empfänger die Nachricht bereits bekommen hatte und bei sich trug, weil er oder sie hier nach dem Schatz gesucht hat.«
Erneut versuchte ich die Worte des Briefes zu entziffern, doch meine Hände zitterten so stark, dass ich die Buchstaben nur verschwommen erkannte. »Du hast recht«, murmelte ich mit bebender Stimme. »Aber das würde ja bedeuten, dass … dass ein Fremder auf unserer Insel herumspaziert ist!«
»Mag sein. Aber wie du selbst gesagt hast, wissen wir nicht, wie lange diese Flaschenpost schon hier herumliegt. Gut möglich, dass dieser Fremde vor unserer Zeit hier war. Wir könnten doch deine Großmutter fragen, schließlich kennt sie alle Geschichten und Mythen, die sich um unsere Insel ranken. Wenn jemand weiß, ob es hier einen Schatz gibt, dann sie.«
»Gute Idee«, murmelte ich, obwohl ich alles andere als überzeugt war.
Plötzlich tätschelte Leah meine Schulter. »Und wie erklärt ihr zwei Superschlauen euch dann diese Spuren dort hinten?«
Erschrocken fuhr ich hoch und sah auf die Stelle, auf die Leahs Zeigefinger deutete. Mein Herz geriet ins Stolpern. »Verdammt, das sind Fußabdrücke, oder?«
»Ich glaube, ich habe dich gerade zum ersten Mal fluchen hören, Bell«, murmelte Leah, was überhaupt nichts zur Sache tat.
Während ich Flynn beobachtete, der zu den Spuren hinüberging und sich daneben in den Sand hockte, wurden meine Handflächen ganz schwitzig. »Manchmal spielen uns die Verwehungen des Sandes einen Streich«, sagte er an niemand Bestimmten gerichtet, »aber hier sind eindeutig die Absätze von Stiefeln zu erkennen. Es sind zweifellos echte Fußspuren … «
Das Pochen meines Herzens wurde so laut, dass es sogar das Rauschen des Meeres übertönte. »Vielleicht haben die Kinder hier gespielt? Diese Bucht gehört ja nicht allein uns«, mutmaßte ich, doch Flynns ernstes Kopfschütteln ließ meine Hoffnung sofort wieder zerspringen.
»Die Kinder wissen, dass sie hier nicht allein hindürfen. Die Strömung ist zu gefährlich. Außerdem sind diese Stiefelabdrücke viel zu groß für Kinderschuhe und die Knirpse gehen normalerweise barfuß, Bell.«
»Dann von einem der anderen Erwachsenen?«, mischte sich Leah ein, doch auch für seine Schwester hatte Flynn nur ein knappes Kopfschütteln übrig.
»Die halten sich hier nicht auf. Überlegt doch mal, seit wie vielen Jahren wir beinahe täglich hierherkommen. Sind wir in dieser Zeit jemals jemandem begegnet?«
»Nein«, antwortete ich leise. »Also stammen sie wirklich von … von einem Fremden?«
»Das ist unmöglich«, erwiderte Leah und schüttelte energisch den Kopf. »Abgesehen von Limea kommt niemand unsere Insel besuchen. Die meisten Leute vom Festland wissen doch nicht einmal, dass wir überhaupt existieren, weil wir so weit vom restlichen Königreich entfernt sind. Und selbst, wenn sie es wüssten: Was sollte jemand auf einem so kleinen, verschlafenen Stück Land suchen?«
»Na, vermutlich die Belohnung, die in der Flaschenpost erwähnt wurde«, mutmaßte ich. »Der Besitzer muss die Flasche auf seinem Weg durch den Sand verloren haben.« Kaum hatte ich es ausgesprochen, beschlich mich ein böser Verdacht. Blitzschnell packte ich Leahs Handgelenk und winkte Flynn zu uns heran.
Zwar runzelte er die Stirn, doch zu meiner Erleichterung schloss er rasch zu uns auf. »Was ist lo–?«
»Die Spuren müssen frisch sein, ansonsten wären sie bereits vom Wind oder vom Meer verwischt worden. Das bedeutet, dass der Fremde vermutlich ganz in der Nähe ist!«, unterbrach ich ihn mit heiserer Stimme. »Wir müssen sofort die anderen warnen und eine Gruppe zusammenstellen, um die Insel abzusuchen!«
»Beruhige dich, Bell, nicht jeder Fremde muss böse Absichten hegen. Vielleicht ist er in Seenot geraten und benötigt Hilfe. Wir können der restlichen Weltbevölkerung schlecht verbieten einen Fuß auf unsere Insel zu setzen, oder?«
»Wer sagt denn, dass er ein normaler Mensch ist?«, zischte ich zurück, woraufhin Leah und Flynn gleichzeitig die Augenbrauen hoben. »Wie meinst du das?«
»Na wie wohl – Gestaltwandler!«
Leah und Flynn wechselten einen Blick. Dann brachen sie beide in schallendes Gelächter aus.
»Was ist daran so komisch?«, zischte ich und bedeutete ihnen leiser zu sein.
»Du und deine Schauermärchen«, antwortete Leah kichernd. »Gestaltwandler gibt es nicht, Bell. Mach die Situation bitte nicht unheimlicher, als sie ist.«
»Pff, natürlich gibt es die«, grummelte ich und verschränkte meine Arme vor der Brust. »Aber selbst, wenn es keiner ist – einem Piraten will ich genauso wenig begegnen!«
»Im Gegensatz zu Gestaltwandlern gibt es die zwar wirklich«, sinnierte Flynn und fuhr sich durch das dunkelblonde Haar, »aber müssten wir dann nicht ein großes Schiff sehen?«
»Können wir bitte erst darüber nachdenken, nachdem wir wen auch immer gefunden und sichergestellt haben, dass er oder sie ungefährlich ist? Kommt schon, lasst uns zu den anderen gehen!« Nervös verlagerte ich mein Gewicht von einem Bein aufs andere, während mein Blick hektisch über den Strand glitt. Mit einem Mal fühlte ich mich beobachtet. Hinter jedem Felsen, ja, sogar unter der Wasseroberfläche könnte jemand verborgen sein. Und auch wenn Flynn und Leah mir nicht zustimmten, war ich davon überzeugt, dass dieser Fremde nichts Gutes im Schilde führte. »Worauf warten wir?« Der schrille Klang meiner Stimme unterschied sich kaum noch vom Kreischen der Möwen.
Die Zwillinge warfen sich einen verschwörerischen Blick zu und nickten langsam, als wären sie zu einer stummen Vereinbarung gekommen. Mit Entsetzen beobachtete ich, wie sich Flynn kurz darauf umdrehte und erneut zu den Fußspuren hinüberlief.
»Nein, nein, nein, nein, nein!«, fluchte ich so hastig, dass es fast wie ein zusammenhängendes Wort klang. Ich rüttelte an Leahs Arm und suchte ihren Blick. »Bei den Göttern, wieso geht er wieder dorthin? Wir müssen so schnell wie möglich weg von hier!«
»Flynn will nur schauen, ob wir etwas übersehen haben.«
»Was sollten wir denn übersehen haben?«, fragte ich und warf fassungslos die Arme in die Luft. »Den Gestaltwandler? Den gezückten Säbel eines Piraten? Den Lauf eines Gewehres?«
»Also wirklich, Bell, nun übertreibst du aber maßlos!«, rügte mich Leah und verdrehte genervt die Augen. »Was, wenn es einen Schiffbrüchigen gibt und die Flaschenpost gar nichts mit ihm zu tun hat? Könntest du es mit deinem Gewissen vereinbaren, einen hilflosen Menschen am Strand zurückzulassen? Sein Schicksal in die Hände der Götter zu legen? Ich denke nicht!«
»Aber –«
»Hey, ihr zwei, kommt mal her!«, unterbrach Flynns Ruf unsere Diskussion.
Wie von einer Wespe gestochen fuhr ich zu ihm herum und wedelte panisch mit den Armen in der Luft umher. »Sei still! Du lockst das Monster an!«
»Hier ist kein Monster«, erwiderte er genauso laut wie zuvor, »aber ich sehe dort hinten einen großen Haufen angespülter Algen, in denen sich wunderschöne Muscheln verfangen haben. Wenn wir die mitnehmen, hätten wir genügend für die Kinder gesammelt und müssten nachher nicht noch einmal aufbrechen. Kommt her, zusammen sind wir schneller!«
Leah und ich tauschten einen kurzen Blick.
»Klingt nach einem guten Plan, oder?«, fragte sie schulterzuckend und setzte sich in Bewegung. Mit heruntergeklappter Kinnlade sah ich ihr nach. Meinten die beiden das etwa ernst? Wie oft musste ich ihnen denn noch sagen, dass wir so schnell wie möglich von diesem Ort fliehen sollten?
Fassungslos beobachtete ich, wie Leah zu ihrem Bruder aufschloss, der neben einem großen Felsbrocken auf sie wartete. Als sie ihn erreicht hatte, liefen sie gemeinsam um den Steinkoloss herum und verschwanden aus meinem Sichtfeld. Nun stand ich ganz allein da. »Bei den Göttern«, murmelte ich vor mich hin, unsicher, was ich nun tun sollte. »Von wegen, Gestaltwandler gibt es nur in Kindermärchen … Wenn ihnen eines dieser Monster einen Arm abbeißt, sollen sie ja nicht auf die Idee kommen, bei mir um Mitleid zu buhlen! Ich werde –«
Ein großer Schatten schoss so dicht an meinem Kopf vorbei, dass mir ein Schrei entwich und ich instinktiv auf meine Knie sank. Als ich aufsah, entdeckte ich eine Möwe, die sich mit kräftigen Flügelschlägen in die Höhe schraubte. In meinen Ohren klangen ihre Rufe wie hämisches Gelächter. Rasch rappelte ich mich wieder auf. Obwohl die Möwe wohl die einzige Zuschauerin meines ungraziösen Falles gewesen war, spürte ich ein heißes Brennen auf meinen Wangen. Plötzlich keimte erneut das Gefühl in mir auf, dass ich von jemandem beobachtet wurde …
Angespannt versuchte ich meinen nicht vorhandenen Speichel hinunterzuwürgen. Flynn und Leah mochten sich selbst verschuldet in Schwierigkeiten bringen, aber immerhin waren sie zu zweit. Ich hingegen, die weder kämpfen noch besonders schnell laufen konnte, wäre bei einem Angriff hoffnungslos verloren. Ich zögerte einen kurzen Augenblick, dann drehte ich mich auf der Stelle um und rannte, so schnell ich konnte, zu dem Felsen, hinter dem Leah und Flynn verschwunden waren. Als ich bei ihnen ankam, blickten mir zwei identische Augenpaare entgegen.
»Alles in Ordnung?«, fragte Flynn hörbar besorgt.
»Wieso siehst du aus, als hättest du ein Gespenst gesehen und wärst mit ihm um die Wette gerannt?«, fügte Leah deutlich weniger mitfühlend hinzu.
Seufzend strich ich mir die vielen Haarsträhnen aus dem Gesicht, die sich während meiner Flucht aus dem Dutt gelöst hatten, und versuchte wieder zu Atem zu kommen. Es gab nicht viel, wofür ich Hass empfand, doch Lügerei zählte definitiv dazu. Dennoch konnte ich mir nicht die Blöße geben, den beiden zu erzählen, dass mein Herz beinahe stehen geblieben wäre, weil ich mich am Strand vor einer Möwe erschrocken hatte.
»Alles bestens«, antwortete ich daher atemlos und zuckte die Schultern. »Ich habe nur sichergestellt, dass wir nichts übersehen haben oder sich jemand von hinten anschleicht. Man könnte sagen, dass ich euch den Rücken freigehalten habe.«
»Soso«, erwiderte Leah lang gezogen, ehe sie sich wieder über den Algenhaufen zu ihren Füßen beugte. »Ich wüsste zwar nicht, vor wem wir uns fürchten sollten, aber danke für deine tatkräftige Unterstützung. Wenn du uns jetzt noch dabei helfen würdest, die restlichen Muscheln aufzusammeln, könnten wir endlich wieder zur Siedlung zurückkehren.«
Eilig nickte ich und lief zu dem großen Algenhaufen hinüber, kniete mich in den feinen Sand und begann damit, eine Muschel nach der anderen aus dem Algengewirr hervorzuziehen. Dabei merkte ich, wie sich mein Atem langsam wieder beruhigte – zumindest, bis Flynn plötzlich neben mir hochfuhr und nach Luft japste.
»Was ist los?«, fragte ich erschrocken und hielt in meiner Bewegung inne.
»Weiß nicht«, antwortete er knapp. »Diese Algen hier sind so ungewöhnlich dunkel, dass ich sie einen Moment lang für nasses Haar gehalten habe. Das Meer ist sauber und klar, wieso ist diese Stelle so dreckig, als hätte man sie durch Matsch gezo–«
Leah schrie auf. Sofort schoss mein Kopf zu ihr hinüber. Als ich verstand, was sich vor meinen Augen abspielte, wollte ich ebenfalls schreien, doch kein Laut drang aus meiner Kehle hervor. Ich wollte wegrennen, doch mein Körper gehorchte nicht. Nicht einmal ein besserwisserisches »Ich hab’s euch ja gesagt« glitt über meine Lippen, während ich aus aufgerissenen Augen auf Leahs Handgelenk starrte, um das sich blasse Finger krallten – vier Finger, um genau zu sein. Den Stummel an der Stelle, an der einst ein Daumen gesessen haben musste, konnte man beim besten Willen nicht dazuzählen.
Als wäre ich Zuschauerin in meinem eigenen Albtraum, beobachtete ich, wie Flynn aufsprang und zu seiner Schwester eilte. Leah versuchte sich derweil loszureißen, doch wer auch immer sie festhielt, ließ nicht locker. Durch die ruckartigen Bewegungen rutschten die Algen beiseite und offenbarten einen leichenblassen Mann, der sich langsam unter dem Matschgrün hervorschälte. Die Schreie von Flynn, Leah und dem Fremden, dessen blasse Augen so weit aufgerissen waren, dass sie den Anschein erweckten, sie würden ihm gleich aus dem Kopf fallen, hallten in meinen Ohren. Er schien im gleichen Alter zu sein wie mein großer Bruder, doch seine Haut war so käsig und aufgequollen, dass er genauso gut auch zwanzig Jahre älter sein könnte.
»Lass sie los!«, kristallisierte sich Flynns Forderung aus dem Stimmengewirr, während er versuchte seine Schwester aus dem Griff des Fremden zu befreien. Er gab dem Mann einen kräftigen Stoß gegen die Brust, woraufhin dieser hustend in sich zusammensackte und von Leah abließ. Sein Gesicht drehte sich in meine Richtung und sein starrer Blick kreuzte meinen. Wie ein Speer bohrte er sich durch sie hindurch. Ein eisiger Schauer ließ meinen Körper erzittern; dieser Anblick würde mich wohl mein ganzes Leben lang bis in meine tiefsten Albträume verfolgen …
Plötzlich schoss die Hand des Mannes mit solch einer unerwarteten Schnelligkeit auf mich zu, dass ich mich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Keinen Wimpernschlag später umklammerten seine knochigen Finger mein Handgelenk auf dieselbe Weise, wie sie zuvor Leah festgehalten hatten. Sie fühlten sich so kalt an wie das Meer in einer frostigen Winternacht.
Vor Angst stiegen mir Tränen in die Augen, mein Körper erstarrte. Ich blickte zitternd in die Augen des Fremden, in denen sich der Wahnsinn widerspiegelte. Wieso hatte ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört und Hilfe geholt, als es mir noch möglich gewesen war? Ich hätte einfach wegrennen sollen … stattdessen war ich meinem Verderben direkt in die Arme gelaufen.
»Er war hier!«, krächzte der Mann mit so rauer Stimme, als hätte er den ganzen Tag lang geschrien. »Ihr seid alle dem Untergang geweiht, die Götter werden kein Erbarmen zeigen. Sie werden die Erde vernichten und Rache für die List nehmen, mit der unsere Vorfahren sie an der Nase herumgeführt haben. Du … du musst …«
Er begann so stark zu husten, dass ich befürchtete, er würde mir entweder auf den Schoß brechen oder ersticken. Das Geräusch des Röchelns, das aus seinem Hals drang, brannte sich in meinen Kopf.
»Lauf, Leah, lauf und hol Hilfe!« Wie in Trance blickte ich zu Flynn hinüber, der eindringlich an den Schultern seiner Schwester rüttelte. Leahs Gesicht hatte die Farbe meines Haares angenommen und ihr Blick wirkte so panisch, wie ich mich innerlich fühlte. So blass und verängstigt hatte ich sie noch nie gesehen. Schwankend stand sie auf und stolperte durch den Sand davon.
Kaum war sie aus meinem Sichtfeld verschwunden, richtete ich meine Augen wieder auf das entstellte Gesicht des Mannes, der sich noch immer an mir festkrallte. »Wer … wer bist du? Und vor welchen Göttern sollen wir uns fürchten? Ich dachte, sie sind –«
»Er ist hier!«
Sein Krächzen ließ mich erschrocken zusammenzucken und nach Luft japsen. So mussten die Stimmen im Totenreich klingen – ich war mir ganz sicher. »Wen meinst du?«
»Sprich nicht mit ihm, Bell!«, wies mich Flynn an, während er nach den Fingern des Fremden griff und mich zu befreien versuchte, doch ich brachte es nicht über mich, dem offensichtlich leidenden Mann meine Aufmerksamkeit zu verwehren. Stattdessen fiel mein Blick auf eine klaffende Wunde an seinem Hals, aus der merkwürdige Geschwüre hervorquollen. Sie erinnerten mich an die zartrosa Seepocken, die an den Unterseiten unserer Stege wuchsen. Gesund sah das definitiv nicht aus.
»Was ist passiert?«, fragte ich so leise, dass ich meine eigene Stimme kaum hörte.
»Sie haben gemerkt, dass ich ihnen auf die Schliche gekommen bin«, erklärte der Fremde, »aber ich habe ihnen nichts verraten! Du musst … ihn warnen!«
»Ihn? Wenn denn?«
»Wir sind verloren«, wich der Mann meiner Frage aus, während er seine Finger so tief in meine Haut bohrte, dass es mich nicht wundern würde, wenn sein Griff einen lebenslangen Abdruck auf meinem Handgelenk hinterließe.
»Gleich kommt jemand, der dir helfen wird«, versuchte ich ihn und mich gleichermaßen zu beruhigen, doch der Mann lachte nur trocken.
»Nein, Mädchen, mich kann niemand mehr retten. Und dich auch nicht.«
Seine Worte erwischten mich so heftig, als hätte ich einen Schlag gegen die Brust kassiert, der allen Sauerstoff aus meiner Lunge gepresst hatte. Kalter Schweiß lief mir über die Stirn. Trotzdem gelang es mir noch immer nicht, meinen Blick von dem Wahnsinnigen abzuwenden. Er wanderte über das blasse Gesicht hinab zu den Handgelenken, an denen merkwürdige Ringe angebracht waren. Auf mich wirkten sie wie die Eisenringe, mit denen wir kleine Boote am Steg befestigten. An einem Menschen hatte ich sie jedoch noch nie gesehen.
Das laute Pochen meines Herzens wurde unerträglich, Tränen brannten mir wie Säure in den Augen. »Flynn«, presste ich wimmernd hervor, »bitte reiß mich los, ich kann das nicht mehr!«
»Ich bin ja dabei«, erwiderte er dicht an meinem Ohr, »aber der Kerl hat einen verdammt festen Griff!«
Wie aufs Stichwort krampften sich die Finger noch fester um mein Handgelenk. Der Blick des Fremden schien währenddessen immer milchiger zu werden.
»Er stirbt«, sprach Flynn das Offensichtliche aus. »Du musst nur noch kurz durchhalten, Bell.«
Seine Worte ließen mich schlucken. Ich wusste, dass er es in diesem Moment nicht böse meinte, aber die Grausamkeit hinter seiner Aussage setzte mir beinahe genauso sehr zu wie der starre Blick des Fremden. Ich wollte nicht, dass er starb – er sollte mich nur loslassen.
Mit einem kraftvollen Ruck riss Flynn die knochigen Finger von meinem Handgelenk. Er wollte mich auf die Füße ziehen und losrennen, doch die Angst ließ meine Muskeln erschlaffen, sodass ich wieder in den Sand sackte. Wie von selbst glitt mein Blick über die nasse Kleidung des Mannes, über das zerrissene Hemd und die tiefen Wunden, die unter dem Stoff hervorblitzten. Was auch immer ihm zugestoßen war, er musste fürchterlich gelitten haben. Und nun würde er sterben. Ganz allein auf einer fremden Insel. Mit niemandem an seiner Seite, der ihm die Hand hielt, während er in die Augen der Todesgöttin blickte. Mein Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Nein. So einen Tod hatte niemand verdient. Was wäre ich nur für ein Mensch, wenn ich ihn so hilflos und allein seinem Schicksal überließe?
Ich konnte es selbst nicht ganz glauben, doch ehe ich mich umentscheiden konnte, streckte ich dem Fremden bereits meine Hand entgegen, die er seinerseits sofort ergriff. Während ich behutsam mit meinem Daumen über seine schrumpelige, vom Meerwasser aufgeweichte Haut strich, verschoben sich seine Mundwinkel zu einem schiefen Lächeln.
Ich erwiderte es, obwohl mir innerlich nach Heulen zumute war. »Du musst keine Angst haben«, versuchte ich uns beide zu trösten. »Ich werde hierbleiben, bis … bis …«
»Bis ich gestorben bin.«
»Nein, bis Hilfe kommt«, widersprach ich mit bebender Stimme. »Leah ist eine schnelle Läuferin, sie und unser Mediziner werden gleich zurück sein.«
Der Fremde schüttelte den Kopf, doch auf seinen spröden Lippen trug er noch immer ein mattes Lächeln. »Die Prophezeiung muss abgewendet werden, sonst wird unsere Welt im wahrsten Sinne des Wortes untergehen. Du musst ihn warnen, Mädchen.«
»Das … werde ich tun«, versprach ich, obwohl ich mich dabei hundeelend fühlte. Wie sollte ich dieses Versprechen jemals einhalten? Ich wusste ja nicht einmal, von wem der Fremde überhaupt sprach!
Aus der Ferne vernahm ich mit aufgebrachte Rufe, doch mein Blick galt nur dem jungen Mann, dessen Atem mit jedem Wimpernschlag leiser wurde.
»Danke«, presste er mit rasselnder Stimme hervor. »Und sag ihm bitte auch, dass … dass die Ereignisse von damals nicht seine Schuld waren. Es war alles eine einzige Lüge, es war –« Erneut brach die Stimme mitten im Satz ab.
Tränen verschleierten meine Sicht, doch ich wagte es nicht, die Hand des Fremden loszulassen, um die Nässe aus meinen Augenwinkeln zu wischen.
»Was war nicht seine Schuld?«, fragte ich heiser, obwohl ich genau wusste, dass diese Unterhaltung zu nichts führen würde. Es war offensichtlich, dass der Mann zu meinen Füßen nicht bei Sinnen war. Was auch immer ihm auf hoher See zugestoßen war, es hatte ein verheerendes Chaos in seinem Kopf hinterlassen. Dennoch wollte ich ihn nicht spüren lassen, wie wenig ich seine Worte verstand. Stattdessen sollte er etwas zur Ruhe kommen und sich keinesfalls noch mehr aufregen.
»Er weiß, was ich damit meine«, hauchte der Fremde und schloss seine Finger fester um meine zitternde Hand. »Ich muss jetzt gehen. Danke, dass … dass du mir Gehör geschenkt hast.«
Verwundert runzelte ich die Stirn. »Gehen? Wohin denn? Ich denke, du solltest lieber liegen bleiben und –«
Ein röchelndes Geräusch, das unter anderen Umständen vielleicht ein Lachen gewesen wäre, drang aus seiner Kehle hervor. »Meine letzte Reise geht ins Niemandsland. Um diese Schwelle zu überschreiten, brauche ich keine Kraft. Bitte behalte meine Worte in Erinnerung und pass auf, dass … dass dich die Untoten … nicht …«
Die Augenlider des Mannes vibrierten wie ein Zitteraal. Als ich hilfesuchend aufsah, entdeckte ich Leah und einige der Inselbewohner neben dem Felsen stehen. Als sich unsere Blicke trafen, wollte Leah sofort zu mir eilen, doch Bea packte sie unverzüglich am Arm und zog sie zurück.
»Nicht anfassen! Bell, verschwinde von dem Kerl!«, rief sie mir aufgebracht zu, doch ich schüttelte verzweifelt den Kopf.
»Er braucht Hilfe!«, erwiderte ich, wobei meine Stimme so heiser klang, dass ich sie zunächst gar nicht als meine eigene identifizierte.
»Für diesen Mann kommt jede Hilfe zu spät.« Alarik, das Oberhaupt unserer Inselgemeinde, kam langsam auf mich zugelaufen. Der Ausdruck um seine schmalen Lippen wirkte noch strenger als sonst. »Flynn, du bringst die Mädchen nach Hause. Bea, du und …«
Der Rest seines Satzes wurde von einem lauten Piepen in meinen Ohren übertönt. Meine Unterlippe zitterte so stark, dass ich kein Wort herausbekam.
Ein letztes Mal wanderte mein Blick auf den Fremden hinunter. Sein Gesicht hatte einen friedlicheren Ausdruck angenommen, doch seine offenen Augen wirkten seltsam stumpf. Irgendwie … milchig. Während seine Pupillen gen Himmel wanderten, öffnete er die Lippen, doch statt Worten glitt nur ein leiser Seufzer über sie hinweg.
Dann erschlaffte sein Handgriff – und mit ihm zerbrach meine bittersüße Illusion, dass es Tod und Elend nur abseits unserer verschlafenen Insel gab.
Kapitel 2
Schweigend starrte ich auf das Feuer in unserem Kamin. An einem normalen Abend hätte ich das leise Knistern des brennenden Holzes genossen. Hätte die prickelnde Wärme auf meiner Haut gespürt und an den fröhlichen Unterhaltungen meiner Familie teilgenommen, die neben mir am Esstisch Platz genommen hatte. Doch seit dem Vorfall am Strand war nichts mehr normal – gar nichts.
Das Knacken des Holzes ging in meinen schreienden Gedanken unter wie ein Stein im Meer. Ich konnte die Wärme des Feuers nicht spüren, weil sich eine eisige Kälte in meine Knochen gefressen hatte, und dem Gespräch meiner Familie lauschte ich schon lang nicht mehr. Stattdessen rührte ich nur stumpf in der Kartoffelsuppe, die mir meine Mutter vor einigen Minuten vor die Nase gestellt hatte. Nein, dieser Abend war ganz sicher nicht normal. Ehrlich gesagt fühlte er sich an wie der Anfang vom Ende.
»Bell, es ist vorbei.«
Mein Herzschlag setzte für einen Moment aus. Zeitgleich erstarrte meine Hand, mit der ich den Löffel führte. Langsam wanderte mein Blick über den gedeckten Tisch zu meiner Mutter, die am Kopfende neben meinem jüngeren Bruder saß und mich besorgt musterte.
»Nein, Mutter.« Meine Stimme klang ganz anders als noch vor wenigen Stunden, als ich mich in meinem Zimmer verschanzt und mir die Augen aus dem Kopf geheult hatte. Der heisere Unterton war zwar immer noch da, aber das weinerliche Beben war verschwunden. Stattdessen klang meine Stimme so kalt und fest wie die Felsen unserer Brandung. »Es ist nicht vorbei. Es hat gerade erst angefangen.«
Meine Mutter stieß einen frustrierten Seufzer aus und nahm Mino den Rest der Brotscheibe aus der Hand, die er zuvor in unzählige Krümel verarbeitet und auf dem Tisch verteilt hatte. »Bell, so geht das nicht«, rügte sie hörbar gereizt. »Du musst versuchen diese schreckliche Erinnerung gehen zu lassen!«
»Ach, so einfach ist das?«, erwiderte ich zynisch. »Denkst du, ich lasse das Erlebte freiwillig in Dauerschleife vor meinem inneren Auge abspielen? Dass ich es schön finde, ständig dem letzten Röcheln des Mannes zu lauschen? Dass ich es mag, seine starren Augen hinter jeder Ecke zu sehen?«
»Nicht so laut, Bell«, flüsterte Mary neben mir und griff unter der Tischplatte nach meiner Hand. Ich erwiderte den Händedruck, doch ihre dünnen Finger fühlten sich genauso kalt an wie meine eigenen. Sofort machte sich ein schlechtes Gewissen in mir breit. Ich wusste, dass sie und mein älterer Bruder Phil es im Moment nicht leicht hatten. Mary trug ein Kind unter ihrem Herzen, doch leider schien sie die Schwangerschaft mehr zu belasten, als es für eine junge Frau ihres Alters normal war. Sie sollte sich nicht auch noch meinetwegen sorgen.
»Wie geht es dir heute, Mary?«, fragte ich leise zurück. Verwundert zog sie ihre schmalen Brauen zusammen und blickte kurz zu meinem älteren Bruder Phil hinüber, ehe sie sich wieder mir zuwandte. »Nun … den Umständen entsprechend.« Ihre Pupillen huschten nervös umher. Ich spürte, wie unser Händedruck feucht wurde. »Gibt es denn schon neue Nachrichten von Limea?«, fragte ich hoffnungsvoll, doch Mary schüttelte nur traurig den Kopf.
»Leider nein«, antwortete mein Bruder an ihrer Stelle und legte seufzend sein Besteck beiseite. »Seit sie unsere Insel vor drei Monaten das letzte Mal besucht hat, ist sie wie vom Meer verschluckt. Niemand hat sie oder ihr Schiff gesehen, niemand weiß, wo sie sich aufhält.«
»Hoffentlich geht es ihr gut«, murmelte ich mehr zu mir selbst als zu den anderen. Ich kannte Limea, die fröhliche Händlerin mit den lockigen grauen Haaren, schon beinahe mein ganzes Leben lang. Seit jeher versorgten sie und ihre Familie uns Inselbewohner mit Nahrung und Baumaterialien vom weit entfernten Festland. Im Gegenzug verkauften wir ihr selbst gemachten Schmuck aus Muscheln, den es so nirgendwo sonst zu kaufen gab. Die Menschen vom Festland waren gierig nach solchen Dingen und gewillt stattliche Preise dafür zu zahlen. Limea und ihr Schiff waren als einziger Handelsweg zum Festland unentbehrlich für uns. Zwar gab es auf unserer Insel ausreichend Palmenholz, Fisch in Überfluss und verschiedene Früchte wie Ananas, Kokosnüsse, Drachenfrüchte und Bananen, aber unser kleines Fleckchen Erde allein könnte niemals unseren gesamten Bedarf an Rohstoffen und Nahrungsmitteln decken, den wir zum Überleben brauchten.
»Das hoffe ich auch«, stimmte mir Mary leise zu.
»Solange sie nicht auftaucht und neue Baumaterialien liefert, kann ich unser Haus nicht fertigstellen«, fuhr Phil zerknirscht fort. »Heute Mittag habe ich die letzten Holzbretter und Nägel verarbeitet, die wir noch übrig hatten, aber sie haben nicht einmal ausgereicht, um ein einziges Zimmer bewohnbar zu machen. So langsam zweifle ich daran, dass es rechtzeitig fertig wird, ehe unser Nachwuchs das Licht der Welt erblickt.«
»Aber das ist doch nicht schlimm«, versuchte ihn meine Großmutter zu beruhigen. Der Klang ihrer einfühlsamen Stimme ließ den Gedankensturm in meinem Kopf gleich etwas leiser werden. Lächelnd tätschelte sie Phils Schulter und blickte zu ihm auf. »Ich freue mich, wenn ich dich und die liebe Mary noch eine Weile bei mir habe. Und wenn mein Urenkelchen endlich zur Welt gekommen ist, erkläre ich mich natürlich gern dazu bereit, auf es aufzupassen und ihm Geschichten vorzulesen, damit du und Mary eine Mütze Schlaf abbekommt.«
»Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist«, erwiderte meine Mutter trocken und rümpfte die Nase. »Man sieht ja, was du mit deinen Schauermärchen bei Bell angerichtet hast.«
Mein Löffel rutschte mir aus der Hand und landete klirrend in meiner Suppenschüssel. Mit offenem Mund starrte ich meine Mutter an, die abwehrend die Hände hob. »Nimm es nicht persönlich Bell, aber es ist nicht zu übersehen, wie sehr dir ihre Geschichten zugesetzt haben. Du bist zu schreckhaft geworden, Kind.«
»Zu schreckhaft?«, kam mir Phil zu vor. »Dir ist aber schon bewusst, weshalb sie so aufgewühlt ist, oder? Jemand ist vor ihren Augen gestorben, Mutter!«
»Das weiß ich doch! Ich sage ja nicht, dass Bell gar nicht trauern darf, aber während Leah und Flynn nur den Anblick einer Leiche zu verarbeiten haben, fürchtet sich Bell zusätzlich vor irgendwelchen Hirngespinsten eurer Großmutter!«
»Gestaltwandler sind keine Hirngespinste, meine Liebe«, entgegnete diese streng und hob mahnend einen Zeigefinger. »Die Tatsache, dass du sie leugnest, macht sie nicht weniger real. Das weißt du genauso gut wie ich.«
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Mino seinen Teller beiseiteschob und ängstlich zwischen uns Erwachsenen hin und her sah. »Gibt es nun Monster oder nicht?«
»Ja!«, antworteten Großmutter und ich wie aus einem Mund.
»Nein!«, erwiderten Mary, Phil und Mutter zur selben Zeit. Verwirrt runzelte Mino seine kleine Stirn.
»Die Verletzungen des Mannes können nicht menschlichen Ursprungs gewesen sein«, erklärte ich und verschränkte trotzig die Arme vor der Brust. »Der Wahnsinn stand ihm ins Gesicht geschrieben und die Wunde an seinem Hals sah aus, als würden Seepocken daraus hervorwuchern!«
»Du standest unter Schock, Bell«, widersprach Phil.
Seine Stimme klang sanft, doch in meinem Herzen glichen seine Worte einer Kriegserklärung. Es fühlte sich an, als würde jemand einen Glassplitter hineinbohren. Dass meine Mutter nicht auf meiner Seite war, überraschte mich nicht. Doch dass mir mein geliebter Bruder ebenfalls misstraute, schnürte mir den Atem ab. Wie konnte er mir nur so in den Rücken fallen? Ausgerechnet er, mein Fels in der Brandung … Obwohl ich es nicht wollte, stiegen mir Tränen in die Augen. »Du glaubst mir also nicht, Phil?«
Er schwieg, doch die Art, wie er meinen Blick mied, reichte mir als Antwort. Hitze stieg in meinem Körper auf und ließ ihn glühen wie das Feuer im Kamin. Ehe ich der plötzlichen Wut Herr werden konnte, schlug ich bereits mit der flachen Hand auf den Tisch und sprang so schnell auf, dass mein Stuhl krachend zu Boden fiel.
»Bell!«, rief meine Mutter erstaunt und starrte mich mit offenem Mund an.
Ich war genauso überrascht wie sie, schließlich schaffte ich es normalerweise nicht einmal, meine Stimme zu erheben. Die widersprüchlichen Gefühle in mir bereiteten mir Sorgen. Ehe ich wieder etwas tat, das ich später bereuen könnte, lief ich ohne eine weitere Erklärung auf unsere schmale Wendeltreppe zu und eilte ins Dachgeschoss. Oben angekommen huschte ich sofort in das kleine Zimmer, das ich mir mit Mino teilte, und knallte schwungvoll die Tür hinter mir zu.
Meine Verzweiflung ließ mein Herz rasen, doch ich wusste nicht, wie ich diese überschüssige Energie am schnellsten loswerden könnte. Nachdem ich einige Runden rastlos durch mein Zimmer gelaufen war, ließ ich mich schluchzend in der kleinen Nische zwischen meinem Bettgestell und der Zimmerwand nieder und zog meine Knie fest an meine bebende Brust. Bereits im Kindesalter hatte ich mich dieser Methode bedient, wenn mir das Leben über den Kopf gewachsen war. In solchen Momenten hatte ich mich gern in diese Ecke zurückgezogen, die Augen geschlossen und mir vorgestellt, dass alles wieder gut werden würde.
Doch als ich jetzt die Lider senkte, tauchte nur ein blasses Augenpaar in der Dunkelheit vor mir auf und jagte mir einen eisigen Schauer über den Rücken. Trotz meiner Schluchzer hörte ich den rasselnden Atem des Fremden, lauschte seiner bebenden Stimme. Der Geruch nach feuchten Algen und etwas Fauligem, das mich an einen verwesenden Fisch erinnerte, kroch meine Nase empor.
Ich erwischte mich bei dem niederträchtigen Wunsch, den Fremden einfach zurückgelassen zu haben. Ich hätte mich zweifelsohne hundeelend gefühlt, aber immerhin wäre ich so dem Anblick entkommen, der mich nun mein ganzes Leben lang verfolgen würde.
Während mir meine Tränen wie Wasserfälle über die Wangen strömten, zitterte mein Körper wie Espenlaub. Mir war so kalt, als hätte ich die ganze Nacht im Meer verbracht. In dem Versuch, meine Schluchzer zu unterdrücken, presste ich mir eine Hand auf den Mund, doch gedämpft konnte ich sie immer noch hören. Wimmernd drückte ich meine Augen so fest zusammen, dass es wehtat. Ich trauerte nicht mehr nur um das Leben des Mannes, sondern auch um mein eigenes. Denn als er seines verloren hatte, war mir meines ebenso genommen worden. Zumindest fühlte es sich so an.
Die Trauer breitete sich über mir aus wie eine Decke aus Blei. Sie drückte fest auf meine Schultern und erschwerte mir das Atmen, aber gleichzeitig rief sie eine Erschöpfung in mir hervor, die meine Gefühle stumpf werden ließ. Meine schreienden Gedanken drangen nur noch dumpf zu mir durch, so, als wären sie nun hinter einer dicken Felsmauer eingeschlossen. Ich verlor das Gefühl für Zeit und Raum und starrte einfach nur in die Dunkelheit, während eine Taubheit Besitz von mir ergriff, von der ich nicht wusste, ob sie mir helfen oder schaden würde.
Als ich meine Augen nach einiger Zeit wieder aufschlug, spürte ich die kühle Zimmerwand unter meiner Wange. Ich musste mehrmals blinzeln, ehe sich meine tränenverklebten Lider voneinander lösten. Mein Kopf schmerzte, als hätte jemand mit einem Zaunpfahl dagegen geschlagen. Seufzend legte ich eine Hand auf meinen pulsierenden Nacken. Ich hatte wohl zu lang in dieser zusammengepferchten Position verharrt … War ich etwa eingeschlafen?
Während ich meine müden Glieder streckte, verzogen sich meine Lippen zu einem ausführlichen Gähnen. Mit einem Mal hörte ich leise Stimmen vor meiner Tür. Mühsam schälte ich mich aus meinem Versteck hervor und ging darauf zu. Als ich die Zimmertür einen kleinen Spalt öffnete und hinaus auf den Flur blickte, entdeckte ich Mary, die eine Hand auf Phils Tür gelegt hatte und mit der anderen Mino festhielt. Aus meinem Versteck heraus beobachtete ich, wie sie die Tür öffnete und einen Schritt in das Zimmer setzte, doch Mino zog fest an ihrem Ärmel und weigerte sich ihr zu folgen. »Das ist doch gar nicht mein Zimmer«, flüsterte er aufgebracht und deutete mit seiner kleinen Hand in meine Richtung. »Ich wohne doch bei Bell!«
»Ja, aber heute übernachtest du bei Phil und mir«, erwiderte Mary leise und versuchte erneut das Zimmer zu betreten, doch Mino blieb stur. Seufzend verdrehte sie die Augen. »Bell geht es nicht gut, sie braucht ein wenig Ruhe.«
»Aber ich störe sie doch gar nicht …« Mino klang so traurig, dass ich ihn am liebsten in den Arm genommen und in unser Zimmer gezogen hätte, doch etwas hielt mich davon ab. Mary hatte nicht Unrecht damit, dass Ruhe im Moment das Vernünftigste für mich wäre. Wenn mich etwas belastete, neigte ich außerdem zu lebhaften Träumen. Ich wollte Mino nicht noch mehr beunruhigen, indem ich ihn weckte, weil ich im Schlaf schluchzte oder schrie. Bei Phil und Mary würde er es heute definitiv besser haben als bei mir.
Schließlich sah ich, wie Mino nickte und langsam hinter Mary ins Zimmer schlich.
Auch nach ihrem Verschwinden starrte ich eine ganze Weile vor mich hin und traute mich nicht meine schützenden vier Wände zu verlassen. Ich wusste, dass ich mich ausruhen sollte, doch in Anbetracht meiner Nervosität erschien mir Schlafen nahezu unmöglich. Ich brauchte etwas, um Energie abzubauen und meinen Körper zu ermüden. Plötzlich kam mir eine Idee. Draußen mochte es dunkel und etwas windig sein, aber ein Nachtspaziergang hatte mir schon oft dabei geholfen, meine Gedanken wieder in die richtige Richtung zu lenken.
So geräuschlos wie möglich schlich ich über den Holzboden unseres kurzen Flures und hielt auf die Wendeltreppe zu. Aus dem unteren Stockwerk drang das helle Licht des Kamins zu mir herauf und erleuchtete die Treppenstufen. Ich konnte das Knacken des Kaminholzes hören, gemischt mit den Stimmen von Mutter und Phil. Normalerweise würde ich sofort umdrehen und wieder auf mein Zimmer gehen, weil es sich nicht gehörte, die Gespräche anderer Leute zu belauschen – doch heute war nichts normal. Also gab ich meiner Neugierde nach und setzte mich auf die oberste Stufe.
»Wie geht es euch beiden, Phil?«, drang die Stimme meiner Mutter in meine Ohren.
Sie klang aufrichtig besorgt; eine Emotion, die sie schon lang nicht mehr gezeigt hatte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, sie seit dem Verschwinden unseres Vaters noch einmal erlebt zu haben.
»Mary geht es miserabel«, seufzte mein Bruder. Die Abgeschlagenheit seiner Stimme brach mir das Herz. »Die Schwangerschaft ist belastend für sie, ständig hat sie mit Übelkeit und Kopfschmerzen zu kämpfen. Ich habe das Gefühl, dass sie in den letzten Wochen empfindlicher geworden ist. Manchmal beginnt sie wie aus dem Nichts heraus zu weinen, an anderen Tagen schafft sie es kaum aus dem Bett. Sie hat mir gestern erzählt, dass sie ihre Familie auf dem Festland vermisst. Außerdem macht es sie traurig, wenn ich den ganzen Tag lang unterwegs bin, um an unserem Haus zu bauen. Letzteres liegt ja nun vorerst auf Eis, aber das macht unsere Lage natürlich auch nicht besser.«
»Verständlich«, pflichtete ihm nun auch meine Großmutter bei. »Dieses Haus ist schlicht zu klein für uns alle. Das war es schon bei eurer Ankunft, aber seitdem sind ja auch noch Mino und Mary dazugekommen.«
»Das Problem sind nicht nur die Räumlichkeiten«, hörte ich erneut die Stimme meiner Mutter. »Ich werde Mino sagen, dass er ab sofort nicht mehr der Jüngste im Haus ist und aufpassen muss, dass er Mary und das Baby nicht stört, aber er ist eben ein Kind. Es wird garantiert vorkommen, dass er durchs Haus tobt und euer Baby weckt. Umgekehrt werden alle mitbekommen, wenn es nachts schreit.«