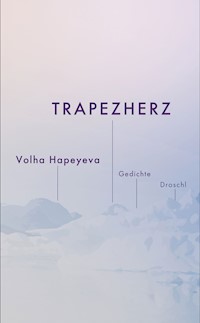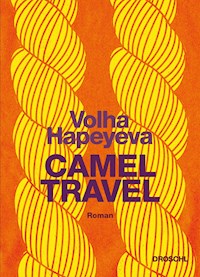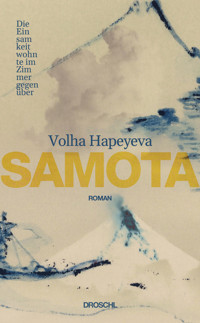
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Droschl, M
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit feinfühligem Sprachzauber und liebevoll gezeichneten Figuren setzt Volha Hapeyeva in ihrem Roman ein Zeichen für mehr Empathie in einer immer verrohter werdenden Welt. Am Anfang herrscht bohrende Stille, doch das Brodeln hat bereits begonnen. Majas Forschungen über den Ausbruch eines Vulkans geraten ins Stocken. Zeitgleich findet in ihrem Hotel der Kongress zur »Regulation von Tierpopulationen« statt und sinistre Gestalten tummeln sich um sie. – In einer zweiten Zeitebene gerät Sebastian mit dem düsteren Jäger Mészáros aneinander, und es geht um Leben und Tod. – Und die leicht schrullig-überdrehte Helga-Maria scheint eine Mittlerin und Wanderin zwischen den Zeiten zu sein. Wie hängt all das zusammen? Die Figuren in Volha Hapeyevas Roman reisen um den halben Erdball, gehen Beziehungen ein und erkunden die Welt von Tieren, Menschen und Vulkanen. Die beiden sensiblen, empathischen Protagonist*innen Maja und Sebastian stehen dabei dem Bösen in unterschiedlicher Gestalt gegenüber, kämpfen um das eigene Überleben, das von Tieren und das von Werten. Im Zentrum von Samota steht die Empathie und die Frage, warum sie so vielen Menschen fehlt oder abhandengekommen ist. Ein geheimnisvolles, verspieltes Buch mit Noir-Elementen und magischem Realismus, das für nicht weniger einsteht als eine bessere Welt und ein glückliches, friedvolles Miteinander.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volha Hapeyeva
Samota
Die Einsamkeit wohnte im Zimmer gegenüber
Roman
Aus dem Belarusischen von Tina Wünschmann und Matthias Göritz
Literaturverlag Droschl
I.
Die Stadt verstummte. Die Stille war mit einem Mal über sie hereingebrochen, obwohl dies nur der letzte Schritt gewesen war. Zuerst hatte sie bloß mit der Schuhspitze eine Linie übertreten, wie ein Sportler oder ein Schüler, der bei einer Prüfung aus dem Stand abspringen soll, dann war sie größer und größer geworden, sodass sich selbst die Bankangestellten wunderten und einander fragten, warum ist es denn so still? Ein jeder hätte sich da gewundert – es war Samstag, an den Kassen herrschte Gedränge, alle schwitzten, während sie warteten, man beobachtete die Nachbarschlangen, und plötzlich war sie da: die Stille.
Warum hatte man sie zuvor nicht bemerkt? Wo war sie die ganze Zeit gewesen? Hatte jemand sie gewaltsam aufgehalten?
Das Frühstück hat sich, so scheint mir, ebenfalls verändert. Seit Langem esse ich morgens kaum noch etwas, doch meine Unlust wächst sich zu Erschöpfung aus. Ja, zu Erschöpfung, nicht zu Müdigkeit. Müdigkeit – das ist der Endpunkt, die unumkehrbare Tatsache, dass Freude selbst als Wort zu existieren aufgehört hat, und, mehr noch, dass es nicht daran liegt, dass die Anzahl der Ereignisse und Gelegenheiten, die du mit diesem Wort verbindest, abgenommen hat, sondern dass du irgendwann beschlossen hast, dass das Wort an sich keinen Sinn mehr hat, dass es zu einfach, zu banal und zu langweilig ist. Vielleicht komme ich bald noch zu Müdigkeit, vorerst empfinde ich aber lediglich Erschöpfung.
Der Geschmack des Kaffees ändert sich, und das liegt sicher nicht an der Art des Getränks, nicht an der Art seiner Zubereitung, sondern an den Rezeptoren, die ihn schmecken. Ein gerade getrunkener Apfelsaft. Ist er vielleicht der Grund, verändert er den Geschmack des Kaffees? Man möchte sich so gern beruhigen, sich selbst versichern, dass alles wieder so wird, wie es einmal war.
Ich sitze beim Frühstück, knete den Teig der eigenen Gedanken durch, um später daraus etwas Essbares zu formen, wovon ich mich über den Tag hin ernähren kann. Doch mein Nachdenken wird von einer Empfindung unterbrochen. In meinem Mund wuchert Gras. Ich liebe Gras, und man kann sagen, ich freue mich darüber, doch man kann das Gras nicht einfach vergessen, es breitet sich tyrannisch hinter den Zähnen und auf dem Zahnfleisch aus und erstickt alles. Wenn man Gras hat, braucht man nichts anderes. Deshalb ändert sich der Kaffeegeschmack, mit dem Apfelsaft hat das rein gar nichts zu tun.
Das Gras wächst nur bei Stille. Sie jagt mir keinen Schrecken mehr ein. Ich entschließe mich, bei ihr zu bleiben. Vorerst. Wieder beruhige ich mich, dass es bloß vorerst ist, aber irgendwo tief in mir spüre ich, dass ich sie wohl nicht mehr vertreiben kann.
II.
Das Auto fuhr den blassgrauen Sandstreifen entlang. Aus dem Fenster sah man Möwen und Kormorane, die gemächlich am basaltenen Himmel kreisten. Nur sie belebten die Landschaft mit ihren gleichmäßigen Bewegungen und fernem Geschrei. Es war nicht kalt, aber außer mir schien nichts und niemand das so zu sehen. Ich knöpfte nicht einmal die Jacke zu, nachdem ich aus dem Auto gestiegen war.
Auf der Vortreppe des Hotels, an dem das Auto gehalten hatte, traten einige Männer von einem Bein auf das andere. Zu sagen, welchen Berufen sie nachgingen, was genau sie hier machten, war eher schwierig und im Prinzip auch sinnlos. Das Hotel gähnte mit dem offenen Mund der Eingangshalle. Das Servicepersonal war den Gästen zahlenmäßig deutlich überlegen. Ich nannte der Rezeptionistin meinen Namen. Nachdem sie mich auf ihrer Liste gefunden hatte, zog sie ein Formular hervor:
»Füllen Sie das bitte aus.«
Ich setzte mich in einen weichen Sessel, holte Stift und Reisepass heraus und begann die notwendigen Daten einzutragen. Ehrlich gesagt verstand ich nicht ganz, für wen und warum hier der Ort und das Datum meiner Geburt von Bedeutung waren. In einer Ecke lief traurig ein Fernseher, entlang der Fenster standen Bäumchen in riesigen Gefäßen, gegenüber – eine verwaiste Garderobe, an der wohl schon seit Jahrhunderten niemand mehr Mäntel abgegeben oder zurückerhalten hatte. Das Hotel des Instituts für Vulkanologie, wie auch die Mehrzahl seiner Forschungsgegenstände (des Instituts, nicht des Hotels, selbstverständlich), schlief, und wann es aufwachen und welche Folgen das haben würde, wagte wirklich niemand vorherzusagen.
Das Hotelzimmer war in solchem Maße standardisiert, dass man sich in jedem beliebigen Land der Welt hätte wähnen können, wenn man die Erinnerung ausschaltete. Ein enger Flur mit kleinem Schrank, ein Bett, das sich scheinbar über dich lustig macht, weil es dich daran erinnert, dass die Mehrzahl der Menschen nicht alleine schläft, ein Tisch, ein Sessel, eine Lampe. Aus irgendeinem Grund musste ich an den australischen Stamm der Guugu Yimidhirr denken, jene Menschen, die Kapitän Cook, als dieser nach dem Namen des ihm unbekannten Tieres fragte, »Känguru« antworteten. In meinen Gedanken tauchte auf einmal das Experiment auf, von dem ich in einem Buch gelesen hatte, bei dem einem Angehörigen dieses Stammes zwei gegenüberliegende Hotelzimmer gezeigt wurden. Sie waren identisch. Die gleiche Badezimmertür links, der gleiche Spiegelschrank rechts, die gleichen Vorhänge, der gleiche Fernseher in der linken Ecke und das gleiche Telefon in der rechten. Doch identisch sind sie nur für uns Europäer. Für die Guugu Yimidhirr sind diese Zimmer unterschiedlich. Für sie ist alles seitenverkehrt. Das Telefon im Osten, der Fernseher in der westlichen Ecke. Das bedeutet, dass diese Zimmer unterschiedlich sind. Und die Guugu Yimidhirr werden sich an sie als ungleiche Zimmer erinnern.
Dieses Zimmer hatte im Unterschied zu vielen anderen, in denen ich bisher untergekommen war, eine Stehlampe und eine richtige Badewanne. Nicht, dass das Begeisterung in mir ausgelöst hätte, aber es erweiterte meine Möglichkeiten der körperlichen Entspannung.
In Kinofilmen oder Werbespots werden oft in der Badewanne sitzende Frauen gezeigt, deren Gesichter Ruhe und Verzückung ausstrahlen. Man beginnt zu glauben, dass man dieselben Gefühle verspüren wird, sobald man in eine Badewanne steigt, dass man ruhig und glücklich wird. Im vollen Bewusstsein, dass nichts anderes als die Mechanismen der Konsumideologie wirken, erlag ich heute aus irgendeinem Grund diesem Reiz und füllte die Wanne mit Wasser, obwohl ich gar nicht gern bade.
Wie erwartet, hielt ich nicht sehr lange durch, von der Hitze begann das Blut in meinem Kopf zu pulsieren, und ich fühlte, wie sich meine Wangen rosarot färbten. Ich konnte das Buch nicht weiterlesen, zumal es ohnehin unangenehm war, mit nassen Fingern beim Blättern graue Abdrücke auf den Seiten zu hinterlassen. Unbequem. Alles hier war unbequem. Ich erinnerte mich an Berichte, dass Menschen in der Badewanne eingeschlafen waren und ertrunken sind. Das erschien mir aber eher unwahrscheinlich, also drehte ich mich auf die Seite und schloss die Augen. Es wurde angenehm.
»Wenn du die Finger ins Wasser tauchst und wartest, vergessen die Jungfische deine Anwesenheit und werden so mutig, dass sie sich dir nähern und mit ihren Körpern deinen kleinen Finger streifen.« Ich begriff nicht sofort, dass das ihre Stimme war.
»Wann bist du angekommen? Und was verschlägt dich überhaupt hierher?«
Aber sie schien mich nicht zu hören.
»Weißt du, in der Natur kann man Analogien finden, mit deren Hilfe man in die Vergangenheit zurückkehren und sich selbst mit Männeraugen betrachten kann.«
»Wozu?«
»Na, ich hab noch mehr Glück, ich bin keine Theoretikerin, ich bin Praktikerin.«
Manchmal erinnern mich die Gespräche mit Helga-Maria an Einbahnstraßen, sie hört mir nicht zu, und ich stelle nicht die richtigen Fragen.
»Zuerst finde ich etwas, beobachte es, staune, und dann suche ich schon Erklärungen und einen freien Platz in der Systematik meiner Funde. Margaritifera margaritifera – die Flussperlmuschel. Ich nehme sie aus dem Wasser und halte ihren Körper, der in etwa so groß ist wie meine Hand, zwischen den Handflächen. Erinnerst du dich, wie früher – der eingeklemmte, imaginäre Ring, wenn wir als Kinder ›Ringlein, Ringlein‹ spielten und die zu Kähnen geformten Hände durch die Hände der Freundinnen führten: Ringlein, Ringlein, du musst wandern«, wir hockten da, und Helga-Maria führte ihre Hände durch meine, dann sprach sie weiter:
»Die Muschel erschrickt, zieht ihre Lippen ein. Versteckt sich. Ich spüre ihre Anspannung und bereue meine Kraft, mit der ich ihr mit einer einfachen Berührung Schmerzen zufügen kann, aber mich verlangt so sehr danach, ihre Lippen zu berühren, dass ich für einen Moment lang den Wunsch verspüre, ihren Panzer zu zerbrechen, um zu bekommen, was ich will. Doch ich warte geduldig, bis sie sich an meine Anwesenheit und die Wärme meiner Hände gewöhnt hat. Und als sie verstanden hat, dass sie nichts zu fürchten braucht, ich nur ein Beobachter bin, fremdelt und verzieht sie sich nicht mehr, sondern ist bereit, ihr Leben gemeinsam mit mir zu genießen, und ich bin ihr dankbar dafür. Wir schauen einander an, und ich begreife, dass ich eine ganze Welt halte. Endlich lässt sie es zu, und ich streiche mit dem Zeigefinger über ihre Lippen, von da, wo der Himmel beginnt, bis hin zu der Stelle, an der ich beginne. Der Strich dieser Berührung lässt meine Nervenenden zittern und sendet ein Signal in mein Hirn, das als ›totale Harmonie‹ übersetzt wird.«
Ich verstand, dass Helga-Maria mir etwas Geheimes erzählte, daher schwieg ich, um sie nicht mit meiner Wirklichkeit zu stören. Ein Tropfen zerstob auf der Oberfläche des Wassers, das die Wanne füllte. Wenn Helga-Maria weinte, begannen ihre Lippen zu brennen, sie wurden heiß und rot, sie legte dann ihre Finger darauf, um die Hitze zu vertreiben, allerdings half das kaum, und sie weinte nur noch mehr. Ich legte meine Hand auf ihre, aber sie sprang auf und rannte aus dem Badezimmer. Ich wollte aus dem Wasser steigen, um sie aufzuhalten, doch da hörte ich bereits die Tür schlagen und verstand, dass es zu spät war. Ich lehnte mich zurück, konnte aber nicht mehr lange so sitzen, ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, wohin sie wohl gegangen war und weshalb sie mir diese Geschichte erzählt hatte.
Zum ersten Mal war ich Helga-Maria in einer Bar begegnet. Sie hatte an diesem Tag furchtbare Kopfschmerzen und war noch dazu durchgefroren, weil sie draußen auf jemanden gewartet hatte, der ihr versprochen hatte, sie angenehm zu überraschen. Aus irgendeinem Grund war ihm das nicht gelungen, vielleicht, weil er nicht zum versprochenen Treffen erschienen war, oder aber, weil er einfach nicht in der Lage war, überhaupt zu überraschen. Helga-Maria war aufgebracht und wollte sich bei einem Tee aufwärmen. An diesem Tag hatte sie granatrote Augen. Sie trank Tee aus einem Plastikbecher und gab vor, ihren Tischnachbarn zuzuhören. Ich tat so, als würde ich meinen zuhören. Dabei versuchte ich eigentlich, das Gespräch an ihrem Tisch aufzuschnappen, das wie an Bändern durch den Raum flatterte.
»Verstehst du, es ist, als sei ich ein Haiku.«
»Und weiter?«
»Und somit habe ich drei Zeilen.«
»Und?«
»Und und. Aber jemand – das wäre schon die vierte Zeile.«
»Was denn, du willst ein korrektes Haiku sein?«
»Wenn ich eine vierte Zeile habe, dann bin ich kein Haiku mehr.«
»Und was bist du dann?«
»Ich weiß es nicht.«
Am Morgen sollten die Unterlagen zum Ausbruch des Akita-Komagatake gebracht werden, daher schlief ich schlecht, ich hatte Angst, das Klopfen an der Tür zu überhören. Als ich auf mein Mobiltelefon schaute, sah ich, dass es schon 9:28 Uhr und noch niemand erschienen war. Frühstück gab es bis 10 Uhr, deshalb beschloss ich, nicht länger zu warten, um nicht den ganzen Tag über hungrig zu bleiben.
Als ich am Tisch saß, sah ich nach, ob ich neue Nachrichten erhalten hatte, und erinnerte mich zufällig an meinen Traum. Irgendein Mann trug mich eine Treppe hinauf, ich war anscheinend in ihn verliebt, aber ein Gedanke trübte meine Freude: was werden die Leute sagen und wie soll das überhaupt gehen. Die Sache war nämlich, der Mann war ein Hund, was seltsam klingt, aber im Traum passieren noch ungewöhnlichere Dinge. Ich sah ihn mal als Hund, mal als Mensch, und versuchte mir wohl einzureden, das sei normal.
Als ich vom Frühstück zurückkam, sah ich vor der Tür meines Zimmers eine Mappe liegen. Ich hob sie auf und öffnete sie. Auf dem Deckblatt war das Emblem des Nationalen Komitees für Seismologie und Vulkanologie aufgedruckt.
Ich ging ins Zimmer, setzte mich aufs Bett und begann zu lesen.
Am 15. September 1970 entdeckten Kletterer am Rande des alten Kraters Me-dake Wasserdampf. Es entstanden neue Fumarolen und Risse im Gestein, am 18. September begann der Ausbruch. Im nächsten Stadium wurden zahlreiche strombolianische Ausbrüche geringen Ausmaßes gemessen, die bis zum 26. Januar 1971 andauerten. Im Vorfeld war keine besondere seismische Aktivität festgestellt worden. Während des Ausbruches stammten alle Signale eines Erdbebens von den Eruptionen. Die Eruptionsaktivität verringerte sich schlagartig nach dem Oktobererdbeben (16. Oktober) im Südosten der Präfektur Akita (M6.2), was möglicherweise mit der Veränderung der Druckfelder im Zusammenhang mit dem Erdbeben stand (Tanaka, 1971a, b). Durch den Ausbruch bildete sich ein Lavastrom mit einer Länge von 500 m und einer Breite von nicht mehr als 300 m. Das Gesamtvolumen des Ausstoßes betrug 1,4 x 106 m³.
Ich versuchte, mir diese Menge vorzustellen. Ich musste 10 Kubikmeter in Liter umrechnen, dann in Milchpackungen. So mache ich das immer, wandle abstrakte Größen in etwas Konkreteres um. Es waren 10.000 Packungen. Und das noch ohne den Exponenten 6 und die Multiplikation mit 1,4.
Es folgten schematische Lagedarstellungen des Kraters und der Fumarolen, außerdem die Temperaturverteilung an der Erdoberfläche vor dem Ausbruch.
Der Gipfel des Akita-Komagatake ist auf 1637 Meter Höhe und damit die höchste Erhebung in der Präfektur Akita, zudem ein aktiver Vulkan, der 1970/71 zum letzten Mal ausbrach. Auf der letzten Seite des Berichtes fanden sich Informationen für Touristen. Man köderte sie mit der Vielfalt der Hochgebirgsblumen von Juni bis August und der Herbstfärbung des Rot-Ahorns. Hingelangen konnte man mit dem Auto, allerdings war die Straße zur Station Nr. 8 des Berges Akita-Komagatake von Juni bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen und von Mitte Juni bis August täglich gesperrt, sodass man in dieser Zeit mit einem Shuttle-Bus zur Station Nr. 8 fahren musste (25 Minuten, 600 Yen). In der Winterperiode, von Ende Oktober bis Ende Mai, war die Straße durchweg gesperrt.
Plötzlich klingelte das Telefon. Wenn jemand in einem Hotelzimmer anruft, ist das immer verdächtig. Misstrauisch nahm ich den Hörer ab und sagte »Hallo«.
»Auf dem Planeten des Kleinen Prinzen gab es auch Vulkane, er putzte sie regelmäßig und bereitete auf ihnen sein Frühstück zu«, ich war überrascht, Helga-Marias Stimme zu hören, denn ich dachte, sie sei abgereist oder erkunde einen neuen Ort, und dass sie keine Lust auf mich und meine Forschungen habe. »Ich denke, wir sollten ein Stück gehen und einige Dinge besprechen. Ich warte unten auf dich«, sagte sie und legte auf.
Die Männer, die ich gestern auf der Vortreppe des Hotels gesehen hatte, standen nun in der Eingangshalle. Sie wirkten verloren und schienen darauf zu warten, dass jemand sie abholt und auf den Weg der Wahrheit führt. Und so kam es auch, aus dem Aufzug trat eine Frau im Businesskostüm. Als die Männer sie erblickten, lebten sie auf, in ihren Augen flackerte nun anstelle der Angst vor dem Unbekannten eine unbekannte Hoffnung. Die Frau trat zu ihnen, und die Männer umringten sie wie Schüler eine Lehrerin oder Hunde ihr Frauchen.
»Lass uns gehen, was klebst du hier fest.«
»Ah«, erwachte ich aus meiner Erstarrung, »ich frage mich, was das für eine Gruppe ist?«
»Dann musst du hingehen und sie fragen, nicht eine Stunde lang rumstehen und sie anglotzen.«
Helga-Maria sprach in einem seltsamen kindlich-jugendlichen Idiolekt, der weder Respekt für das Gegenüber noch Taktgefühl als Kategorien kannte.
Wir verließen das Hotel. Der Himmel änderte seine Farbe. Obwohl die Sonne in Dunst gehüllt war, hatten es die Augen ohne Sonnenbrille schwer. Zur Bahnstation waren es fünfzehn Minuten zu Fuß.
»Also, worüber wolltest du reden?«, fragte ich Helga-Maria schließlich, obwohl mir selbst nicht klar war, wozu. Als ob ich ein besonderes Redebedürfnis hätte. Was sollte dieses ewige Streben, ein Gespräch zu beginnen, Fragen zu stellen, als kümmerte mich das Leben anderer Menschen? Bloß idiotische Erziehung und der Wunsch, allen zu gefallen, indem man Interesse an ihren Frauen, Männern, Kindern, Katzen, Nieren und Depressionen zeigt …
»Über gar nichts, ich wollte einfach nur mit dir zur Bahnstation gehen«, unterbrach Helga-Maria meine Misanthropie.
Und schon fühlte ich mich wieder wie eine dumme Person. Ich hätte schweigen sollen. Einige Minuten lang schimpfte ich noch mit mir, dann verlagerte sich meine Aufmerksamkeit auf eine Möwe, die über den einsamen Strand trippelte. Sie fand etwas und schrie laut, um ihre Freundinnen über ihren Fund zu informieren. Die ließen nicht lange auf sich warten, und schon eine Minute später hüpften fünf weitere Vögel um sie herum. Die erste, die die anderen herbeigerufen hatte, begriff jetzt anscheinend, was sie angerichtet hatte, verteidigte ihren Schatz und verjagte die Konkurrentinnen. Die Widersprüchlichkeit im Verhalten dieser Möwe, die erst selbst die Freundinnen ruft, um sie dann wieder zu verjagen, erinnerte mich an eigene Charakterzüge, denn so hatte auch ich manchmal, ergriffen von Fröhlichkeit und sommerlicher Euphorie, Gäste eingeladen und konnte es dann gar nicht mehr erwarten, dass sie endlich wieder gingen. In diese Gedanken versunken merkte ich gar nicht, dass wir bei der Bahnstation angekommen waren.
»Lass uns Zug fahren«, schlug Helga-Maria plötzlich vor, »warte hier, ich kaufe die Tickets.« Sie ging ins Bahnhofsgebäude, und ich blieb draußen stehen und wartete. Ich kam nicht mal dazu, mich aufzuregen, dass sie meine Antwort gar nicht abgewartet hatte. Manchmal fasziniert einen die Entscheidungskraft anderer, als wüssten sie es besser, als wären sie die Erwachsenen und du das Kind.
In Bahnhöfen, Flughäfen und Verwaltungsgebäuden war es immer der Fußboden gewesen, der mich als Kind vor der Einsamkeit bewahrt hatte. Ob nun Linoleum, Beton oder Marmor, es gab immer Muster, Linien und Figuren. Und während die Erwachsenen ihre Dinge erledigten, dachte ich mir Spiele und Beschäftigungen für mich und den Fußboden aus. Man konnte abzählen, wie viele Schritte auf eine horizontale Linie passen, oder einfach nur auf die grünen Dreiecke hüpfen. Die Fliesen hier weckten allerdings keine Ideen in mir, deshalb studierte ich die Sandkörner und den Dreck in den Fugen. Ein Hund lief vorbei, geschäftig und selbstsicher, als sei er unterwegs zu einem wichtigen Termin. Ich sah ihm so lange hinterher, wie ich konnte, dann kam Helga-Maria zurück und wir gingen zum Zug.
Als wir in den halb leeren Wagen gestiegen waren, setzten wir uns einander am Fenster gegenüber. Praktisch. Man kann reden oder auch nicht oder aus dem Fenster schauen.
Ich nahm ausländische Städte mittlerweile nicht mehr als fremd wahr. In jeder Gasse und an jeder Biegung des Fußwegs konnte ich die Stadt sehen, in der ich geboren war, so wie man im Frühling den Herbst sehen kann und umgekehrt. Anpassungsfähigkeit ist eine seltsame Eigenschaft.
Vor dem Zugfenster verwandelte sich die urbane Gegend langsam in dörfliche Landschaft. Nur selten trat die Sonne hervor und kitzelte die Rücken der Pferde, die auf den Feldern grasten. Dabei war grasen nicht das treffende Wort, um ihren Zustand zu beschreiben. Diese Pferde standen in einer Linie, erst eins, dann das zweite, dahinter das dritte. Sie kauten kein Gras, schwenkten ihre Köpfe nicht und stampften nicht mit den Hufen. Sie schwiegen. Und ihr ganzer Körper schwieg mit ihnen. Die Pferde, die ich bis dahin gesehen hatte, waren völlig anders. Sie sprachen mit dem Gras, mit den Fliegen und manchmal mit mir, und mit ihnen sprach auch ihr Körper.
»Denkst du, es gibt einen Grund?«
»Grund wofür?«
»Ihr Schweigen.«
»Ich denke schon.«
Ich war froh, dass Helga-Maria mich aus dem Hotelzimmer herausgeholt hatte und dass sie mir gegenübersaß, sie war so ganz anders als ich. Manchmal, wenn ich sie anschaute, spürte ich ein Unbehagen ob meiner wissenschaftlichen Meriten und emotionalen Arktis. Ihr Wissen und ihre Weisheit waren anderer Art, und das bedrückte mich: als sei mein Wissen künstlich, ihres aber – echt.
»Vielleicht haben diese Pferde etwas gespürt und versuchen nun vor lauter Schreck unbemerkt zu bleiben?«, erwiderte Helga-Maria, als hätte sie meine Gedanken gelesen.
»Vielleicht, aber mir scheint, dieses Schweigen war nicht ihre Entscheidung. Es scheint eher eine Folge oder ein Symptom von etwas zu sein, das bereits geschehen ist.«
»Die Menschen bauen Mist, und die Tiere müssen hinter ihnen aufräumen. Wie in dieser Geschichte mit dem Brot.«
»Wovon sprichst du?«, fragte ich.
»Früher, als die Getreidekörner noch den gesamten Halm bedeckten, war die Ernte sehr beschwerlich für die Menschen. Einmal, als sie wieder auf dem Feld waren, jammerten und schimpften sie wie nie zuvor, dass die Ähre zu groß sei und das Ernten zu schwer. Gott hörte ihre Beschwerde und streifte die Körner von den Ähren, von oben bis unten, ließ nur die Halme zurück. Und so wäre es noch heute, wären da nicht die Hunde gewesen.«
»Welche Hunde? Was haben die damit zu tun?« Ich verstand kein Wort.
»Der Hund, der mit auf dem Feld war, begriff, dass dann nichts mehr übrig bliebe und der Hunger käme, also jaulte er zu Gott und bat ihn, wenigstens ein paar Körner an der Ähre zu lassen. Und Gott war gnädig und ließ oben ein paar Körner stehen. Die Menschen essen also nicht ihren Anteil des Brotes, sondern den Hundeanteil.« Helga-Maria machte eine Pause, als hätte sie etwas Grundlegendes gesagt, über das ich nachdenken sollte. »Die Menschen stört immer irgendetwas. Nur wenige Menschen wissen, wie man sich an dem freut, was einen umgibt, was man bereits hat. Wobei die größere Freude nicht davon kommt, was du hast, sondern vom Sein.«
»Jeder Existenzialist wird deine Annahmen widerlegen.«
»Das sind keine Annahmen. Das sind meine Postulate, sozusagen.«
»Zufrieden sein mit dem, was man hat – das hat den Beigeschmack einer Rechtfertigung der bestehenden Ordnung. Sitz still, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster und freu dich darüber, dass du wenigstens das noch hast.«
»Ich meine etwas anderes, und das weißt du genau.«
Natürlich wusste ich, dass es Helga-Maria nicht um Gottesfürchtigkeit ging, sie wollte einfach diese Seite der Harmonie und der Liebe hervorkehren und genauer beleuchten. Empathie ist wirklich eine komplizierte Charaktereigenschaft. Man kann immer Argumente dafür und dagegen finden und auf dieser feinen weißen Linie stehen bleiben, die das eine vom anderen trennt.
»Ich glaube, hier müssen wir aussteigen«, sagte ich, stand langsam von meinem Platz auf und versuchte einzuschätzen, wie man am besten zum Ausstieg kam.
Im Nachbarstädtchen, in das wir gelangt waren, ging das Leben seinen langsamen Gang, wie er für kleine Städte üblich ist. Hier wurde man daran erinnert, was ein gemütlicher Abend bedeutet, und konnte den Sonnenuntergang nicht nur in Bruchstücken oder kurzen Augenblicken erleben, sondern ihn vollkommen genießen, Zeugin davon werden, wie sich der Lichteinfall in den Gassen veränderte und die Dämmerung wie ein Grenzsoldat mit ihrem Erscheinen ankündigte, dass man gleich das Territorium des Tages verlassen und in den Abend eintreten würde.
»Sieh mal«, sagte Helga-Maria, als wir vor dem Schaufenster einer Kunstgalerie stehen geblieben waren, die gleichzeitig ein Antiquariat war. »Fast wie du.«
Ich verstand nicht, was sie meinte, und wie ein Mensch, der keine Gedanken lesen kann und überrumpelt wurde, versuchte ich, alles gleichzeitig zu betrachten und erkannte nichts.
»Was, worauf zeigst du denn? Ich verstehe nicht.« Ich versuchte weiter zu finden, was sie so beeindruckt hatte.
»Na dort, links, sieh doch, das Bild. Siehst du es? Fast wie du.«
Und da sah ich es auch. Am Ufer des Meeres, das wie die Fortsetzung des Strandes aussah, in einer Chaiselongue, halb sitzend, halb liegend, eine Frau. Aus der Ferne konnte man sie für einen biegsamen Draht oder ein Flatterband halten. Der untere Teil des Körpers hatte den Künstler wohl mehr gereizt, weshalb er ihren Beinen besondere Aufmerksamkeit gewidmet hatte, sie waren im Verhältnis zum oberen Teil des Rumpfes, den Armen und besonders dem Kopf unproportional lang. Sofort wurde man an Bilder erinnert, die Kinder aus benachteiligten Familien malten, und die psychologischen Analysen allzu großer Hände (die bedeuten, dass jemand geschlagen wird) oder fehlender Finger (die bedeuten, dass jemand keinen Kontakt zu anderen aufbauen kann). Und natürlich, wozu braucht eine Frau einen Kopf. Winziges Gesicht, geschlossene Augen, üppiges Haar. Blond, die Farbe des Sandes und der Chaiselongue. Eine Hand lag auf der Seitenlehne, die andere war nach oben geworfen. Eine typische offene Pose.
»Und was daran bin ich?«, entrüstete ich mich beinahe und fühlte plötzlich meine alte Unzufriedenheit mit meinen Beinen wieder aufsteigen, die ich für zu dick hielt, genau wie die auf diesem Bild.
»Die Frau und der Vulkan, fast wie bei dir«, Helga-Maria streckte den Finger aus und zeigte, wohin ich schauen sollte.
Ich hatte mich so auf die Frau konzentriert, dass ich den Vulkan hinter ihr übersehen hatte. Dem Maler nach lag der Vulkan auf einer Insel, nicht weit vom Strand entfernt. Aus ihm stieg pfahlförmiger Rauch auf, daneben hing die Sonne, die auch ein Vollmond hätte sein können. Ein seltsames Bild, irgendwie albern und plump, eine Kombination aus Modigliani und den Bildern der Primitivisten. Solche Bilder bereiten mir Unbehagen, ich weiß nicht, was ich von ihnen halten soll, sie passen nirgendwohin, man kann sie nirgends hinstellen oder aufhängen, weshalb sie einfach im Zimmer meines Bewusstseins herumliegen und mit ihrer Einzigartigkeit nerven. Um diesen Gedanken zu beenden, wandte ich mich vom Schaufenster der Galerie ab.
»Ist das nicht die Gruppe aus unserem Hotel?«, fragte Helga-Maria und zeigte in die Richtung, in der zwei, drei Männer und eine Frau standen.
»Ja, das sind sie«, bestätigte ich verwundert.
Die Männer fotografierten mit dem Telefon eine Anzeige an einem Mast, während die Frau ihnen etwas erzählte. Die Ampel wurde grün, und sie gingen auf die andere Straßenseite. Zum Glück liefen wir in dieselbe Richtung, passierten den Mast, und ich hielt an, um die Anzeige zu lesen, die sie interessiert hatte. Belohnung garantiert. Hund vermisst. Im Rudel gesehen, eine Telefonnummer und drei Fotos. Normalerweise war auf solchen Anzeigen viel Text und nur ein Foto, hier war es umgekehrt. Ein Bild des verschwundenen Hundes, er lag da mit verzweifelt-traurigem Blick. Auf dem zweiten ebenfalls der Hund, aber in Bewegung, irgendwohin laufend. Auf dem dritten war er inmitten anderer Hunde zu sehen. Beim Betrachten des letzten Bildes spürte ich etwas Unbestimmtes, als sei das ein Rudel Menschen und kein Hunderudel. Als sei er nicht grundlos davongelaufen. Als sei es dort, von wo er weggelaufen war, noch viel schlimmer gewesen als hier in diesem Rudel mit den ihm kaum bekannten Wesen, die alle eine seltsame Sprache sprachen und so merkwürdige Verhaltensweisen und Gesetze hatten.
»Warum interessiert die bloß dieser Aushang?«, dachte ich laut.
»Frag mich nicht«, antwortete Helga-Maria gleichgültig. Ihre Gedanken waren mit etwas anderem beschäftigt. »Lass uns lieber irgendwo einen Kaffee trinken, mit einem Stück Kuchen dazu, und dann zurückfahren. Ich merke, dass mein Zuckerspiegel sinkt und ich bald durchdrehe. Ich habe gehört, dass es hier ganz gute Desserts geben soll. Hausgemachte Delikatessen, sozusagen.«
Ich widersprach nicht, ein guter Kaffee hat noch niemandem geschadet, und kulinarische Besonderheiten hatten für mich höhere Priorität als architektonische oder museale, auch wenn ich Süßes nicht sonderlich mag.
Als ich ins Hotel zurückkam, brannte in der Eingangshalle schon das orange-gelbe Licht, ›warm‹ – wie es auf den Glühbirnenverpackungen geschrieben steht. Ich mag es nicht sehr, weißes oder ›kaltes‹ Licht ist mir lieber. Während ich zum Aufzug ging, bemerkte ich wieder die Männer. Sie saßen um einen niedrigen Tisch und besprachen etwas. Ich schnappte einen Gesprächsfetzen auf:
»Morgen werden wir über einen erfahren, dass es ihn nicht mehr gibt.«
Im Zimmer angekommen, zog ich die Schuhe aus und schaltete den Fernseher an. Allein zu leben ist gleichermaßen Vor- und Nachteil bei der Ernährungsfrage. Man kann sich Aufwand sparen und eine Dose mit Mais aufmachen oder gleich bis zum Morgen durchhalten. Aber manchmal wünscht man sich die Aufmerksamkeit und Fürsorge einer anderen Person, nicht nur der eigenen, man möchte nach Hause kommen und hören: »Zieh dich um und setz dich an den Tisch«. Auf Dienstreisen stellt sich ein ganz eigener Rhythmus ein. Der Körper ändert den gewohnten Ablauf und ordnet sich der Agenda der Panels, Kaffeepausen und gemeinsamen Mittagessen unter. Ein wirkliches Bedürfnis zu essen existiert kaum.
»Morgen werden wir über so manche erfahren, dass sie nicht mehr unter uns weilen.«
Ich drehte den Kopf zum Fernseher. Auf dem Bildschirm war ein dicker, rotgesichtiger Mann mit Cowboyhut zu sehen, unten am Bildrand stand: Tommy Musk, Bürgermeister der Stadt West (Bundesstaat Texas), nach einer Explosion in der örtlichen Düngemittelfabrik.