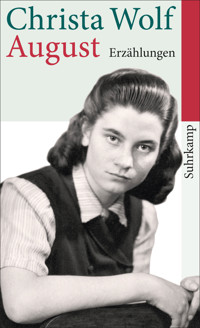11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1973 erklärte Christa Wolf, dass für sie kein grundsätzlicher Unterschied bestehe zwischen ihrer Prosa und ihrer Essayistik, denn deren gemeinsame Wurzel sei »Erfahrung, die zu bewältigen ist: Erfahrung mit dem ›Leben‹, mit mir selbst, mit dem Schreiben, das ein wichtiger Teil meines Lebens ist, mit anderer Literatur und Kunst. Prosa und Essay sind unterschiedliche Instrumente, um unterschiedlichem Material beizukommen«. Das sind auch die Themen ihrer Essays und Reden, die in der chronologischen Reihenfolge ihres Entstehens in dieser Ausgabe versammelt sind. Christa Wolf bezieht als kritische Zeitgenossin Position, setzt sich mit poetologischen Reflexionen über ihr Selbstverständnis als Autorin auseinander und nähert sich über wesentliche Berührungspunkte Gefährt:innen und Kolleg:innen an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Christa Wolf
Sämtliche Essays und Reden
Band 1: 1961-1980 Lesen und Schreiben
Herausgegeben von Sonja Hilzinger
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Probleme junger Autoren
Das siebte Kreuz
Diskussionsbeitrag zur zweiten Bitterfelder Konferenz 1964
Eine Rede
Tagebuch – Arbeitsmittel und Gedächtnis
Notwendiges Streitgespräch
Einiges über meine Arbeit als Schriftsteller
Diskussionsbeitrag
Brecht und andere
Das Eigene. Juri Kasakow
Fünfundzwanzig Jahre
Selbstinterview
Die zumutbare Wahrheit. Prosa der Ingeborg Bachmann
1
2
3
4
Deutsch sprechen
1
2
3
4
Probe Vietnam
1
2
3
Der Sinn einer neuen Sache. Vera Inber
Glauben an Irdisches
1
2
3
4
5
6
7
Lesen und Schreiben
Beobachtung
Lamento
Tabula rasa
Medaillons
Himmelsmechaniken
Weltbilder
Realitäten
Kurzer Entwurf zu einem Autor
Erinnerte Zukunft
Ein Besuch
1
2
3
4
5
Bei Anna Seghers
Anmerkungen zu Geschichten
Gegenwart und Zukunft
Gedächtnis und Gedenken. Fred Wander: Der siebente Brunnen
1
2
3
Dankrede zum Fontane-Preis
Über Sinn und Unsinn von Naivität
Diskussionsbeitrag zum
VII
. Schriftstellerkongreß der
DDR
1973
Diese Lektion: Chile
Sinnwandel. Zu Thomas Mann
Fortgesetzter Versuch
Max Frisch, beim Wiederlesen oder: Vom Schreiben in Ich-Form
Zum Tod von Maxie Wander
Berührung. Maxie Wander
Ein Satz. Bremer Rede
Beispiele ohne Nutzanwendung. Stockholmer Rede
biblioteka universalis
Der Schatten eines Traumes. Karoline von Günderrode – ein Entwurf
1
2
3
4
5
6
7
Der Schmerz
Lieber Franz. Brief an Franz Fühmann
Auskunft
Nun ja! Das nächste Leben geht aber heute an. Ein Brief über die Bettine
Die Dissertation der Netty Reiling
Anekdotisches
Von Büchner sprechen. Darmstädter Rede
Begegnungen. Max Frisch zum 70. Geburtstag
Anhang
Nachwort
Editorische Notiz
Zeittafel
Dank
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Probleme junger Autoren
So friedlich liegst du vor mir
auf der Karte, westliche Heimat.
Einen Finger breit ist der Raum
zwischen Werra und Main,
mit meinen Händen decke ich dich zu,
nicht um zu vergessen, nein,
um dich zu lieben.
Diese Zeilen sind aus dem Poem »Sichtbar wird der Mensch« des jungen Schriftstellers Walter Werner. Ein Lyriker leidet an Deutschland, an der Spaltung seines Landes. Schmerzvoll-liebende Passagen hat auch der Roman »Entscheidung« von Anna Seghers, wenn er westdeutsche Landschaft, einfache Menschen vom Rhein beschwört. Ein solches Buch findet sich nicht mit der Spaltung ab, es gibt seinen Beitrag, sie zu überwinden.
Aber versteht unsere Literatur – besonders die Literatur der jungen Schriftsteller – sich schon immer als Teil, als Kernstück der künftigen sozialistischen deutschen Nationalliteratur? Bemühen wir uns wirklich, mit unserem Buch, unserem Gedicht zur ganzen, zwar jetzt auseinandergerissenen, aber doch auf die Dauer unteilbaren Nation zu sprechen? Oder haben wir uns unbewußt schon mit dem Zustand von heute abgefunden? Ist es überhaupt noch möglich, Bücher zu schreiben, die hüben wie drüben in gleicher Weise wirken?
Das sind, gerade jetzt vor dem V. Deutschen Schriftstellerkongreß, Hauptfragen für unsere Literatur. Wir haben nur noch nicht genügend verstanden, daß es nicht irgendeine, sondern die Forderung an einen deutschen Schriftsteller unserer Zeit ist, Nationalbewußtsein schaffen zu helfen. Das heißt: unser Volk seine ganz besondere Lage, seine ganz besondere Verantwortung in der heutigen Weltsituation verstehen zu lehren. Ein Buch wie Anna Seghers' »Entscheidung« sorgt dafür, daß die Wunde der »offenen Grenze« nicht vernarbt. Es hält – wie vorher Deutschlandgedichte Johannes R. Bechers oder Brechts – die Sehnsucht nach einem schönen, einheitlichen, von der düsteren Last der Vergangenheit freien Deutschland wach. (Bertolt Brecht sagt in seiner »Kinderhymne«: »Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das liebste mag's uns scheinen, so wie andern Völkern ihrs.«)
Man beginnt in letzter Zeit, über Züge des Provinzialismus in unserer Literatur zu sprechen. Nach meiner Ansicht wirkt eine literarische Arbeit immer dann provinziell, wenn sie ihr eigenes, natürlicherweise begrenztes Thema nicht als einen Teil des großen Themas unserer Tage zu sehen und zu gestalten vermag. So wichtig es ist, das Leben in unseren Betrieben, zum Beispiel in den sozialistischen Brigaden, zum Gegenstand unserer Literatur zu machen, so tragen doch gerade in letzter Zeit manche dieser Geschichten enge, provinzielle Züge. Warum? Ich glaube, weil der Autor die neuen Erscheinungen in unseren sozialistischen Brigaden zu isoliert und oberflächlich »abschildert«, weil er sie nicht als Teil eines großen Umwandlungsprozesses in unserer Republik begreift – eines Prozesses, der den ganzen Menschen in allen seinen Lebensäußerungen erfaßt; weil er oft nicht zu zeigen versteht, wie unsere Anstrengungen mit dem Kampf der Menschheit auf der ganzen Erde zusammenhängen.
Ich bin sicher, daß man über Menschen, die hier bei uns leben, die in einem Betrieb arbeiten oder in einer Genossenschaft, die Ärzte, Lehrer, Ingenieure, Wissenschaftler sind, so schreiben kann, daß es auch einen Bauern am Rhein, einen Arbeiter im Ruhrgebiet packt, ergreift, vielleicht aufrüttelt. Provinziell ist nicht der Stoff der Literatur, sondern höchstens ihr Gehalt. Es ist nicht richtig, wenn junge Schriftsteller klagen, sie könnten keinen Beitrag zur nationalen Thematik unserer Literatur leisten, weil sie Westdeutschland nicht kennen. Dieser Einwand beruht zum Teil auf einem Mißverständnis. »Nationale Thematik« bedeutet nicht unbedingt: einen Stoff haben, der teils hier, teils drüben spielt; sondern: unser Leben, die Vorgänge, die sich bei uns vollziehen, die Veränderungen im Leben unserer Gesellschaft und der Menschen, die bei uns leben, als national bedeutsam darzustellen.
Ältere Genossen erinnern uns immer wieder an die große nachhaltige Wirkung sowjetischer Bücher und Filme auf Menschen, die in kapitalistischen Ländern lebten, in den zwanziger Jahren. Wie konnte »Zement« von Gladkow oder der »Panzerkreuzer Potemkin« auf Leute, die an bürgerliche Lebensformen, an ganz andere Themen und Stoffe, an eine bürgerliche Literatur gewöhnt waren, so nachhaltig wirken? Eben weil sie aus den Büchern und Filmen (selbst aus weniger meisterhaften als den beiden, die ich nannte) den Atem einer großen, ernst zu nehmenden Veränderung spürten; weil hier das Neue, das sich damals erst unter größten Schwierigkeiten in einem Land der Welt vollzog, als das künftig Natürliche, weil Menschengemäße für alle Menschen geschildert wurde.
Das siebte Kreuz
»Jetzt sind wir hier. Was jetzt geschieht, geschieht uns«, heißt es im ersten Kapitel des Romans »Das siebte Kreuz«. Dieses Eingangskapitel, mächtiger Anschlag eines großen Themas, ist unerreicht in der zeitgenössischen deutschen Literatur: der Blick über die Rhein-Main-Ebene; der Schäfer Ernst in seiner spöttisch-stolzen Haltung, dessen roter Halstuchzipfel steif wegsteht, »als wehe beständig ein Wind«; der aufsteigende Frühnebel, der Rauch aus den entfernten Fabriken, die sanfte vernebelte Sonne, unter der die Äpfel reifen. Die schönen Einzelheiten dieser Landschaft sammeln sich zu ganzer, unteilbarer Schönheit in der starken Lebensfreude des Menschen: »… zu diesem Stück Land gehören, zu seinen Menschen und zu der Frühschicht, die nach Höchst fuhr, und vor allem, überhaupt zu den Lebenden.«
Die sieben Häftlinge sind um diese Zeit schon ausgebrochen. Ihre Flucht ist im Konzentrationslager Westhofen schon bemerkt. Die Sirenen haben schon geheult, die Wachmannschaften sind unterwegs, die Suchhunde losgemacht. Georg Heisler liegt an seine Weidendammböschung gepreßt, die Finger in Gesträuch gekrallt, durch nichts mehr geschützt als durch den dicken Nebel. Ehe wir ihn sehen, sehen wir seine Heimat, wo seine Freunde leben, die Frauen, die er geliebt, die Genossen, mit denen er gearbeitet hat. Städte und Dörfer, durch die er fliehen wird; die ihm schön erscheinen werden, weil sie ihn verbergen, beschützen, retten: sein Land.
Inniger ist kaum eine Landschaft beschrieben worden. Vor unseren Augen verdichten sich Tätigkeiten, Handlungen, Gedanken zum festen Gewebe des Volksalltags. Ohne Aufhebens werden die Fäden sichtbar gemacht, die von alters her das ganze Gewebe tragen und halten, die dauerhafter sind als so manches, was sich zu seinen Lebzeiten für unsterblich erklärte. Gelassen werden die Schicksale von Herrschern und Reichen genannt, die sich für unvergänglich halten, aber durch Gewalt oder durch das unwiderstehliche Wirken der Zeit längst untergegangen sind. Die Hügelkette, einst »der lange Rand der Welt«, da ihr Limes den Römern für immer die Grenze zwischen Kultur und Wildnis zu bezeichnen schien – heute nicht einmal für Kinder ein Hindernis, ihre Verwandten nachmittags zu Kaffee und Streuselkuchen zu besuchen; der zarte Mönch, der von hier aus hineintritt in die vollkommene Wildnis, »die Brust geschützt mit dem Panzer des Glaubens« – »aber nicht den Adler und nicht das Kreuz hat die Stadt dort unten im Wappen behalten, sondern das keltische Sonnenrad«. Dieses Stück Erde war Sammelplatz des Frankenheeres, Schauplatz der Kaiserwahlen. Hier stellten die Jakobiner ihre Freiheitsbäume auf. Das Zweite und nun das »Dritte« Reich gingen darüber hin (»Tausende Hakenkreuzelchen, die sich im Wasser kringelten!«). Sie alle, Potentaten und Usurpatoren, richteten nichts aus gegen den stolzen Gleichmut des Schäfers Ernst, der, wie das Land, von alledem nichts weiß und doch so dasteht, »als wüßte er all das und stünde nur darum so da«.
So hat das vorher noch keiner gesehen. Wer es kannte, wird es jetzt so sehen. Wer ihm neu begegnet, wird es wiedererkennen. »Macht und Glanz des gewöhnlichen Lebens«, in dem alles beschlossen ist: Banalität und Poesie. Der Geschmack des täglichen Brotes und der alltägliche Kampf des Volkes um das Brot. Die Härte seines Kampfes und seine Größe. Davon lebt das Buch, auch wenn die Erinnerung an einen Heisler, an die sieben Kreuze und ihre furchtbaren Schatten über Deutschland künftige Leser nicht mehr schmerzen wird wie uns. Dieses Buch wird nicht aufhören, in seinen Lesern ein brennendes Gefühl des Am-Leben-Seins zu wecken, Glück und Qual zugleich. Und man wird dafür keinen besseren Ausdruck finden als die Worte: »Jetzt sind wir hier. Was jetzt geschieht, geschieht uns.«
Anna Seghers ist, während sie dieses große Bild vom Leben ihres schwer unterdrückten, schwer leidenden, teils widerstehenden, teils zögernden und teils kapitulierenden Volkes entwirft, ganz auf ihr inneres Auge, auf die Zuverlässigkeit ihres Gedächtnisses, auf die Untrüglichkeit ihrer Phantasie angewiesen. Deutschland ist für sie unerreichbar. Das sechste, das siebente Emigrationsjahr vergehen über der Arbeit an diesem Roman. Als sie ihn zu schreiben beginnt, ist sie schon eine erfahrene Erzählerin.
Ihr Grundstoff, die sozialen Zustände und Kämpfe dieses Jahrhunderts, wird in den ersten Erzählungen aufgenommen (»Grubetsch«; »Die Ziegler«) und beherrscht ihr erstes Buch: »Aufstand der Fischer von St. Barbara«. Der neue Ton, die Eigenart dieser gleichnishaften, fast legendären Beschreibung einer Fischerrebellion vor der angenommenen Landschaft einer Nordseeinsel, überraschte auch die bürgerliche Literaturkritik. Anna Seghers bekam für dieses Buch den Kleist-Preis. Im selben Jahr, 1928, sie ist achtundzwanzig Jahre alt, wird sie Mitglied der Kommunistischen Partei.
Sie war in Mainz aufgewachsen, in der Landschaft des »Siebten Kreuz«, als Tochter eines Kunsthändlers. In ihrer Kindheit und Jugend wurden ihr die Kulturtraditionen ihres Volkes und anderer Völker vertraut. Sie studierte Kunstgeschichte, reiste in verschiedene Länder Europas. Mit wachem Bewußtsein hat sie die hoffnungs- und qualvollen Jahre nach dem ersten Weltkrieg erlebt. Als Studentin begegnete sie Revolutionären, die nach gescheiterten Revolutionen aus ihren Ländern in Ost- und Südosteuropa emigriert waren. Aus ihren Erzählungen, aus der Erfahrung internationaler Solidarität, entsteht ihr zweites Buch: »Die Gefährten«. Als die Herrschaft Hitlers beginnt, muß sie mit ihrer Familie das Land verlassen.
In der Emigration gibt es nur ein Thema: Deutschland. Damit steht Anna Seghers nicht allein. Die sozialistische deutsche Literatur, nach 1933 über viele Länder verstreut, leistet ihren Beitrag, dem Volk die tieferen Gründe für die Katastrophe zu offenbaren.
1933 beginnt Anna Seghers mit dem Roman »Der Kopflohn« ihren großen Deutschlandzyklus – den bisher einzig dastehenden Versuch, das Schicksal der Deutschen seit dem Ende des ersten Weltkrieges in einem umfassenden epischen Werk darzustellen. Nach dem »Kopflohn«, einer schonungslosen Untersuchung, warum ein deutsches Dorf sich dem Faschismus ergibt, erscheint 1937 in Amsterdam »Die Rettung«, ein Bergarbeiterroman aus der Zeit der großen Krise zu Beginn der dreißiger Jahre.
Dann beginnt die Schriftstellerin die Arbeit am »Siebten Kreuz«. Das Material für ihr Buch, die Tatsachen, erfragt sie sich von Menschen, die aus Nazi-Deutschland flüchten konnten. Auch von den Kreuzen erzählt man ihr, die in einem Konzentrationslager für geflohene Häftlinge aufgestellt wurden. Sie ist gewöhnt, Menschen zum Reden zu bringen, ihre Geschichten aufzunehmen und zu verarbeiten. Als Historikerin weiß sie mit Zeitungsmeldungen, Dokumenten, Archivmaterial umzugehen; als Marxistin hat sie die Sicherheit in der produktiven Auswahl.
Sie schreibt in Cafés oder in ihrer Wohnung im Pariser Vorort Bellevue. Was niemand ihr geben kann, muß sie aus sich selbst nehmen – das Wichtigste: diese fast unheimliche Sicherheit in der Charakterisierung der Menschen, ihrer Veränderung unter der faschistischen Diktatur, ihrer Deformierung oder Bewährung. Von der Echtheit in diesem Punkt, von der dokumentarischen Treue ihrer Vorstellungskraft für tausend wichtige Einzelheiten hing alles ab. Der Abstand, der durch die Trennung entstanden war, mußte eingeschmolzen werden. So selten und bewundernswert diese Leistung ist – sie hat nichts Mystisches. Sie kann nur einem Dichter gelingen, der seit langem in jedem Augenblick des Lebens alle vergangenen Augenblicke mitsieht – die genutzten und die versäumten – und alle künftigen Möglichkeiten, gute und schlimme.
Die Schriftstellerin schreibt für Leser, die es damals nicht gibt und die es erst wer weiß wann geben würde. Sie wendet sich mit Beschwörungen, Mahnungen, ja mit Ratschlägen an ihre Landsleute, an die Deutschen in Hitlers Drittem Reich. Die aber würden vor dem Ende dieses Reiches kaum von diesem Buch erfahren. Zu wissen: Sie müßten schneller zu sich selbst finden, würden sie es kennen … Nicht nur Talent und Kenntnisse, auch Mut gehörte unter diesen Umständen zu einem solchen Roman, mehr Mut, Beharrlichkeit und Selbstüberwindung, als sowieso zum Schreiben gehören.
Das Manuskript entsteht unter unsicheren äußeren Verhältnissen: Wenige Monate, nachdem es abgeschlossen ist, marschieren deutsche Wehrmachtsstiefel durch Paris, zwingen seine Autorin, sich zu verbergen, überantworten eines der wichtigsten Bücher, das damals in deutscher Sprache geschrieben ist, einem ungewissen, zufälligen Schicksal. Anna Seghers schreibt am 19. Dezember 1939 an F. C. Weiskopf nach New York: »Ich habe meinen Roman beendet und ihn an meinen Verleger geschickt (einen früheren Mitarbeiter des Kiepenheuer Verlages, C. W.), der augenblicklich in New York ist.« In diesem und einem folgenden Brief vom März 1940 bittet sie, alles zu tun, damit »Das siebte Kreuz« schnell in englischer Sprache erscheinen kann: »… weil mir dieses Buch besonders am Herzen liegt. … Ich hoffe, daß Ihr bald Erfolg habt. Ich würde unendlich glücklich sein, und ich werde Euch stürmisch umarmen, denn, wie ich gesagt habe, dieses Buch hat für mich eine besondere Bedeutung …«
Inzwischen wird Anna Seghers von der Gestapo in Paris gesucht. Es gelingt ihr nach Monaten, mit ihren beiden Kindern in den unbesetzten Süden Frankreichs zu entkommen, in ein kleines südfranzösisches Städtchen in der Nähe des Lagers Le Vernet, wo ihr Mann mit anderen deutschen Antifaschisten von den Vichy-Behörden interniert ist. In Marseille, auf der zermürbenden Jagd nach Ausreisepapieren für Mexiko, beginnt sie »Transit« zu schreiben – ein Buch, das die deutschen Leser noch für sich entdecken müssen –, sie setzt es fort auf dem Schiff, das sie nach Mexiko bringt.
Erst 1942 erscheint »Das siebte Kreuz« in englischer Sprache in einem amerikanischen Verlag, später als Riesenauflage in einer der größten Buchgemeinschaften der Vereinigten Staaten. Dies war die Zeit nach dem Kriegseintritt der USA, die Regierungszeit Roosevelts; damals gab es in Amerika ein großes Interesse an einem Buch wie dem »Siebten Kreuz«, damals konnte ein solcher Stoff in Hollywood verfilmt werden. Viele mit den deutschen Verhältnissen nicht vertraute Leser erfuhren hier zum erstenmal, daß der Faschismus sich zuerst gegen das eigene Volk richtet, zuerst im eigenen Volk Widerstand findet.
Fast gleichzeitig erscheint der Roman im Emigrationsverlag »Das freie Buch« in Mexiko zum erstenmal als Ganzes in deutscher Sprache (die ersten beiden Hauptkapitel waren vor dem Krieg in der Zeitschrift »Internationale Literatur« in Moskau gedruckt worden). Ist auch die Auflagenhöhe dieser ersten deutschsprachigen Buchausgabe nicht hoch, war sie doch eine Leistung unter den in jeder Hinsicht schwierigen Bedingungen des fremden Landes.
Die Zeichen eines großen Talents sind in jedem der früheren Bücher der Seghers sichtbar. Sie selbst kennt sich zu genau in unwägbaren Veränderungen aus, als daß sie nicht verstünde, wie schwer man die Besonderheit des »Siebten Kreuz« schildern kann. Mit den üblichen Begriffen der Literaturkritik ist sie kaum zu erfassen. Die vollständig gelungene Synthese von sozialer und nationaler Problematik in diesem Buch kann, so bedeutsam sie ist, nicht alles erklären. Woher diese überraschende Steigerung zu bestürzender Vollkommenheit? Alles Literarische ist abgefallen. Die Wahrheit selbst spricht nüchtern, unwiderlegbar. Was eingesetzt wurde, sie zu erzeugen – Schmerz und Liebe, Trauer und Heimweh, Hoffnung und Zorn –, tritt nun hinter sie zurück. Die strenge Grenze der genauen Beschreibung von Vorgängen wird nicht durchbrochen. Was gebändigt, doch immer gegenwärtig hinter dieser Grenze bleibt, gibt erst dem Buch Wärme und Fülle.
Unmittelbar, nachdem sie ihren Roman beendet hatte, im Dezember 1939, plante Anna Seghers einen »großen Essai über das gewöhnliche und gefährliche Leben, eine Arbeit von großer Aktualität«. Er wurde nicht geschrieben. Doch die Spannung zwischen diesen Polen »gewöhnlich« und »gefährlich« ist eines der Grundelemente im »Siebten Kreuz«, ein Prinzip seiner Komposition, widersprüchliches, handlungstreibendes Motiv. Ganz gewiß gehörte sie in jenen Jahren zu den Grunderfahrungen verfolgter, illegal kämpfender Antifaschisten, wie sie eine Grunderfahrung des Heisler ist: Staunen über den Fortgang des normalen Lebens, Sehnsucht, in ihm untertauchen zu dürfen; Enttäuschung des Franz Marnet, daß die Nachricht von der Flucht der sieben Häftlinge »fast nicht einsickern wollte auf dem dürren Boden des gewöhnlichen Lebens«. Und auch wieder der Schutz, den es dem Gehetzten bietet: »So gelassen strömt das gewöhnliche Leben, daß es den mitnimmt, der seinen Fuß hineinsetzt.« Das schwerste ist, die Abgesondertheit zu ertragen; einen Menschen, der Georg heißt wie man selbst, bei einer Liebesnacht belauschen zu müssen, ihn heiß um das allergewöhnlichste Mädchen zu beneiden. An Dutzenden von Menschen vorbeizukommen, die ihrer tagtäglichen Beschäftigung nachgehen, in die scheinbar sich selbst genügende Harmonie fremder Schicksale einzudringen. Wie versteht man den Franz Marnet, wenn er sich einen Augenblick lang fragt – da er doch längst bereit ist, jede Gefahr auf sich zu nehmen –, »ob dieses einfache Glück nicht alles aufwiege. Ein bißchen gewöhnliches Glück, sofort, statt dieses furchtbaren unbarmherzigen Kampfes für das endgültige Glück irgendeiner Menschheit, zu der er, Franz, dann vielleicht nicht mehr gehört.«
Ihm ist schon geantwortet, an einer anderen Stelle des Buches, von einer Frau, die er nie kennen wird, der Frau Bachmann. Ihr ist durch die Schwäche, durch den Verrat des Mannes gerade dies zerstört: ihr »gewöhnliches Leben mit den gewöhnlichen Kämpfen um Brot und Kinderstrümpfe. Aber ein starkes, kühnes Leben zugleich, heißer Anteil an allem Erlebenswerten.«
Die Einsicht, wie sehr sie einander bedrohen, das gewöhnliche und das gefährliche Leben, hängt eng mit der Erkenntnis zusammen, wie unlösbar sie miteinander verquickt sind. Jeder, vor dem der Flüchtling oder einer seiner Helfer erscheint, steht vor der Frage: Bist du bereit, alles, was dir lieb ist, aufzugeben, um es dir zu erhalten? Es zeigt sich: Wer am stärksten an diesem Leben hängt, wer am meisten unter Abseitsstehen leidet, der besteht am ehesten. Es liegt etwas Unheimliches in der Unerbittlichkeit dieser Prüfung, von der nicht einmal jeder der Geprüften etwas ahnt: Schon durch eine Überlegung des Arbeitskollegen, ob er für die jetzt benötigte Hilfeleistung in Frage käme, wird er erhoben oder fallengelassen.
Kein Gedanke, daß die, welche einer Tat, eines Opfers für wert gehalten wurden, untadlig und ohne Fehler seien. Vom Koloman Wallisch, dem österreichischen Arbeiterführer, der 1934 gehängt wurde, hat die Seghers in einem Gespräch sagen lassen: Er war »Fleisch vom Fleisch der Arbeiterklasse, das man gequält hat. … Deshalb ist der Mann nicht tot und heilig, sondern mit Fehlern und lebendig.« Ähnlich bildet sich »in den Dörfern und Städten seiner Heimat das Urteil über Georg, das unzerstörbare Grabmal« – über jenen Heisler, der früher alle möglichen Geschichten am Hals gehabt, alle möglichen Streiche ausgeführt hat, die sich als Nebensache erwiesen, als die Nazis in Westhofen versuchten, ihn und gerade ihn zu brechen, als er zeigen konnte, wer er wirklich war.
Wie ungeheuer gefährdet, wie bedroht dieses normale Leben ist, an das Tausende Menschen sich klammern wie an ihr Seelenheil, ohne zu merken, daß es zur Falle wird – das kann nur der glaubhaft machen, der um die Faszination des Volksalltags weiß, der auch die kleinste seiner Regungen nicht verachtet: nicht die Verwendung landschaftlich gefärbter Ausdrücke aus der Umgangssprache, nicht die Neigung des Volkes, einander mit Spitznamen zu rufen. Aus jedem Augenblick dieses Buches holt die Dichterin das Äußerste heraus, weil jeder für Georg der äußerste Augenblick sein kann. Das gibt den Alltagsszenen ihren Doppelsinn. Sie könnten nicht intensiver, alltäglicher, auch verlockender wirken als unter dieser Bedrohung. Prall, farbig, duftend, wohlschmeckend und wirklichkeitsvoll sind die unscheinbaren Dinge, aus denen so ein Alltag besteht: die Jacke des kleinen Helbig, das blütenweiße Kopftuch seiner Freundin, die roten Korallen in Elli Mettenheimers Ohren, die Dampfnudeln der Liesel Röder, der tischgroße Apfelkuchen in Marnets Küche, in der sich an so einem Apfelkuchensonntag sogar die vier Reiter der Apokalypse, nachdem sie ihre Pferde an den Gartenzaun gebunden, »wie vernünftige Gäste benehmen« würden. In ganz bestimmten hintergründigen Augenblicken durchleuchten uralte Märchenmotive die Vielschichtigkeit und Einsamkeit der Situation. »Gab es nicht irgendein Märchen, in dem ein Vater dem Teufel verspricht, was ihm zuerst aus dem Haus entgegenkommt?« fragt sich der alte Mettenheimer, gequält in der Liebe zu seinem liebsten Kind. Paul Röder, auf die Hilfe eines vertrauenswürdigen Menschen angewiesen, versteht sich plötzlich auf das Geflüster der Menschen, wie jener Mann im Märchen sich auf die Stimmen der Vögel verstand, nachdem er von einer bestimmten Speise gekostet. Und die stumme beklommene Mahlzeit des Flüchtlings bei dem Ehepaar Kreß: »Ach, essen von sieben Tellerchen, trinken aus sieben Gläschen, keinem ist's ganz geheuer dabei …«
»Seit zweitausend Jahren hat die Kunst sehr wenig Grundstoffe hervorgebracht. Die Abwandlung ist vielfältig«, schreibt Anna Seghers einmal. Vielfältige Abwandlung von »Grundstoffen« gibt es auch in diesem Buch: erste Fragen des Kindes, erste Liebe, Kummer über erste Enttäuschung, unverbrüchliche Lebensfreundschaft, Treulosigkeit, Verrat – das widerfährt jedem, immer. Man erkennt es, man fühlt sich erkannt. Ein kleiner, manchmal winziger Zusatz macht aus dem Gestern das Heute, aus den vorbeifließenden Leben das eigene, im Innersten berührende Schicksal. Aus der Zeit, die da zum Zerreißen zwischen Beharrungsvermögen und Gefahr gespannt ist, macht dieser winzige Zusatz für jeden Leser: Gegenwart. Das Gegenwartsbewußtsein der Autorin, das »Jetztgefühl der Epoche« machen aus dem Material das Kunstwerk, das dauern wird, weil es seiner Zeit nichts schuldig blieb. Die Quelle für ihre Arbeit und für jede Kunst hat Anna Seghers selbst genannt: »Wir haben im eigenen Volk empfangen, was Goethe den Originaleindruck nennt, den ersten und darum unnachahmlich tiefen Eindruck von allen Gebieten des Lebens, von allen gesellschaftlichen Zuständen, den Eindruck, an dem wir bewußt und für immer vergleichen und messen.«
Ein großes Talent zeichnet sich nicht dadurch aus, daß ihm zufällt, was anderen Mühe macht. Viel eher kennzeichnet es die Fähigkeit, sich aller Mittel zu seiner Verwirklichung, die seine Zeit ihm in die Hand gibt, auf ertragreichste Weise zu bedienen. Anna Seghers hat sich in den dreißiger Jahren, ehe und während sie an ihrem Buch schrieb, auf verschiedene Weise mit seiner Problematik auseinandergesetzt.
1935, auf dem Internationalen Schriftstellerkongreß zur Verteidigung der Kultur in Paris, der mit auf ihre Anregung einberufen worden war, spricht gerade sie über jenes vieldeutige, viel mißdeutete, mächtige Wort: Vaterlandsliebe. Ernst, ohne nationalistische, aber auch ohne antideutsche Ressentiments, untersucht sie, was Vaterlandsliebe bedeuten könne, in dieser Zeit und für Deutsche.
»Es ist noch nicht allzulange her, seit Menschen für die Idee ›Vaterland‹ ein schweres Leben erleiden oder einen schweren Tod. Am Anfang der bürgerlichen Epoche, da wurde der Nationalstaat die neue und weite und gemäße Form für neue gesellschaftliche Inhalte, ein Tiegel, in dem die Reste des Feudalismus vertilgt wurden. Damals war es ein und dasselbe, Patriot und Revolutionär zu sein … Fragt erst bei dem gewichtigen Wort ›Vaterlandsliebe‹, was an eurem Land geliebt wird. Trösten die heiligen Güter der Nation die Besitzlosen? … Tröstet die ›Heilige Heimaterde‹ die Landlosen? Doch wer in unseren Fabriken gearbeitet, auf unseren Straßen demonstriert, in unserer Sprache gekämpft hat, der wäre kein Mensch, wenn er sein Land nicht liebte … Entziehen wir die wirklichen nationalen Kulturgüter ihren vorgeblichen Sachwaltern. Helfen wir Schriftsteller am Aufbau neuer Vaterländer, dann wird erstaunlicherweise wieder das alte Pathos wirklicher nationaler Freiheitsdichter aufs neue gültig werden.«
Anna Seghers war sich früh bewußt, daß ein Epiker in der deutschen Literatur damals kaum eine Tradition vorfand, an die er anknüpfen konnte. Es gab nicht den großen deutschen Gesellschaftsroman. Anna Seghers sagt auf diesem Pariser Kongreß, was sie später oft wiederholen wird:
»Selten entstand in unserer Sprache ein dichterisches Gesamtbild der Gesellschaft. Große, oft erschreckende, oft für den Fremden unverständliche Einzelleistungen, immer war es, als zerschlüge sich die Sprache selbst an der gesellschaftlichen Mauer … Bedenkt die erstaunliche Reihe der jungen, nach wenigen übermäßigen Anstrengungen ausgeschiedenen deutschen Schriftsteller. Keine Außenseiter und keine schwächlichen Klügler gehören in diese Reihe, sondern die Besten: Hölderlin, gestorben im Wahnsinn, Georg Büchner, gestorben durch Gehirnkrankheit im Exil, Karoline Günderrode, gestorben durch Selbstmord, Kleist durch Selbstmord, Lenz und Bürger im Wahnsinn. Das war hier in Frankreich die Zeit Stendhals und später Balzacs. Diese deutschen Dichter schrieben Hymnen auf ihr Land, an dessen gesellschaftlicher Mauer sie ihre Stirnen wund rieben. Sie liebten gleichwohl ihr Land. Sie wußten nicht, daß das, was an ihrem Land geliebt wird, ihre unaufhörlichen, einsamen, von den Zeitgenossen kaum gehörten Schläge gegen die Mauer waren. Durch diese Schläge sind sie für immer die Repräsentanten ihres Vaterlandes geworden.«
1938 schreibt sie, in ähnlichem Zusammenhang, schon während der Arbeit am »Siebten Kreuz«: »Wir hatten keinen deutschen Barbusse, keinen deutschen Romain Rolland.« Schon damals studiert sie, was moderner Gesellschaftsroman heißt, bei den Franzosen (sie liest, nachdem sie von Paris fliehen mußte, aus der Bibliothek eines kleinen südfranzösischen Städtchens den ganzen Balzac) und bei den Russen (Tolstoi, Dostojewski). Einem Moskauer Freund schreibt sie auf eine Frage nach der Wirkung russischer Literatur: »… Da kamen in den russischen Büchern die Gedanken und Handlungen, auch die größten, aus dem Leben heraus. Das Leben war dichter als meins, die Menschen waren mehr Menschen, ihr Leid war mehr Leid, ihre Freiheit war mehr Freiheit, der Schnee war auch mehr Schnee, das Korn mehr Korn. Weil aber alles unmittelbar aus dem Leben kam, gewann ich sozusagen den Mut zum Schreiben. Ich verstand, daß es nichts gibt, was man nicht schreiben kann … Ich lernte (unbewußt), wie wichtig es beim Schreiben ist, daß das Bewußtsein aus dem Sein kommt. Daß Revolution und Konterrevolution mit jedem Alltag verbunden ist.«
Heute klingen diese Sätze wie eine Selbstinterpretation. Nun, da es das organisch gewachsene Werk der Seghers gibt, »ein Gesamtbild der Gesellschaft in unserer Sprache«, nun kommt es uns nicht mehr so schwierig vor, wie es ihr selbst an seinem Beginn erschienen sein muß: aus diesem Hexenkessel von Wirklichkeit ihren Stoff heraus- und heraufzureißen (denn: »Was erzählbar ist, ist überwunden«); Deutschland zu zeigen in seinem grellen, zuckenden Übergang von der alten zur neuen Gesellschaft, das brodelnde Durcheinander als Kämpfe der Klassen zu schildern. Gestalten heißt: etwas begreifen, noch nicht Begriffenes in das Licht des Bewußtseins rücken. In allen ihren Büchern ist der Grundvorgang »die Entschleierung des Menschen, das Durchblitzen ihres wahren Gesichts«.
Anna Seghers beendete ihre Rede auf jenem Pariser Kongreß im Jahre 1935 mit einer Strophe des Italieners Manzoni, die sie siebzehn Jahre später, wieder in der Heimat, Berliner Studenten noch einmal zitiert – mit der zurückhaltend-eindringlichen Geste des Lehrers, der weiß, daß der Kampf um die Seelen der Menschen mit der Zerschlagung des Faschismus eigentlich erst beginnt:
Wehe dem, der die Fahne verkannte,
der, wenn Leiden und Opfer vorbei
und die Fackel des Sieges entbrannte,
sich verhüllt: Ich war nicht dabei.
Dies könnte man, müßte man sich auf vier Zeilen beschränken, für den Kern, für das ideelle Zentrum ihres Buches erklären. – Anna Seghers hat damals, durch den zufälligen Hinweis eines Freundes angeregt, Manzonis Roman »Die Verlobten« gelesen. Sie suchte nach einer Möglichkeit, mit einer einfachen Geschichte einen Querschnitt durch die ganze deutsche Gesellschaft legen zu können. Der Manzoni-Roman beschreibt den Irrweg zweier Verlobter aus niedrigem Stand durch das Italien des 17. Jahrhunderts. An Inhalt und Stoff der Absicht der Dichterin sehr fern, entzündete er doch die Idee für die Struktur des eigenen Buches: Die Flucht wird den Georg Heisler mit allen Klassen des Volkes in Berührung bringen, wird es ermöglichen, den Zustand dieses Volkes und sein moralisches Verhalten zu zeigen. Das Gelingen der Flucht dieses einen wird die Legende von der Allmacht der Nazis zerstören. Der wichtige Punkt, an dem Idee und Fabel eines Buches in eins zusammenfließen, war erreicht. – 1942, schon in Mexiko, »Das siebte Kreuz« soll gerade dort erscheinen, schreibt Anna Seghers über ihren Eindruck von Manzonis Buch: »Auch das Werk eines Manzoni, klassisch im hergebrachten Sinn, maßvoll im Aufbau, in jedem Satzgefüge, gibt das italienische Volk innen und außen als Ganzes. Keine politische Leidenschaft, eine kleine, beinah banale, zivile Begebenheit, die Liebe irgendeines Edelmannes für ein Bauernmädchen auf seinem Territorium, genügt dem Dichter, an dieser Begebenheit alle Konflikte seines Volkes in allen Schichten, in allen Individuen zu zeigen.«
Als »Das siebte Kreuz« endlich zu uns kam, war es in fremden Sprachen schon ein Welterfolg. Gegen Ende des Krieges war es in einer Riesenauflage als Taschenbuch für die bewaffneten Streitkräfte der Vereinigten Staaten gedruckt worden. Ein Deutscher, Soldat in der amerikanischen Armee, hatte Anna Seghers geschrieben: »Als wir bei Mainz über den Rhein fuhren, habe ich den Helm abgenommen, Dir und den Freunden vom ›Siebten Kreuz‹ zu Ehren.« Zu dieser Zeit hat in Deutschland noch niemand das Buch gekannt. 1946 erschien im Aufbau-Verlag die erste Buchausgabe in Deutschland.
Ich sehe noch, in der altmodischen Handschrift meiner alten Lehrerin, den merkwürdigen Namen und den merkwürdigen Titel an unserer Schultafel stehen: Anna Seghers. Das siebte Kreuz. Wir wurden – das muß 1948 gewesen sein – gebeten, nach Goethe und Rilke nun auch dies durchzunehmen, da es heutzutage nun einmal sein müsse. Ohne Vorbehalte, wenn man bitten dürfte. Ich sehe noch den schnell zerfleddernden Rowohlt-Rotationsdruck, den wir dann wirklich lasen. – Was aber lasen wir? Die atemberaubende Geschichte der Flucht eines Menschen, eines Kommunisten. Wir wünschten diesem Flüchtling das Gelingen seiner Flucht – man konnte nicht anders. Gleichzeitig wunderten wir uns: Glaubten wir doch, das zu kennen, was in jenen Jahren Deutschland gewesen war; wir hielten unsere kindliche Erinnerung damals noch für zuverlässig. Sollte also unter der glatten, uns oft glücklich erscheinenden Oberfläche ein solcher Heisler, sollten viele seinesgleichen um ihr Leben gelaufen sein, vielleicht an uns vorbei? Und hatten die anderen, die Erwachsenen, ihn aufgenommen – ihn ausgeliefert?
Die Fragen, die uns das Buch eingab, hingen eng mit unseren anderen Fragen aus jener Zeit zusammen. Sie drückten uns so, sie drängten sich so vor, daß wir weit davon entfernt waren, dieses Buch wirklich zu erkennen und zu verstehen. Außerdem: Um ein Buch richtig schätzen zu können, muß man viele gute Bücher gelesen haben. Auch davon waren wir weit entfernt. Doch die Frage, was in unserem Volk lebendig, gesund, wandlungsfähig geblieben sei, war direkt an uns gerichtet.
Heute erscheint dieser Roman uns »klassisch«. Wir sehen, welches Maß an Voraussage in ihm steckt, unter welchen Schwierigkeiten errungen. Nicht zuletzt hat er uns das Bild jener Jahre mitgeformt. Erst allmählich nahmen wir die Welt der Dichterin in uns auf. Als letztes vielleicht spürt man das besondere, klare Licht, das aus diesem Kunstwerk kommt, so tragisch einzelne seiner Szenen, so bitter der Ausgang mancher Handlung: Das Licht eines nicht leicht erworbenen, nicht oberflächlichen und billigen Glaubens an dieses Volk, das mancher in jenen Jahren glaubte aufgeben zu müssen, das die Schriftstellerin niemals aufgab, weil sie es besser kannte. Das hat sie befähigt, sieben Kreuze zu diesem Symbol zu erheben. Das Licht, von dem ich sprach, kommt aus der Idee, die die Handlung trägt und durchleuchtet. Sie tritt manchmal direkt hervor – wie in der großen Szene des Verhörs des Wallau; meist zieht sie sich hinter die Handlung zurück. Sie lebt auf in den Häftlingen von Westhofen, als ihnen klar wird: Heisler ist entkommen: »Ein kleiner Triumph, gewiß, gemessen an unserer Ohnmacht, an unseren Sträflingskleidern. Und doch ein Triumph, der einen die eigene Kraft plötzlich fühlen ließ nach wer weiß wie langer Zeit, jene Kraft, die lange genug taxiert worden war, sogar von uns selbst, als sei sie bloß eine der vielen gewöhnlichen Kräfte der Erde, die man nach Maßen und Zahlen abtaxiert, wo sie doch die einzige Kraft ist, die plötzlich ins Maßlose wachsen kann, ins Unberechenbare.«
In diesem Buch wird dem Volk reich zurückgegeben, was einst von ihm empfangen wurde. Dies wurde geschrieben mit dem festen, gut gegründeten Vertrauen, daß es nicht vergeblich sein würde. Denn der Stoff, aus dem dieses Buch gemacht ist, ist dauerhaft und unzerstörbar wie weniges, was es auf der Welt gibt. Er heißt: Gerechtigkeit.
Diskussionsbeitrag zur zweiten Bitterfelder Konferenz 1964
Alle unsere öffentlichen Diskussionen in den letzten Monaten, die Beschlüsse der Partei zu verschiedenen Gebieten unseres Lebens haben einen gemeinsamen Kern. Es geht darum, die Möglichkeiten, die unsere Gesellschaft in ihrer jetzigen Etappe bietet, besser zu nutzen, die Voraussetzungen zu schaffen, daß die erkannten Gesetze des Sozialismus bewußt angewendet werden können in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, im Bildungswesen. Worin bestehen die Möglichkeiten unserer Gesellschaft für die Kunst?
Manchmal werden immer noch Klischeeantworten angeboten: materielle Förderung, Betriebsverträge, öffentliche Ehrungen von Künstlern. Das alles ist etwas, aber es ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche springt einem in die Augen wenn man – wie ich zum Beispiel kürzlich – für einige Tage in Westdeutschland ist. Meine Gesprächspartner dort waren meist junge Menschen, übersatt von dem platten Antikommunismus ihrer offiziellen Propaganda, an sachlichen Informationen über die DDR brennend interessiert. Man konnte sehen, daß die Jugend besonders empfindlich reagiert auf das Ende jenes Trancezustandes, in den das sogenannte Wirtschaftswunder für Jahre Teile der westdeutschen Bevölkerung versetzt hat. Man steht jetzt in dieser imponierenden Warenkulisse und fragt sich: Was nun? Man fragt uns: Wißt ihr was Besseres? Man erwartet von uns wohlüberlegte, praktische, brauchbare Antworten. Daraufhin liest man auch unsere Bücher. Man erwartet keine platten Antworten, keine Ausflüchte. Man kann durchaus auch Probleme vertragen.
Man wundert sich über unsere Themen. Das ist mir besonders aufgefallen. Man sagt uns: Was ihr da schreibt, das halten westdeutsche Schriftsteller nicht für literaturfähig: die wirklichen, im täglichen Leben entstehenden Konflikte junger Leute, den Alltag von Millionen Menschen, das gewaltige Thema des Arbeiters in einer hochentwickelten Industriegesellschaft, die Kampfaktionen, die – wie zum Beispiel die Ostermarschbewegung – außer ihrem politischen Gehalt eine große moralische Bedeutung für jeden einzelnen ihrer Teilnehmer haben. Sie bedeuten nämlich, daß in einem streng abgezirkelten, sehr begrenzten Bereich gesellschaftlicher Betätigungsmöglichkeit sich plötzlich für sie ein Feld auftut für Aktivität, für Initiative, für Kühnheit, für Ideenreichtum, überhaupt für die Entwicklung einer Persönlichkeit – übrigens auch für die Förderung künstlerischer Talente.
Wir haben an einer Ostermarschrevue teilgenommen. Da haben wir Songs und Lieder gehört mit spritzigen, frechen Texten, von Laien gesungen und begleitet, die jedem FDJ-Abend zur Förderung junger Talente Ehre machen würden. Zum Beispiel gab es einen Text – drüben muß die Polizei von jeder Demonstration benachrichtigt werden, und sie begleitet die Demonstration vorn und hinten mit Jeeps –: »Der Polizei ein Osterei. Die Polizei ist auch dabei. Die Polizei, dein Freund und Helfer, sie ist auch dieses Jahr dabei.« Ihr könnt euch denken, wie die das singen … Wir haben mitgesungen. Diese jungen Leute, in denen wie in jedem Menschen das Bedürfnis ist, sich selbst in Kunst ausgedrückt zu sehen, fühlen sich – das war eine unserer interessantesten und ich muß auch sagen unerwarteten Beobachtungen – von der westdeutschen Literatur im Stich gelassen. Sie sagten uns: Von euch müßte mal einer herkommen, das alles hier genau kennenlernen und darüber schreiben. Nicht etwa, daß sie kommunistische Bücher haben wollten; aber sie haben uns zugetraut, daß wir uns auf alle Fälle um die Bereiche des Lebens kümmern würden, die sie interessieren und in denen sich ihre täglichen Probleme und Konflikte abspielen. Denn wir sind natürlich in sehr vielen Punkten ganz verschiedener Meinung gewesen. Darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel.
Sie sehen, daß man mit uns nicht nur über Ästhetik, sondern auch über Ökonomie, Politik, Soziologie und Psychologie zum Beispiel reden kann. Sie stimmten spontan unserer Ansicht zu, daß ein Schriftsteller viel wissen muß, um in den komplizierten Organismus der modernen Gesellschaft eindringen zu können, und sie suchen, was ganz natürlich ist, unsere Gesellschaft, unsere Ideale, unser Bild vom Menschen in unseren Büchern.
Wir können auch lernen in diesen Diskussionen. Wir müssen uns daran gewöhnen, daß manches, was uns selbstverständlich ist, dort noch nie gehört wurde. So wurde es ihnen noch nie gesagt. Nicht jede Frage, die uns dumm vorkommt, ist provokatorisch gemeint. Ich habe zwar früher schon gewußt, daß wir verantwortlich für Westdeutschland sind, jetzt fühle ich mich verantwortlich gegenüber ganz bestimmten Menschen. Es geht mir jetzt so, daß alles, was ich nicht gut genug mache oder was wir zusammen nicht klug genug machen, nicht offensiv genug – mir scheint, wir sollten viel offensiver sein, mehr positive Tatsachen schaffen und viel weniger in die Defensive gehen gegenüber falschen Ansichten, sondern unsere positiven Tatsachen ihnen entgegensetzen –, daß alles, wo wir nicht schnell genug vorwärtskommen, wo wir nicht konsequent genug Hemmnisse überwinden, sogar dann, wenn sie schon erkannt sind, daß mich das alles jetzt nicht nur in unserem Namen ärgert, sondern auch in ihrem Namen, im Namen dieser jungen Leute. Denn sie sind, wenn sie es auch nicht wissen, auf uns angewiesen und wir auf sie.
Die westdeutschen Zeitungen wittern natürlich irgendeine Art von Unrat. Sie geben Alarmzeichen, darunter sogenannte Kritiken unserer Bücher. Vergleicht man sie untereinander, hat man den Eindruck, daß hier eine Art automatisch arbeitendes Elektronengehirn durch die Speisung mit zwei einander entgegengesetzten und sich ausschließenden Informationen in Unordnung geraten ist. Die eine Information ist: Es gibt keinen zweiten deutschen Staat, also auch keine zweite deutsche Literatur. Die zweite: Da entsteht in jenem nicht existierenden Staat unter den Bedingungen extremer Unterdrückung Literatur. Da wird diese Literatur, die sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen im Staat auseinandersetzt, sie begleitet, aktiv an ihnen mitarbeitet, nicht nur freiwillig von den unterdrückten Bürgern gelesen, und zwar in Massen, sondern sie wird auch heiß diskutiert. Da gibt es Meinungsverschiedenheiten, heftige Gegensätze, aber weiterhin Literatur.
Nun kann jeder westdeutsche Rezensent nach seinem Charakter, nach der Färbung seiner Zeitung oder nach der finanziellen Lage und dem Grad der eigenen Desinformation über uns eine Variante aussuchen, wie er diese beiden unvereinbaren Axiome doch zu einer Literaturkritik verarbeitet. »Revolte gegen das Regime« – wünschen sich die einen, »besonders raffinierte kommunistische Propaganda« – warnen die anderen. Falsches Lob soll uns schmeicheln, falscher Tadel uns schrecken. Besonders tut sich da die Gilde der »Ostexperten« hervor, jene Leute, die vor ein paar Jahren noch bei uns waren und sich sehr sozialistisch gebärdeten. Aber was wirklich los ist – Tucholsky würde sagen, sie wissen es nicht; Kenntnisse wären hier vonnöten, dialektisches Denken, die Fähigkeit, Prozesse zu begreifen. Da fällt die Klassenschranke, und der Apparat hakt aus. Er läuft leer und kaut nur noch an ein paar unverdaulichen Fakten herum. Man möchte ihnen sagen: Spart euch die Mühe! Mit uns rechnet nicht! Doch da sie nicht glauben wollen, daß in unserem Lande in fast zwei Jahrzehnten der Sozialismus zur menschenbildenden Kraft geworden ist, daß er die tägliche Arbeit von Millionen Menschen darstellt und kein Hirngespinst, werden sie auch diesen gutgemeinten Rat wahrscheinlich nicht annehmen.
Nun gibt es ja Leute, die können sich daran gewöhnen, einen Apfel zu Boden fallen zu sehen und jemanden seelenruhig immerzu dabei sagen zu hören: Er fällt nicht. Solche Leute gibt es auch bei uns, aber sie haben geringere Chancen auf die Dauer. Es gibt Künstler, die den Streit um den Apfel für unerheblich halten, die da überhaupt keinen Apfel sehen, sondern zum Beispiel Leere. Wir haben in Frankfurt am Main den Bergman-Film »Das Schweigen« gesehen, der unerhörtes Aufsehen machte, bis zu Anfragen im Bundestag. Am Nachmittag des gleichen Tages waren wir im Auschwitzprozeß, und zwar in jener Sitzung, in der das Gericht sich darauf konzentrierte, den Sachverständigen Professor Kuczynski der Befangenheit zu bezichtigen, anstatt die Wahrheit seines Beweises über die Verflechtung großer Chemiekonzerne mit dem faschistischen Staat zu überprüfen. Aus beidem, dem Film und dem Prozeß, gingen wir mit Beklommenheit. Wir konnten den Eindruck nicht loswerden, daß diese beiden Ereignisse auf komplizierte und indirekte Weise, aber doch miteinander zusammenhängen: die drückende, sterile, bürokratische Atmosphäre dieses Prozesses, die drückende, sterile Leere, Angst, Einsamkeit und Verzweiflung dieses Films. Eine Kunst, die den Menschen allein läßt in einer solchen Welt, die nur noch Symptome registriert und auf jede Deutung verzichtet, die eigentlich nur den Selbstmord übrigläßt, eine solche Kunst liefert den Menschen aus, sie suggeriert ihm die Relativität aller moralischen Werte, sie trägt dazu bei, ihn letzten Endes auch wehrlos zu machen gegen Auschwitz.
Da wirkt dann in der gleichen Stadt – um nur einmal die Widersprüchlichkeit der Erscheinungen drüben zu zeigen – unter solchen Umständen die Feststellung einer einfachen Wahrheit von der Bühne herunter wie eine Sensation. Man stellt sich hin und sagt, was alle wissen: Der Apfel fällt. Wir sahen die Aufführung des »Stellvertreters« von Hochhuth, in dem es – einen Tag nach dem Auschwitzprozeß – von der Bühne herunter folgenden Dialog zwischen dem Vertreter der katholischen Kirche und diesem Auschwitzdoktor gab. Der Vertreter der katholischen Kirche sagt: Menschen brennen hier, der Brandgeruch von Fleisch und Haaren. Darauf der Doktor von Auschwitz: Sie reden dummes Zeug. Was Sie sehen, ist lauter Industrie, Schmieröl und Roßhaar, Arzneien und Stickstoff, Gummi und Granaten. Hier wächst ein zweites Ruhrgebiet heran, IG-Farben und Buna haben hier Filialen, Krupp demnächst. Luftangriffe erreichen uns nicht, Arbeitskräfte sind preiswert. –
Ich komme auf meine Ausgangsfrage zurück: Worin bestehen die Vorzüge der sozialistischen Gesellschaft für die Kunst? Ich muß sagen, zum Beispiel darin, daß wir als Bürger der DDR in diesem Auschwitzprozeß mit anderen Gefühlen sitzen konnten als unsere jungen Begleiter neben uns, Bürger der Bundesrepublik. Sie machten uns zum Beispiel auch darauf aufmerksam, was wir nicht bemerkten, daß wir im Gespräch dauernd die Vokabel verwendet haben: bei uns in der DDR. Jemand sagte zu mir: Ich würde nicht im Traume daran denken, jemals zu sagen, bei uns in der Bundesrepublik, nicht einmal soweit würde ich mich mit diesem Staat identifizieren.
Für die Kunst bestehen die Vorzüge unserer Gesellschaft darin, daß ihr Wesen mit den objektiven Gesetzen der Entwicklung, mit den objektiven Interessen der Menschen übereinstimmt, daß sie also nicht den Ehrgeiz hat, als mystisches, undurchschaubares Etwas vor den Leuten zu erscheinen; man kann sie mit einigem Fleiß kennenlernen, ihre komplizierte Struktur in ihren offenen und geheimen Keimen, in ihrer Widersprüchlichkeit. Die Wahrheit über sie zu verbreiten schadet ihr nicht, sondern nützt ihr. Zum erstenmal in der menschlichen Geschichte stellt sie keinen unüberbrückbaren Widerspruch mehr dar zum humanistischen Wesen der Kunst. Soweit, glaube ich, sind wir uns alle einig.
Nach diesen Feststellungen aber fangen die meisten Fragen an, über die wir uns gerade in der letzten Zeit gestritten haben. Jetzt nämlich beginnen die Meinungsverschiedenheiten über konkrete Sachen: Was ist denn Wahrheit? Und was ist die Wahrheit der Kunst, die statistische, die soziologische, die agitatorische? Was kann man den Lesern an Problematik und Konflikten zumuten?
Ich will euch hier ein Beispiel erzählen, das mir kürzlich ein Kollege von seiner Zusammenarbeit mit einer Zeitung berichtete. Man hatte ihn als Reporter zu einem besonders gut beleumdeten Brigadier einer Baubrigade geschickt, der kürzlich in die Partei eingetreten und dessen Bild schon überall erschienen war. Man hatte ihm gesagt: Und nun zu dem Bild die wahrheitsgetreue, lebensechte Reportage! Er ging zu dem Brigadier und fand einen sehr aufgeschlossenen Menschen, der ihn sofort einlud mitzukommen und ihm alles erzählte. Schon auf der Autofahrt in seine Wohnung ging es los. Der Kollege sagte: »Es ist nett, daß du mich mit nach Hause nimmst zu deiner Familie!«
»Ach Gott, Familie, mit der Frau stehe ich in Scheidung.«
»Aber du hast doch Kinder?«
»Na ja«, sagte der Brigadier, »Kinder … Mein Sohn sitzt gerade im Kittchen wegen versuchter Republikflucht.«
Dann sagte mein Kollege: »Aber du bist doch in die Partei eingetreten aus Überzeugung?«
Sagte der andere ehrlich: »Klar, ehrlich. Das war so: Unsere Brigade hatte furchtbar viel gegen schlechte Arbeitsorganisation und alle möglichen Mängel und Fehler zu kämpfen. Und wir sind nicht durchgekommen, obwohl ich ein ganz gut ausgebildetes Mundwerk habe. Da haben meine Kumpel gesagt: Hier nützt bloß eins, einer von uns tritt in die Partei ein, dann kann er besser auf den Tisch hauen. Da ich der Brigadier bin, fiel die Wahl natürlich auf mich, und so bin ich in die Partei eingetreten.«
Der Schriftsteller schwieg darauf wahrscheinlich eine gewisse Zeit lang, ein wenig betroffen. Da sagte der Brigadier nach einer Weile zu ihm: »Weißte, laß dir darüber keine grauen Haare wachsen. Es ist schon in Ordnung, daß ich drin bin, das habe ich inzwischen gemerkt.«
Der Schriftsteller findet das prima und schreibt das. Nun fängt der Kuhhandel an. Ihr müßt wissen, es ist keine ausgedachte Geschichte – darum erzähle ich sie. Bei ausgedachten Geschichten ist es ja noch schwieriger.
Also jetzt geht es los: »Muß denn der mit seiner Frau in Scheidung stehen?«
»Ja«, sagt der Schriftsteller, »ich weiß nicht, ob er muß, aber er steht.«
»Kannst du das nicht streichen?«
»Gut, aber dann haben wir gar kein Familienleben, und kein Familienleben, das ist für den sozialistischen Menschen auch nicht typisch.«
»Dann laß wenigstens das mit dem Sohn weg!«
»Aber die Leute, die den Brigadier kennen, kennen auch den Sohn!«
Darauf hat der Schriftsteller gesagt: »Hört zu, ihr habt mich zu dem geschickt, ich habe mir das nicht ausgesucht.«
Da stellte sich heraus, sie hatten einen anderen Brigadier im Kopf, sie wollten einen anderen auf der Zeitungsseite haben.
Der Auftrag wurde zurückgezogen, ein Auftragshonorar wurde gezahlt. Insofern ging die Sache friedlich aus. – Es wurde gestern über die Mitarbeit des Schriftstellers an unserer Presse gesprochen. Stellt euch vor, zwei, drei oder vier solcher Erfahrungen, und jeder Schriftsteller klappt sein Notizbuch zu und versucht sich anderweitig.
Ich war vorige Woche in der 8. Klasse einer Schule, in der ich zur Jugendweihe sprechen soll, und habe versucht, die Kinder vorher etwas kennenzulernen. Ich habe über Literatur gesprochen. Da meldete sich ein kleiner Junge von vierzehn Jahren und sagte: »Frau Wolf, ich habe in letzter Zeit vier Jugendbücher gelesen. In allen vieren gab es einen durch und durch überzeugten FDJler, der alle positiven Eigenschaften hatte, die es auf der Welt gibt, und seine viel schlechteren, ihn umgebenden Kameraden überzeugte. Finden Sie das richtig?«
Ich war diplomatisch und fragte ihn: »Wie ist es denn in Wirklichkeit?«
Da antwortete er ganz lakonisch: »Abweichend.«
Nun habe ich tatsächlich nicht den Mut aufgebracht, diesem Jungen die Gesetze des Typischen in der Literatur zu erklären, sondern ich habe gesagt: »Es sollte ruhig mal einer über das Abweichende schreiben.«
Manchmal kommt man mit den Leuten von der Zeitung, von denen ich vorhin gesprochen habe, in folgende Lage: Sie haben irgendwie das Gefühl, sehr ehrlich wahrscheinlich: Jetzt sitzen wir alle schön gemütlich zusammen – in einer Troika oder in einem Düsenflugzeug – und reisen dem Sozialismus entgegen. Und dann beobachten sie irgendwelche Schriftsteller und Künstler, im Gestänge herumturnend und irgendwo dranrumbohrend. Und jetzt wird Alarm gegeben: Die bohren den Tank an! Darauf müssen wir uns auf Diskussionen darüber einlassen, wo der Tank liegt, denn diese Leute haben nicht immer den Bauplan der Maschine vor Augen. Ich will nicht behaupten, daß alle Schriftsteller und Künstler ihn immer vor Augen hätten, aber es kommt doch vor; denn auch wir leben fünfzehn Jahre in unserer Republik und haben unsere wesentlichen Eindrücke und unsere Erziehung hier erfahren, genau wie jeder andere normale Bürger. Nun gut, es wird also Alarm gegeben, riesige Rettungsmannschaften werden in Bewegung gesetzt, die sowohl diese Leute als auch uns hindern, ordentlich auf unserem Gebiet zu arbeiten. Wir müssen mit einer Hand immer abwehren und sagen: Laßt doch, laßt doch, das ist nicht der Tank! Das dauert aber sehr lange. Wenn die Maschine jahrelang fliegt und nicht abstürzt und vielleicht sogar trotz unserer Bohrerei die Geschwindigkeit beschleunigt hat, dann erst sind sie bereit, mit uns über den Bauplan der Maschine zu diskutieren. Und trotzdem passiert es uns dann nach langer Zeit immer noch, daß hinter uns getuschelt wird, wenn wir durch irgendeinen Saal gehen: Das waren doch die, die damals … ihr wißt schon … den Tank! – Ihr könnt jetzt darüber lachen, und ich kann Witze erzählen. Vor einem halben Jahr noch hätte ich keine Witze erzählt, und ihr hättet vielleicht nicht gelacht. Das gehört zu dem Kapitel »Konflikt und Überwindung«.
Ich möchte nur sagen, daß diese Art, uns anzubohren, auch daran hindert, die wirklichen Anbohrer zu erkennen. Das sollte man sich überlegen. Sie hindert uns auch daran, im richtigen Moment und schnell genug konsequent selbstkritisch zu sein, was für uns dringend notwendig ist. Wir müssen vielleicht noch mehr als jeder andere Mensch möglichst schnell zu einem selbstkritischen, echt kritischen Verhältnis zu unserer eigenen künstlerischen Arbeit kommen. Es ist interessant, daß mir dabei im letzten Jahr nicht die offizielle Kritik im allgemeinen geholfen hat, sondern die Diskussion, die ich mit »normalen« Lesern hatte. – Das war keine Polemik! Es haben sich nämlich tatsächlich im letzten Jahr alle Widersprüche oder wenigstens alle wichtigen Widersprüche, die in der jetzigen Etappe unserer kulturellen Entwicklung auftreten, offen gezeigt. In all diesen Diskussionen ging es eigentlich nicht nur um Literatur, sondern es ging um alle Probleme unseres Lebens.
Wer könnte behaupten, daß wir dabei nicht viel zu lernen gehabt hätten! Ich habe zum Beispiel FDJ-Versammlungen erlebt, in denen plötzlich, ohne daß ich das voraussehen konnte, über den Begriff der Heimat diskutiert wurde. Da habe ich mehr gelernt als die Jungen, die dort diskutiert haben. Der FDJ-Sekretär kam danach zu mir und sagte: Eigentlich stand das Thema »Heimat«, »DDR« usw. erst auf unserem Plan für die nächste Woche. Er war etwas durcheinandergekommen. In mancher Lehrerversammlung, in der schon damals ganz offen über Probleme diskutiert wurde, die jetzt im neuen Bildungssystem aufgegriffen worden sind, habe ich gedacht: Wenn jetzt der zuständige Schulrat da wäre!
Ich möchte nur noch ganz wenige Sätze über die Rolle sagen, die die Literaturkritik in unserer Gesellschaft spielen könnte, die sie aber nicht spielt. Der Geschmack und die Urteilssicherheit und die Erschütterungsfähigkeit der Leser sind viel weiter fortgeschritten als die Literaturkritik. Sie lassen sich in dem Klischee der schematischen Literaturbesprechung alten Stils gar nicht mehr erfassen. Ich war selbst Germanistin und schimpfe nicht gern auf meine Berufskollegen. Aber ich habe mir überlegt: Woher kommt es eigentlich, daß die Kritiken so unlebendig und so schematisch sind? Ich habe manchmal den Eindruck, daß viele Kritiken nicht für die Leute geschrieben werden, die sie lesen sollen, und auch nicht für den Autor, sondern für irgendwelche in der Einbildung vorhandenen höheren Instanzen, die sich dazu freundlich äußern sollen. Da schwingt noch die Tendenz zu großer Vorsicht und eventuell sogar der Angst aus einer Zeit mit, in der selbständiges Denken und Verantwortungsbewußtsein noch nicht so selbstverständlich waren wie heute.
Ich bin der Meinung, daß man zum Beispiel als Trapezkünstler unbedingt mit Seil, Schutzgürtel und Netz arbeiten muß. Aber wenn man schreibt – auf welchem Gebiet auch immer –, kann man nicht mit Netz arbeiten; da muß man schon ein kleines Risiko eingehen, das aber mit Verantwortung verbunden sein soll.
Eine Rede
Sie alle sind schon mehr als einmal dabeigewesen, wenn jemand plötzlich anfing, aus seinem Leben zu erzählen. Jeder von Ihnen hat schon einem oder vielen anderen von sich selbst erzählt. Vielen Menschen, die zu meiner oder einer älteren Generation gehören, kommt heute ihre eigene Vergangenheit ganz abenteuerlich und unwahrscheinlich vor. Wie oft hört man: Wenn das jemand aufschreiben würde – es wäre ein ganzer Roman! – Ist Ihnen schon aufgefallen, daß die meisten sogenannten wahren Geschichten mit dem Satz enden: Schade; so was kann ja niemals geschrieben werden …
Ich will hier nicht den alten Streit fortführen, ob alles, was im Leben vorkommt, einen gebührenden Platz in der Kunst finden kann und muß; vielmehr will ich versuchen, ein paar Lebensgeschichten zu erzählen. Beide Männer, die mir ihre Geschichten selbst erzählt haben, sind heute Mitte Dreißig. Der eine, der mir vor kurzem in einem Bürozimmer im Verwaltungshaus eines großen Werkes gegenübersaß, wiederholte immer wieder, selbst erstaunt: Das kann nie im Leben einer schreiben!
Er ist in den baufälligen Arbeitervierteln einer alten Stadt geboren, Kind einer großen Arbeiterfamilie. Er war ebenso arm wie klug und wißbegierig, auch ehrgeizig. Seine Mutter nahm das Stipendium für die Oberschule vom Nazistaat. Der Junge nahm das braune Hemd und die »Führer«schnur und glaubte, er sei Glied eines Herrenvolkes, und der Weg aus der Arbeitervorstadt führe über Polen und Rußland – Länder, die von minderwertigen Rassen bewohnt seien. Das Wort »Klasse« hat er, bis er sechzehn Jahre alt war, nur mit Haß und Verachtung aussprechen hören. Mit einem zu großen Stahlhelm bedeckt, ein viel zu schweres Gewehr auf der Schulter, verbiß er sich 1945 fanatisch mit einem Trüppchen Verzweifelter in die Verteidigung seiner Heimatstadt. Mit einem der ersten Transporte unverbesserlicher Kriegsverbrecher wird er tief nach Rußland hinein verschickt – für drei Jahre. »Dort«, sagte er, »war ich, der Proletenjunge, wieder Putzer der Herren Offiziere. Was da mit mir los gewesen ist – das kann keiner schreiben.«
Er kommt zurück. Die ihn einst weggeschickt haben, Kommunisten, wollen ihm nun die Hand reichen. Er schlägt diese Hände weg. Er beginnt als ungelernter Arbeiter in einem Betrieb.
Heute ist dieser selbe Mann, fünfunddreißigjährig, Doktor der Ökonomie und Leiter eines großen Werkes. Was in den letzten fünfzehn, zwanzig Jahren mit ihm passiert ist, muß man wohl die Geburt eines Menschen nennen. Jedesmal, wenn man ihn trifft, ist er in heftige Kämpfe und Auseinandersetzungen verwickelt. »Mensch«, sagt er, »was hier dauernd los ist, das kann kein Mensch schreiben!«
Anfang dieses Jahres saß ich in Westdeutschland mit einem jungen Mann zusammen, einem Altersgenossen dieses Werkleiters. Seine Geschichte hatte einen anderen Kehrreim, den ich damals zum erstenmal hörte: »Ich frage mich manchmal, was aus mir geworden wäre, wenn ich bei euch in der DDR leben würde.«
Dieser Mann hatte günstigere Startbedingungen als unser Werkleiter. Sein Vater, ein sozialdemokratischer Journalist, ließ nicht zu, daß die Nazis ihm seinen Sohn wegnahmen. Er brachte ihn nach Kriegsende in die Politik. Der Junge wurde ein begeisterter Jugendfunktionär der SPD, bekannt und erfolgreich in seinem Bezirk. Auf großen Versammlungen stritt er erbittert gegen die Kommunisten. Jeder, der ihn kannte, sagte ihm eine gute Karriere voraus.
Dieser selbe Mann ist heute kleiner Angestellter in einer nebensächlichen Verwaltungsstelle. Eines Tages stand er vor der Entscheidung: prinzipienlos den antirevolutionären Weg seiner Partei mitgehen oder zu seinen eigenen neuen politischen Einsichten stehen. Er wird wegen zu starker Linkstendenzen aus der SPD ausgeschlossen. Seine frühere Partei warnt heute öffentlich vor ihm als vor einem gefährlichen kommunistischen Unterwanderer. Jeder, der ihn kennt, sagt, er habe seine Karriere verpfuscht. Sein Leben sind die Abende und das Wochenende, wenn er zu jungen Menschen geht, wenn er reden, werben, organisieren kann. Der größere Teil seiner Talente und Fähigkeiten liegt brach. Er fragte uns: Wie wäre ich heute, wenn ich bei euch lebte?
Die bürgerlichen Romane und Dramen der letzten zwei Jahrhunderte sind voll von tragischen Geschichten: Ein junger Mann will einen großen, edlen Traum im Leben verwirklichen, aber er zerbricht physisch oder moralisch an den Schranken seiner Gesellschaft, an ihrer Unfruchtbarkeit, ihrer Stumpfheit. Werther, Julien Sorel, Anna Karenina müssen zugrunde gehen. Es gibt Statistiken oder Schätzungen über die Opfer der Kriege seit Hunderten von Jahren. Keine Statistik wird je über das Drama derjenigen Rechenschaft ablegen, deren Begabung, vielleicht Genialität mißbraucht oder erstickt wurde. Keiner wird je die Menschen zählen, die den langsamen Tod der Verbitterung, der Resignation, der Selbstaufgabe gestorben sind.
Wir fangen gerade an, die ersten Sätze von anderen Geschichten zu schreiben. Wahrhaftig keine Märchen von ewig lächelnden Leuten, die auf rosigen Wolken wandeln. Erzählungen von schwer, oft unter Anspannung aller Kräfte arbeitenden Leuten. Berichte von Menschen, die sich entschlossen haben, unter »Glück« nicht Faulheit und Unterdrückung, sondern Produktivität zu verstehen und unter »Unglück« nicht Verlust an Eigentum, sondern den Verlust der Möglichkeit, schöpferisch zu sein. Zum erstenmal treibt die Wirklichkeit uns Lebensstoff zu, der uns nicht zwingt, unsere Figuren physisch oder moralisch zugrunde gehen zu lassen. Die Konflikte werden dabei nicht schwächer, sondern eher schärfer, moralischer, das heißt: menschlicher. Tausende von einzelnen, oft komplizierten, den ganzen Menschen aufwühlenden Antworten auf die alte Frage, ob der Mensch sich selbst erschaffen kann ohne Antreiberei, freiwillig und bewußt mit seinesgleichen zusammenarbeitend.
Die Gefahr, bestimmte persönliche Erlebnisse, bestimmte Zeitereignisse zu über- oder zu unterschätzen, bedroht jeden. Man braucht manchmal lange Zeit, um die Bedeutung einer Entscheidung, einer Bekanntschaft, die Tragweite eines Irrtums oder einer Unterlassung ganz zu begreifen. Die Geschichtsbücher sind voll von kuriosesten Fehleinschätzungen kluger Leute über ihre eigene Zeit. Wir, die wir intensiver über unsere Geschichte nachdenken, als das in Deutschland früher üblich war, behaupten nicht, nach diesen fünfzehn Jahren am Ziel zu sein. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, daß hinter jedem Ziel neue Anforderungen auftauchen. Aber wir können sagen: In diesem Teil Deutschlands, der vor zwanzig Jahren noch von Faschisten beherrscht und von verbitterten, verwirrten, haßerfüllten Leuten bewohnt wurde, ist der Grund gelegt zu einem vernünftigen Zusammenleben der Menschen. Die Vernunft – wir nennen es Sozialismus – ist in den Alltag eingedrungen. Sie ist das Maß, nach dem hier gemessen, das Ideal, in dessen Namen hier gelobt oder getadelt wird.
Ich glaube nicht, daß wir uns später korrigieren müssen, wenn wir das heute schon als Tatsache und als den entscheidenden Fortschritt in unsere Geschichtsbücher schreiben.
Tagebuch – Arbeitsmittel und Gedächtnis
Auf einer der letzten Seiten meines Tagebuchs steht ein Brecht-Gedicht aus dem Jahr 1944:
Lektüre ohne Unschuld
In seinen Tagebüchern der Kriegszeit
Erwähnt der Dichter Gide einen riesigen Platanen- baum
Den er bewundert – lange – wegen seines enormen Rumpfes
Seiner mächtigen Verzweigung und seines Gleich- gewichts
Bewirkt durch die Schwere seiner wichtigsten Äste.
Im fernen Kalifornien
Lese ich kopfschüttelnd diese Notiz.
Die Völker verbluten. Kein natürlicher Plan
Sieht ein glückliches Gleichgewicht vor.
Tagebuch! Das Thema ist erweiterungsbedürftig. Wer könnte, wer möchte dreißig Minuten über sein Tagebuch reden? Aber: der Autor und das Tagebuch anderer – damit ließe sich beginnen. Am liebsten: das Tagebuch derer, die selbst nicht Autoren sind …
Die Leute, die in hundert Jahren leben, werden vielleicht neugierig sein auf ihre Vorfahren; sie werden, nehme ich an, Zeit haben, jede Art von Neugier zu befriedigen. Es wird ihnen nicht ganz leicht werden, sich uns vorzustellen. Sie werden nach den Büchern suchen, in denen wir uns selbst beschreiben. Ein bißchen ratlos werden sie sie wieder aus der Hand legen: Mehr haben die nicht über sich gewußt? Oder: Mehr haben sie nicht sagen wollen? Vielleicht auch werden sie, besser als wir selbst, begreifen, was alles, wieviel Verschiedenes sich heutzutage zwischen einen Autor und die schlichte, wahrheitsgetreue Erzählung über seine Welt schiebt.
Wie auch immer – Auskunft über die inneren Vorgänge um die Mitte dieses Jahrhunderts werden sie in Dokumenten dieser Zeit suchen müssen.
Wie ja auch wir selbst es schon tun. Ich kann nicht sagen, daß Romane meine erregendste Lektüre der letzten Jahre gewesen wären. Wir sind mißtrauisch geworden gegen Erfindungen über das Innenleben unserer Mitmenschen. Außerdem: die Wirklichkeit hat sich als unübertrefflich gezeigt. Wenn auch nicht als unübertrefflich schön. »Wie dieser Vers stockt das Herz«, heißt es in einem Gedicht von Stephan Hermlin, in dem sich auch die Zeile findet: »Die Zeit der Wunder ist vorbei.«
Wir lesen Akten, Briefsammlungen, Memoiren, Biographien. Und: Tagebücher. Wir wollen Authentizität. Nicht belehrt – unterrichtet wünscht man zu sein. Die großen Fragen, welche die Kunst zu stellen hat, können nicht aufgegeben werden. Wer sonst als die Kunst soll die Synthese finden all jener oft schwer erklärbaren menschlichen Verhaltensweisen unserer Tage? Wer, wenn nicht sie eine vernünftige, uns gemäße Ordnung bringen in die Sturzflut der sogenannten Fakten?
Vier Tagebücher liegen vor mir. Das zeitlich früheste und das zeitlich späteste sind fast gleich weit vom magischen Datum der Jahrhundertmitte entfernt. Die da schrieben, waren oder sind unsere Zeitgenossen. Sie lebten auf kleinem Raum: tausend Kilometer im Quadrat. Wir lesen ihre Aufzeichnungen und fragen: Wieviel Schichten hat die Zeit? Wieviel Möglichkeiten, in ihr zu leben?