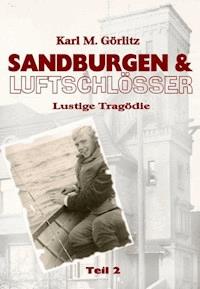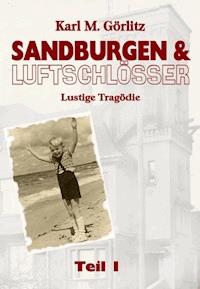
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer mitteldeutschen Flüchtlingsfamilie im goldenen Westen der Republik. Geschildert aus der Sicht ihres schwärzesten Schafes in drei Bänden. Ein gewaltiges Panorama vom Kriegsende bis zum Heute, randvoll mit Anektdoten, schrägen Typen und kreischkomischen Situationen. Sie werden Ihnen ans Herz wachsen: Die sächsische, teilgebildete Mutter und ihr etwas zu klein geratener Ehemann als großer Manager, die Söhne, von welchen der eine wohlgeraten und der andere auf krummen Wegen durchs Leben wandelt. Folgen Sie ihnen durch fast siebzig Jahre Zeitgeschichte, amüsanter kann eine Zeitreise kaum sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Imprint Sandburgen & Luftschlösser. Lustige Tragödie – Teil 1 Karl M. Görlitz published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Für Rüdi und Rosa
Karl M. Görlitz
SANDBURGEN&
LUFTSCHLÖSSER
Lustige Tragödie
Aufstieg und Fall einer mitteldeutschen Flüchtlingsfamilie im prosperierenden Westen der Republik. Geschildert aus der platten Sicht ihres schwärzesten Schafes auf schlappen 1.800 Seiten in drei Bänden.
DER AUTOR :
Inhaltsverzeichnis
Vorspiel
Statt eines Nachworts
Made in Coswig
Die Aschenputteljahre
Lehrjahre sind keine Herrenjahre
Paris
Der Eintänzer aus der Fischbratküche
Das Haus im Grünen
Community
VORSPIEL
Wenn man es sportlich sieht, bin ich Sieger nach Punkten. Ich habe überlebt. Mein Bruder wartet in seinem billigen Fichtensarg darauf, in ein handliches Häufchen Asche verwandelt zu werden.
Ich stehe mit seinem Wohnungsschlüssel im Flur des Hauses, in dem er zuletzt wohnte. Ein schöner Altbau. Langsam steige ich die Treppen hinauf und suche den Namen Popig an den Türen. Nichts! Kein Popig! Ich habe mich doch nicht geirrt, der Schlüssel zum Hausflur passte! Verunsichert bleibe ich wieder stehen. Ein Nachbar stöhnt beim Heraufkommen.
»Können Sie mir sagen, wo Herr Popig gewohnt hat?«
»Ja, gleich im Erdgeschoss.«
Natürlich! Wie konnte ich diesen Eingang übersehen, die geborstenen Glasscheiben der Türe sind mit Brettern ausgebessert. Zögernd stecke ich den Schlüssel ins Schloss. Er passt. Als ich öffne, schlägt mir schwer der beizende Gestank alter Katzenpisse entgegen. Es würgt mich sofort, und erschüttert vom Anblick, der sich meinen Augen bietet, bleibe ich stehen.
So etwas kenne ich höchstens aus dem Kino, und da war so was wenigstens ohne Geruch. Wie andere mit spitzen Fingern etwas berühren, trete ich sozusagen mit spitzen Füßen ein. Ich steige über Essensreste, auf denen sich imponierende Schimmelpilzkulturen gebildet haben, trete über verdreckte Unterhosen, umrunde Flecken, die zusammen mit den Essensresten und alter Katzenkacke das Muster eines ehemals chinesischen Teppichs bereichern, stehe fassungslos vor einem Ledersofa, das umringt von Batterien leerer Flaschen offensichtlich den Lebensmittel-Punkt des Bruders bildete. An dem er geklebt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Umringt von Büchern, Schallplatten und Manuskripten, die sich an den Wänden stapeln. Durchmischt mit Briefen, geöffnet und ungeöffnet, alten Socken und Lumpen. Auf dem Sessel sehe ich seine Armbanduhr neben verstreuten Gewürzen. Auf dem Tisch, unter Bergen von Müll, entdecke ich die Silberleuchter, die unsere Mutter einst seinem Vater schenkte.
Ich gehe weiter, ich kann mich nirgendwo setzen. Im Bad finden sich andere Hinterlassenschaften, besser kann man nicht demonstrieren was man von der Welt hält. Erst nach langem Spülen weicht der Dreck.
Im Flur liegt zwischen dem ganzen Müll Geld auf einer Kommode, nicht viel, aber immerhin, Geld hatte er immer. Ich stecke davon zwanzig Mark ein. Ich habe kein Geld, auch wie immer. Ich werde Blumen davon kaufen. Ein letzter bitterer Witz. Er wird seine Beerdigungsblumen selbst bezahlen.
Auf dem Schreibtisch türmen sich Briefe, Akten, Notizen, Trink- und Essensreste. Wie soll ich in diesem unsäglichen Durcheinander überhaupt etwas finden?
Mutlos setze ich mich doch, und nehme einen der Ordner in die Hand. Beim Aufschlagen fällt mein Blick zuerst auf Grundbuchurkunden, dann auf Schriftwechsel, den Erbfall betreffend. Heureka! Beim allerersten Griff, das, was ich suche.
Welch grausame Ironie. Da hat er nun den Erbstreit um das Vermögen im Osten gewonnen, und nun ist er seine Grundstücke nicht losgeworden. Unser Millionär hat sich mit Geldern vom Sozialamt ins frühe Grab saufen müssen. Auf zwei Millionen war der Besitz nach der Wende geschätzt worden, aber nachdem der Investor Aldi wegen der ungeklärten Besitzverhältnisse abgesprungen war, hat er auf dem Trockenen gesessen. Pech!
Unsere gemeinsame Halbschwester Jutta, von der ich die Todesnachricht vorgestern erhalten habe, hat schon am Telefon darüber gekichert. Bei ihr ist der Ofen völlig aus, nicht einmal zur Beerdigung wird sie erscheinen. Nichts will sie mehr davon wissen, was auch eine fromme Lüge ist, denn sie birst geradezu vor Neugier. Schließlich tun sich völlig neue Möglichkeiten für uns auf. Jetzt sind wir die gesetzlichen Erben.
Mich schaudert. Es ist, als läge ein Fluch auf dieser Hinterlassenschaft. Dieser unappetitlichen, in der ich gerade sitze, und jener, im fernen Coswig, unserem Heimatstädtchen. Zwei Tote hat sie bereits gefordert.
Unsere Mutter schon ist darüber vor Ärger ins Grab gesunken. Ärger über den unbotmäßigen Sohn, der sie wutschnaubend ausgebootet hat, als sie ihren Anteil einforderte. Nach all den Nächten, in denen der Sohn volltrunken telefonisch um Geld und Zuneigung heulte, und so ihr komfortables Rentnerdasein zum Teufel ritt. Das Karussell der drei Kinder, welches sich immer schneller um Mutter drehte und immer neuen Hass gebar.
Ich bin gerade noch rechtzeitig abgesprungen, den Bruder hat es nun endgültig aus der Kurve getragen.
Und in Leipzig lacht die Dritte, welche durch die Mauer für längere Zeit geschützt blieb. Hass und Schreie und Flüstern, griechische Tragödie in sächsischer Mundart. De Ginder von Medäa, Band eens.
Zumindest der Tod war gnädig zu ihm, er soll friedlich im Schlaf an einer inneren Blutung gegangen sein, so der Arzt. Heutzutage stirbt ja niemand mehr, man geht einfach. Und wer die Zeche nicht bezahlen kann, wird vom Staat diskret entsorgt als Grillgut der preiswertesten Variante. Schlichte Fichte drumherum vom Sarg-Discounter, die Abwärme ins Fernheiznetz eingespeist und der Rest ab in die Dose, neuerdings auch zum Mitnehmen. Alles für schlappe zwei Mille hat man mir vorhin beim Bestatter offeriert, denn als Angehörige sind wir zur Zahlung verpflichtet.
Jutta, die Schwester, hat schon am Telefon abgewunken, keinen Pfennig für den Schuft. Seit dem Schmähbrief ist die einstige Verbündete nicht mehr zu sprechen für den Bruder. Dieses Problem hat sich ja nun von selbst aufs Eleganteste gelöst. Ich war ihm leider nicht einmal einen eigenen Brief wert, sondern erhielt praktischerweise nur eine Kopie mit einigen für mich bestimmten Freundlichkeiten, in welchen mir unter anderem jegliche moralische Kompetenz aberkannt wird. Womit er unbedingt recht hat.
Dabei hatte es nach unserem letzten Gespräch noch so gut ausgesehen. Endlich war er eingeknickt und hatte weinend seine Fehler eingestanden. Endlich schien die Fehde vorüber, danach hatte ich ihm als großmütiger Sieger jegliche Hilfe bei seinem Alkoholproblem zugesagt. Es hat nicht sollen sein, meine Hilfsbereitschaft verwehte bei der kurzweiligen Lektüre, die drei Tage später im Briefkasten lag. Seither herrschte Schweigen für einige Jahre, ich ließ ihn ziehen mit Vaterhaus und Mutterkomplex. Zum Schluss vereinfachte sich das stumme Ringen mit dem Halbbruder auf die schlichte Frage: wer hält länger durch.
Drei verschiedene Väter ließen ihre Gene in uns Geschwister einfließen. Die künstlerische Ader erbten wir offensichtlich von der Mutter, auch eine gewisse Suchtprädisposition, um es mal vornehm auszudrücken. Mutter süffelt elegant, der Bruder als Bonvivant und schreibender Gesellschaftskritiker, ich kiffe, und in Juttas Adern fließt Theaterblut, die schlimmste aller Drogen. Jutta blieb freiwillig zurück bei unserer Flucht in den Westen, hatte sie doch längst Abstand genommen von der liebenden Fürsorge von Mutter und Stiefvater, und so wurde es zum jahrelangen Zweikampf mit dem jüngeren Bruder um etwas, das ich ihr nur zu gern überlassen hätte. Die Gunst der Mutter, um die auch die Schwester heftig buhlte, wenn Champagner-Ruth sich die Ehre in ihrer Geburtsstadt gab und ihre Tochter jedesmal halb ruiniert zurückließ, weil diese ihr unbedingt westlichen Standard bieten wollte und nichts Gnade fand vor dem kritischen Blick der hohen Frau, Herrscherin der Herzen, deren Untertanen nach Liebe lechzten, die sie nicht mehr fand, seit der Geliebte in Russland fiel. Verhärtetes Herz, vergeblich von Zweitmann und Zweitwagen umworben, mit Zweitfrisur und dritten Zähnen.
Und ich sitze jetzt hier und zerbreche mir den Kopf, wie ich die Bestattung bezahlen soll, denn ich bin vollkommen pleite, wie schon so oft. Es geht mir mächtig gegen die Ehre, dass seine Ehemaligen die Kosten übernehmen wollen, auf der anderen Seite haben sie sicher ein Testament von seiner Hand mit erfreulichen Aussichten.
Und vor seiner letzten Freundin hatte mich Jutta ausdrücklich gewarnt. Diese weilte mit Peter einige Jahre zuvor bei der Schwester für einige Tage zu Besuch. Jutta kennt die Frau. Eine Erbschleicherin, wie sie im Buch steht, die den Bruder Peter nur aus finanziellen Gründen attraktiv fand. Ja, wahrlich, attraktiv hatte der Bruder bei unserem letzten Treffen wirklich nicht mehr gewirkt.
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie verlottert der ausgesehen hat mit seiner Sozialarbeiterin, die ihn obendrein
als Fall betreut hat, vorwiegend bei mir im Ehebett.« Jutta ist schlau.
Was für eine vertrackte Geschichte, eigentlich sollte man sie aufschreiben. Jutta schreibt fürs Theater, Peter schrieb für die Zeitung, nur ich bin aus der Art geschlagen als Art-Direktor im Werbewesen. Ich gehöre eher der bildenden Kunst an und gelegentlich male ich Bilder, um meine leeren Wände zu füllen. Streng nach Bedarf und möglichst zur Farbe des Raumes passend, aber trotzdem ziemlich gut. Wirklich berufen fühle ich mich dazu allerdings nicht, eher schon zur Architektur und ganz besonders zur Gestaltung von Innenräumen. Vielleicht haut mich deshalb die Theatralik dieses Zimmers so in den Sessel. Trotzdem bin ich sicher, dass das ärmliche Bild nicht ganz stimmt, genau so wenig wie das schlossartige Ambiente bei mir.
Ich weiß genau, dass Peter über eine geheime Geldquelle verfügte, genau so sicher, wie ich weiß, dass hinter meiner reichen Fassade gerade mal wieder die Not zu Hause ist.
Die ungleichen Brüder. Ist das nicht was für einen Roman? Auch sonst gäbe es noch allerlei Zutaten dazu. Sex und ein bisschen Crime, ein Unfall, der verdächtig nach Gewalteinwirkung riecht, Studentenrevolte, Schwulenbefreiung und Psychogrusel mit Rollentausch und Persönlichkeitsspaltung. Mit fatalen Situationen und komischen Nebenrollen.
Jedenfalls - was hätte ein Shakespeare aus dem Stoff gemacht -, soll ich mich trauen? Bei mir geriete das Ganze höchstenfalls zum Comic. Das wäre schon eine seltsame Umkehrung unserer beider Berufe. Peter malte neuerdings. Vincent riefen ihn die Kneipenkumpel, wenn er farbverschmiert einlief, obwohl er beide Ohren noch besaß.
Verwirrt beende ich den Gedankengang, irgendwie stehe ich immer noch unter Schock. Ich muss mich sputen, gleich bin ich mit der Erbschleicherin verabredet. Ich packe den Ordner in die Tüte zu Peters Totenschein. Mein Blick fällt auf einige Bilder, die an der Wand lehnen. Seine Bilder. Seine Bilder, die ihm Anlass waren, die letzte Therapie abzubrechen. Ich blättere flüchtig durch seine Bilder. Nichts Besonderes, wie es scheint. Dazwischen aber einige übermalte Fotos. Köpfe in der Mitte des Bildes, übermalt und überkritzelt. Köpfe, die aus leeren Augenhöhlen blicklos in eine Zukunft starren, von der er wusste, das sie ohne ihn stattfinden wird. Mich fröstelt.
Noch einmal lasse ich meinen Blick kreisen. Tatsächlich, wie aus einem Film. Allerbitterste Armut. Nur der nagelneue Fernseher und die beeindruckende Stereoanlage stören das Bild ein wenig, sie verraten mir, dass hier auch Geld gewesen sein muss. Wahrscheinlich wieder am Fiskus vorbei gemogelt. Von unserem Sozialisten, dessen größte Sorge es war, Mutters letztes Geld vor dem Finanzamt zu retten. Ich muss hier weg.
Ich laufe zwei Straßen weiter, hier irgendwo wohnt Brigitte Funke. Seine letzte Freundin, die Sozialarbeiterin, die Erbschleicherin. Ich suche eine Weile, die Hausnummer ist versteckt, aus einem der Eingänge kommt eine Frau. Eine dickliche Frau mit einem runden, offenen Gesicht und leicht basedowschen Augen, in denen eine Ehrlichkeit liegt, die mich alle Vorsicht vergessen lässt. Wir fallen uns spontan in die Arme. Sie ist keine Erbschleicherin. Sie führt mich in eine kleine, akkurat aufgeräumte Wohnung und wir sprechen über den Verstorbenen. Ja, bis vor drei Jahren war sie seine feste Freundin. Sie hatte sich in ihn verliebt, aber als alle Therapieversuche scheiterten und er immer weiter in den Suff abglitt, hatte auch sie das Handtuch geworfen. Doch sie waren Freunde geblieben.
Seine Wohnung hatte sie in den letzten Jahren nicht mehr betreten. Sie konnte den Dreck nicht mehr aushalten, er musste zuletzt immer bei ihr antraben. Manchmal musste er sogar, bevor er ihre Wohnung betreten durfte, wie ein Kind die Hände ausstrecken. Sie prüfte dann, ob er seine Hände wenigstens auch ordentlich gewaschen hatte. Das musste ihm gefallen haben. Eine Rückführung in unsere glücklichere Kinderzeit. Wir sprechen lange über den Toten, während wir auf die anderen warten: seine Ex-Freundin Heidi mit ihrem Sohn und eine Sylvia, wohl die Herzensfreundin, in deren Haus auf Mallorca Peter öfter Urlaub gemacht hat. Sie erscheint mit ihrer Tochter.
Wir setzen uns zu einem Kaffee in die Küche. Drei seiner Witwen, die sich zu meinen Richterinnen aufspielen werden. Die ihn selbst nicht ertragen haben, nur wenige Jahre jeweils. Witwe Heidi kommt mit ihrem Sohn Björn und der Freundin.
Ich kenne Heidi und Björn. Beide hatte ich schon mal aus unserer Wohnung in Berlin hinauskomplimentiert. Peter mutete mir zu, diese seine damals neueste Freundin bei mir zu parken, um selbst in Ruhe zu verschwinden. Die Aussicht, eine Woche zwei völlig fremde Personen beherbergen zu müssen, brachte mich damals ziemlich auf die Palme. Schon nach zwei Tagen sah ich Rot. Die Dame war nicht in der Lage, auch nur eine Tasse wegzuräumen. Da platzte mir der Kragen.
Heidi sieht ungefähr so aus, wie ich sie in Erinnerung habe, nur etwas älter und moppeliger; sie ist ziemlich klein. Da wirkt man schnell so. Wieder sprechen wir über den Toten, auch das mit der Erbschaft kommt schnell auf den Tisch.
Heidi ist im Besitz eines Testaments, ihr Sohn Björn ist dort als Haupterbe eingetragen. Brigitte ist im Besitz eines neueren Testaments, mit dem das vorige ungültig wird. Sie will es aber nicht präsentieren, weil zu viele Schulden auf der Erbschaft ruhen. Sie erbt ja die Schulden mit. Die müssen zuerst beglichen werden. Das Geld hat sie nicht.
Meine Schwester Jutta und ich sind die gesetzlichen Erben. Peter hat dafür gesorgt, das der Streit weitergeht .Björn macht zum ersten Mal den Mund auf zum Thema: Er will das Geld nicht, ihm ist das ganze Hick-Hack zuwider. Er will es spenden. Sofort bin ich für ihn eingenommen. Der Junge ist vernünftig. So ähnlich habe ich mich vorhin auch geäußert, als Brigitte und ich noch allein waren. Keiner will das Erbe. Sylvia meint, es sei doch eigentlich schade, der Fiskus würde alles bekommen.
Wir sind um sechzehn Uhr mit Peters Rechtspfleger verabredet. Dort werden wir weiter sehen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, die Erbschaft anzutreten, ohne sofort die Schulden begleichen zu müssen, sondern erst beim Verkauf der Grundstücke. Ich erzähle, dass ich mir von den vier Grundstücken eins ausgeguckt hatte. Das Grundstück, auf dem Opa seinerzeit bauen wollte. Das hätte ich gern im Tausch zu den anderen gehabt. Zwei Häuser weiter steht mein Geburtshaus. Ein sentimentaler Grund mehr, mir wenigstens einen Garten auf einem Teilstück zu errichten. Ich hatte in den letzten Jahren oft davon geträumt. Nun wird es wohl ein Traum bleiben.
Vielleicht weiß mein Rechtsanwalt ja Rat; ich werde ihn in Berlin kontaktieren.
Später, bei Peters Rechtspfleger, besprechen wir die Wohnungsauflösung, die Kündigung und andere Dinge. Die beiden Damen wollen sich opfern und Ordnung schaffen. Die verwertbaren Teile können sie behalten oder verkaufen. Nicht mal ein Andenken möchte ich, weder Mutters Silberbesteck, geschweige denn die Silberleuchter vom Stiefvater. Nulla!
Natürlich kommt noch die ganze Erberei zur Sprache. Zwei Testamente und zwei gesetzliche Erben, die außer einer vagen Hoffnung einen Haufen Schulden zu erwarten haben.
Die Stadt Wesel, die dem Stiefvater damals einen Lastenausgleich zahlte, hat sich auf einem der Grund stücke eintragen lassen.
Die Stadt Dortmund hat Rechte an einem anderen, um die Sozialhilfe für den mittellosen Künstler zurückzufordern.
Dazu kommen noch fünfzehntausend DM für Telefonate mit den berüchtigten 0190er Nummern. Wie hat er das nur geschafft? Mir hätte die Telekom längst den Saft abgeklemmt, wortwörtlich.
Um vier Liegenschaften dreht es sich. Drei davon sind noch da. Das ehemalige Elternhaus, den Getreidehandel mit Hof, Speichern und Ställen hat er klammheimlich doch veräußert, der Fiskus ist begeistert. Übrig bleiben Großvaters Grundstück, mit kleinem Bauernhof und den Garagen, auf welchem sich außer einer großen Freifläche auch noch Gärten der zerstrittenen Großeltern befanden. Circa zwölftausend Quadratmeter reines Bauland.
Dann kommt noch ein winziges, nur ein paar hundert Quadratmeter, das gar nicht mehr genau auszumachen war. Ich weiß, wo es sich versteckt. Popigs Privatbunker war darauf angelegt, ich habe selbst oft genug darin gesessen.
Danach ist noch das Land, welches mit dem Geld meines leiblichen Vaters erworben wurde, im Angebot. Gut zwanzigtausend Quadratmeter. Eine LPG mit Gewächshäusern wurde nach unserer Flucht dort installiert. Mittlerweile ist von der LPG kaum noch etwas zu sehen. Diebe haben die Stahlkonstruktionen säuberlich abmontiert, da der Bruder es versäumt hat, einen Zaun um das Gewerbegebiet zu ziehen.
Der Anwalt, der Peters Rechtspflegschaft übernommen
hat, empfiehlt dringend, die Erbschaft abzulehnen:
»Sie handeln sich lediglich einen Haufen Ärger ein«, sagt er.
Peters letzte Freundin nickt bestätigend:
»Wie oft waren wir in Coswig, kein Interessent hatte sich gezeigt.« Sie wird ihr Testament nicht vorlegen, keinesfalls.
Bleibt nur noch die Dame mit ihrem Sohn, deren An sprüche nun wieder gültig sind. Sie muss sich das noch überlegen. Ich auch, obwohl ich ebenfalls der Meinung des Anwalts zuneige.
Das schöne große Grundstück, das von Anfang an mir gehören sollte, da es vom Geld meines gefallenen Vaters gekauft worden war! So viel Quadratmeter und nicht mal ein Plätzchen für ein Wochenendgärtchen! Denn von Berlin aus, wo ich wohne, ist unsere Geburtsstadt leicht zu erreichen.
Unrecht Gut tut selten gut, schießt mir wider Willen durch den Kopf. Ich wäre anders mit dem Ererbten umgegangen. Deshalb brauche ich auch noch ein wenig Bedenkzeit. Außerdem ist da auch noch die Schwester, die ein Wörtlein mitzureden hat. Sie will mit Peters Ableben nichts zu tun haben, zu tief sitzt der Hass auf den Bruder. Aber erben will sie schon. So hat sie mir großzügig die Formalitäten überlassen. Anschließend trennen wir uns.
Ich übernachte bei meiner Stiefmutter männlicherseits. Da ich nicht schlafen kann, baue ich mir um Mitternacht ein Pfeifchen mit Zauberkraut und kriege prompt einen Weinkrampf. Zum ersten Mal in meinem Leben weine ich über den kleinen Jungen, der ich war, der bei der fremden Familie alles, aber auch alles, immer besonders gut machen wollte und so gescheitert ist.
Ich heule auf. In den letzten Tagen war ich zum ersten Mal wieder fast glücklich gewesen, im Zug zurück nach Düsseldorf war das verschwunden. Ich hatte neugierig den mitgeschleppten Ordner durchblättert. Als erstes sprang mir das Anschreiben eines Rechtsanwalts aus Wesel ins Auge, eines Schulfreundes von Peter, der übrigens auch einst mein Schulfreund war.
Die Ansprüche von Jutta und mir seien seiner Ansicht nach völlig gerechtfertigt, der Rest des Schreibens be stand aus dezenten Hinweisen, wie Peter die Klagefrist, die wir vielleicht nicht einhalten würden, für sich nutzen könnte.
Der Bruder hat uns betrogen und er hatte auch schon seine Mutter betrogen. Der Hass ist wieder da. In meiner ersten Wut denke ich sogar daran, Peters Anwalt, der den Fall schließlich am besten kennt und dessen Forderungen ja auch noch bestehen, umzudrehen, ihn für Jutta und mich einzusetzen und das ganze Erbe anzufordern.
Wieder schluchze ich und ziehe trotzig den Rotz durch die Nase hoch. Mit diesem Hass lässt sich schlecht leben. Wenigstens als Genugtuung will ich was für all die Demütigungen, die mir zugefügt wurden. Vom Stiefvater und seinem eingeborenen Prinzregenten.
Plötzlich dröhnt eine innere Stimme laut wie ein Glockenschall. Erschrocken blicke ich auf. Die Schwiegermutter nebenan muss den Lärm ja nicht unbedingt mitkriegen.
»Lass ab«, sagt sie mit Donnerhall, »Lass ab und du wirst frei sein.«
Hallo! Gehts vielleicht noch etwas gestelzter? Bibelstunde war vorvorgestern.
Aber die Stimme bleibt und wiederholt ihr tönendes Angebot.
»Lass ab...«
»Aber eine Genugtuung will ich schon.«, wage ich es kleinlaut einzulenken.
»Gut«, sagt die innere Stimme weiter, »du hast deine dumme Genugtuung doch längst, erinnere dich. Der Vater hat zum Schluss seinem eigenen Sohn nicht einmal mehr einen Sitzplatz angeboten. Das ist deine Genugtuung, damit soll es genug sein..«
»Gut«, flüstere ich erschöpft und merke entzückt, wie der Frieden in mir wieder zurückkehrt. Es soll ein Schlussstrich gezogen werden. Ich bin frei.
Am nächsten Morgen holt mich Björn vom Bahnhof ab, ich muß noch Blumen besorgen. Rote Nelken für unseren Sozialisten, der sein Geld mit sozial und parteilich geförderter Erwachsenenbildung verdient hat, das er selbstverständlich ebenfalls am Fiskus vorbeischleusen musste. Zu den Nelken gesellen sich dann doch noch rote Rosen und weiße Levkojen. Plötzlich ist mir das zu kaltschnäuzig.
Die Erbunterlagen habe ich vorhin Björn gegeben. Ich nehme sie nicht mit nach Berlin. Ich verzichte ganz.
Auf dem Friedhof warten schon Peters Freunde. Erstaunt registriere ich, wie viele gekommen sind - er war beliebt. Ich nicht mehr - meine Freunde sind auf der Strecke geblieben. Ich haste in die Grabkapelle, wo ich mein Gebinde niederlege. Ich will einen anständigen Abschied. Er war mein Bruder.
An der Trauerfeier mit Mozarts Requiem und Peters Gedichten kann ich nicht teilnehmen. Es wäre Heuchelei. Ich warte draußen.
Anschließend gehen wir in seine Stammkneipe zu einem kleinen Umtrunk, den Brigitte organisiert hat. Die Leute sind freundlich zu mir. Für sie bin ich nicht so sehr der feindliche Bruder, sie stellen nur die Ähnlichkeit fest. Eine hängt sich bei mir ein und fragt eifrig:
»Stimmt das, eure Mutter hat geklaut?«
Es stimmt!
Manchmal hat unsere Mutter was mitgehen lassen. Kleine, nutzlose Dinge, die ihr aber diebisches Vergnügen bereiteten.
Peter hat auch geklaut. Mit Vorliebe Lebensmittel.
Ich werde lockerer. Es sind viele nette Leute – seine Freunde. Irgendwann erscheint Silvia. Sie drückt mir den Text ihrer Rede in die Hand. Ich überfliege ihn, er erscheint mir gut und passend. Nur eins macht mich stutzig! Die bittere Armut, in der Peter gestorben ist. Überdimensionierter Fernseher und sauteure Stereoanlage verraten mir, seine Armut, seine bittere, kann so bitter nicht gewesen sein. In unserer Familie gibt es Schauspieler.
Ich inszeniere mich, das weiß ich – aber der Bruder? Das La Bohème-Schlussbild drängt sich mir auf. Ja, so hat es auf mich gewirkt. Aber alles ist echt. Er ist tot. Trotzdem! Ich wäre ja auch in meiner Dekoration gestorben. Und seltsam – zwei Schwindsüchtige? Sollte er etwa auch?
Schnell schiebe ich den Gedanken beiseite und schaue wieder auf Silvias Text. Ein Gedicht von Peter ist mit eingebunden. Ich wische förmlich mit den Augen darüber, ich kann es noch nicht lesen. Doch eine Bemerkung brennt sich mir ein. Er konnte Nähe nicht lange zulassen. Wie bei mir. Diese Ähnlichkeiten! Ich war doch immer das genaue Gegenteil von ihm!
Hastig falte ich den Zettel zusammen. Hat er etwa in irgendeiner Form an seiner eigenen Legende gestrickt? Ist er als Schriftsteller etwa gut?
Unsere Schwester schreibt auch, nur ich bin aus der Art geschlagen, ich bin Grafiker.
Ich wende mich lieber wieder Silvia zu; sie hat mein Manuskript, sie wird mir gleich sagen ob sich das Weitermachen lohnt. Brigitte hat doch auch in einem Anfall von Präkognition laut und äußerst bestimmt gesagt:
»Ja, du wirst es schreiben.«
Silvia beginnt mit einer Kurzkritik, in der sie schon die Ausgangssituation bemängelt. Als ich nicht sofort verstehe, sagt sie zu mir:
»Du solltest es aufschreiben, aber nur für dich, um dir deine Situation klar zu machen. Für eine Veröffentlichung taugt es nicht.«
Diesen Spruch kenne ich. So was sagt man in der Psychiatrie gerne den einfach strukturierten Patienten. Ich bin enttäuscht. Ich bin kein Schriftsteller.
Am frühen Nachmittag ist Schluss mit dem Umtrunk. Brigitte sieht völlig fertig aus, aber sie möchte noch einen Kaffee bei sich zu Hause für uns kochen. Ich latsche mit, muss ich doch noch bis zum Abend auf meinen preiswerteren Zug warten.
Spätabends, ich bin wieder in Berlin, liege ich auf meinem alternativen Hochbett. Ein halbes Pfeifchen habe ich intus, nicht viel, ganz leichtes Gras. Ich überdenke die letzten Tage, ich bin todmüde, aber ich kann nicht schlafen. Plötzlich heule ich wieder. Aber diesmal tut es nicht weh. Als hätte man einen Stöpsel gezogen, läuft der ganze Kummer einfach ab und spült auch die Verbitterung fort.
Nach tiefem, traumlosem Schlaf erwache ich gut gelaunt und zufrieden. Neben mir liegt noch die Pfeife von gestern, es sind noch ein oder zwei Züge drin. Man will ja nichts umkommen lassen. Und plötzlich!
Mit einem lauten Geräusch, einem klickenden, fügt sich ein nächster Mosaikstein ein.
Wir waren Rivalen bis in den Tod. So hatte ich das nie gesehen. Wir hatten uns, auch räumlich weit voneinander entfernt.
Wir waren trotzdem aneinandergefesselt, bis einem von uns die Luft ausging. Darum habe ich so großmütig Hilfe angeboten, als er am Telefon aufgab. Darum hatte der nachfolgende Brief, dieses Pamphlet, mich so tief getroffen. Wir waren Rivalen. Und ich habe überlebt. Der Überlebende wird die ganze Geschichte aufschreiben.
Ich sehe: Unser beider Leben war eine Fingerübung fürs Schreiben. Plötzlich hat alles seinen Sinn. Alles rückt an die richtige Stelle.
Der kleine Junge, dem ich jeden Abend ein Märchen erzählen musste. Die Zeit, die wir Brüder uns damit vertrieben, Dramen für unser Kasperle-Theater zu verfassen. Die vielen Anekdoten, die zu kleinen Spielszenen aufgebläht, unsere Freunde entzückten.
Die Psychiatrie, wo ich mir einen Teil meines Rüstzeugs holte, mit frei erfundenen Geschichten über mich selbst spielte, aber auch echte Antworten suchte. Plötzlich bekommt das alles einen Sinn.
Ich bin ein Erzähler - ich wusste es nur nicht.
Diese Geschichte muss niedergeschrieben werden. Überglücklich seufze ich auf. Aber schon setzt die Stimme der Vernunft ein.
»Jetzt bist du total von der Rolle«, sagt sie.
Egal.
»Und warum kommen dir die Formulierungen so seltsam bekannt vor? Du hast geklaut, aus anderen Texten!«
Egal! Sie passen zu meiner Geschichte. Ich bin kein Literat - ich will einen Bericht abliefern.
STATT EINES NACHWORTS
Hier sitze ich nun, zwei Jahre nach der ersten Fassung, die staunenswerte 1.200 Seiten umfasst, um die lesenswerten Teile herauszulösen. Zwei Jahre dauerte die Niederschrift, zwei Jahre kursierten die zehn Exemplare, die auf dem Heimcomputer erstellt worden waren, im Bekanntenkreis. Das wird jetzt ein ganz anderes Buch, denn die Urteile der Leser waren alle ähnlich.
Zu lang, zu überfrachtet mit guten Ratschlägen. Zu viel laienhafte Psychologie. Besonders im Mittelteil, nachdem ich tatsächlich meine Psychomacke herausbekommen hatte. Da hab ich mich wirklich schier endlos ausgebreitet. Als Eigentherapie mochte das wohl seinen Sinn gemacht haben, aber welchen Leser interessiert schon der ganze Quark.
Dazwischen aber war man amüsiert. Besonders wenn ich mich nur auf den reinen Handlungsstrang konzentrierte.
Und doch. Zum ersten Mal im Leben habe ich etwas zu Ende gebracht. Fünfzig Jahre war ich mir selbst ein Rätsel. Fünfzig Jahre verlief mein Leben nach zwei Grundmustern: Entweder ich preschte los und irgendein Baum fiel mir in den Weg. Oder ich überwand alle Schwierigkeiten und hörte doch kurz vor dem Ziel auf. Weil da noch etwas war.
Etwas, das mich wie ein unlösbares Gummiband auf den Nestrand zurück katapultierte. Und je mehr ich mich abstrampelte, je näher ich bei meinen Flugversuchen dem ersehnten Ziel kam, desto heftiger zog es in die Gegenrichtung. Etwas wollte vorher gelöst werden.
Als Schwuler bin ich eine Laune der Natur, eine verspielte Arabeske. Ich bin ein Ornament und meine Kunst ist das Ornament. Ich habe mich stets gewundert, warum ausgerechnet Ornamente solche Faszination auf mich ausüben. Besonders jene der klassizistischen Epoche. Warum ich Möbelbeschläge sammle und sich zu Hause die Vorlagen türmen. Jetzt weiß ich.
Ich weiß, warum ich unverdrossen Empire-Kränze und Palmetten auf die Biedermeier-Möbel nagele. Warum auf den Wänden zu Hause, auf den grafischen Arbeiten im Beruf, immer wieder Ornamente auftauchten. Schon beim ersten Entwurf, den ich als Lehrling des grafischen Gewerbes vorlegte, räkelten sie sich im Hintergrund.
Endlich weiß ich einigermaßen darüber Bescheid, und seltsamerweise wurde ein Ornament zum Schlüssel zu dem Verschütteten.
Gelegentlich glich mein Leben Wagners Opern in der Fassung für Salonorchester und Blockflöte. Besonders dann, wenn die Simulation des Fortpflanzungsvorgangs und seine Folgen mein ganzes Denken beherrschte.
Ich habe überlebt, weil ich stark und tapfer bin. Andere umschreiben das eher als zähes Luder, was zwar nicht ganz so charmant klingt, aber in etwa die gleiche Aussage beinhaltet.
MADE IN COSWIG
Coswig hieß das Nest. An der Elbe gelegen zwischen Dessau und Wittenberg. Eine Fähre führte auf die andere Elbseite in das Gartenreich von Wörlitz. Herr Görlitz aus Wörlitz, witzelten Freunde später, auch wenn das nur bedingt stimmte.
Vor dem Fenster war noch oft das stolpernde kalloppa di kalloppa eines müden Pferdes auf dem Kopfsteinpflaster zu hören, kaum gedämpft durch das Laub der Linden beidseitig der Straße.
Schon seltener war das Geräusch eines Autos zu vernehmen und gelegentlich schnaufte ein Lastwagen mit Holzvergaser asthmatisch über die Luisenstraße.
Wir wohnten in der Nähe des Bahnhofs und ein Stückchen hinter den Bahnschranken stand noch ein anderes Haus, das in meinem frühkindlichen Leben eine wichtige Rolle spielte. Mein Geburtshaus.
Eine Turmvilla, in der die Restfamilie des Nazi-Offiziers, dessen Lenden ich entsprossen war, in zwei Zimmerchen hauste. Nach dem Krieg war Wohnraum knapp geworden und Großmutter Görlitz hatte mit ihrer Schwester Hedwig ohnehin nicht mehr den Platzbedarf, den sie für ihre fünf Söhne beansprucht hatte.
Es gab keine Söhne mehr.
Mein Vater fiel 1943, meinem Geburtsjahr, an der Ostfront. Er starb in Russland, irgendwo in der Nähe seines eigenen Geburtsortes.
Die Familie war nach der Oktober-Revolution aus dem
Land komplementiert worden, da sie zur besitzenden Klasse gehörten. Ohnehin waren sie Deutsche, die zum Bau der russischen Eisenbahn mit ihrer Ingenieurskunst beigetragen hatten - und die Eisenbahn war fertig.
So hatte es Großvater Görlitz wieder in die Heimat gezogen, wo er es ebenfalls zu gewissem Wohlstand brachte. Seinen Söhnen muss Adolfs Idee mit dem neuen Lebensraum im Osten außerordentlich gut gefallen haben, denn sie waren begeisterte Anhänger des Führers geworden.
Mutter erzählte oft, wie mein Vater von einem Rittergut im Osten faselte, wo er des Morgens nach erfrischendem Ritt durch die Felder die Herrschaft über seine zweihundert Seelen ausübte. Oh - wie gut kann ich das verstehen!
Vater und einer seiner Brüder betrieben in Leipzig einen Verlag, in welchem sie hauptsächlich Schulbücher produzierten.
Vater war überwiegend mit der künstlerischen Seite der Produktion betraut und fertigte die nötigen Schulbuch-Illustrationen gleich selbst. Mutter glaubte noch Jahrzehntelang, dass ihr lieber Mann Buch für Buch mit Originalzeichnungen verschönerte. Von Gutenberg und Drucktechnik hatte sie wenig gehört. Eigentlich wusste sie auch über die ganze Familie ihres Mannes herzlich wenig, aber das Wenige wurde endlos wiederholt, bis es mir zu den Ohren heraushing.
Da war zuvörderst erst einmal Vaters makellose, griechische Nase, deren Fehlen sie bei mir so oft beklagte, denn ich hatte leider nur ihr Riechorgan geerbt. Ferner die ulkigen Marotten mit denen er ihr Herz erobert hatte und seine künstlerische Empfindungsfähigkeit. Die Eleganz, mit der er seine maßgeschneiderten Anzüge trug, die ebenmäßigen Zähne und sein Charme.
Zu seinen Marotten gehörten Schlafanzüge mit Bügelfalten. Wie oft hatte Mutter das erzählt, und von dem Wunder, dass er allmorgendlich völlig unzerknittert dem Bette wieder entstieg.
Überhaupt muss er immer wie aus dem Ei gepellt gewirkt haben, und Mutter rätselte lange, warum sein Gesicht immer so frisch strahlte, wenn er zu einem Rendezvous mit ihr erschien. Er hatte sich jedes mal ein Viertelstündchen vor die Höhensonne gesetzt. Seine strahlende Erscheinung lockte nicht nur die Damen, sondern auch jene des verfemten sogenannten „Dritten Geschlechts“ in großer Zahl an. Er zog sie an wie Licht die Motten, und Mutter berichtete oft erschüttert, mit welcher Vehemenz er die Avancen der Unglücklichen ablehnte. In dem ansonsten so zärtlichen, hoch musikalischen Manne, der so gerne im Gewandhaus Wagners Klängen unter Furtwänglers Taktstock lauschte, loderte ein wahrer Hass auf dieses artfremde, undeutsche Treiben und oft musste er sich mit bloßen Fäusten Respekt verschaffen.
Er hatte einen besonderen Blick für jene Unseligen und oft wies er Mutter auf den Einen oder Anderen hin, der ihn einen Moment zu lange angestarrt hatte.
»Mike!«, erzählte Mutter gern: »Ich hab da nie was gesähn, wirklich. Ich hab da nie was bemärkt, bis er mich anstieß und losgrollte. Dein Vater war eben sehr sensibel.«
Die Brüder wohnten noch im Elternhaus, doch mein Vater besaß in Leipzig ein sogenanntes Pied à terre in Form eines möblierten Zimmers. Dort in Leipzig lernten sich Mutter und Vater kennen und dort wurde ich vermutlich auch gezeugt.
Sieben Jahre hatte es gedauert, bis der Mann aus der Turmvilla endlich nach der Ehe fragte und er fragte erst, als ich schon unterwegs war. Es war für Mutter schwierig gewesen, war sie doch mit dem Beruf einer Putzmacherin weit unter Stande für diese eher großbürgerliche Familie.
Ärger hatte es im Vorfeld der Hochzeit allerdings reichlich gegeben, denn sie schleppte ein schweres Handikap in Form einer unehelichen Tochter mit sich herum: Meine Schwester Jutta.
Oft hatte Mutter mir versichert, dass sie vorher von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. Was ich gerne glaubte, denn sie wirkte ein Leben lang so. Nach einer durchzechten Nacht war sie im Bett ihres Galans erwacht, entjungfert und gleich schwanger. Trotz der ruchlosen Tat waren die Absichten des Besagten ehrenhaft. Er wollte sie unbedingt ehelichen. Leider hatte Mutter danach eine solche Abneigung gegen die körperliche Vereinigung erfasst, dass sie jedes mal durch das Toilettenfenster flüchtete, sobald sie des Hochverliebten durch die Schaufensterscheibe des Hutsalons ansichtig wurde.
Sex wurde so ein Leben lang zu etwas unerhört Schmutzigem, Verbotenem bei ihr.
Vermutlich lag sie da bei dem Mann mit den Bügelfalten im Schlafanzug ganz richtig. Willi hieß ihr Traum und der ließ verdammt lange auf sich warten, zumal er auch noch bei seinem Bruder unter dem Pantoffel stand, der diese Mesalliance höchlichst verurteilte. Dieser verbot dem jüngeren Bruder schlichtweg den Umgang mit der Gestrauchelten und jedesmal, wenn er für einige Tage seinen Besuch in Leipzig ankündigte, beendete Vater folgsam das Verhältnis mit der Geliebten, bevor der Gestrenge erschien.
Mutter, der eine gewisse Raffinesse, trotz der katastrophalen Unwissenheit, nicht abzusprechen war, handelte jedesmal ähnlich. Da sie hübsch und charmant war, mangelte es ihr nie an Verehrern. Sie nahm das Urteil gelassen entgegen und erschien am Abend am Arm eines anderen Galans in den Bars und Cafés, von denen sie annahm, dass die beiden jungen Lebemänner sie aufsuchen würden. Es gelang ihr wohl meistens und sie konnte ein wenig Komödie spielen, bis Willichen vor Eifersucht schier verging und eine Szene machte.
Talentiert war sie ja und ihre Hutkreationen gefragt. Wie gesagt: Sieben abwechslungsreiche Jahre trieb das junge Paar sein Spiel auf diese Weise, bis es Mutter endlich gelang, in den heiligen Stand der Ehe zu treten. Vermutlich war die Schwangerschaft das letzte Druckmittel gewesen, um den Unwilligen zur Hochzeit zu bewegen. Der Krieg näherte sich bereits seinem tragischen Ende und es gab keine Parfümpäckchen aus Paris mehr, wo Vater vorher stationiert war. Wie erleichtert muss sie gewesen sein, als endlich das Telegramm mit folgendem Inhalt von der Front kam:
»Komme auf Heiratsurlaub, mach die Papiere fertig.«
Endlich konnte sie in die Turmvilla einziehen. Besonders weit hatte sie es ja nicht mehr. Das Schicksal hatte sie bereits nach Coswig geführt. Nach dem großen Bombardement Leipzigs hatte man Frauen und Kinder im Umland untergebracht, und Mutter war, wie das Leben so spielt, ausgerechnet in Coswig gelandet. Auch hatte man für Abwechslung im eintönigen Berufsalltag gesorgt. Als Zwangsverpflichtete wurde ihre Kreativität in der Coswiger Munitionsfabrik dringend benötigt.
Von den Einwohnern misstrauisch beäugt und ob ihrer auffallenden Erscheinung abgelehnt, hatte sie sich einen der begehrtesten Junggesellen der Stadt geangelt. Ich fürchte, ihr Erfolg bei Schwiegermutter und Schwägerin hielt sich in Grenzen. Besonders nach dem Tod des geliebten Mannes, dem das Glück der Vaterschaft nur für zwei Monate zuteil wurde, kam es zu Spannungen.
Mutter zog bald, nach kurzem Gastspiel im Hause Görlitz, mit zwei Kindern wieder aus.
Die Turmvilla war zum Trauerhaus geworden. Vater war tot, sein Bruder, der Verleger, ebenfalls. Der reiche Onkel in der Röhm-Uniform, der mit der schicken Villa, weilte auch nicht mehr unter den Lebenden: Er verunglückte mit seinem Mercedes auf dem Rückweg von Berlin nach Leipzig tödlich, und die Gerüchte, dass sein Tod nicht ganz zufällig erfolgte, wollten nicht verstummen. Zumal die Familie in seinem Nachlass äußerst kompromittierende Briefe von und an einen jungen Mann gefunden hatte.
Was seine Alibi-Dauerverlobte Lina Carstens betrifft, ist sie mir nur aus dem Kino bekannt, wo sie erfolgreich Pater Brown als Haushälterin von einer Strafversetzung zur nächsten stoisch hinterher trottete. Oder als Lina Braake mit der Bank ein Hühnchen zu rupfen hatte. Mein Lebtag habe ich mich nicht gewagt, an diese Tante in spe heranzutreten, doch im Film war sie mir immer äußerst sympathisch erschienen. Damals war sie noch jung und hübsch und hatte im Rollenfach Salonschlange bei der Ufa geglänzt.
Das ist eigentlich schon alles, was ich über die Familie meines Vaters weiß. An Großmutter Görlitz erinnere ich mich nur noch dunkel.
Ich erinnere mich an eine strenge, verfinsterte Frau, in deren Zimmer ganze Heerscharen von Bronze-Kriegern und Göttern über sämtliche Schränke und Stellflächen marschierten und mir war immer seltsam beklommen in ihrer Nähe. Einzig ein fischendes Bronzeknäblein fand mein Gefallen, da der Fisch, der an seiner Angel hing, allerliebste bewegliche Schuppen besaß, mit denen der Schwanz zappeln konnte.
Ich ging gar nicht gern zu ihr. Schon lieber war mir da Tante Hedwig mit ihrem Kraushaar, das immer ein wenig an eine aufgesprungene Rosshaar-Matratze erinnerte. Aber auch sie gehörte nicht gerade zu meinen Lieblingen. Wie sagte Jutta?:
»In dieser Familie waren nur die Männer schön.«
Am liebsten von der Görlitz-Familie besuchte ich aber doch meine Tante Mieke, die ein kleines Häuschen in einer anderen Straße besaß und Mutter zweier Kinder war. Die Kinder waren schon außer Haus und Cousin Achim bereitete sich auf seinen Beruf als Förster vor. Obwohl es in dem Häuschen immer muffig roch, eroberte sie doch mein Herz mit kleinen Geschenken. Bei fast jedem Besuch erhielt ich ein Tier aus Achims Spielzeugfundus, bis ich einen ganzen Zoo und einen Bauernhof mein eigen nannte.
Ich machte meine Besuche stets allein, da der Kontakt zwischen Mutter und der Görlitz-Familie vollends abgebrochen war. Der Grund des Zerwürfnisses war ein anderer begehrter Junggeselle, dessen Gunst sie erlangt hatte.
Auf diesen hatte eigentlich Tante Hedwig wohl mehr als nur ein Auge geworfen, sondern vermutlich auch noch ihre Pferdekrause, bevor Mutter sie aus dem Rennen drängte. Zumal Hedwig auch noch die Stellung einer Prokuristin in der Firma des Begehrten innehatte.
Allerdings hatte der potentielle Heiratskandidat, Hans Popig, noch nicht die Leitung der Firma übernommen, er arbeitete noch brav bei seinem Vater Reinhard als Angestellter.
Die Aussicht auf eine Schwiegertochter mit Afrolook hatte wiederum der Mutter von Hans nicht sonderlich gefallen. Sie wünschte sich Gesellschaft, denn im Hause hatte sie eigentlich nur die Dienstboten zum Gespräch. Das Ehepaar Popig redete nicht mehr miteinander. Sieben Jahre hatten sie nur noch über die Dienstboten Kontakt miteinander gehalten. Bei Tisch zum Beispiel wurde das aufwartende Mädchen informiert:
»Sag der mal, ich brauch die Butter!«
Falls Sie dieses Verhalten merkwürdig finden, kann ich nur gutgelaunt antworten: Ich auch.
Sieben lange Jahre hatten sie es so miteinander getrieben, bis Opa Popigs völlige Ertaubung das Problem von selbst löste. Mit dem Sohn sprachen allerdings noch beide Elternteile, doch der hatte offensichtlich noch nicht allzu viel zu vermelden.
Also - Großmutter Popig hatte eine Zuneigung zu der attraktiven, munteren Witwe mit den hübschen Kindern gefasst und beschlossen, ebendiese als Schwiegertochter zu installieren.
So wurden die Einladungen ins Haus Popig immer häufiger, und Sohn Hans verliebte sich dann auch folgsam in die Frau seines ehemaligen Todfeindes. Ich glaube, er hat sie wirklich geliebt, anders kann ich mir die lange Ehe mit der Widerspenstigen sonst nicht erklären.
Mutter war mittlerweile nicht mehr ganz unvermögend, aus Vaters Erbteil war ihr eine stattliche Summe zugeflossen, die für Juttas und meine Erziehung aufgewendet werden sollte.
So kam es, dass nach der angemessenen Trauerzeit von einem Jahr, Mutter noch vor Kriegsende ihrem Hans das Jawort gab. Selbstverständlich wurde Wohnung im Hause der Popigs genommen.
Als Baby hatte ich von dem ganzen Hin und Her nichts mitbekommen, aber meine Schwester Jutta war damals schon zehn Jahre alt und konnte vor einiger Zeit diese Wissenslücke schließen.
Meine eigenen Erinnerungen beginnen als Sohn von Hans, und für die meisten Coswiger war ich anscheinend der Große von Popigs leiblichen Söhnen. Ich hieß so, selbst meinen schönen Vornamen Karl hatte man mir unterschlagen - ich wurde mit dem Zweitnamen Michael gerufen. Oder meistens Mimi, als Kosenamen für das Kleinkind, das zum Sonnenschein für die alten, sprachlosen Großeltern wurde.
Ich war offiziell der Sohn des Kaufmanns Hans Popig, und als solcher fühlte ich mich tatsächlich. Der eigene Vater war eine ferne Geschichte, die ich vom Hörensagen kannte, und die wenigen, die mein Schicksal als Waise bedauerten, sah ich stets völlig fassungslos an. Ich besaß einen Vater und eine komplette Familie. Sogar noch ein wenig mehr. Verwandtschaft, die meine Geschwister nicht hatten. Und Geschenke, um die mich der jüngere Bruder beneidete, und die er nur allzu gern zerbrach.
Über die alten Popigs, deren Stolz ich alsbald wurde, wären vielleicht noch ein paar Worte zu sagen.
Reinhard und seine Frau waren ebenfalls deutsche Immigranten. Sie kamen aus Texas. Dort selbst hatten sie eine große Erdnussfarm nebst Wäscherei erfolgreich betrieben, bis ein Ohrenleiden, für das sich nur in Deutschland ein Spezialist fand, das Paar auf den alten Kontinent zurückführte. Pikanterweise wurde nach dem Verkauf Öl auf dem Farmgelände bei St. Antonio gefunden, was dem alten Geizkragen das restliche Leben wohl gründlich vergällt hat.
Doch immerhin hatte er für sein Anwesen gute Gold-Dollars erhalten und in Deutschland tobte gerade die Inflation nach dem ersten Weltkrieg. Für Gold-Dollars war alles zu bekommen und so gönnte er sich in Wittenberg, unweit von Coswig, das Schützenhaus der Stadt, um es fortan als Kneipe und Restaurant mit Frau und Sohn zu betreiben. Sogar für einen Spitznamen hatte das amerikanische Geld gesorgt. Wenn sich Großmutter in ihrer Kutsche zeigte, hieß es allgemein:
»Da kommt unsere Dollarprinzessin.« In kleineren Städten kennt man sich eben.
Großmutter Popig besaß Verwandtschaft in der Nähe, deshalb wohl war die Wahl auf die Lutherstadt gefallen. Beider Sohn Hans muss elf Jahre alt gewesen sein, als sie Amerika verließen, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Am Wittenberger Gymnasium verbrachte er den Rest seiner Schulzeit.
In seinen amerikanischen Blondie-Comicalben blätterte ich später gern, auch wenn ich die Texte nicht verstand. Ei, was wären die wohl heute wert?
Schon seltener durfte ich mit seiner Münzsammlung spielen. Am faszinierendsten fand ich allerdings die elektrische Eisenbahn, die er aus den Staaten mitgebracht hatte. Die Dächer der ziemlich großen Blechwaggons ließen sich abheben. Innen waren die Personenwagen mit allerliebsten Bänken nebst Zubehör ausgestattet. Leider sauste die Elektrolok so schnell um die Kurven, dass der ganze Zug ständig entgleiste. Deshalb hatte man sie auf den Dachboden verbannt, wo ich sie nur selten in die Hand bekam.
Doch zurück zu den alten Popigs und deren Zuneigung füreinander.
Als Oma Popig nach einer, selbstverständlich allein verbrachten, Urlaubsreise zurückkehrte, fand sie Ehemann und Sohn nicht mehr- das Anwesen war verkauft. Der Gute hatte in Coswig, einem Ort in der Nähe Wittenbergs, einen Getreide-, Futtermittel- und Kohlenhandel erworben und war bereits mit Sohnemann und Maus umgezogen. Er hatte vergessen, seiner lieben Frau Mitteilung zu machen. So weit ging die gegenseitige Sprachlosigkeit.
Oft sah ich meinen Großvater des Abends im Kassenraum mit der großen Glasscheibe sitzen. Glatzköpfig, mit gichtig gekrümmten Fingern, zählte er die Tageseinnahmen und warf den Vorbeigehenden scheele und bedrohliche Blicke zu. Wie der alte Scrooge aus Dickens Weihnachtserzählung.
Einzig ich hatte keine Angst vor ihm. Alle Anderen der Hausgemeinschaft lebten in gewisser Furcht vor ihm. Ich liebte ihn geradezu und hatte seltsamerweise Narrenfreiheit bei dem Tyrannen. Schon als Kleinkind kletterte ich mit Vorliebe auf seiner Glatze herum und schrie ihm mit Begeisterung meine Mitteilungen ins Ohr. Voller Stolz holte ich ihn Sonntags aus der Kneipe ab, wo er in sein Schachspiel vertieft saß. Bevor wir gingen, prosteten wir uns noch feierlich mit unseren Schnapsgläsern zu, deren eines mit saccharinsüßer, roter Limonade gefüllt war.
Auch durfte ich mir in seinem Garten, der unmittelbar an Omas Garten grenzte, nach Herzenslust ungestraft den Bauch vollschlagen. Sogar ihre Gärten hatten sie getrennt, zwar ohne Zaun, doch mit jeweils einer Laube versehen, in der jeder für sich allein saß.
Andere hatten nicht so viel Glück wie ich. Jutta erzählte jüngst, wie sie einmal kurz davor stand, gelyncht zu werden, nachdem sie in der irrigen Annahme, dem Alten zu helfen, einen ganzen Baum völlig unreifer Birnen abgeerntet hatte. Das arme Stadtkind, das sich mit solchen unreifen Früchtchen nicht auskannte.
Es steht zu befürchten, dass meiner Schwester Jutta ohnehin nicht solch ein Erfolg im Hause Popig beschieden wurde, wie er mir zugefallen war. Das gemeinsame Zusammenleben mit ihr in Coswig ist völlig in den Tiefen meines Unterbewusstsein verschollen. Meine Erinnerung setzt erst ein, als Jutta bereits in Leipzig bei der anderen Großmutter logierte, die unserer Mutter das Leben geschenkt hatte. Meine Schwester kenne ich nur als Besuch. Ich galt als ihr Liebling und sie war mein Augenstern. Ich liebte sie fast wie die eigene Mutter. Es waren meine Festtage, wenn sie erschien. Selbstverständlich brachte sie ihren jüngeren Brüdern stets etwas mit, was unsere Zuneigung noch mächtig verstärkte.
Jutta war nach Leipzig gegangen, um am dortigen Opernhaus Ballerina zu werden, sie galt als begabt. Unsere Mutter hatte die Berufswahl der Tochter mehr als missbilligt, doch die Großmutter hatte das Berufsverbot hintertrieben und ihr Enkelkind heimlich beim Ballett angemeldet.
In meiner Erinnerung klaffte hier jahrelang ein merkwürdiges Loch. Wenn Mutter von ihren Nächten im Bunker erzählte, in denen sie mit dem vor Furcht mäuschenstillen Baby Schutz vor den Vergewaltigungen durch die russische Siegermacht suchte, kam Jutta praktisch nicht vor. So sah ich mich stets allein mit der Mutter, die Ärmchen ängstlich um ihren Hals geklammert, während Jutta ausgeblendet blieb. Ich vergaß diese erste gemeinsame Zeit vollkommen, wie ich so viel aus der Coswiger Zeit vergaß. Für mich war mein großes Vorbild Jutta immer in Leipzig und studierte Tanz.
Ein Studium war für Vater Popig nicht vorgesehen. Er trat folgsam seine Stellung als Nachfolger in der Firma des Vaters an, der sein Glück mit Materiallieferungen zum Bau der Autobahn bei Dessau gemacht hatte. Waren auch der Adel und das Großbürgertum längst enteignet, so klammerte sich der unbelehrbare Mittelstand zäh an seinen Besitz. Längst war noch nicht alles verstaatlicht und es gab noch unzählige Selbständige, denen allerdings zunehmend der Handlungsspielraum entzogen wurde.
Die Ärzte und Apotheker, die gezwungen waren, Medikamente und Ersatzteile für ihre Apparaturen aus dem Westen zu schmuggeln. Die kleineren Fabrikanten, denen abstruse Sollerfüllungsvorgaben gemacht wurden, die sie ohne Material und geflickte Maschinen kaum noch bewältigen konnten. Die Bauern, die nicht das Verlangen hatten, in der Kolchose fremdbestimmt, auf ihrem ehemaligen Land zu wirtschaften. Die Händler, die kaum etwas zum Handeln erhielten. Die vielen Schikanen, denen der Mittelstand ausgesetzt wurde und der zu einem Exodus ohne Gleichen führte; von dem sich das Land nie richtig erholte.
Ich habe es noch im Ohr. Bei jedem Versagen einer altersschwachen Maschine wurde der Ruf „Sabotage“ laut und fieberhaft nach einem Schuldigen gesucht, bis ein Opfer gefunden war.
Wie oft hatten bedrängte Unternehmer Vater Popig ihr Herz ausgeschüttet. Klappte etwas nicht, wurde ein Plansoll nicht erfüllt, ertönte dieser amtliche Schrei und eine Untersuchungskommission suchte nach den Übeltätern. Da diese ebenfalls ein Plansoll zu erfüllen hatte, wurden die Klassenfeinde oftmals sehr schnell dingfest gemacht, und eigenartigerweise waren es meist die Unternehmer und Leiter der Privatwirtschaft, die konspirativ der jungen Republik schaden wollten.
Was von der Großindustrie übrig geblieben war, wurde zumeist von unseren Befreiern demontiert und als Reparationsleistung in stalinistische Hände überführt. Mit dem traurigen Rest durften wir leben. Es herrschte Mangel an Allem. Viele Jahre noch versuchte man mit Tauschhandel über die Runden zu kommen.
Vater Popig gelang dieses offensichtlich ziemlich gut. Kohlen, Düngemittel und Saatgut waren Güter, die zum Überleben der ländlichen Bevölkerung benötigt wurden und wir lebten nicht schlecht davon. Wir litten nicht ganz so große Not wie der Rest der Stadt, da die Bauern gern Lebensmittel gegen Saatgut tauschten. Im Frühjahr erschienen sie mit Körben voller Spargel, im Herbst mit Pilzen. Wir nahmen alles, was Hof und Garten hergaben, und Vater gab her, was er von der Planwirtschaft abzweigen konnte. Opa baute sich im Garten den dringend benötigten Tabak an, dessen Blätter, aufgefädelt in langen Girlanden, den Speicher schmückten.
Er hielt sich hinter dem Haus Karnickel, Hühner und Enten, die verdrossen in der betonierten Pfütze schwammen, die er zum Wohlergehen der delikaten Tierchen geschaffen hatte. Ich sehe ihn noch in seinem Geflügelhof sitzen, dessen Boden vom Vogelkot so widerlich glitschig war, dass ich nur selten diesen Teil des Grundstückes betrat. Er sitzt da, zwischen den Knien eine widerspenstige Gans, die sich vergeblich zu befreien sucht. Neben ihm steht ein Eimer mit Haferbrei, aus dem er mit den Händen große Knödel formt, die er der empörten und längst übersatten Gans in den Rachen schiebt. Sogar das Schlucken erleichtert er dem lieben Tier, dem der üppige Bissen buchstäblich im Halse stecken bleibt. Mit langen, massierenden Bewegungen streicht er den deutlich sichtbaren Kloß im Gänsehals nach unten, um Platz zu machen für die nächste Leckerei.
Das war noch die humanste Methode des allseits beliebten Gänsenudelns, andere Mäster nagelten die Füße gleich auf Brettchen, um den kräftezehrenden Bewegungsdrang der Tiere einzudämmen. Fett mussten sie damals sein, das Fett war wertvoll. Bei Schweinen wie bei Gänsen, denn die Bevölkerung war mager.
Ich akzeptierte die Mast achselzuckend. Tiere waren Nahrung. Und außerdem passierte den armen Gänsen sonst nichts weiter. Sie waren danach schön satt, und wer konnte das in dieser Zeit schon von sich behaupten. Ich jedenfalls war immer hungrig.
Auch ein Huhn, das orientierungslos über den Hof flog, weil sein Kopf auf dem Hackholz zurückgeblieben war, brachte mich nicht aus der Fassung. Da sah ich schon mehr den Festtagsbraten, zu dem es sich in der Röhre verwandelte, und Huhn gehörte zu meinen Leibgerichten. Es war ein eher pragmatischer Umgang mit den Nahrungsquellen, wir wohnten auf dem Land. Und mochten die Küken und Häschen auch noch so niedlich sein, waren sie groß, wurden sie gegessen.
Sogar das Schlachten von Schweinen fügte unseren Seelen keinen Schaden zu. Zwar durften mein Bruder Peter und ich nie zu Hause zusehen, wenn die Tiere abgestochen wurden. Doch ein-zweimal die Woche besuchte ich meinen Freund, den Fleischermeister, um den Werdegang des Schweines vom Tier zur Wurst genauestens zu studieren. Zumal nach vollbrachter Tat fast immer ein Würstchen dabei heraussprang. Überhaupt konnte ich Handwerkern stundenlang zusehen. Es war faszinierend zuzuschauen, wie unter ihren Händen etwas entstand.
Coswig galt als Fischer- und Töpferstädtchen. Durch die Verschmutzung des Flusses war ersterer Berufszweig ein wenig in Bedrängnis geraten, doch Töpfer gab es noch einige. Bei Onkel Gellert, einem Freund Vaters, verbrachte ich ganze Nachmittage neben der Drehscheibe in dessen Töpferei, die eigentlich schon eher eine Fabrik war. Ich konnte mich einfach nicht satt sehen an dem Wunder, das unter den Händen eines Drehers entstand. Wie die Wände eines Gefäßes nach oben strebten, höher und höher, und dabei immer dünnwandiger wurden. Geglättet durch matschigen Schlicker und ständig befeuchtete Hände. Es schien wie Zauberei. Plötzlich hatte eine Vase oder ein Krug Gestalt angenommen. Mit einem Draht vom Boden der Drehscheibe geschnitten, stand das Werk des Tonkünstlers danach auf langen Brettern, um im Schatten zu trocknen, bevor es gebrannt und glasiert das Werk verließ.
Für uns Kinder ließ der gute Onkel Gellert allerliebste Tellerchen und Krüglein drehen, doch wir achteten ihrer nicht sonderlich. Gingen sie zu Bruch, gab es bald darauf neue Geschirre, denn der Mann war kinderlieb. Mehr noch als die Puppengeschirre interessierte uns allerdings der rohe Werkstoff. Mit ihm konnte man wunderbar spielen, und wenn wir Glück hatten, wurden unsere künstlerischen Erzeugnisse mit gebrannt.
Ebenso ausdauernd konnte ich dem Glasschleifer, der im Souterrain eines Nachbarhauses seine Werkstadt betrieb, zuschauen. Die Exaktheit, mit der er Kerbe für Kerbe in dem vom Glasstaub milchigen Kühlwasser, das über den Schleifstein floss, in ein Glasobjekt fräste, bis ein wundervolles Muster entstand, nötigte größte Hochachtung ab.
Ich stand auch gern in der Backstube und beobachtete, wie der Konditor versuchte, mit den erbärmlichen Zutaten, die ihm zur Verfügung standen, üppige Torten zu kreieren. Mit Pudding, Süßstoff und schauerlichen Aromen hergestellte Cremes, die die Füllung dieser abenteuerlichen Backwerke bildeten, hatte ich allerdings so meine Probleme. Meist verzichtete ich dankbar auf die freundlich angebotenen Kostproben, ich war besseres gewohnt. Süßigkeiten waren zum Glück ohnehin nicht mein Fall. Da saß ich schon lieber in der übel beleumundeten Kutscherkneipe vor einem Becher dampfender Pferdeknochenbrühe, die dort für zwanzig Pfennige feilgeboten wurde. Die Eltern waren entsetzt gewesen, als ihnen zugetragen wurde, wo der geliebte Sohn sein Taschengeld verpulverte, doch immer wieder mal erschien der Knirps bei der Salzlecke.
Ich sah beim Schuster zu, beim Sattler und beim Schmied. Noch heute habe ich den Geruch von verbranntem Horn in der Nase, wenn ein glühend heißes Eisen unter den Pferdehuf genagelt wurde. Ich stand beim Böttcher und beim Tischler, selbst in der Molkerei studierte ich die Kunst der Käseherstellung. Ich schaute zu und lernte dabei so manches.
So habe ich auch später von Mutter kochen gelernt, allein nur vom Zuschauen.
Eine weitere Lieblingsbeschäftigung in meiner frühen Kindheit bestand darin, stundenlang durch Coswig zu stromern. Coswig gehört heute zum „Biosphärenreservat Mittleres Elbtal“und ist vor allem wegen seiner Umgebung erwähnenswert. Von Dessau kommend, folgt die Hauptstraße ein kurzes Stück dem weiten Bogen des Flusses rechter Hand, bevor Häuser den Blick auf den Strom versperren. An dieser Straße liegen wie auf gefädelt alle Sehenswürdigkeiten. Das Schloss, der Marktplatz mit schönen Bürgerhäusern, Rathaus, Nicolaikirche, Klosterhof und einige Renaissance-Gebäude.
Vis à vis vom Rathaus biegt die Hauptgeschäftsstraße fast im rechten Winkel ab und durchquert das restliche Städtchen, um in unsere Luisenstraße zu münden.
Wir wohnten in der Nähe des Bahnhofs in einem bescheidenen Wohnhaus mit stattlichen Nebengebäuden zur Hofseite. Fuhr man die Luisenstraße noch ein Stück weiter, gabelte sich die Straße hinter den Bahnschranken.
Und dort lag mein eigentliches Geburtshaus. Eine große Villa mit Turm, die ein ziemlich hässlicher Klotz zu nennen war. Einzig der Turm mit hölzernem Wehrgang hob sie ein wenig aus dem Mittelmaß. Der Turm ist heute verschwunden, so dass ich nach der Wende prompt erst einmal daran vorbeilief.
Der romantischste Teil des Städtchens aber lag gleich hinter dem Marktplatz: Ober- und Unterfischerei. Eine breite Treppe führte hinunter zu Gässchen und Fachwerkhäusern und endete in den Elbwiesen. Von oben hatte man einen hervorragenden Blick über die Schleife des Stroms, eingebettet in Wiesen und Wäldchen, mit der Fähre im Hintergrund. Auf der anderen Seite lag der Auwald mit einer schnurgeraden Straße hindurch, die direkt auf das Wörlitzer Schloss zuführte.
Coswig besaß ebenfalls ein Schloss, das grau und abweisend seine mächtigen Mauern über den Fluss erhob. Einst war es ein barocker Wohnsitz gewesen. Eine dreiflügelige Anlage mit Treppenturm, deren Innenhof sich zur Elbe hin öffnete. Aber seit es als Gefängnis genutzt wurde, hatte man einen vierten Flügel angefügt, so dass von der verspielten Pracht rein gar nichts mehr zu sehen übrig geblieben war. Dunkel und unheildrohend thronte es über der Stadt und die Leute flüsterten über das Elend in seinen Mauern. Auch von der Hauptstraße trennte es ein hoher Steinwall. Und in den oberen Stockwerken ließen sich gelegentlich schemenhafte Gesichter durch die vergitterten Fenster erahnen. Ein Schloss wie bei Kafka. Die Leute versuchten es zu ignorieren, was bei seiner Größe nicht eben einfach war.
Das Städtchen war heil geblieben, der Krieg hatte uns übersehen. Die Bomberverbände waren über uns hinweggedonnert, um ihre tödliche Ladung über Dessau zu kippen. Wir waren nicht kriegswichtig genug. Gott sei Dank. So konnten wir weiter in der Luisenstraße wohnen, das einzige Anwesen, an welches ich mich erinnern kann.
Ich wusste wohl dunkel, dass ich in der Turmvilla geboren worden war, doch das interessierte mich nicht sonderlich. Auch kannte ich das Bauwerk weniger von Besuchen bei der ungeliebten Verwandtschaft, sondern eher von endlosen Anproben bei dem taubstummen Herrenschneider, der ebenfalls einige Räume für sich und seinen Sohn reklamiert hatte. Das Haus mit den vielfarbigen Flurfenstern, die bei Sonnenlicht wunderliche Muster auf die Wände des Inneren malten, wirkte trotz des bunten Glases immer düster und dunkel.
Der Schneider war stumm und sein Sohn Hansi stotterte. Doch da Hansi in meine Klasse ging, freundeten wir uns ein wenig an und durchstreiften des öfteren den seltsam kahlen Obstgarten, der hinter dem Haus lag. Keine einzige Blume zierte diesen Garten, und auch der große Vorplatz sah nie eine gärtnerische Hand.
Hansi war es, der mir die beiden Turmzimmer zeigte, nachdem wir herzklopfend das brüchige, hölzerne Treppenhaus überwunden hatten. Die Aussicht aus den Fenstern war schier berauschend. In der Ferne erhoben sich die waldigen Hügel des Flämings, überragt vom Bismarckturm, einem Aussichtsturm, der regelmäßig das Ziel unserer Schulwanderungen war.
Auf der anderen Seite sah man über die Dächer der Stadt zu den vier Türmen des Schlosses, erspähte das Rathaus und die Kirche und weiter erahnte man Wörlitz auf der anderen Elbseite. Sofort erwachte in mir der Wunsch, selbst einmal mit solcher Aussicht zu leben, die mich das Schönste dünkte, was ich je gesehen. Ich sah hinüber zur anderen Straßenseite, wo der Kunstmaler gerade aus seinem Atelier trat, der als bester Freund des verstorbenen Vaters galt, und schwor mir, eines Tages in diesem Turm zu wohnen. Mindestens! Besser noch, gleich in einem eigenen zu wohnen. Mindestens! Oder noch besser, gleich in einem richtigen Schloss mit Aussichtsturm. Ja, das wäre es wohl! Ein Schloss musste her.
Der junge Maler, dem ich mit hochroten Öhrchen von diesem neuesten Lebensziel berichtete, grinste nur breit, bevor er sagte:
»Wahrlich, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dein Vater hatte ähnliche Wünsche.«
Ich hatte schon viele Stunden in der Werkstatt dieses Künstlers verbracht und zugeschaut, wie er einfache Zeitungsfotos der DDR-Gewaltigen in große Ölgemälde umsetzte. Sein Können hatte mich stets tief beeindruckt. Zuhause bei uns hing eine schöne Rötelzeichnung unserer Mutter von seiner Hand.
Das Anwesen der Popigs war nicht ganz so beeindruckend wie die Turmvilla, aber hier hatte ich meine ersten Schritte gemacht, hier war das kleine Brüderchen geboren worden. Es war mein Zuhause
Es bestand aus einem schlichten, zweistöckigen Wohn- und Geschäftshaus. Ein kleiner Erker im Obergeschoss war der einzige Schmuck der Fassade. Darüber erhob sich ein Satteldach.
Hinter dem Haus öffnete sich ein überraschend großer Hof. Auf der rechten Seite Schuppen und eine Scheune, auf der linken ein großes Lagerhaus. In der Scheune befanden sich die Pferdeställe und Räume für Gerätschaften und Fuhrwerke. Darüber befand sich ein riesiger Heuboden. Durch Luken im Boden konnten die eisernen Raufen der Pferdeställe direkt gefüllt werden.
Ach, der Heuboden! Als ich heranwuchs, war er für uns Kinder der zweitschönste Ort im ganzen Anwesen. Hier konnte man toben! Es war zwar verboten, weil hier auch die Häckselmaschine stand, doch wir wurden selten erwischt.
Die Häckselmaschine war wirklich gefährlich. Ich sah einmal, wie der lederne Transmissionsriemen riss. Die Wucht, mit der er an die Wand klatschte, hätte gut einen Mann erschlagen können. Vor der Häckselmaschine hüteten wir uns. Aber nichts war mit dem Gefühl zu vergleichen, wenn wir uns, gleich nebenan, vom Gebälk laut kreischend ins das duftende Heu fallen ließen.
Gegenüber, auf der anderen Seite des Hofes, lag ein größeres Lagerhaus mit einer Rampe davor. Hier wurden die Fuhrwerke mit Düngemittel und Saatgut beladen. Im Inneren des Lagerhauses gab es einen alten Fahrstuhl, der ächzend die Getreidesäcke nach oben beförderte.
Auf der Rückseite des Wohnhauses lag der Eingang zum Büro. Daneben verbreitete eine Art amerikanische Holzveranda Urlaubsstimmung. Diese Veranda wurde nie benutzt. Von ihr hatte man einen unverbaubaren Blick auf die Brandmauer des Lagerhauses. Zwei Terrakottaampeln, die einsam und nie bepflanzt, von der Decke hingen, vervollständigten das trostlose Bild. Ganz hinten, zwischen den Stallungen und Lagerhaus, schloss eine Backsteinmauer den Hof zum Nachbargrundstück ab. Vor dieser Mauer lag die Jauchegrube. Über ihr schwebten auf Holzbalken zwei Plumpsklosetts.
Dieses herrliche Anwesen hatte sich Opa also gekauft. Aber er hatte noch mehr gekauft. Ein wirklich großes Grundstück zu Spekulationszwecken, zwischen zwei Straßen gelegen. Vorn ein Hof, umringt von Wohnungen der Angestellten, Garagen und Schuppen. Hinten eine große freie Fläche mit Apfelbäumen.
Später kaufte der Stiefvater noch ein größeres Grundstück von zwanzigtausend Quadratmetern, um auf ihm eine Obst- und Gemüseplantage zu errichten. Schließlich litt die Stadt große Not, und Vater Popig wollte die Versorgungsengpässe überwinden. Da im Hause Popig gerade eine gewisse Geldknappheit herrschte, hatte Mutter das ererbte Görlitzgeld ihrem Manne zur Verfügung gestellt. Sie tat das ohne Arg und ohne schriftliche Vereinbarung - schließlich waren sie miteinander verheiratet. Der Kaufpreis würde nach und nach auf ein Sparkonto zu Juttas und meinen Gunsten zurückerstattet werden.