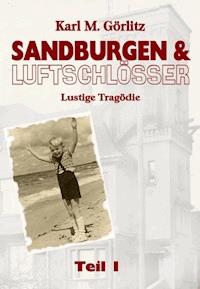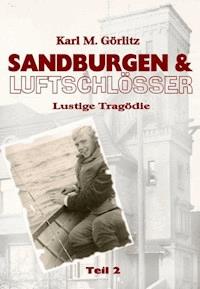
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer mitteldeutschen Flüchtlingsfamilie im goldenen Westen der Republik. Geschildert aus der Sicht ihres schwärzesten Schafes in drei Bänden. Ein gewaltiges Panorama vom Kriegsende bis zum Heute, randvoll mit Anektdoten, schrägen Typen und kreischkomischen Situationen. Sie werden Ihnen ans Herz wachsen: Die sächsische, teilgebildete Mutter und ihr etwas zu klein geratener Ehemann als großer Manager, die Söhne, von welchen der eine wohlgeraten und der andere auf krummen Wegen durchs Leben wandelt. Folgen Sie ihnen durch fast siebzig Jahre Zeitgeschichte, amüsanter kann eine Zeitreise kaum sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Imprint Sandburgen & Luftschlösser. Lustige Tragödie – Teil 2 Karl M. Görlitz published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de Copyright: © 2012 Karl M. Görlitz ISBN 978-3-8442-3149-6
Für Rüdi und Rosa
Karl M. Görlitz
SANDBURGEN &
LUFTSCHLÖSSER
Lustige Tragödie
Aufstieg und Fall einer mitteldeutschen Flüchtlingsfamilie im prosperierenden Westen der Republik. Geschildert aus der platten Sicht ihres schwärzesten Schafes auf schlappen 1.800 Seiten in drei Bänden.
DER AUTOR :
Karl Michael Görlitz wurde 1943 zwischen Dessau und Wittenberg geboren und wuchs nach der Flucht am Niederrhein auf. Heute lebt er mit Mann und Frau in Berlin.
INHALTSVERZEICHNIS
Die ganz große Liebe
Die Party
Die Hochzeit
Sieben Jahre Glück und nie ein böses Wort
Die Auferstehung
Das Jahr in der Wüste
Rüdiger
Ein Abend im Hause Fischer
Rosas Erbe
Ein Besuch in Berlin 1979
Trennung
Was vom Tage übrig blieb
Die Rückeroberung
DIE GANZ GROSSE LIEBE
Bevor sie über mich hereinbrach, mit der Macht von Urgewalten, verliebte ich mich noch in einen Kommilitonen. Eine Liebe, die unerwidert blieb, handelte es sich doch um einen kompletten Hetero. Er führte den selben Vornamen wie ich und glich mir äußerlich auf verblüffende Weise. Auf Partys wurden wir gelegentlich verwechselt, aber das machte rein gar nichts, ohnehin galten wir alsbald als Zwillinge. Wir saßen tagsüber zusammen, gingen zusammen einkaufen und abends tranken wir gemeinsam unser Bier. Nur pinkeln gingen wir solo.
In ihn musste ich mich einfach verknallen. Es war, als würde man sein Spiegelbild verehren, und eine Person mit narzistischen Tendenzen ist absolut verloren, wenn sie ihrem Alter-Ego gegenübersteht. Es war absolut faszinierend, der Kerl besaß auch noch den gleichen Charme, welchen er auch noch beliebig ein und ausschalten konnte, wie das Original. Wobei uns diese Frage meistens umtrieb, wer die Matrix und wer die Kopie. Da wir uns der gleichen Vorlieben rühmten, war es nur selbstverständlich, dass er sich in Rosa verliebte. Ein bisschen anders war er leider schon. So wurden wir für einige Zeit ein merkwürdiges Trio, welches im Kreis umeinander nachjagte. Morgens stand er am Bahnhof, um Rosa abzupassen, oder mit Blumen vor der Praxis, in der sie laborierte. Abends versuchte ich ihm die Vorzüge der männlichen Liebe vergeblich schmackhaft zu machen.
Und Rosas Dickschädel war unverbrüchlich auf mich programmiert. Mir war es langsam egal, als schwul zu gelten, im Semester wussten es bald alle. In Wesel allerdings trug ich noch gern die Tarnkappe, nur wenige wussten um mein wahres Wesen.
Auch dem Bruder hatte ich es noch nicht offenbart, er schleppte noch schwer an den alten Vorurteilen. Ali Röder, ein gemeinsamer Bekannter, hatte mir einst den Hinweis gegeben, Peter zeige ein ungesundes Interesse an ihm, und als ich den Bruder daraufhin ansprach, widersetzte er sich dermaßen wütend und schwulenverachtend, dass ich es für geraten hielt, über mich vorerst zu schweigen.
Bei Alis Hinweis hatte es sich offenbar mehr um eine Wunschvorstellung seinerseits gehandelt, denn er war ebenfalls homophil, wie ich eines Abends feststellen konnte. Gelegentlich hatte Peter Schulfreunde mit zu unserem Stammtisch geschleppt, darunter war auch besagter Ali gewesen. Ali war nicht ganz so mein Fall. Obwohl, so für eine Nacht war er auch nicht zu verachten, leider ging auch das schief.
Ja, und jetzt rannten wir, Rosa, Alter-Ego und ich, im circulus vitiosus, wie der Lateiner so schön sagt. Als Dreigestirn feierten wir auch die größte Party, die ich je organisiert habe und die auch gleichzeitig zur Abschiedsparty geriet, weil wir bald danach in der Landeshauptstadt ansässig wurden.
Sie fand im Saal des Tennis- und Ruderbootclubs statt und geriet mir zur wahren Dekorationsorgie. Nächte am Nil nannte sich das Kostümfest, und da gerade wieder Karneval nahte, übernahm dann der Verein unsere gesamte Ausstattung für die jährlich stattfindende Jecken-Sitzung, was uns die Saalmiete ersparte. Wir arbeiteten zu fünft vier Wochen an den Kulissen. Rosa, Monca, Mr. Kammer, Karlchen und ich, gelegentlich unterstützt von Peter. Es sah aus wie beim Monumentalfilm.
An der Stirnseite des Saals erhob sich ein sitzender Ramses aus Draht und Pappmaché, auf seinen Knien eine gewaltige Schale, in welcher Räucherwerk glimmte. Eine Reihe von Pappsäulen verstärkte den tempelhaften Eindruck. Decke und Wände wurden verkleidet und mit Hieroglyphen und allerlei ägyptischen Malereien geschmückt. Die Tische mit den Bierfässern wurden mit Strohmatten zu Nilbarken umgestaltet.
Es war eine Wucht – naja, zumindest für Wesel. Es war soviel Arbeit, dass ich nicht dazu kam, mir über das eigene Kostüm Gedanken zu machen. Dafür machte sich Mutter welche. Aus gelb gestreiftem Stoff bastelte sie mir eine Stirnhaube, wie auf den alten Abbildungen. Ein großer Kragen aus rundgebügelten gelben, grünen und blauen Bändern auf Vlieseline umschloss den Hals und die Heldenbrust. Über einer züchtigen Badehose saß ein knapper Lendenschurz mit Knoten unter dem Nabel. Sandalen mit goldenen Schnüren, die kreuzweise um die Waden gewickelt waren, komplettierten das gewagte Kostüm.
Der Clou aber war das Ganzkörper-Makeup. Endlich durfte ich so viel Bräune anlegen, wie ich wollte. Den Körper badete ich förmlich in Tam lo, einer frisch erfundenen Bräunungslotion, einem wahren Wunder für Bleichgesichter. Sie verlieh ein wundervolles, gelbliches Braun, das nur wenig an Gelbsucht erinnerte und meist fleckig ausfiel, weil es schwer war, die Lotion gleichmäßig zu verteilen. Später entwickelte die Firma eine fetthaltige Emulsion, die sich besser verteilen ließ, anfänglich konnte man genau sehen, wer sich künstlicher Bräune bedient hatte. Die behandelte Hautpartie erhielt scharf konturierte Ränder, so dass die Leute meist aussahen, als hätten sie eine Maske aufgesetzt. Augenbrauen und Haaransatz wurden zu Problemzonen, weil sich dort die Flüssigkeit nicht genügend verreiben ließ, was den maskenhaften Eindruck noch verstärkte. Aber so, in der Badewanne als halbes Vollbad, ging es. Die Augen erhielten eine dunkle Umrandung mit dem typischen, bis zu den Schläfen reichenden Lidstrichen. Darüber klebte Mutter noch farbige Glassteine. Nein, war das raffiniert! Liz Taylor als Cleopatra war ja ein Husten gegen mich! Selbst mein Alter-Ego zeigte sich begeistert.
»Mann, du siehst ja aus, wie der Guru aus Fellinis Julia und die Geister.«
Wir hatten den Film neulich zusammen gesehen, mir hatte dieser Heilige, dem die Masina zugeführt wird, besonders gut gefallen, und so behagte mir das Kompliment außerordentlich.
Kammer ging als römischer Soldat, mit muskulösem Brustpanzer und kurzem Röckchen, was auf mich mehr als anregend wirkte. Minirock stand ihm ausgezeichnet und der Waschbrettbauch des ledernen Harnischs war einfach hinreißend. Schade, dass darunter nicht ein ebensolcher steckte. Aber auch so wirkte er äußerst begehrenswert. Ob er vielleicht am heutigen Abend meinem verführerischen Aussehen erlag?
Leider hatte sich Mutter auch um Rosas Kostüm verdient gemacht, so dass nur eine geringe Chance bestand. Rosa erschien als Phönix ohne Asche, mehr so als Feuervogel mit rasantem Kopfputz. Für sie hatte Mutter ganze Arbeit geleistet. Ihre künftige Schwiegertochter lag ihr sehr am Herzen. Sie trug das vielleicht schönste Kostüm des Abends, obwohl Sternchen, als Nofretete zurechtgemacht, mit konischer Haube und Schlange eine ernstzunehmende Konkurrenz darstellte. Irgendwie hatte sie allerdings die Geschichte ein wenig zu ihren Gunsten zurechtgebogen, an ihrem Arm schritt der Freund als Marcus Antonius, mit güldenem Lorbeerkranz und hellblauer Seidentoga, der bekanntlicherweise zu Cleopatra gehörte. Was soll ich sagen, auch an diesem Abend gelang es mir nicht, den Freund meines Herzens zu überzeugen, er verzehrte sich nach Phönix, dieser Schlange, die ich an meinem Busen genährt. So ein Kammer-Spiel aber auch!
Bei Veranstaltungsschluss trug uns die begeisterte Damenwelt auf den Schultern zum Wagen, um noch am und im Swimmingpool unseres verehrten Zahnarztes bis in den Morgen zu feiern. Da ritten wir nun auf der enthusiastischen Menge. Ich und mein Überich konnten zusammen nicht kommen. Er kam lieber woanders. Rosa allerdings ließ sich sich auch nicht erweichen, und so blieben wir alle ungeküsst, bis nach einigen Wochen der verschmähte Galan das Problem löste, in dem er sich bei der Folkwang-Schule in Essen bewarb und entschwand. Dorthin mochte ich ihm nicht folgen, obwohl wir uns ursprünglich zu Dritt beworben hatten und angenommen waren. Was sollte ich in Kettwig bei Essen? Außer einem Schloss mit anerkannter Hotelküche hatte das Nest nichts zu bieten. Mir stand der Sinn mehr nach Abenteuern in der Hauptstadt der Region.
Eine kleine Wohnung musste her! Unbedingt! Rosa suchte für Monca und sich, da beide zusammenziehen wollten, ich für mich allein.
Die beiden Mädchen wurden zuerst fündig und Freund Karlchen begann zu renovieren. Leider hatte er nicht mitder Neugier der Vermieterin gerechnet, die unentwegt herumschnüffelte. Außerdem sollte man die Farbreste vielleicht doch besser nicht in der Badewanne entsorgen. Jedenfalls sah sich Monca nebst Freund unsanft vor die Tür gesetzt, und Rosa hatte ein Problem. Allein war ihr die Miete zu teuer. 110 DM betrug der Mietzins. Kalt. Sehr kalt sozusagen, denn die zweizimmrige Bude war ohne Heizung und das Dach ungenügend isoliert. Dafür war es im Sommer angenehm mollig und auf der Fensterbank wurde der Toast auch ohne Toaster appetitlich braun.
Rosa verdiente beim Urologen 600 DM brutto, nach Abzug der Steuern blieb da nicht viel. Ritterlich sprang ich in die Bresche, nicht ohne mich besorgt zu erkundigen, ob nächtlicher Herrenbesuch wirklich nichts ausmache. Da es für Vermieter noch den Kuppeleiparagraphen gab, erhielten wir zwei Mietverträge über je eine Hälfte der Wohnung.
Hanni, so hieß die Wirtin, fand Wohlgefallen an mir und wurde jedesmal neckisch, wenn ich mit einem Problem auftauchte. Sie war zwar verheiratet, aber die Ehe konnte man getrost wohl als ein wenig zerrüttet bezeichnen. Der Ehemann litt an einem leichten Alkoholproblem und oft kurvte die ehemalige Barmaid, die durch Erbschaft zu Haus und Hof gelangt war, missmutig durch die Altstadt, um ihren aushäusigen Gemahl zu suchen.
Sie kannte die Kneipen, in welchen der geliebte Ferdinand zu verkehren pflegte und suchte diese systematisch ab, um den Säumigen heimzuleiten. Sie fand ihn selten, das Aas von Ehemann besaß die Stirn, sich in der Eckkneipe, nur zwei Häuser weiter, volllaufen zu lassen. Auf die Idee, ihn in unmittelbarer Nachbarschaft zu suchen, kam sie nie. Besonders helle war sie nicht.
Das Haus aus der Gründerzeit, in dem beide die Parterrewohnung innehatten, glänzte vor Sauberkeit, die hellblauen Kacheln am Sockel der Fassade blitzten stets frisch gewaschen. Schließlich wollte man sich nichts nachsagen lassen. Ihr Haus war sauber und rein, die Holztreppen fast täglich frisch gebohnert, von den Majolikafliesen im Vestibül hätte man speisen können.
Ganz im Gegensatz zum Nachbarhaus, dessen viel schönere Fassade langsam verfiel und in welchem nie etwas repariert wurde, so dass beide Häuser im krassen Gegensatz voneinander abstachen, bis nach Jahren ruchbar wurde, dass es ihr ebenfalls gehörte.
Morgens um Fünf machte sich Hannilein ans schwere Werk und putzte und scheuerte, dass es eine wahre Lust war. Sie bohnerte und kehrte und inspizierte den Müll, um nachzuschauen, was die lieben Mieter am Vorabend verzehrt hatten. So war sie stets auf dem Laufenden und ihre Kritik berechtigt. Die Hinzens tranken allabendlich eine Zweiliterflasche Valpolicella, das konnte doch nichts sein, und die Kunzens verzehrten verdächtig oft Ölsardinen, ob die sich wohl nichts besseres leisten konnten? So verbrachte sie ihre Tage im Dienste der Reinlichkeit und der Selbstinformatik zusammen mit der hinfälligen Mutter, welche ebenfalls bei dem nicht mehr so ganz so jungen Glück ein Zimmerchen innehatte. Die restliche Zeit verbrachte sie gern hinter dem Spion der Wohnungstüre, so dass Kenner schon mal höflich grüßten, wenn sie am Parterre vorbeigingen, was sie stets in höchste Wut versetzte. Manchmal kam sie dann herausgeschossen, ein burgunderrot gefärbtes Springteufelchen mit keifender Stimme, das kein Blatt vor den Mund nahm und seine Meinung explizit verkündete. Jemand hatte heimlich eines Nachts ein Pornodia auf die Linse ihres Türspions geklebt. Die Ermittlungen dauern noch an.
Am Wochenende pflegte sie den Gatten einzusperren, wenn sie das Haus kurzzeitig verließ, der arme Mann wurde dann höchstens mit Eimer und Seifenlauge beim Reinigen der Kachelfront am Samstag gesehen.
»Dat is wie bei der Marine.«, pflegte er dann übellaunig zu erklären, wenn wir feixend vorbeischlenderten. Ja, in ihrem behaglichen Heim herrschten Zucht und Ordnung, kein Stäubchen besaß die Unverschämtheit, sich auf dem polierten Küchenschrank niederzulassen. Die Fingerabdrücke, die der holde Gatte auf dem Möbelstück hinterließ, waren Anlass für erregte Diskussionen, in welche die Mieterschaft selbstverständlich mit einbezogen wurde. Der Gatte rächte sich durch sein Überstundenwesen, zum Beweis lieferte er das schwerverdiente Geld bei ihr ab, das er sich meist von den Mietern oder seinen Saufkumpanen lieh.
Ferdi hatte immer Schulden. Irgendwie zweigte er es dann von den Einnahmen ab, da er die Bücher führte und ihr Vermögen gewinnbringend vermehrte. Oder was sie dafür hielt, denn von Anlagegeschäften hatte sie keinen Schimmer und jeder weiß doch, wie verlustbringend manche Geldanlagen enden. Kam er des Nachts mit Getöse angeschwankt, klingelte er sie wach, um den Schlüssel zu schonen. Der Durchlauferhitzer in unserem Bad funktionierte dann wie ein Sprachrohr.
Das anschließende Gezänk bereitete viel Vergnügen, wenn es seltsam hohl und überdeutlich vom Parterre zu uns in den vierten Stock heraufdröhnte. Selbstverständlich bekamen die anderen Mietparteien, die am selben Kaminzug hingen, die häuslichen Auseinandersetzungen ebenfalls mit, und so waren wir eine Hausgemeinschaft, in der die rechte Hälfte immer ein wenig mehr wusste als die Mieter der linken Seite.
Ultimo wurde bar in der Küche abkassiert, was meist Gelegenheit zu einem umfassenden Gedankenaustausch bot und uns mit den neuesten Direktiven vertraut machte. Das hinfällige Mütterlein trug dann noch seinen Teil zu der fröhlichen Gesprächsrunde bei, die äußerst unfroh werden konnte, wenn ein Mieter in Verzug geriet.
Ansonsten war Hanni gar nicht so verkehrt, man wusste genauestens, woran man mit ihr war und nachtragend war sie überraschenderweise auch nicht. Sie war wie ein Sommergewitter, hatte sie sich ausgetobt, zog bald die Sonne ein, in ihrem goldenen Herzen und sie zeigte ihre neckischen Seiten. Dann klapperten die Augenlider mit dem pfundschweren Lidschatten fröhlich wie eine gewisse Mühle am Bach und das Gespräch plätscherte wie ein munteres Bächlein mit gestrengen Einwürfen der sittsamen Mutter, welche ihrem ehrbaren Kohlenhandel nachtrauerte.
So sehr auch die vordere Fassade des Hauses glänzte, so traurig sah es auf der Hofseite aus. Unverputzter Backstein, schmutzig vom Kohlenstaub und zwei Weltkriegen, erinnerte der Hof fatal an Zille und sein Mülljöh, die Feuchtigkeit fand ungehinderten Zugang zu den Wohnungen, so dass nie Trockenrisse bei den furnierten Mahagonimöbeln zu befürchten waren, mit welchen Oma Schmitz Behausung im ersten Stock ausstaffiert war.
Unsere beiden Zimmer nahmen die gesamt Breite des Hauses ein. Rosa hatte den Blick auf den trübseligen Hof mit den Mülltonnen und das angrenzende Gewerbegebiet, aus welchem munteres Hämmern von der erstarkten Wirtschaft heraufdrang, mein Fenster in der Dachgaube lag so weit zurückgesetzt, dass es nur den Blick auf einen Teil des Gegenübers ermöglichte, die Straße dazwischen blieb verborgen. Zwischen beiden Räumen lag ein Flürchen, dessen hinterer Teil zum Wandschrank umgebaut war. Das war äußerst praktisch, ersparte es uns doch den Kleiderschrank. Die Zimmertüren lagen sich gegenüber, und ließ man sie geöffnet, bekam die Bude eine überraschend großzügige Optik, die die lumpigen fünfzig Quadratmeter fast vergessen ließ. Rosas Zimmer war schlauchartig und erweiterte sich im hinteren Bereich zu einer Nische mit Spülstein.
Nach der ersten Party hätte mich fast Karlchens Schicksal ereilt und ich wäre beinahe wieder aus der Mietergemeinschaft ausgestoßen worden. Nicht dass wir zu laut gewesen wären, im Gegenteil. Ich bat den angeheiterten Besuch, sich die Schuhe auszuziehen, um still an dem Spion der Parterre-Kontrollinstanz vorüberzugleiten, hatte aber nicht mit den gebohnerten Stufen gerechnet und dem frühen Arbeitsbeginn der unentwegt Schuftenden.
Ich war mit hinuntergeschlichen, um die Haustür aufzusperren, und auf dem letzten Absatz rutschte einer der kichernden Gäste auf den spiegelblanken Dielen aus. Mit Donnergetöse sauste er auf dem Hintern die gewachsten Treppenstufen hinunter und landete punktgenau im wischwassergefüllten Putzeimer der fleißigen Hausfrau. Daraufhin erhob sich ein zwiefaches Wehgeschrei. Eimerseits von dem Gast, der ein unfreiwilliges Bad mit schmerzendem Rücken in Hannis Putzlauge genommen hatte, und andererseits von der empörten Sauberkeitsfanatikerin, die sich um den Lohn ihrer Mühen gebracht sah. Sie wurde nicht müde, darauf hinzuweisen, dass dies ein anständiges Haus sei und ein solches Benehmen ein solch schwerer Frevel an der heiligen Hausordnung, dass er nur mit sofortigen Auszug geahndet werden könne.
Nun ja, es gelang mir, die tobende Hauswirtin mit Charme zu besänftigen, in dem ich etwas von fröhlicher Jugend und Tugend nebst überschäumender Lebensfreude murmelte, und fein darauf verwies, dass die Tage jugendlichen Übermuts auch bei ihr noch nicht so lange vorbei sein könnten, so frisch wie sie aussähe.
Daraufhin zog sie die Kündigung zurück, aber fortan begegnete sie Rosa mit gewissem Misstrauen, während sie mit mir stets versuchte zu flirten, was noch viel schrecklicher war. Bei allen Missliebigkeiten musste ich fortan ganz tapfer sein und mich in der Parterreküche den Annäherungsversuchen geschickt widersetzen, ohne das Rothaargebirge von Wirtin ernstlich zu verletzen. Im übrigen bekam Rosa ein ähnliches Problem mit dem geehrten Hauswirt, der nächtens auch schon mal gern auf Strümpfen am Spion vorbeischlich, um bei uns noch einen Schlummertrunk zu nehmen, wenn er noch Musik hörte.
Natürlich pumpte uns der geliebte Ferdi auch gelegentlich an, wie übrigens wohl alle im Haus, und manchmal konnten wir den Mietzins nicht pünktlich zahlen, weil der Hauswirt seinerseits mit der Rückzahlung des „Überstundengeldes“ im Verzug war, was auf beiden Seiten eine gewisse Hektik nach sich zog. Wie er es schaffte, nachts unbemerkt an seiner lauernden Gattin vorbeizuschleichen, wird mir ein ewiges Rätsel bleiben. Ich war meist weniger glücklich.
Ich erinnere mich noch gut an die pikante Szene, die sich mir bot, als sie eines Nachts, aufgezäumt wie ein Zirkusgaul, im Türrahmen stand. Damals muss sie um die Fünfzig gewesen sein, also für einen jungen Spund wie mich weit jenseits von Gut und Böse. Sie hatte sich in ein gewagtes, superkurzes Babydoll-Nachtgewand gehüllt, welches mehr zeigte als mir bekömmlich war, aus pinkfarbenem, hauchdünnen Nylon, mit Schwanendaunen-Besatz am Hals, welcher schon ziemlich faltig war, und in voller Kriegsbemalung unter den hocherotisch aufgetürmten Haaren, die wirkten, als stünde ihr Haupt in lodernden Flammen. Die Füße steckten in aufreizenden, hochhackigen Pantöffelchen, die farblich wunderbar zu Haar und Negligé passten, nur nicht zum Rest, trotz der schmeichelhaften Pompons.
Ich war zu Tode erschrocken, als ich ihr aufreizendes Lächeln gewahr wurde, der junge Mann in meiner Begleitung ebenfalls. Aber ihr Lächeln erstarb, als sie bemerkte, dass ich nicht allein war. Gerettet!
»Gott, ich habe gedacht, mein Ferdi kommt nach Hause«, stammelte sie noch, bevor sie die Türe hastig zuschlug, um hinter dem Spion wieder Aufstellung zu nehmen. Es gelang uns, ernst zu bleiben, bis wir mein Zimmer erreicht hatten, erst oben verloren wir die Fassung.
Was für eine Szene! Das war ja genau wie in dem Witz vom Ehemann, der seine Frau im Bett mit einem Fremden überrascht und haltlos zu lachen anfängt und auf die verwirrte Frage des Liebhabers, warum er denn so lache, erwidert: » Na, ich muss ja - aber Sie?!«
Armer Ferdi. Zum Glück wandeln beide nicht mehr auf irdischen Wegen, wie so einige, deren Geschichte ich sonst nicht guten Gewissens erzählen könnte, trotz der falschen Namen.
Auch meine große Liebe sank jüngst ins frühe Grab, und es ist eine der zweifelhaften Freuden des Alterns, zu sehen, wer vor einem in die Grube fährt. Der Tod wurde zu unserm ständigen Begleiter, seit in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts fast unser gesamter Freundeskreis in Berlin von der Aids-Seuche hinweggerafft wurde. Gerade die Besten traf es, die besonders Hübschen und Witzigen, die entsprechend viele Chancen auf dem Fleischmarkt hatten.
Welch ein Jammer! Es waren die Leute, mit denen ich gerne alt geworden wäre - es hat nicht sollen sein. So bleibt mir nichts anderes übrig, als Chronist wenigstens darüber zu berichten. Im zweiten Band, der von meiner Berliner Zeit erzählt, werden sie Aufnahme finden.
Lassen Sie uns nun zurückkehren in die 60er, wo mir das Leben noch unkomplizierter und heiterer schien, obwohl auch nicht ganz ohne Tücken. Nach einigen Vorgeplänkeln war die Wohnung und ich bereit für die große Liebe. Zu den Vorgeplänkeln gehörten ein Medizinstudent und ein junger Elektrofachmann, dessen Vater in Köln Neonwerbung produzierte.
Der Eine findet Erwähnung, weil ich mit ihm die neue Wohnung gewissermaßen einweihte, was nicht ganz ohne Probleme für meine Rosa war. Der Andere ist mir eher wegen seines Freundes in Erinnerung, der unbedingt Schauspieler werden wollte. Das Aussehen hatte er ja - die faszinierendsten blauen Augen, die ich je gesehen habe. Auf mich wirkte er immer wie ein leicht verderbter Engel, mit seinem zwingenden Blick. Aber gleich Filmschauspieler, und dann gleich bei Fellini? Wir schmunzelten jedesmal heftig, wenn er damit anfing. Wir, Rosa und ich, waren die Stars der Düsseldorfer Szene, und dieser Udo Kier nur eine zeitweilige Randfigur aus Köln. Wie man sich doch irren kann!
Jedoch eines haben Rosa und ich in der kurzen Zeit unseres Starruhmes geschafft. Wir brachen das ghettomäßige der Szene auf, die ausschließlich Männern vorbehalten war, weil wir fast nur noch zusammen erschienen. Und unser Beispiel machte Schule. Die Tunte von Welt erschien alsbald mit der Herzensfreundin, und auch der Damenlokus in der Loge 69 von Horst Kaiser wurde freigelegt, dem anderen Lieblingslokal, das wir zu zweit beehrten und in welchem wir eine zeitlang regelrecht Hof hielten.
Der Jungmediziner blieb mir in Erinnerung, weil er der Erste war, mit dem ich Sex in der neuen Wohnung hatte. Rosa war schockiert und hängte alte Handtücher vor das Riffelglas der Türfüllung, um auch ja nichts mitzubekommen. Vorher hatte sie zwar mehrfach versichert, es mache ihr nichts aus, aber als es dann tatsächlich so weit war, reagierte sie einigermaßen fassungslos. Jedoch diesbezüglich blieb ich hart. Was sollte mir eine Bude in der Stadt, wenn ich aus Rücksicht keinen Lover mit nach Haus nehmen konnte. Ich schlief nicht mit Frauen, ebensowenig wie mit ihr. Diesbezüglich hatte sie von mir nichts zu erwarten, und dabei blieb es auch. Und siehe da, sie erholte sich auffällig schnell und schlief nun ihrerseits mit Schwulen, die sich einmal heterosexuell ausprobieren wollten, und das waren gar nicht wenige.
Ja, die Wohnung und wir waren fertig für die Liebe, jedoch die liebe Liebe offensichtlich noch nicht für uns. So blieb es fürs erste bei kürzeren Jagdabenteuern, wir fischten zusammen aus demselben Pool und stritten uns gelegentlich um die Beute. Als Konkurrentin war meine Liebste nicht ungefährlich, zumal sie schnell auf den Geschmack gekommen war und nur noch mit angeschwulten Bisexuellen ins Bett ging.
»Sie sind einfach die besseren Liebhaber und achten mehr auf die Bedürfnisse von Frauen«, sagte sie oft.
Das kann ich nachvollziehen, auch wenn ich es nie praktisch ausprobiert habe. Bei den Heteromännern jener Zeit hatte es sich offenbar noch nicht so herumgesprochen, dass Frauen längere Anlaufzeiten und sinnliche Stimulanzien, sowie mehr Hingabe benötigten. Oswald Kolle fing sein segensreiches Aufklärungs-Werk erst an. In der schwulen Community war ein solches Verhalten undenkbar. Verschaffte man dem Partner nicht die gleiche Lust, flog man über kurz und nicht erst lang aus den Betten. Außerdem hatten wir Schwule wesentlich mehr Praxis aufzuweisen, als der gewöhnliche Hetero. Bei einer Gemeinschaft, die sich über sexuelle Interessen definiert, bleibt das wohl auch nicht aus, und Männer trennen ohnehin leichter Sex und Liebe. Das eine hat mit dem anderen ja auch wenig zu tun.
So war es bei mir, einesteils suchte ich den Mann fürs Leben, andernteils hinderte mich das nicht, auch Röschen zu lieben. Am liebsten hätte ich beides gehabt, aber es war klar, dass es das nicht geben konnte. Entweder – oder! Oder vielleicht doch? Nein, wohl doch eher nicht, auf eine Trennung würde es wohl hinauslaufen. Schade eigentlich, wir passten ansonsten so gut zusammen, und vor der Aussicht, als alte Tunte am Bahnhof herumzuschleichen, um mir für meine Rente einen preiswerten Stricher ein zukaufen, wie ich es täglich zu sehen bekommen hatte, graute mir ziemlich.
Diesbezüglich war die schwule Szene gnadenlos. Alte Männer hatten in ihr nicht vorzukommen und wurden verlacht, wenn sie sich in den angesagten Homobars blicken ließen. Für sie gab es höchstens Willi, der eine Stricherbar ganz in der Nähe unserer Wohnung betrieb. Unter den Schwulen war der Jugendwahn besonders heftig, und selbst mir war klar, dass ich nicht immer Einundzwanzig bleiben würde. Schade eigentlich.
Es war toll zu erleben, wie die Gespräche für einen Moment verstummten, wenn Rosa und ich eine Homobar betraten, es war wunderbar, wenn wir aufgehübscht, Arm in Arm, über die Kö schlenderten und die Leute stehen blieben, um uns nachzuglotzen. Rosa stieß mich oft heimlich an, hochamüsiert. Zwei Blondinen im Sauseschritt, und das weiß, Dank Wilhelm Busch, jedes Kind: die Zeit saust mit.
So schön wie es war, jung zu sein und die Aufmerksamkeit aller Welt zu erregen, es war nicht für immer und ein wenig mehr sollten wir auch dagegenzusetzen haben. Allein war das kaum zu schaffen und irgendwie schwebte mir ein abgeklärtes Alter mit Rosa vor. Homosexuelle Beziehungen hielten nie so lange, ich wusste von keiner. Das Nachspielen von heterosexuellen Ehen funktioniert bei Schwulen leider nicht so dolle, promisk wie wir sind.
Aber eine Freundschaft mit einer Frau könnte überdauern, besonders wenn sie sich so schadlos hielt, wie meine Rosa. Die Frau trieb es ja fast heftiger als ich. Ihr Witz war schärfer und ihr Partypillenverbrauch war größer als meiner. Rosa sonnte sich im Erfolg und ich sog die Zuwendung der Menge begierig ein. Ein merkwürdiges Pärchen waren wir schon. Wer uns nicht kannte, hielt uns für Geschwister, was wir im Grunde ja auch waren. Wir benutzten dasselbe Poly-Color, Make up und Wimperntusche. Das verbindet.
An den Wochenenden fuhren wir noch oft nach Hause. Rosas Mutter saß allein in der Vierzimmerwohnung, die sie selbstverständlich nicht aufgeben wollte. Ihre Schwiegermutter hauste nur ein paar Straßen weiter, ebenfalls allein. Beide Damen mieden sich nach Herzenslust. Die Schwiegermutter, und somit Rosas Großmutter, die jeden Pfennig dreimal umdrehte und die Quittungen der Geschenke sorgsam aufhob, um jedes Jahr zu Weihnachten triumphierend beweisen zu können, wieviel Geld sie in die Familie investiert hatte, (es war schon ein festes Ritual), war so geizig, dass sie sogar das Geschenkpapier wieder aufbügelte, erst recht das kostbare Schleifenband.
»Esst euch ruhig satt, ich hungere gern.« Mit solchen Aufforderungen hatte sie ihre Familie endgültig von ihrer gastlichen Tafel vertrieben, so dass sie nur zu Festtagen bei der ungeliebten Schwiegertochter aufkreuzte. Hatte sie alle Papierchen und Schleifchen sorgfältig zusammengelegt, um sie daheim zu horten, brach sie zumeist in Tränen aus, weil es ganz bestimmt das letzte Weihnachtsfest war, das ihr noch lebend vergönnt sei.
Das hofften wir schon lange, leider war sie erstaunlich zäh und überlebte sogar noch die ungeliebte Schwiegertochter. Ihr Vermögen war mittlerweile recht stattlich, wie man so hörte, und sie erschien täglich bei der Sparkasse ihres Vertrauens, in welcher auch der geliebte Sohn damals seinen Wirkungskreis gefunden hatte, um den Kontostand zu überprüfen. Laufen konnte sie zwar kaum noch, aber bis zum Konto schaffte sie es auf Krücken noch täglich. Das war schon mehr als ein Wunder, aber schließlich hatte sie ja auch mit der Arbeiterwohlfahrt eine günstige Busreise nach Lourdes unternommen.
Mein Bruder Peter hatte sich ebenfalls aus Wesel zurückgezogen und schmollte in Bochum als Politologiestudent über den endgültigen Verlust seiner geliebten Monca, die bei einem mit uns verbrachten Urlaub in Zantvoort in die Arme von Karlchen zurückgekehrt war. Endlich war Schluss mit dem ganzen Hin und Her, mal Karlchen, mal Peter, das Mädchen konnte sich auch nicht so recht entscheiden. Winni, ein holländischer Kurzzeitlover von mir, der in einem Reisebüro arbeitete, hatte den gemeinsamen Urlaub an der Küste seines Landes organisiert, und zwar so geschickt, dass wir innerhalb von vierzehn Tagen dreimal umziehen mussten, bis wir zu viert endlich das gebuchte Appartement am Strand bekamen.
Durch Winni und seinem besten Freund, der bei Selbach arbeitete, war ich mit René bekannt geworden. Dem Boss, der mich aufgefordert hatte, mal mit der Arbeitsmappe bei ihm zu Hause vorbeizuschauen, ging ich tunlichst aus dem Wege, aber sein Personal war hochinteressant, und in seinem Twen-Shop trank ich gern einen Kaffee gratis. Es gab da so einen Geschäftsführer, der mehr als aufregend war und von welchem niemand so recht wusste, wie er gepolt war. Auf einer Party erhielt ich die Gelegenheit, es herauszufinden und wir stritten uns wie ein altes Ehepaar. Entzückend! Auch später riss der Kontakt nicht ab. Der Ehemann einer Kollegin, in der ersten Agentur nach meinem Studium, arbeitete als Chefdekorateur bei Dolf Selbach, und selbst in Berlin in späteren Jahren ließ mich die Personalebene nicht los.
Mit René war es gerade kurz vor dem Umzug vorbei gewesen, und ich litt noch heftig an den Nachwehen dieser unglücklichen Liebe. Es war ein merkwürdiger Urlaub, in welchem wir ständig zwischen Zandvoort und Amsterdam pendelten. Es fing schon schräg an. Winni aus Roermond hatte bei uns genächtigt, um den gemeinsamen Abflug nicht zu verpassen. Winni war ein liebenswerter Schusselkopf, der alles verlegte und vieles verpasste. Rosa mochte ihn besonders.
An besagtem Morgen kam der Gute wieder mal überhaupt nicht aus der Hüfte. Wo hatte er seine Schönheitscreme hingelegt und wo den Pickelabdeckstift? Diesbezüglich war der Junge ein wahrer Hypochonder und Kosmetikfreak. Unter drei Kosmetiktaschen, für den Notfall, wagte er keinen Wochenendtrip, und seine Pickel erblühten geradezu unter dem Ansturm von Aufbaucremes, Nachtglättern in Tiegelchen, Faltenstoppern für müde Augen und Emulsionen für strapazierte Haut. Letztere waren wenigstens zu etwas nutze, als Gleitcreme taten sie hervorragende Dienste.
Er setzte sich dermaßen spät an den Frühstückstisch, dass die Wurstscheiben sich schon wellten und das Ei wieder Kühlschranktemperatur angenommen hatte. Selbst da war er nicht aus der Ruhe zu bringen, obwohl die Abflugzeit immer gefährlicher näherrückte. Rosa und ich befanden uns schon am Rande der Hysterie, jedoch alle Mahnungen, sich um Himmels Willen doch etwas zu beeilen, prallten an ihm ab, wie Pingpongbälle an Granit.
»Ich kann morgens nicht so schnell.« Damit mümmelte er genüsslich sein Frühstücksei, das er Löffel für Löffel mit einem Butterflöckchen verfeinerte, während unten der erboste Taxifahrer Sturm schellte, weil er seit einer halben Stunde auf seine Vorbestellung wartete. Zum Schluss war keine Zeit mehr, den Tisch abzuräumen, wir ließen alles stehen und liegen, so wie es war, um mit hängen und würgen, buchstäblich in allerletzter Minute, den Flieger zu erwischen.
Adieu, Aufschnitt und Schinken, adieu, Süßrahmbutter und Frischmilch. Wenn wir zurückkehren, würde sich so manches gerollt haben und der eine oder andere sauer.
Als sich dann noch im Badeort herausstellte, dass sich der Gute bei der Terminierung um eine Woche vertan hatte und wir in der Hochsaison plötzlich ohne Quartier dastanden, hätte ich ihn am liebsten in die Häckselmaschine geschmissen. Entsprechend muffig war meine Laune bei den diversen Umzügen, mit welchen wir die Woche überbrückten.
Liebeskrank und gereizt wie ein Stier, verblieb ich fast den ganzen Urlaub. Das Apartmenthotel, in das wir endlich einzogen, war doof, obwohl hochkomfortabel und das teuerste am Platz, weil in einem Hochhaus gelegen, der vielgerühmte Tuntenstrand viel zu weit entfernt und das kreischende Treiben dort ungelegen. Tunten, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun hatten, als dauernd die Badehose zu wechseln, wenn sie gerade mal nicht an der Bar den Partner schön soffen. Die hässlichsten Krähen, wie immer die Lautesten, die sich um einen Brocken zanken. Nervtötend!
Nein, da blieb man doch besser am Heterostrand vorm Hotel und schlürfte seinen Kaffee hinter dem gläsernen Windschutz der Strandbaude. Mit Heftchenromanen, die wir einander wechselseitig vorlasen, vertrieben wir uns die Zeit bis zum Abend. Das war ganz lustig, denn fast zu jedem Satz gab es einen launigen Kommentar. Stand da etwa: „Er warf seine Augen die Straße hinunter...“, krähten wir vor Vergnügen, wenn aus einem anderen Heftchen der Satz: Sie machte aber nicht viel Aufhebens darum..., folgte. Bald saß das ganze Cafépublikum um uns herum und blödelte mit. Bei solchen Gelegenheiten fiel Rosa immer besonders viel ein. Witz besaß sie ja reichlich.
Abends fuhren wir mit dem Vorortzug nach Amsterdam, um dort auszugehen, das Nachtleben im Ort interessierte uns nicht so besonders. Im D.O.K. (der angesagteste Tuntentreff in Amsterdam überhaupt) kam meine Liebste stundenlang nicht von der Toilette, als ich nach ihr suchte, fand ich sie auf dem Männerklo, wo sie umringt von einer Horde wissbegieriger Tunten Schminktips verriet.
Monca war wie stets gelangweilt, Männer, die ihren Reizen widerstanden, törnten sie ziemlich ab. Ich flirtete verzweifelt an der Bar mit sämtlichen Spiegeln, weil ich festgestellt hatte, dass ich nur lächelnd wirklich begehrenswert aussah. In einer anderen Ecke schmollte Winni über den Verlust seiner geliebten Pickel, Rosa hatte energisch alle Cremes und Tinktürchen vom Spiegelbrett verbannt, weil nicht einmal für die Zahnbürste ein Plätzchen übrig geblieben war, und hatte den Jungen dazu verdonnert, seine Nase mal ohne alle Hilfsmittel, außer Sonnenöl, in die würzige Seeluft zu halten.
Die Wirkung war verblüffend gewesen: nach drei Tagen war der Gute frei von Pusteln. Jetzt hatte er gar nichts mehr, worüber er sich Sorgen machen konnte und musste sich pickelfrei dem Leben stellen. Welch ein Jammer, ließen sich doch sonst so viele Unzulänglichkeiten auf die Jugendakne schieben.
Ich selbst war ziemlich wählerisch geworden, ein bisschen war mir der plötzliche Erfolg in Düsseldorf wohl zu Kopf gestiegen. Manchmal fühlte ich mich wie das hässliche Entlein von Andersen, das endlich als stolzer Schwan unter seinesgleichen ruderte.
Manchmal allerdings fühlte ich mich immer noch wie kurz vor der Mauser. Besonders wenn ich allein, mit unschönen Absichten, unterwegs war. Aufgetakelt und angedresst, ein wahres Wunder. An solchen Abenden lief gar nichts. Es waren Abende, die ich wie unter einer Käseglocke verbrachte, ohne Kontakt zu den Lebenden. Auch die vielen Bekannten kriegten schnell mit, dass sie heute einen Anderen vor sich hatten und verkrümelten sich schnell nach ein paar Belanglosigkeiten. Seltsam.
An solchen Abenden ging ich immer öfter auf die Toilette, völlig verunsichert, um nachzuschauen, ob ich noch da sei. Doch, ich war es, zweifelsfrei, schön wie eh und je. Warum fühlte ich mich plötzlich so von der Außenwelt abgeschnitten? Verstärkt wurde das merkwürdige Gefühl noch durch den Umstand, dass ich bei solchen Gelegenheiten auf die kleinen Muntermacher in Tablettenform gänzlich verzichtete, weil unter ihrer Wirkung die Libido futsch war. Ich konnte es mir aussuchen; entweder ich quasselte den ganzen Abend, unterhielt die Runde und kriegte anschließend keinen mehr hoch, oder ich stand stumm und notgeil in der Prärie und kriegte keinen ab. Beides wollte vorher gründlich bedacht sein.
Ohnehin waren die besten Abende die, die mich gänzlich unvorbereitet trafen, dann war mir auch mein Aussehen egal und ich blieb weitgehend natürlich. Es war, als bestünde ich aus zwei Personen, trotzdem machte ich mir nie ernsthaft Gedanken darüber. Ich schob die Wesensänderung ausschließlich auf den Pillenkonsum.
Nun ja, das Schicksal meinte es gut mit mir, jedenfalls in der letzten Urlaubswoche. Ein neuer Mann, von mehr als passablem Aussehen und Wesen, erbarmte sich meiner Spiegelfechtereien und siehe da, der Resturlaub wurde noch ganz nett. Er kulminierte in einem Wochenende, an welchem Karlchen überraschend auftauchte, um seine Monca zurückzuerobern, womit Bruder Peter gar nicht einverstanden war und ebenfalls anreiste, und einer endgültigen Überbelegung unseres Appartements durch meinen Adrian, dem Herzens- und Tulpendieb.
Es war einfach zauberhaft. Die beiden Rivalen, die sich am Liebsten an die Gurgel gegangen wären. Winni, der sich mit seiner Rolle als Hausfreund noch nicht so recht abgefunden hatte, und mein neuer Lover Adrian, welcher von all dem Beziehungsstress keinen blassen Schimmer mitbekam.
Monca genoss die Situation mit den beiden Streithähnen und mochte sich lange nicht entscheiden. Ich fand es an der Zeit, den Bruder endlich über meine unglückselige Veranlagung aufzuklären, was mir nur ein brummiges: »Weiß ich längst!« einbrachte.
Rosa versuchte die Spannung zu mildern, indem sie Lokomotive spielte und uns aufforderte, sich als Waggons anzuhängen, was bis auf Peter alle begeistert taten, um durch die viel zu kleine Ferienwohnung zu kurven, zu den Takten von: In the Summertime. Diesen Hit höre ich noch immer, denke ich an diesen Urlaub zurück.
Am Sonntagabend war der Bruder abgereist, Karlchen als Sieger zurückgeblieben, Adrian zu seinen Tulpen zurückgekehrt und Rosa mehr als erleichtert. Winni und ich waren leicht betrunken und freuten uns auf die Heimkehr am nächsten Tag ins schöne Rheinland. Armes Brüderchen! Als Verlierer war er mehr als humorlos, er lachte lieber über die Schwächen der Anderen.
Schon seit einiger Zeit hatte er sich in Wesel vom Stammtisch zurückgezogen. Genauer gesagt, seit dem Besuch bei der Schwester im damaligen Ost-Berlin vor einigen Monaten. Seither war er mir irgendwie feindlich vorgekommen. Er hatte sich noch mehr abgesondert und mit dem Fotografen seiner brötchengebenden Zeitung ein Vorhaben verwirklicht, bei welchem ich ausdrücklich unerwünscht war. Na bitte, wenn er sich unbedingt vom großen Bruder emanzipieren musste, gutes Gelingen. Aber gleich so krass? Musste er mich auch gleich so verächtlich behandeln, als hätte ich seine Probleme mit dem schönen Geschlecht verursacht? Hämisch war er mir nach der Visite entgegengetreten und hatte mit einer ellenlangen Bücherliste, die fast die gesamten Westliteraturhits umfasste, vor meinen Augen herumgewedelt.
»Diese Bücher soll ich Jutta besorgen. Den Kontakt pflege ich jetzt! Du brauchst dich gar nicht zu bemühen.«
Was hatte er der Schwester wohl alles über mich berichtet? Da waren wohl einige Richtigstellungen vonnöten.
Es war noch gar nicht so lange her, dass wir als junge Erwachsene bei der Schwester in Treptow unseren Antrittsbesuch gemacht hatten. Zu irgendeinem Familienfest waren wir geladen, es war ganz nett und sehr feuchtfröhlich gewesen. Auch Rosa war mitgekommen, und der Schwager war mehr als entzückt von dem neuen Familienmitglied gewesen. Vielleicht sogar ein wenig zu begeistert, wie mir Rosa hinterher gestand. Ich hatte der Schwester endlich reinen Wein eingeschenkt und hatte erfahren, dass sie sich das längst schon so gedacht hatte und mit Kollegen vom anderen Ufer stets allerbeste Kontakte pflegte. Selbst ihr Gatte war in der Kriegsgefangenschaft....pssst, psssst! Also auch der! Ach nee!
Nun ja, ganz unwidersprochen wollte ich die Verurteilung nicht hinnehmen, es war vielleicht besser, Jutta hörte beide Seiten. Schon die seitenlange Wunschliste bei diesem Geizkragen von Bruder. Sie würde sich noch wundern. Immerhin hatte ich einmal als ihr Liebling gegolten, und ich hatte mich diesbezüglich nicht groß geändert. Also war ich heimlich nach Berlin getrampt. Gewohnt hatte ich bei einem anderen Kurzzeitlover, welchen ich beim Osterausflug mit der Familie nach dem schönen Spree-Athen kennengelernt hatte. Jener Ostertrip war auch nicht ohne Komik gewesen. Verzweifelt war ich durch die Stadt getrabt, weil ich wieder einmal keine einschlägigen Adressen mithatte, bis ich mir ein Herz fasste, in ein Taxi stieg und meinen Wunsch nach einem Schwulenlokal formulierte, worauf der Fahrer fragte:
»Wollen Sie ins Chez nous mit Transvestiten?«
Nein, wollte ich nicht, eher in ein Tanzlokal für Schwule. Also war er losgebrettert und hatte mich vorm Kleist Casino abgeladen. Und das lag genau gegenüber vom „Hotel Berlin“, in welchem wir logierten!
Ist das nicht ein Dorf? Damals stand das Terrassenhaus zwischen Hotel und Lokal noch nicht, und von meinem Hotelzimmerfenster sah ich direkt auf den Eingang besagter Schwulenbar.
Danach hatte es endlose Ferngespräche in die geteilte Hauptstadt gegeben, die sorgsam allnächtlich in Vaters Arbeitszimmer stattgefunden hatten, bis ich mich auf den Weg machte. Den Eltern war eine Studienreise nach Paris vorgegaukelt worden, zum Beweis hatte ich Mutter ein silbernes Salatbesteck und Peter eine Petroleumlampe vom „Pariser Flohmarkt“ mitgebracht. Peter hatte sich zwar gewundert, dass auf dem Glaszylinder eine Berliner Marke eingeätzt war, aber seine Bedenken hatte ich mit dem Hinweis auf deutsche Wertarbeit in aller Welt leicht zerstreuen können. Er brauchte nicht zu wissen, dass ich heimlich zur Schwester gefahren war und leider auch noch vergeblich, denn die Gute war gar nicht zu Hause.
So ein Mist das auch! Telefonisch hatte ich mich nicht ankündigen können, da das zu Hause bös aufgefallen wäre. Ohne Voranmeldung lief kein Gespräch in die Täterä. Also stand ich als Überraschungsgast vor der Türe. Ein bisschen unheimlich war es schon gewesen, ganz allein die Grenzkontrollen zu passieren und drüben die richtigen Anschlüsse für die öffentlichen Verkehrsmittel zu finden.
Es war noch gar nicht so lange her, dass wir Söhne mit der Mutter zum ersten Mal wieder zurück in den Osten gefahren waren. Mutter war vor Angst halb gestorben und dicke Schweißperlen waren über ihre Stirn gerollt, als die Söhne mit den Papieren in der Kontollbaracke verschwanden. Bei der Fahrzeugkontrolle war den Zöllnern ein Villeroy & Boch-Service aufgefallen, und Peter hatte frech behauptet, nur mit eigenem Geschirr die DDR anzusteuern. Auf diese Bemerkung war er ungeheuer stolz und erzählte sie noch wochenlang.
Seither pöbelte er jedesmal mit den Beamten herum, zum höchsten Ärger seiner Mutter, die gern etwas unauffälliger eingereist wäre. Seine Rechte kannte er und wusste ziemlich exakt, wie weit er gehen konnte. Es war jedesmal ein großes Ärgernis, mit seinem Wagen die Grenze zu passieren. Ein aufgeblasener Wicht, der beim geringsten Anlass stänkerte. Mit Mut hatte das wenig zu tun, denn er hielt sich getreu an die Buchstaben des Gesetzes, außerdem liebäugelte er schwer mit dem kommunistischen Sozialismus wie alle Intellektuellen jener Zeit. Was man liebt, darf man auch kritisieren, belehrte er mich. Nun ja, ich liebte den Kommunismus nicht so besonders und hielt mich entsprechend zurück.
Sein Vater hatte beim letzten Berlin-Besuch fast einen Herzinfarkt erlitten, als er ahnungslos in die U-Bahn stieg und auf der Station Kochstraße die Ansage hörte:
»Achtung, sie verlassen jetzt West-Berlin.«
Er hätte sich noch schnell gerettet, aber der Zug war schon angefahren und passierte die vermauerten Geisterbahnhöfe mit den schwer bewaffneten Grenzposten, um erst am Bahnhof Friedrichstraße wieder zu halten.
Aschfahl und durchnässt vom Angstschweiß hatte Hans die Fahrt überstanden und sein Sohn hatte fast gejubelt vor Freude, dass er um so vieles mutiger war als sein Erzeuger. Was hatte Hans eigentlich auf dem Kerbholz, dass er solche Panikattacke erlitt?
Der Rat der Stadt Coswig hatte doch einen äußerst freundlichen Brief geschrieben, um ihn zur Rückkehr zu bewegen. Es läge absolut nichts gegen ihn vor, hatte es da geheißen, aber Hans hatte nur den Kopf geschüttelt und gesagt:
»Auf diesen Leim krieche ich denen nicht!«
Irgendwas wird es schon gewesen sein, schließlich wäre er kurz nach Kriegsende fast in Sibirien gelandet, wegen irgendeiner Kleinigkeit, aber Frechheit siegt - er hatte sich herausreden können.
Und nun stand ich in der Herkomerstraße und klingelte voller Vorfreude auf die geliebte Schwester. Es dauerte endlos lange, bis jemand öffnete. Es war der Schwager. In seinem Gesicht spiegelte sich unliebsame Überraschung und ein Anflug von Ärger, wie mir schien. Er zögerte, mich einzulassen, endlich öffnete er die Tür ein Stück weiter.
»Jutta ist gar nicht da, sie hat einen Termin in.... und kommt erst übermorgen zurück. Und ich bin mitten in der Probearbeit.«
Der Schwager inszenierte mittlerweile am Metropol-Theater in der Friedrichstraße und fürs DDR-Fernsehen in Adlershof. Was er gerade probte, teilte er nicht mit.
»Na, komm erstmal rein und trink einen Kaffee, aber du musst verstehen, ich habe dringend zu tun und kann mich nicht kümmern.«
Damit trat er beiseite und ich schlüpfte hinein. Alsbald fand ich mich in einem Sessel des Wohnzimmers wieder mit einer Tasse scheußlichen Ostkaffees, während der Schwager im Nebenzimmer weiterprobte. Dem Kollegen war ich kurz vorgestellt worden, mit allen Anzeichen des Bedauerns über die unliebsame Unterbrechung.
»Ja, das ist Juttas Bruder.«
Auf dem Tisch war mir ein dicker Wälzer aufgefallen. »Sieh ihn dir ruhig an, alt genug bist du ja schließlich.«, hatte der Schwager gesagt. Als wäre ich noch ein Kind von vierzehn. Der unfreundliche Empfang hatte auf mich gewirkt, wie ein eiskalter Guss. Alle Vorfreude war schlagartig dahin. Dieser Berlintrip entwickelte sich langsam zu einem kompletten Desaster.
Schon mein Logis war fürchterlich. Der so männliche Mann, den ich von früheren Berlinbesuchen kannte und bei dem ich für ein paar Tage Unterschlupf fand, war mir diesmal unglaublich tuntig erschienen. Mit Pantöffelchen war er an die Haustür geschlurft, um mich spätabends einzulassen.
»Ja wo bleiiibst du denn so lange, ich hab schon sooo gewartet!«
Beim Trampen kann man seine Ankunftszeit eben nicht so genau angeben, das ist nicht wie bei der Bundesbahn, obwohl die mittlerweile auch ziemlich variabel ist. Im Bademantel, der bei ihm sehr feminin ausfiel, war ich empfangen worden, und danach hatte er noch herzhaft über eine Fernsehschmonzette geweint, deren Ende er unbedingt noch mitkriegen musste.
Um Himmels Willen, bei welcher alternden Tunte war ich hier nur gelandet? Am Telefon war mir seine Stimme auch nicht so quäkig vorgekommen. Gut, ich war damals nicht mehr ganz nüchtern gewesen, aber der Oster-Kaffeeklatsch mit seinen Freunden am nächsten Nachmittag war eindeutig nett gewesen. Mir hatte der bürgerliche Tuntenkreis überaus gut gefallen, so etwas kannte ich bis dato noch nicht. Aber diesmal war alles so ganz anders.
Und nun saß ich hier frustriert und gelangweilt bei meinem Schwager in Treptow. Noch beim letzten Besuch hatte er sich so begeistert geäußert; über das tolle Mädchen mit dem Maiglöckchenstrauss aus Seide im Haar. Mein irrsinnig interessanter Beruf, Werbegrafiker!Oho! Immer am Puls der Zeit, aha, uhu. Mein Schwager Erwin, der ewige Schauspieler. Immer auf der Bühne, oder was?
Missmutig betrachtete ich den Stoffschirm der Tischlampe, die Erwin mit aus Westillustrierten ausgeschnittenen Markenzeichen dekoriert hatte. Unter dem Martini-Schriftzug war noch deutlich der Text der Rückseite sichtbar. Den hätte er vorher vielleicht schwärzen sollen, dann sieht man ihn im Gegenlicht nicht mehr.
Schauspieler! - Neulich erst war mir angetragen worden, auch einer zu werden. Es gab in der Kunstschule eine Schauspielertruppe, und ich war aus Neugier mal hochgestiefelt, um die Proben zu erleben. Der Anführer der Klasse, ein Profi aus Neuss, hatte mir einfach das Textbuch in die Hand gedrückt, mit den Worten:
»Passives Zuhören gibts hier nicht, mach mit oder geh!«
Schillers Räuber, mir war der Spiegelberg zugewiesen worden. Nun ja, - nach Beendigung der Lesung hatte der Mann mir ein Textstück zum Auswendiglernen mitgegeben, in der nächsten Stunde wollte er das vorgetragen wissen. Amüsiert war ich darauf eingestiegen und hatte ein Stücklein Räuberhauptmann einstudiert, eine saftige Stelle, in welcher er über ein überfallenes Nonnenkloster prahlt, am nächtlichen Lagerfeuer, glaube ich. Mein Vortrag war äußerst lebhaft gewesen und ich hatte mich beim Lachen ein bisschen auf dem Boden gewälzt und mit der Hand bekräftigend auf die Dielen geklatscht, als er mich mit starrem Blick unterbrach und sagte:
»Mensch sag mal, du musst aber unbedingt Schauspieler werden. So etwas habe ich ja noch nie erlebt, besonders wenn du dich freigesprochen hast, kriegt deine Stimme so etwas Stahliges, dass es mir kalt den Rücken hinunterläuft. Und dein komödiantisches Talent ist ungeheuer. Du musst einfach Schauspieler werden - nein, du bist es bereits.«
Wer hört so etwas nicht gerne, die Lobhudelei ging mir runter wie Honigseim, besonders wenn es einmal der Herzenswunsch gewesen war. Jedoch in Anbetracht der bisherigen Erfolge war ich eher skeptisch verblieben, und als der gute Mann tatsächlich mit einer ernsthaften Rolle in Neuss kam, sagte ich nein. Den Doktor Frankenstein in einer Gruselkomödie sollte ich machen, eine ziemlich große Rolle sogar. Nein, vom Tonband kannte ich meine Stimme und mochte sie ganz und gar nicht, und jede Tunte konnte schauspielern, das gehörte sozusagen zu den Überlebensstrategien. Nein und nochmals nein, ich war kein Schauspieler, und wenn doch, dann mit eigenem Text.
Außerdem, ein theaterbesessener Schwager reicht vollkommen für unsere theatralische Familienbande aus. Und während ich in seinem Wohnzimmer vor mich hin brütete, erklangen aus dem Nebenzimmer Anweisungen wie: »Jetzt gehst du bis zum Strich, dann machst du eine halbe Drehung. Eins, zwei, so. Die Kamera erfasst dich von links und du machst einen Schritt vorwärts.«
Aha, die Herren proben wohl fürs Fernsehen. Im ersten Moment hatte ich geargwöhnt, die beiden bei ganz etwas anderem gestört zu haben. Reines Wunschdenken, Görlitz. Aber irgendwie hatte der Schwager so einen ertappten Eindruck gemacht.
Wie konnte ich auch erwarten, mit offenen Armen empfangen zu werden, der Mann schuftete für Frau und Kind. Nach einer Höflichkeitspause würde ich mich schnell verdrücken. Seufzend blätterte ich in dem blau gebundenen Wälzer. Ein Werk für die forensische Medizin, ein Lehrbuch, nicht unbedingt für Laienaugen gedacht. Leichen in allen Lebenslagen, abgeschlagene Glieder, grässliche Verstümmelungen, ein Kompendium des Grauens.
Erschrocken klappte ich das Buch wieder zu. Das brauchte der Mann für seine Komödien? Von den hochinteressanten Schattenseiten des Lebens hatte er vorhin getönt. Offensichtlich war ich doch noch nicht alt genug, das hier war mir zu schattig.
Ich verabschiedete mich bald und entfloh in den Westen. Da war es entschieden freundlicher. Die Wohnung der jungen Familie in Treptow war mir diesmal düster und ungemütlich erschienen. Knarzendes Parkett, schlimme Tapeten, vom Mobiliar gar nicht zu reden. Zwar gab es Flügeltüren und Jugendstilstuck, aber das ganze war mir ziemlich abgewirtschaftet vorgekommen. Mann, was hätte ich aus solch einer Bude machen können. Auch mit wenig Mitteln und vor allem ohne Lämpchen mit Decoupage-Westmarken. Die machten den Kohl auch nicht mehr fett. Die frischgebackenen Eltern entschuldigten sich stets mit Hinweisen auf die Mangelwirtschaft. Dabei mangelte es ihnen offenbar ein wenig an Phantasie.
Ich machte keinen weiteren Versuch, die Schwester zurückzuerobern, sondern überließ die Kontaktpflege Mutter und dem Bruder. Zwar sortierte ich brav meine alten Klamotten aus, die zum Schwager wanderten, und schmuggelte gelegentlich ein neuwertiges Hemd dazwischen, damit der arme Mann nicht nur Abgetragenes empfing. Ansonsten beschränkte ich mich auf die seltenen Besuche, die die Schwester im Westen machen durfte. Den Schwager sah ich viele Jahre nicht mehr, und als wir uns wiedersahen, waren seine besten Jahre vorbei und er ein alter Mann. Jedoch immer noch herrscht eine mehr als ungemütliche Atmosphäre zwischen uns, ganz besonders wenn wir zufällig allein sind. Ich wurde nie wieder zu einem Fest eingeladen, Peter und Jutta hatten den Stab über mich gebrochen. Sollten sie nur. So ein schlimmer Finger war ich ja nun auch wieder nicht.
Und während das unfrohe Erinnerungsbild verblasst, verraucht auch der Zorn auf den Bruder, der noch einmal in mir hochgestiegen ist. Der Bruder war mit seinen kleinen Gehässigkeiten schließlich auf offene Ohren getroffen, aber das allein konnte es eigentlich auch nicht gewesen sein, was zu solch einer vehementen Ablehnung führte.
Die geliebte Schwester war ich jedenfalls los und wie sich später herausstellen sollte, wohl für immer. Ihr Töchterlein, folglich meine Nichte, habe ich nur als Kleinkind gesehen, und als ich sie wieder traf, war sie eine junge Frau, die mir fremd blieb.
Was Peter betrifft, rang er weiter munter mit seiner Profilierungssucht und seinem plötzlichen Drang, sich aus dem vermeintlichen Schatten des großen Bruders zu lösen. Bisher hatte ich ihn am Weseler Stammtisch eher in Schutz genommen und ihn verteidigt, wenn er anfing, die Leute mit seinen ewigen Diskussionen zu langweilen. Danach ließ ich ihn gewähren, wie er wollte.
Auch seine Galerie, die er mit dem Zeitungsfotografen eröffnete, betrat ich nur einmal nach der Fertigstellung. Fotokunst wurde in ihr angeboten. Kahle Zweige im Gegenlicht in hochkünstlerischem Schwarz-Weiß und andere Kompositionen. Passend dazu waren die Wände weiß und die Türen und Fensterrahmen schwarz gestrichen. Offensichtlich war das Weseler Publikum noch nicht reif für eine derart hochmoderne Präsentation. Vielleicht hätten die beiden aber auch einen anderen Standort wählen sollen, als ausgerechnet eine Wohnstraße am Stadtrand, wo das Laufpublikum gegen Null tendierte.
Jedenfalls schloss der Kulturtempel innerhalb kürzester Zeit wieder seine Pforten und Peter entschwand nach Bochum, um an der Ruhruniversität sein Studium aufzunehmen. Die Freundschaft zwischen uns Brüdern war wieder vorbei und jeder ging fortan seinen Weg. Selbst der gemeinsame Urlaub an der holländischen Küste zeigte einmal mehr unsere konträr verlaufenden Lebensbahnen auf.
Wir aber kehrten zurück ins fröhliche Rheinland, wo uns beim Öffnen der Wohnungstür ein pestilenzartiger Gestank entgegenschlug. Oma Schmitz konnte doch nicht spontan bei uns verblichen sein, die hatte doch gar keinen Schlüssel! Als wir um die Ecke kurvten, sahen wir die Bescherung. Der Frühstückstisch! Den hatten wir ja vollkommen vergessen! Ach je! Die Butter hatte sich dünne gemacht und versucht, zu fliehen. An den Tischbeinen war sie heruntergelaufen und hatte sich anschließend im Teppichboden verkrümelt. Mitten in der Fettpfütze auf dem Tisch prangte die Aufschnittplatte mit einem samtigen Überzug aus feinstem Edelschimmel. Die Leberwurst hatte die ersten Gehversuche schon hinter sich. Der Inhalt der Milchtüte war zu herbem Frischkäse geronnen, und im Honigtopf schwamm eine ertrunkene Biene. Überdosis! Winnis Restei starrte uns wohlwollend entgegen, gespannt darauf, was wir zu seiner gelungenen Verwandlung sagen würden. Wir waren wieder zu Hause!
Trotz des versauten Teppichs waren wir erheitert. Auch wenn wir eher bürgerlich waren, ein bisschen Bohème passte doch auch recht gut. Rosa hatte ohnehin keinen Ehrgeiz, durch hausfrauliche Qualitäten zu glänzen. Sie ging lieber arbeiten, den Kochpart hatte sie ganz mir überlassen, und Putzen gehörte zu den Tätigkeiten, zu welchen wir keine Berufung verspürten. Nicht, dass wir verlottert gewesen wären, oberflächlich betrachtet. Nein! Beileibe nicht.
Aber für die Freuden einer makellosen Oberfläche, wie die Wirtin im Parterre, waren wir einfach nicht geschaffen. Gab es da nicht auch eine gewisse Esther Vilar, die behauptete, ein Haushalt sei mit den modernen Hilfsmitteln überhaupt kein Problem mehr und spielend zu schaffen?
Rosa und ich waren mehr für das spielerische Element. In unserem Spülstein türmte sich das benutzte Geschirr, verborgen hinter dem Wandschirm, und als ein neues Geschirrspülmittel für stark verkrustetes Porzellan mit der wunderbaren Aufforderung, Leb jetzt, spül später, auf den Markt gespült wurde, schien es wie für uns gemacht.
Wenn ich heute so überlege, welch üppige Menüs, mit sechs und mehr Gängen, ich damals in der winzigen Kochecke hinter dem Schirm auf dem zweiflammigen Kocher zubereitet habe, scheint mir das an ein Wunder zu grenzen. Ich hatte da so ein rotierendes System, mehrere Töpfe gleichzeitig kreisen zu lassen, um alles gleichmäßig warm auf den Tisch zu bringen, das ich heute nicht mehr fertigbrächte. Der einzige Vorteil, den diese Kitchenette besaß, war, dass man überhaupt nicht mehr hin und herlaufen musste. Für Gehfaule ideal!
Natürlich musste ich, nebenbei zum Studium, noch etwas Geld verdienen. Das mussten fast alle. Ich hatte mir etwas ziemlich Bequemes ausgesucht, das nur stundenweisen Einsatz erforderte: Marktforschung für Zigarettentestreihen. Meist war ich derjenige, der auf der Straße Probanden ansprach. Der Interviewer saß derweil mit den Fragebögen im Nebenzimmer einer Kneipe. Als Dankeschön gab es eine Packung Zigaretten und ein Getränk während des Interviews. Meist wählten wir die Eckkneipe gleich neben der Kunstschule, so hatte ich es nicht weit und konnte Studium und Nebenjob glänzend miteinander vereinbaren.
Auch Rosa machte an ihren freien Nachmittagen ganz gern mal mit - in einem anderen Team, das meist in einer Altstadtkneipe logierte. Das war auch nicht ohne Komik, denn eines Tages kam die Sittenpolizei. Besorgte Bürger hatten die junge Frau, die wahllos unbescholtene Passanten ansprach und mit Männern in die Kneipe verschwand, angezeigt.
»Rauchen Sie?« Auf diese Frage bekam die attraktive junge Frau meist eine Zigarette angeboten. Missverständnisse allerorten.
Ich beeilte mich stets, den Leuten zu versichern, daß wir für keinen Buchclub warben, nein, bei uns gab es sogar ein kleines Geschenk für die zwanzig Minuten, die ein Interwiev dauerte.
Es war die letzte Idee, die der kleine Bruder vom großen Bruder übernahm. In Bochum machte Peter einen ähnlichen Job. Natürlich musste er den Interwiever machen, für die Straße war er sich zu schade. Also wurde ich gern hinzugerufen. Meist machte ich mit, hatte aber wenig Lust in Bochum in seiner Bude zu nächtigen, was zu seiner Verdrossenheit beitrug. Eine Nacht in seiner Hütte hatte mir gereicht. Das schmuddelige Bettzeug dampfte förmlich, dazwischen saß der Bruder in seiner vergrauten Unterhose auf dem kahlen Boden, wo Plattenspieler und Sammlung stand und dudelte wahllos Barockmusik. Er ging die Sache systematisch an, was oben auf dem Stapel lag, wurde aufgelegt, bis er durch war und danach arbeitete er sich wieder zurück. Lieblingsstücke, wie früher, hatte er offenbar nicht mehr.
Der Bruder war alternativ geworden und verachtete unser Konsumdenken. Die Selbach-Lederjacken, die unsere Mutter ihm schenkte, trug er widerwillig, die Anzüge ebenfalls, aber wehe, ein Detail stimmte nicht. Dann wurde er zum Rächer der Enterbten, der stundenlang den Kundendienst strapazierte. Konsequent wie immer. Er ließ sich nichts gefallen.
Rosas und meine Wohnung war ihm ein Gräuel. Aufgehübscht im Brigitte-Stil, nicht würdig, einen großen Geist zu beherbergen. Dafür kam unsere Mutter jetzt häufiger. Bochum besaß für sie wenig Reize und sie traf sich gern mit dem jüngeren Sohn in Düsseldorf. Öfter blieb sie auch mal über Nacht, um mit uns einen Altstadtbummel zu machen, was meist mit einem formidablen Restaurantbesuch begann. Mittlerweile kannten wir uns gut aus, und nach einigen langweiligen Abenden kam ich auf die Idee, die Ahnungslose mit in die Tuntenbars zu schleppen, was ihr außerordentlich gut gefiel, da so viele schöne Männer und wenig Konkurrenz ihrer harrten. Sie hat nie begriffen, in welche anrüchigen Lokale wir sie führten. Wenn sich zwei Männer küsten, erklärte ich ihr nonchalant, dass es bei der heutigen Jugend so üblich sei, auch die homosexuelle Komponente auszuleben und Schwule nicht auszugrenzen. Manche Leute fänden das hochmodern und geradezu „in“. Dann schüttelte sie den Kopf und sagte:
»Dänen habbchs ooch gleich angesähn.«
Nun ja, Mutter war eben ein Musterbeispiel selektiver Wahrnehmung. Sogar mit unseren Bekannten freundete sie sich an, und so gab es meist ein großes Hallo, wenn wir uns trafen. Geizig war sie ja nicht und ich opferte gern auch mal einen Nachmittag, um sie bei ihren Streifzügen über die Kö zu begleiten. Meist sprang ein Pullöverchern oder ein Höschen dabei heraus, allerdings sauer erarbeitet, denn die Frau zu beraten war ein Sisyphosjob. Zufrieden war sie nie.
Ganze Boutiquen wurden durchgemustert, die zunehmend erschöpften Verkäuferinnen schleppten und schleppten, bis etwas in die engere Wahl kam und vom Chauffeur abgeholt wurde, um zu Hause oder bei uns in aller Ruhe anprobiert zu werden. Auch Rosa, als zukünftige Schwiegertochter, wie Mutter glaubte, partizipierte meist. Wir änderten selten etwas, ganz im Gegensatz zu der gnädigen Frau.
Wie immer brachte sie alle, die mit ihr zu tun hatten, zur Verzweiflung. Das fing damit an, dass sie die gesetzlichen Ladenschlusszeiten vollkommen ignorierte und unbekümmert immer weiter probierte, und hörte auf bei den tausenderlei Extrawünschen, mit denen sie Personal und Schneider zu mildem Wahnsinn trieb.
Eine wahrhaft schwierige Kundin, trotzdem winkten die Beraterinnen der exklusiven Pelzwerkstätten sie begeistert herein, wenn sie ihrer ansichtig wurden.
»Oh, Frau Popig, wir haben wieder etwas für sie.«
Ein wahres Zauberwort für unsere Mutter und stolzgeschwellt ob ihres Bekanntheitsgrades betrat sie die nächste Geldfalle, um dortselbst wieder auf einen höflichen Leim zu kriechen. Ich konsumiere, also bin ich.
Ich selbst war auch nicht viel besser. Wie zu Hause in Wesel hatte ich mir angewöhnt, ebenfalls eine Auswahl mitzunehmen. Nur mit den Rechnungen lief es nicht ganz so glatt wie in der Kleinstadt. Manchmal weigerten sich die Lieben einfach, den lächerlichen Betrag zu übernehmen und ich musste seufzend selbst zahlen.
Der Bruder betrachtete Mutters Treiben kopfschüttelnd wie auch sein Vater. Hätten sie gewusst, wieviel Geld die Dame wirklich verbriet, wären sie außer sich gewesen. Mit Kleinkrediten von Onkel Heinz polsterte sie ihr Konto auf. Sie zahlte ihre Raten ja zurück, bei dem verworfenen Sohn sah das schon anders aus.
Rosa machte das auch gern, sie spazierte ins Direktorenzimmer, lächelte süß und schlenderte mit einem Bündelchen Scheine wieder hinaus. Höchst ärgerlich, dass der Onkel die Kredite zurückerstattet sehen wollte. Taten wir es nicht, petzte er Zuhause und der Alte hatte wieder reichlich Gesprächsthema.
Das reife Paar stritt immer häufiger, besonders gern vor Besuch, wenn sie knülle waren und die Bekannten blieben reihenweise lieber zu Hause. Je stiller es um sie herum wurde, desto mehr mehr mussten sie für angemessenen Lärm sorgen.
Ich erinnere mich noch an eine Feier, bei welcher sogar die Möbel in Mitleidenschaft gerieten. Mutter saß in den Trümmern ihrer englischen Kommode und Hans seufzte beglückt, weil sie sich gerade wieder vertragen hatten.
»Du kriss neue Möbel, alles kriss du neu!« Mit diesen Worten machte er sich über den Schreibsekretär her und begann ihn fachmännisch auseinanderzunehmen. »Alles sollsu neu haben.«
Während der kleinen Auseinandersetzung hatten sie sich mit reifen Erdbeeren beschossen. Tapeziert musste ohnehin schon wieder werden. Trunken folgte er ihr ins Schlafzimmer, da die letzten Gäste ohnehin geflohen waren, um seine ehelichen Rechte wahrzunehmen. Peter und ich hatten uns ebenfalls zurückgezogen und standen oben, über das pompöse Rokokogeländer gebeugt, um den Rest des abziehenden Sturms als Hörspiel wahrzunehmen, wie wir es öfters taten.
Aus dem Schlafzimmer ertönte trunkenes Gekreische.
»Da fähld ä Stickchen, Hans. Da fähld noch was!«
Mutters rücksichtsvolle Art, mit dem unzulänglichen Lover umzugehen. Peter und ich lächelten uns verlegen an, bevor wir in unseren Zimmern verschwanden. Manchmal konnte der Alte einem fast leid tun.
»Peinlich.«, murmelte Peter noch, bevor die Tür sich hinter ihm schloss.
Ja, für Peinlichkeiten war zu Hause oftmals mehr als gesorgt.
Einen Spitzenabend in puncto Peinlichkeit legten sie allerdings zu Dritt hin, unter Einbeziehung ihres Busenfreundes Heinz, der an jenem Abend den großen Wortführer machte. Ein Besuch aus dem Osten war gekommen. Ein Oberstaatsanwalt, der alte Akten über die Judenvernichtung nach Bonn transportierte, wie mir der Bruder erklärte. Der den Kontakt zu unserer Schwester Jutta hielt, die den Mann mit Grüßen und einem Geschenk zu uns geschickt hatte. Der Bruder deutete auch an, dass da wohl noch mehr als nur Freundschaft sei, in Ostberlin kriselte die Ehe ein wenig. Der nimmermüde Schwager war dem schönen Geschlecht mehr als zugetan und der Staatsanwalt gehörte zu Juttas Gegenmaßnahmen.